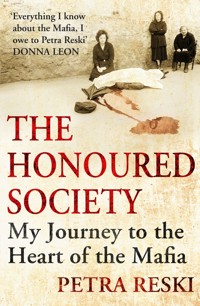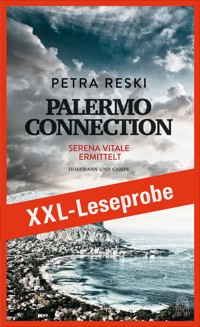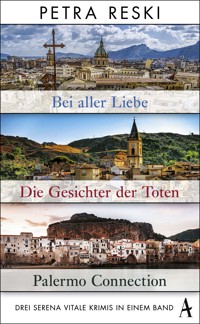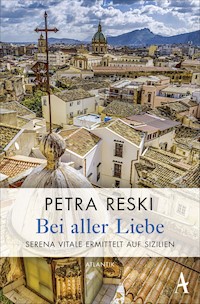19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine besondere Beziehung: Petra Reski beschreibt Italien aus der Sicht einer Nicht-Italienerin. Als Deutsche erlebt sie die scheinbar verwirrende politische Entwicklung Italiens nicht aus der Distanz, sondern aus nächster Nähe. »Perfide und wunderbar (…) ›All'italiana‹ enthält viele interessante, auch berührende Passagen, besonders dann, wenn es um Reskis Beziehung zu Italien geht.« Frankfurter Allgemeine Zeitung Petra Reski, die preisgekrönte Autorin und Reporterin, erzählt in ihrem Buch eine Entwicklungsgeschichte – diejenige Italiens seit 1989 und ihre eigene. Sie lebt seit 1991 in Italien. Mit einem stellenweise heiteren, manchmal melancholischen, aber immer aufklärerischen Italien-Buch setzt sie nach dem großen Erfolg ihres Venedig-Buches – »Als ich einmal in den Canal Grande fiel. Leben in Venedig« – die Serie fort. »Dabei enthalten die 300 Seiten Sprengstoff. Das ist typisch für Petra Reski, Investigativ-Journalistin und Bestseller-Autorin. Die wortgewandte Schreiberin hüllt die krassesten Tatbestände gern in einen sacht ironischen Plauderton.« Süddeutsche Zeitung Die Journalistin Petra Reski berichtet in ihrem politischen Sachbuch - aus Gerichtssälen, - aus Gefängnissen - aus Petrochemieanlagen - aus Palazzi - aus vertrockneten Olivenhainen - aus antiken Ruinen - aus Eisenbahnabteilen - aus Sakristeien - von den Sofas der Escorts - und nicht zuletzt von den Esstischen Petra Reski hat, wie wenige Deutsche, mit ihrer Liebe zu Italien ernst gemacht und einen Italiener geheiratet. Sie hat Italiens politische und kulturelle Kämpfe miterlebt und auch geteilt. Nun wollte sie mehr als eine Zuschauerin sein und wurde Italienerin, auch, um in Italien wählen zu können. Dafür setzte sich Petra Reski jahrelang mit der italienischen Bürokratie auseinander. Ihr Ringen um die Staatsangehörigkeit steht stellvertretend für ihre Beschäftigung und Identifikation mit dem Sehnsuchtsland der Deutschen. Denn kaum eine Nation ist über ihre Geschichte und Geschichten auf so vielfältige Weise mit denen Deutschlands verknüpft wie Italien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Petra Reski
All'italiana!
Wie ich versuchte, Italienerin zu werden
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Petra Reski zeichnet ein Porträt Italiens als Entwicklungsgeschichte des Landes, in dem sie seit 1989 lebt. Mit unbestechlichem Ton berichtet sie aus Gerichtssälen und Petrochemieanlagen, aus Palazzi und antiken Ruinen, aus Sakristeien, von den Sofas der Escorts – und nicht zuletzt von den Esstischen. Ihr hindernisreicher Weg zum italienischen Pass steht für die Auseinandersetzung mit einer Nation, deren Geschichte und Geschichten auf vielfältige Weise mit denen Deutschlands verknüpft sind.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Karten
Prolog
Italienisch für Anfänger
Frühling von Palermo
Ein letzter Venezianer
Wie deutsch bin ich?
Auf schwankendem Boden zwischen Ost und West
Die Kunst, etwas dahinter zu erkennen
Knoblauch und anderes Unverdauliches
Palermo und Sonne und Zuversicht
Falcone. Borsellino
Das Leben geht weiter
Ein Land im Krieg
Eine neue Zeitrechnung
Ein ständig braun gebrannter Mann
Zu reich, um uns zu beklauen
Betrug an einer Waise
Ich gebe, damit du gibst
Kleine renitente Zellen
Über den richtigen Gebrauch von Schimpfwörtern
Weltmeister
Die Regeln des italienischen Lebens
Familienbegräbnis mit fünfzigtausend Verwandten
Ah, la Germania
Fernsehen
Wo bin ich zu Hause?
La famiglia
Bunga Bunga
Der Endverbraucher und die Nichte des ägyptischen Präsidenten
Italiener machen
Kaum größer als ein Schulkind
Anständige Leute
Berlushka bye-bye
Der Pakt
Trüffel und Fünf Sterne
Clowns an die Macht!
Das Ende einer italienischen Geschichte
Sand, weiß wie Puderzucker
Italienischer Klamauk
Mit der Mafia verhandelt man nicht
Demokratie im Urlaub
Über die Feuerbakterie
Vor dem Herzen gefaltete Hände
Der Messias
Das harmonische Zusammenleben
Über Diskrepanzen
Ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin eine Christin
Il Presidente
Technisch unsterblich
Lukrez und das Ende des Obskurantismus
Epilog
Zeittafel
Ohne es zu wollen, sind wir in den warmen und tiefen Bauch Italiens gelangt,
wo alles passieren kann, sogar der Wunsch, dortzubleiben.
Ennio Flaiano,
La solitudine del satiro
Für Lino
Karten
Prolog
Vor einigen Jahren kam ich auf die Idee, Italienerin werden zu wollen. Also besser gesagt: Halbitalienerin. Weil ich meine deutsche Staatsangehörigkeit ja behalten wollte. Ich dachte, dass mir, einer mit einem Italiener verheirateten EU-Bürgerin, die italienische Staatsangehörigkeit vielleicht nicht unbedingt nachgeworfen, aber mehr oder weniger automatisch zugeteilt würde. Okay, es würde wieder darum gehen, ein paar Dokumente vorzulegen, klar. Aber wer wie ich es geschafft hat, die bürokratischen Hürden für eine deutsch-italienische Eheschließung in Form von amtlich übersetzten und beurkundeten Ehefähigkeitszeugnissen, Geburtsurkunden, Aufenthaltsbescheinigungen der Meldebehörde und eines mit Ärmelschonern bewaffneten Beamten des Münchener Kreisverwaltungsreferats zu überwinden, neigt zu einer gewissen Selbstüberschätzung.
Bei dem Staatsangehörigkeitsding ging es mir darum, in Italien wählen zu können. Und das nicht nur bei Bürgermeisterwahlen, sondern auch bei Parlamentswahlen. Wobei schon die Teilnahme an Bürgermeisterwahlen einen Riesenaufwand an Bürokratie darstellt, weil EU-Bürger in Italien keineswegs automatisch eine Wahlbenachrichtigung bekommen, sondern sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Wahlregister ihres Wohnorts eintragen lassen müssen – aber kein EU-Bürger weiß das, weil er nicht darüber informiert wird, was eigentlich die Aufgabe des Präfekten wäre. Eigentlich.
Dank der mir innewohnenden Renitenz habe ich es dennoch geschafft, mich eintragen zu lassen: Im Wahllokal unweit des Campo Santo Stefano brach Panik aus, als ich auftauchte, weil keiner wusste, in welchem Wahlregister mein komischer, definitiv unitalienischer Name – das K existiert im italienischen Alphabet nicht – zu finden war. Die Wahlhelfer waren dermaßen verwirrt, dass sie mir nicht nur den Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl, sondern gleich auch noch den für die Wahl des Präsidenten der Region Venetien in die Hand gedrückt haben – und wäre an dem Tag auch noch die italienische Regierung zu wählen gewesen, sie hätten mir auch dafür den Stimmzettel gegeben, nur um mich wieder loszuwerden.
Ehrlich gesagt hatte ich den Wunsch, in Italien zu wählen, vor 2013 niemals verspürt, weil das Parlament bis dahin im Wesentlichen von im Amt versteinerten Archäopteryxen beherrscht wurde: etwa vom vierundneunzigjährigen Giulio Andreotti, siebenmaliger Ministerpräsident und Senator auf Lebenszeit, vom achtundachtzigjährigen Giorgio Napolitano, Senator auf Lebenszeit und zwei Mal Staatspräsident, oder vom siebenundsiebzigjährigen Senator Silvio Berlusconi, viermaliger Ministerpräsident und vorbestrafter Steuerhinterzieher.
Kurz: Es gibt nichts, was ein längeres Leben beschert als ein Sitz im italienischen Parlament. Deshalb bleiben italienische Politiker dort sitzen, bis sie tot sind. Und manche sterben nie.
Die Regierungen wechseln, aber die Gesichter bleiben die gleichen. Es gibt Parlamentarier, die sitzen siebzig Jahre lang im italienischen Parlament. Folglich waren Wahlen in Italien jahrzehntelang so spannend wie in der DDR zu Honeckers Zeiten: Berlusconi gewann. Und falls er ausnahmsweise mal nicht gewann, kaufte er sich ein paar Abgeordnete, um die neue Regierung zu Fall zu bringen.
Im Jahr 2013 aber kandidierten zum ersten Mal die Fünf Sterne, was für die Archäopteryxe im Parlament so etwas war wie das Erscheinen des Antichrists oder die gewaltsame Machtübernahme durch die Bolschewiki unter Führung Wladimir Iljitsch Lenins. Ich aber hoffte, dass endlich etwas Leben in die verknöcherte italienische Politik fahren würde. Ungefähr so, wie es einst der Einzug der Grünen in Turnschuhen in deutsche Parlamente geschafft hatte. Okay, war auch keine Revolution, aber immerhin war Umweltschutz in Deutschland seitdem nicht mehr allein die Sache von ein paar Ökofreaks, die einem verbieten wollten, den Ölwechsel wie üblich im Wald zu machen.
In den Monaten bis zu den Parlamentswahlen 2013 würde ich es vermutlich nicht mehr fertigbringen, die italienische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Aber sicher bis zu den nächsten Wahlen im Jahr 2018. Hoffen ließ mich, dass der Antrag digital einzureichen war. Genauer gesagt: Er sollte »telematisch übermittelt« werden. Wie praktisch!, dachte ich, wie modern!
Die Website des italienischen Innenministeriums war nicht wirklich intuitiv zu bedienen – man braucht nicht nur eine Brille, sondern auch eine gewisse Vertrautheit mit Behördensprache –, aber immerhin: Sie existierte. Umberto Eco hat in Wie man einen verlorenen Führerschein ersetzt sehr schön beschrieben, dass man in den Mäandern des italienischen Behördenapparats keinen verlorenen Führerschein ohne das »Eingreifen einer höhergestellten Persönlichkeit« ersetzen kann. Und ich, die sich gelegentlich mit italienischen Postbeamten zankt, wusste zu schätzen, dass mir die Suche nach einer »höhergestellten Persönlichkeit« dank der Onlineregistrierung erspart würde. Zuversichtlich beschloss ich, das Unternehmen »italienische Staatsbürgerschaft« generalstabsmäßig in Angriff zu nehmen. Allerdings hatte mich der Ausdruck »telematische Übermittlung« auch leicht beunruhigt. Nicht nur, weil er verdächtig nach jenen Frühzeiten klang, als die ersten Rechner zur Berechnung der Flugbahnen von Projektilen erfunden wurden, sondern auch, weil mich »telematisch« an »telepathisch« und damit an den Magier Catweazle erinnerte, der aus dem Mittelalter in die Gegenwart versetzt worden war und sich vor modernen Dingen wie Telefonhörern fürchtete, die er »Zauberknochen« nannte. War die digitale Revolution im italienischen Innenministerium wirklich angekommen?
Es dauerte einige Monate, um Kopien vom Personalausweis, einen Auszug aus dem Strafregister, eine Kopie der Geburtsurkunde und eine der Eheschließungsurkunde zu besorgen; das Ganze von einem amtlichen Übersetzer übersetzt, besiegelt und beglaubigt. Nicht etwa, dass ich die für unsere Heirat bereits übersetzten und beglaubigten Urkunden hätte verwenden können. So weit kommt’s noch. Nein, sie mussten neu übersetzt und beglaubigt werden. Ich lud alles telematisch hoch, zahlte zweihundert Euro auf das Postkonto des Innenministeriums ein, erhielt ein Aktenzeichen und einen Beleg zum Zahlungseingang – und hörte nichts mehr. Mein Antrag auf die italienische Staatsbürgerschaft: eine Flaschenpost im Meer der Bürokratie.
Allerdings besorgte mich das nicht sonderlich, es hieß, dass die Wartezeiten bis zur Verleihung der Staatsbürgerschaft zwei Jahre betragen: Bis zu den nächsten Parlamentswahlen sollte die Flaschenpost doch wohl angekommen sein.
Dachte ich.
Italienisch für Anfänger
Natürlich stellt sich die Frage, wie man auf die zugegeben irre Idee kommen kann, an den italienischen Parlamentswahlen teilnehmen zu wollen. Um das zu erklären, muss ich zu meinen Anfängen in Italien zurückkehren.
Im Grunde fängt alles mit Reportagen an, die nicht gedruckt werden. Es ist das Jahr 1989, ich habe die Journalistenschule abgeschlossen und befinde mich am unteren Ende der Rangordnung im Auslandsressort des Sterns, als Reporterin zuständig für kommunistische Regime im November, Bürgerkriege in Afrika und Katastrophen, die an Feiertagen stattfinden. Ich werde für die Reportagen eingesetzt, die sonst keiner machen will, etwa über die Schließung der Lenin-Werft in Danzig zu berichten, oder dafür, mit einem alkoholisierten Fotografen einen Monat lang durch Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei zu reisen, um über »die Jugend« im Ostblock zu berichten. Eine Reportage, die nie erscheint: Wir befinden uns in jenen goldenen Zeiten des Journalismus, als sich Chefredakteure noch leisten können, Reportagen für den Papierkorb produzieren zu lassen.
Um mich darüber hinwegzutrösten, beschließe ich, einen sechswöchigen Sprachkurs in der Toskana zu absolvieren, in Castiglioncello, einem kleinen Seebad unweit von Livorno, in dem einst Luchino Visconti und Marcello Mastroianni ihre Sommer verbrachten. Ich betrachte den Kurs als Investition in meine Zukunft – für den Fall, dass es mit einer Korrespondentenstelle in Paris nichts wird, was der Plan A ist, insofern der Paris-Korrespondent endlich mal abgelöst würde. In Rom wacht der Italien-Korrespondent zwar eifersüchtig über seinen Vorgarten, aber der kann ja nicht alles machen. Und im Auslandsressort des Sterns gibt es niemanden, der Italienisch spricht.
Es ist die Zeit vor den Billigflügen, also fahre ich mit der Bahn von Hamburg nach Italien, ab München in einem italienischen Zug. Zu meiner großen Verblüffung geht der Schaffner am Vormittag die Abteile ab und fragt, ob man zum Mittagessen einen Platz im Speisewagen reservieren will. Ich reserviere – und bin fassungslos, als ich sehe, wie an Tischen mit weißen Tischtüchern frisch zubereitete Spaghetti serviert werden. Was für eine Zivilisation!, denke ich. Was für eine Esskultur!
Als Romanistin verfüge ich zwar über Grundkenntnisse des Italienischen, aber von Italien weiß ich so gut wie nichts – wenn man davon absieht, dass ich als Zwanzigjährige Opfer der Mafia-Folklore des Paten geworden und vom Ruhrgebiet nach Corleone gefahren bin. Praktisch direkt, vier Tage Fahrt, Übernachtung auf Parkplätzen und ohne einen einzigen Blick auf Venedig, Florenz oder Rom zu werfen. Im Studium der Politikwissenschaften habe ich Italien immerhin etwas gestreift, weil der Eurokommunismus Thema der mündlichen Prüfung meines Staatsexamens war. Ich kann immer noch referieren, dass der Eurokommunismus der Versuch eines demokratischen Kommunismus war, ausgehend von den kommunistischen Parteien Italiens und Frankreichs. Ich weiß auch noch dunkel, was der »Historische Kompromiss« und wer Berlinguer war, aber abgesehen davon beschränkt sich meine Kenntnis von Italien auf Pizza Quattro Stagioni ohne Schinken und Sambuca zum Espresso.
Diese kulturelle und sprachliche Lücke will ich füllen, und die Toskana mit ihren zypressenbestandenen Hügelketten erscheint mir für den Einstieg besonders geeignet. In Castiglioncello widme ich mich vormittags den Feinheiten der entfernten Vergangenheit, dem passato remoto, nachmittags fahre ich mit einer Vespa durch die Gegenwart: nach Volterra, wo aus den Mauern des römischen Theaters weißer Flieder wächst, nach Pisa, wo vor der Piazza dei Miracoli Schürzen mit dem Gemächt des David von Michelangelo verkauft werden, und nach Bolgheri, wo ich mitten auf der Zypressenallee beim Schalten die Kupplung zu schnell kommen lasse, weshalb die Vespa einen Sprung macht und mich unter sich begräbt.
In den sechs Wochen meines Sprachkurses lerne ich, dass das Italienische, anders als wir es uns in Deutschland vorstellen, eine erstaunlich förmliche Sprache ist. Was meist in den Hintergrund gerät, weil die Italiener sehr nachsichtig sind, wenn sich ein Ausländer die Mühe macht, ihre Sprache zu erlernen. Im Unterschied zu Frankreich, wo mich jeder Tabakhändler beim geringsten Hauch eines Akzents in dem Satz »Un paquet de Camel light s’il vous plaît« mit einem »Mais vous n’êtes pas française!« abgestraft hat, überschlagen sich die Italiener förmlich, wenn ich nur ein grazie über die Lippen bringe, sie ertragen geduldig, wenn ihnen ein ciao aufgedrückt wird (mit ciao wird nur begrüßt, wer geduzt wird), und feiern jede Bildung des richtigen Konjunktivs wie eine geglückte Atlantiküberquerung.
Als Romanistin bin ich ambitioniert, wobei mein Ehrgeiz durch die Existenz des passato remoto etwas ausgebremst wird. Die ferne Vergangenheit macht mir zu schaffen – eine Form, die wie das passato prossimo, die nahe Vergangenheit, abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit beschreibt, wodurch sich beide vom imperfetto unterscheiden. Aber schon zu beurteilen, ob die Vergangenheit fern ist oder nahe, ist ja wohl sehr subjektiv. Kurz: Das passato remoto macht mich fertig, der Konjunktiv erst recht, ich sage nur: congiuntivo trapassato. Im Italienischen gibt es Zeiten, die kann man sich als Deutsche gar nicht vorstellen, geschweige denn konjugieren.
Wenn ich nachmittags nicht gerade mit der Vespa durch Lavendelfelder, Olivenhaine und Weinberge fahre, gehe ich mit meinen Verbtabellen an den Strand, um mich von den Tücken der italienischen Grammatik zu erholen. Der parzellierte und beharkte Strand ist eine teure Angelegenheit, aber der Bademeister hat ein Herz für mittellose deutsche Sprachschülerinnen und schenkt mir immer einen Liegestuhl.
Und in diesem Liegestuhl stelle ich zu meiner Überraschung fest, dass die Italiener am Strand nicht über das beste Sonnenöl, sondern über das System der illegalen Parteienfinanzierung von Sozialisten und Christdemokraten reden, über Amtsmissbrauch und Bestechungsgelder, über Mafiaverwicklungen und Mordkomplotte.
Sie klingen dabei, als ginge es um das letzte Boccia-Turnier, und benutzen weder das historische Perfekt, also das passato remoto, was ja eine abgeschlossene Handlung der Vergangenheit ausgedrückt hätte, noch den Konjunktiv, mit dem man Unsicherheit, Möglichkeit, Wunsch, Sorge und Furcht verdeutlicht hätte. Selbst vom congiuntivo trapassato, mit dem man einen Sachverhalt beschreibt, der laut meiner Grammatik »entweder als irreal angesehen oder subjektiv betrachtet wird«, ist keine Spur. Nein, sie sprechen im Indikativ Präsens, einer Zeitform, die man benutzt, »um ein tatsächliches Ereignis in der Gegenwart zu beschreiben«, wie meine Grammatik versichert. Ereignisse, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Und das, obwohl ich Journalistin bin. Und drei deutsche Tageszeitungen täglich lese. Also kaufe ich mir auch noch täglich die Repubblica und versuche vergeblich dem auf die Spur zu kommen, was ich am Strand gehört habe.
Es nimmt mich sehr für Italien ein, dass man so offen über die dunklen Seiten des Landes spricht. Andererseits finde ich es verwirrend. Denn dieser Craxi war doch bis vor Kurzem Ministerpräsident. Und wie war es möglich, dass er auch noch ins Europäische Parlament einziehen konnte, obwohl hier am Strand alle wissen, wie korrupt seine sozialistische Partei ist?
Nach diesem Craxi haben sich drei weitere Ministerpräsidenten sehr schnell im Amt verschlissen: Amintore Fanfani, Giovanni Goria, Ciriaco De Mita. (Bei uns heißen Politiker Helmut oder Hans-Dietrich, und hier tragen sie Namen wie Romanhelden: Amintore! Ciriaco! In Deutschland hätte man mit einem Namen wie Amintore vielleicht als Schlagersänger überzeugen können, aber definitiv nicht als Ministerpräsident.) Sie sind Christdemokraten, was mir ein Indiz für einen Machtwechsel zu sein scheint: Die Wähler hatten offenbar die Sozialisten abgestraft, worauf die konservativen Christdemokraten gefolgt sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
Skeptisch macht mich allerdings, wie gedehnt die Italiener am Strand das Wort de-mo-cris-tia-ni aussprechen. Dalla padella alla brace, sagen sie und lachen mich aus, wenn ich sie frage, ob sich die politische Lage dank des Wechsels der regierenden Partei verbessert habe. Dalla padella alla brace übersetze ich mit »Von der Pfanne auf den Grill«, woraus ich schließe, dass man keinen Vorteil darin sieht, von einem democristiano statt von einem Sozialisten regiert zu werden, weil man praktisch vom Regen in die Traufe kommt.
Die Leute am Strand machen mich zudem darauf aufmerksam, dass man in Italien keinesfalls Neuwahlen ansetzt, nur weil gerade ein Ministerpräsident zurückgetreten ist. Kommt hier dauernd vor. Wenn jedes Mal ein neues Parlament gewählt werden müsste, nur weil ein Ministerpräsident zurückgetreten ist, müssten sie ja praktisch ständig zur Wahl rennen, heißt es, man käme zu nichts mehr, das Land wäre lahmgelegt, man würde sein ganzes Leben in der Wahlkabine verbringen, grazie a Dio sei man gegen diese Tortur gefeit, es reiche schon, dass die derzeitige Regierung die neunundvierzigste seit Kriegsende sei.
Wenn ich es richtig verstehe, hatten wir in Deutschland in der Zeit, in der man in Italien neunundvierzig Regierungschefs verschlissen hat, nur sechs Bundeskanzler, von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl, der für meinen Geschmack auch schon viel zu lange im Amt ist. Folglich kommen, wenn ich richtig gerechnet habe, auf einen deutschen Bundeskanzler acht Komma eins sechs italienische Ministerpräsidenten.
Klar, dass so etwas ermüdet. Allerdings geht meine Rechnung nicht ganz auf, denn wie mir die Italiener aus den Liegestühlen nebenan erklären, tauchen von diesen neunundvierzig Ministerpräsidenten einige immer wieder im Amt auf, was ich als ganz besonders absurd empfinde: Wenn einer doch klar bewiesen hat, dass er nicht regieren kann, und zum Rücktritt gezwungen wurde, wie kann er dann wieder gewählt werden?
Man kann also die neunundvierzig italienischen Ministerpräsidenten nicht einfach durch die sechs deutschen Bundeskanzler teilen, die italienische Politik fängt an, in eine hoch komplizierte Textaufgabe auszuarten: Wie viele Ministerpräsidenten bleiben übrig, wenn man von den bisherigen neunundvierzig (Stand: Sommer 1989) diejenigen abzieht, die nicht nur einmal, sondern bis zu sieben Mal Ministerpräsident waren, und diese durch die sechs deutschen Bundeskanzler teilt?
Da sich mir die italienische Politik als ähnlich knifflig darstellt wie die diversen Vergangenheitsformen der italienischen Sprache, beschließe ich, mich vorerst mehr den schönen Seiten des Landes zuzuwenden. Also Kunst und Kultur. Schließlich befinde ich mich in der Toskana, der Wiege der Renaissance. Auf diesem Boden entstand die Frage nach dem Wesen der Schönheit, nach idealen Maßen und Proportionen – sage ich mir, wenn ich auf meiner Vespa über die Hügelketten vorbei an Festungsmauern von Florenz nach Lucca fahre, durch Pisa und Siena. Käfer prallen wie Geschosse von meinem Helm ab, Fliegen bleiben auf meinem Lippenstift kleben, ich aber spüre im Vorbeifahren nur den Duft einer frisch gemähten Wiese und der Pinien, bewegt vom Wind, der so sanft über die Hügel streicht, als würde er das Gras bürsten.
Nach den Grammatikstunden leiste ich mir mittags einen gerösteten Toast im Caffè Ginori – allein das ein kultureller Fortschritt gegenüber Deutschland: ein mit Käse gefüllter Toast, der geröstet serviert wird! Ich höre Lucio Dalla Se io fossi un angelo singen und berausche mich an acqua brillante: Ein Land, in dem man Tonicwater »glänzendes Wasser« nennt, kann nicht anders, als Poeten hervorzubringen, finde ich.
Abends gehe ich in der Ciucheba tanzen, der legendären Diskothek von Castiglioncello mitten in einem Pinienhain. Als Sprachschülerin kommt man umsonst rein. Was für Sprachschüler natürlich nicht gilt. Aber warum nicht endlich mal ein Privileg genießen, sage ich mir, wenn ich an der Schlange vorbeitänzele. Die Kellner sehen alle aus wie junge Marcello Mastroiannis, dazwischen wuchert toskanische Fauna: Einer sieht aus und redet wie Roberto Benigni in Daunbailò, aber ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Was, wenn er einfach nur ein Doppelgänger ist? Ein anderer ist ein sehniger Guru, angeblich ein berühmter linker Schriftsteller, der von allen hofiert wird und mich zu sich nach Hause zum Essen einlädt.
Er lebt in einem aufwendig restaurierten Bauernhaus, zeigt mir den Flügel, an dem seine Lebensgefährtin immer ihre Chopin-Etüden gespielt habe, und serviert mir eine Kichererbsensuppe, die nicht einfach eine Kichererbsensuppe mit frischem Rosmarin und einem Schuss Olivenöl sei, sondern ein Wahrzeichen der Toskana, ja ein Bekenntnis zum einfachen Leben, eine wahre Festa dell’Unità-Suppe, für die er die Kichererbsen zwölf Stunden lang eingeweicht und sie den ganzen Vormittag habe köcheln lassen.
Von der proletarischen Kichererbsensuppe kommt er auf das Scheitern des Historischen Kompromisses zu sprechen, also dieses Versuchs, den Teufel, vulgo die Kommunistische Partei Italiens, mit etwas Weihwasser, den Christdemokraten, zu benetzen – womit die Koalition zwischen der KPI und den Christdemokraten gemeint war. Darauf fällt mir der Eurokommunismus wieder ein, der sich hier in der Toskana möglicherweise gut angefühlt hat. In der Tschechoslowakei, in Ungarn oder Polen, wo ich gerade einige Wochen verbracht habe, steht der Kommunismus allerdings für eine andere Realität. In Prag hat der Geheimdienst vor meinen Augen eine Studentin verhaftet, mit der ich gerade ein Interview führte, und in Danzig habe ich Großmütter erlebt, die selbst unter Tränengas »Jaruzelski ist ein Judas« skandierten.
Im Osten ist man auf den Kommunismus nicht besonders gut zu sprechen, sage ich, was der sehnige linke Guru so aber nicht stehen lassen will: Das sei doch kein Freiheitskampf, in Polen würde schließlich die CIA ihre Fäden ziehen, das sei allgemein bekannt.
Es mag daran liegen, dass ich als Bergmannstochter immer etwas empfindlich reagiere, wenn mir Bürgersöhne erklären wollen, was links ist – zumal die kommunistische Führung in Peking gerade die Protestbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens hat niederschießen lassen. Jedenfalls fange ich an, in meinem dürftigen Italienisch mit dem sehnigen linken Guru herumzustreiten, der mir Bürgerlichkeit und mangelndes kritisches Bewusstsein vorwirft. Das erinnert mich an mein Soziologiestudium, an die »Einführung in die Hauptströme des Marxismus«, den Grundkurs »Theorie des Klassenbegriffs und der proletarischen Klasse« und daran, dass im Seminar niemand außer mir wusste, was ein Ecklohn ist – ich das aber von meiner Tante Ruth gelernt hatte, die als Metallarbeiterin immer die Akkordlöhne kaputt gemacht hat, weil sie zu schnell arbeitete. Aber das erzähle ich dem linken Guru nicht. Auch weil ich nicht weiß, in welcher Vergangenheitsform ich von der Akkordarbeit meiner Tante erzählen müsste: ferne Vergangenheit ohne jeden Gegenwartsbezug oder nahe Vergangenheit?
Als ich mit meiner Vespa wieder vom Hof rolle, sehe ich im Müll zwei leere Kichererbsensuppendosen liegen. Daran denke ich bis heute, wenn ich mir eine Festa Dell’Unità-Kichererbsensuppe mit Rosmarin und Olivenöl anreichere.
In der Ciucheba hängen nicht nur sehnige linke Schriftsteller herum, sondern auch jede Menge Typen, die behaupten, schon als Schüler Teil von Lotta Continua gewesen zu sein und ihre Ferien nur deshalb in der Sommervilla der Familie zu verbringen, weil sie ihre Mütter nicht enttäuschen wollten. Als einer von diesen Lotta-Continua-Typen hört, dass ich Journalistin bin, hält er mir einen langen Vortrag über die Rolle des Journalismus im Kapitalismus. Ich nippe solange an einem Martini und studiere die an den Wänden hängenden Fotos von Berühmtheiten, die hier aufgetreten sind. Es sind lauter Namen, von denen ich, abgesehen von Lucio Dalla und Gianna Nannini – Latin lover, latin lover/Stai con le tue foto/Stai con i tuoi trucchi –, noch nie gehört habe. Etwa ein androgyner Sänger namens Renato Zero, dessen Liedtexte hier alle mitsingen können.
Oder ein Kabarettist namens Beppe Grillo, der im Fernsehen einen Witz über diesen Craxi gemacht hat – was ja nach allem, was ich über Craxi am Strand gehört habe, wohl das Mindeste ist, was man tun kann. Die Roberto-Benigni-Wiedergänger und jungen Marcello Mastroiannis versuchen mir den Witz zu erklären, er geht ungefähr so: Der Sozialist Craxi fährt mit seinem Parteifreund Martelli nach China. Fragt der Parteifreund: Hier sind eine Milliarde Chinesen – und die sind alle Sozialisten, richtig? Ja, klar, warum?, fragt Craxi. Und Martelli sagt: Aber wenn hier alle Sozialisten sind, wen beklauen sie dann? Daraufhin schütten sich alle vor Lachen aus. Ich lache auch etwas, aber mehr aus Höflichkeit. Und die Italiener lachen noch mehr, als sie mir erzählen, dass dieser mir unbekannte Kabarettist nicht mehr im Fernsehen auftreten darf, seit er diesen kleinen Witz über Craxi gemacht hat. Finden alle völlig normal. Gut, sie finden es nicht richtig, natürlich nicht, aber eben normal: So ist das eben in Italien.
Und noch bevor ich das vertiefen kann, also den Zusammenhang zwischen dem, was man als »normal« empfindet, und dem »So ist das eben in Italien«, fragen mich einer der Lotta Continua-Anhänger und einer der jungen Marcello Mastroiannis, ob ich Lust hätte, am nächsten Tag mitzukommen an die »weißen Strände« von Rosignano Solvay, ein paar Kilometer südlich.
Castiglioncello ist wie Rosignano Solvay ein Ortsteil von Rosignano Marittimo, ich wundere mich nur etwas über dieses unitalienische »Solvay« im Namen, das klingt wie ein Waschpulver. Aber egal, ich bin neugierig und fahre mit zu diesem Wunderstrand. Der Sand ist gleißend weiß, und das Wasser glitzert türkisblau. Ein kleines Mädchen gräbt sich bis zum Hals in den Sand ein, ein kleiner Junge stürzt sich kopfüber in die Fluten, genau wie der junge Marcello Mastroianni und der Lotta Continua-Anhänger. Nur ich bleibe sitzen. Denn ich habe mich umgedreht und auf rauchende Schlote, Kühltürme und Abgasrohre geblickt, aus denen weißer Schleier aufsteigt.
Die Idee, vor einer Chemiefabrik zu baden, finde ich bizarr. Wobei ich das offenbar als Einzige hier so sehe. Genussvoll legen sich manche sogar in den Abwasserkanal, weil der so schön warm sei wie Thermalwasser. Und wen jucken Kühltürme und Schlote, wenn aquamarinblaue Unendlichkeit vor dir glitzert? Zumal wir, wie meine Begleiter sagen, dieses Juwel nicht mal teilen müssen mit den Horden von Florentinern und Livornesen, die hier am Wochenende einfallen.
Ja, gut, sie geben zu, dass die »weißen Strände« ihre Farbe nicht der Natur verdanken, sondern den Einleitungen des Chemiemultis Solvay. Aber Gott, ja, das bisschen Soda wird doch niemanden umbringen. Der junge Marcello Mastroianni grinst und der Lotta Continua-Anhänger belächelt mich: Das wird doch schon seit Jahrzehnten hier eingeleitet. Also kann es so schlimm nicht sein.
In Deutschland vergeht kein Tag, an dem nicht über das Waldsterben und den sauren Regen geklagt wird, und hier soll ich mich an einen Chemiestrand legen? Wie ist es möglich, dass an einem Ort, der Italien-Sehnsucht in Tüten verkaufen könnte, in einer Landschaft voll perfekter zypressenbestandener Hügelketten nicht in den Tourismus, sondern in die Chemieindustrie investiert wird?
Mamma Solvay wird die Sodafabrik hier genannt, sie gilt als die größte Europas. Meine Begleiter erklären, dass Rosignano Marittimo seiner Mamma Solvay nicht nur Häuser, Schulen und ein Krankenhaus verdankt, sondern auch einen Ruderclub und ein Theater – weshalb ein ganzer Ortsteil nach dem Chemieriesen benannt ist. Fassungslos schüttele ich den Kopf. Nicht nur vom jungen Marcello Mastroianni, sondern auch vom Lotta Continua-Anhänger ist jedes kritische Bewusstsein abgefallen. Sie werden nicht müde, den gleißend weißen Sand und das ultramarinblaue Wasser zu preisen.
Zukunftsgläubig, wie ich in jenem Sommer bin, beschließe ich, den Strand von Rosignano Solvay für ein überkommenes Relikt zu halten: Kurz vor dem Fall der Mauer glauben wir an den Aufbruch in eine bessere, gerechtere und auch sauberere Welt – warum soll das nicht auch für von Chemiemultis verpestete toskanische Strände gelten?
Am Ende meines sechswöchigen Sprachkurses sind meine Beine voller Blutergüsse, weil ich das mit der Kupplung der Vespa bis zum Schluss nicht richtig hingekriegt habe. Aber ich spreche ein schönes Hochitalienisch ohne K-Schwäche – also ohne das in der Toskana verbreitete Unvermögen, das »k« auszusprechen (hasa für »casa«). Als mich im Zug zurück nach Hamburg ein Mann aus Verona mit dem für die Stadt typischen stimmlosen s anspricht, glaube ich, dass er mit einem schweren Sprachfehler geschlagen sei. Aber er hat schwarze Locken wie ein Etrusker, was mich über seinen sprachlichen Defekt hinwegsehen lässt.
Komisches Land, dieses Italien, denke ich. Voller Widersprüche: Man spricht offen über schreckliche Skandale, und Zustände, die anderswo eine Revolution ausgelöst hätten, werden hier belacht. Man regt sich darüber auf, dass die Sozialisten klauen, und lacht, als ein Kabarettist aus dem Fernsehen eliminiert wird. Man lebt in einer der schönsten Landschaften der Welt und legt sich an einen verpesteten Strand. Und lacht auch darüber.
Frühling von Palermo
Die Investition in meinen Italienischkurs hat sich gelohnt, noch im gleichen Jahr darf ich zum ersten Mal als Journalistin nach Sizilien fahren, beauftragt mit einer Reportage über den »Frühling von Palermo«, jene Aufbruchstimmung, die auf der Insel herrscht, seitdem zwei kühne Staatsanwälte den schon damals legendären »Maxiprozess« gegen die Mafia führen.
In Palermo lerne ich einen Polizisten kennen, der von zwei Leibwächtern geschützt wird, die ihn in einer gepanzerten Limousine fahren. Was für ein eigenartiges Land, denke ich, hier müssen die Polizisten bewacht werden! Das Innenministerium in Rom hat ihm Personenschutz verordnet, heißt es, weil man in Sizilien sonst nicht mehr für seine Sicherheit garantieren könne.
Der Polizist heißt Montalbano, wie der Kommissar, den Andrea Camilleri später erfinden wird. Der echte Montalbano ließ nicht nur Heroinraffinerien der Pizza Connection auffliegen, er hat in Trapani auch das Centro Scontrino, den Sitz mehrerer verbotener Freimaurerlogen, durchsuchen lassen, womit er die Verbindung zwischen Freimaurern, führenden Christdemokraten, dem Vizepräfekten und dem Chef der Gemeindepolizei aufdeckte. In der Geheimloge Iside 2 planten Richter, hohe Staatsbeamte, Unternehmer und Mafiabosse ihre Geschäfte – womit er sich extrem unbeliebt gemacht hat, bei all denjenigen, die an der Macht sitzen. Daraufhin wurde Montalbano von Trapani nach Palermo versetzt und musste als Leiter des Mobilen Einsatzkommandos den Schreibtisch von Ninnì Cassarà übernehmen, seinem von der Mafia ermordeten Vorgänger – bis er wieder versetzt wurde, diesmal ins Kommissariat von San Lorenzo. Hier, am Rand von Palermo inmitten von Plattenbauten und Bretterbuden, befindet sich das Territorium von Mafiaboss Totò Riina.
Das alles erfahre ich nicht von Saverio Montalbano, sondern von den italienischen Journalistenkollegen, die ich während meiner Recherche kennenlerne. Sie alle sprechen voller Hochachtung von Montalbano. Und lachen, wenn ich frage, wie man einen so erfolgreichen Polizisten einfach versetzen kann, ohne dass die Hintergründe dieser Versetzung bekannt werden? Aber sicher wird auch dies bald der Vergangenheit angehören, denke ich, schließlich sind wir alle zuversichtlich in jenem Sommer 1989. Endlich bewegt sich die Welt: Im Osten bröckelt der Beton, und wir Journalisten sind davon überzeugt, dass auch in Italien das Fundament wankt, auf dem die Mafia, die Christdemokraten und die korrupten Sozialisten ihre Herrschaft errichtet haben.
Montalbano selbst hält sich zurück, was seine Enthüllungen betrifft. Genauer: Er sagt kein einziges Wort. Wenn ich ihn auf seine Versetzungen anspreche, schnalzt er nur kurz mit der Zunge und kichert etwas verlegen, wie jemand, dem es unangenehm ist, im Mittelpunkt zu stehen.
Wenn ich von Palermo aus mit meiner Mutter telefoniere, macht sie mir schwere Vorwürfe: Im Jahr zuvor habe ich eine Reportage über den Bürgerkrieg im Südsudan gemacht, und in ihren Augen besteht in Sachen Gefährlichkeit kein großer Unterschied zwischen dem Südsudan und Sizilien. Als ich Montalbano davon erzähle, lacht er und sagt: Bestellen Sie Ihrer Mutter, dass Sie hier in Palermo die am besten bewachte Journalistin sind!
Aber es hätte meine Mutter keineswegs beruhigt, wenn sie gewusst hätte, dass ich mit einem Polizisten, der wegen seiner Ermittlungen von zwei Polizisten bewacht und auf Stellen versetzt wird, deren letzte Inhaber ermordet wurden, in seiner gepanzerten Limousine zum Mittagessen gefahren bin. Nie werde ich den satten Klang der Autotüren vergessen und dass Montalbano für sich Krake bestellt hat, die im Ganzen serviert wird, dampfend und blutrot.
Ich erfahre, dass nur drei Wochen vor meiner Ankunft Nino Agostino, Streifenpolizist des Kommissariats von San Lorenzo, zusammen mit seiner schwangeren Frau ermordet worden ist, erschossen von zwei Killern auf Motorrädern. Und dass Nino Agostinos Vater geschworen hat, sich erst wieder zu rasieren, wenn die Mörder gefasst sind – weil er keine Sekunde an die offizielle Version glaubt, dies sei ein »Verbrechen aus Leidenschaft« gewesen. Sein Sohn war auch einer der Leibwächter von Montalbano. Mit Nino Agostino wird die Liste der von der Mafia ermordeten Polizisten immer länger, allein drei starben im Jahr 1985: Beppe Montana, Ninni Cassarà, Roberto Antiochia.
Ich erfahre nur, dass kurz vor meiner Ankunft in Palermo vor der Ferienvilla des Antimafia-Staatsanwalts Giovanni Falcone in Addaura ein elf Kilo schwerer Sprengsatz gefunden wurde, der per Fernsteuerung gezündet werden konnte. Dieses Attentat schlug fehl, und in Palermo kursiert das Gerücht, Falcone habe es selbst inszeniert, um seine Bekanntheit und seinen Einfluss zu vergrößern. In einem Interview mit der Unità lese ich, dass Falcone das Attentat auf menti raffinatissime, »raffinierte Köpfe«, zurückführt, die bestimmte Aktionen der Mafia steuern. Den Ausdruck menti raffinatissime verstehe ich nicht. Aber ich vergesse ihn nie.
Zurück in Hamburg, lese ich in der Repubblica, dass im Justizpalast von Palermo die Rede von einem Denunzianten ist, il corvo genannt, der Rabe, der in anonymen Briefen Antimafia-Staatsanwalt Giovanni Falcone beschuldigt, einen reuigen Mafioso als »Staatskiller« eingesetzt zu haben. Der Denunziant, dessen Identität niemals enthüllt wird, soll sich in den Reihen der Staatsanwaltschaft befinden, weshalb vermutet wird, dass die Antimafia-Staatsanwaltschaft einen »Maulwurf« beherbergt. Also jemanden, der sich in eine Organisation einschleicht und sie zu manipulieren versucht, ein Spitzel im Justizpalast – und ich bekomme erste Zweifel, ob die Hubschrauber, die Falcone Geleit geben, ihn wirklich schützen können.
Meine allererste Reportage über Palermo erscheint auch nicht. Aber am Ende dieser Reise habe ich ein Land und eine Liebe fürs Leben gefunden: in Venedig, wohin ich von Palermo aus geflogen bin, weil ich dort ein Interview führen sollte. Das auch nicht zustande kommt. Stattdessen läuft mir der Italiener meines Lebens zu. Schicksal eben.
Ein letzter Venezianer
Der Italiener meines Lebens ist vor allem Venezianer. Was das bedeutet, kann ich zunächst nicht abschätzen. Meine Hamburger Freundinnen finden es exotisch, dass ich mich ausgerechnet in einen Venezianer verliebt habe, weil es bekanntlich nur noch so wenige von ihnen gibt. Weil sie davon ausgehen, dass Venezianer alle in Palazzi wohnen und über ein ausgeprägtes Stilempfinden verfügen, treiben mich meine Freundinnen an, vor dem ersten Besuch des Venezianers in Hamburg die Möbel in meinem Ein-Zimmer-Appartement umzustellen, damit der Raum an Weite gewönne. Meine wesentliche Konzession an die erwarteten hohen ästhetischen Ansprüche des Venezianers besteht im Lackieren meines Papierkorbs mit weißem Sprühlack. Den Papierkorb besitze ich heute noch.
Meine Familie im Ruhrgebiet ist im Hinblick auf Venedig gespalten. Die Frauen finden es romantisch und erzählen etwas von der Stadt der Liebe, obwohl meine Tante Anita Venedig als Einzige tatsächlich gesehen hat, auf der Rückfahrt von Jugoslawien, und da hatte es schlecht gerochen, aus den Kanälen. Die Männer geben sich wenig beeindruckt und fragen sich, wie man sich so etwas freiwillig antun kann: im Wasser zu wohnen, wo doch alle wissen, wie teuer es wird, wenn sich der Schwamm erst mal im Mauerwerk eingenistet hat?
Der Venezianer ist allergisch gegen Tomaten und Kaffee, er verabscheut Knoblauch und interessiert sich nicht für Fußball. Unter meinen Hamburger Freundinnen und großen Teilen meiner Bergmannsfamilie bestehen deshalb ernsthafte Zweifel daran, ob es sich hier wirklich um einen echten Italiener handelt. Vor allem, weil er stets und fast entschuldigend betont, Venezianer zu sein, was aber keiner richtig versteht, also diesen Unterschied zwischen dem Dasein als Italiener und dem als Venezianer. Keiner außer meiner ostpreußischen Großmutter, die zeitlebens Wert darauf legt, vor allem Ostpreußin zu sein, genauer gesagt Ermländerin.
Alle anderen fragen sich: Was soll das heißen, dass er vor allem Venezianer ist? Ist er deshalb vielleicht weniger Italiener?
Wenn er in Italien ist, ist er vor allem Venezianer, sage ich, und wenn er in Deutschland ist, dann ist er vor allem Italiener. Das liegt daran, dass er sich immer den Schwächeren zugehörig fühlt – so versuche ich es mir zu erklären. Denn natürlich weiß der Italiener, dass man in Deutschland etwas herabblickt auf Italien, das Land des dolce vita, das ja wohl nicht viel mehr hervorgebracht habe als Pizza, Pasta und diesen Sambuca mit der Kaffeebohne, den der italienische Wirt nach dem Essen ausgibt.
Und die Venezianer sind eine vom Aussterben bedrohte Art, schon deshalb muss man sich mit ihnen solidarisch fühlen.
In Deutschland aber wissen die wenigsten, wie schwach Venedig ist – wovon ich mir im Sommer 1989 selbst ein Bild machen kann: Ich komme kurz nach dem verheerenden Pink-Floyd-Konzert in die Stadt, jeder erzählt mir davon. Die Bilder von dem unter Müll versunkenen Markusplatz sind erst einen Monat zuvor um die Welt gegangen. Venedigs Heimsuchung hat seitdem einen Namen: Pin Floi, wie die Venezianer sagen. Pin Floi ist das Sinnbild für Venedigs Niedergang, seine von Horden zertrampelte Würde. So, wie die Venezianer dieses Pin Floi aussprechen, teilen sie mit, wie sehr sie das alles verachten: die Verhöhnung ihrer Stadt, die Geringschätzung ihrer Kultur und Geschichte, die Gier, mit der man sich an Venedig krallt, um die Stadt auszuschlachten für eigene, profitorientierte Interessen.
Der Venezianer erzählt, dass bei Pink Floyd die mir bereits als verdächtig bekannten Sozialisten ihre Finger im Spiel hatten: Der Sozialist Gianni De Michelis, Vizepremier der Regierung De Mita und wenig später Außenminister der sechsten Regierung Andreotti, habe das Konzert unbedingt in seine Heimatstadt holen wollen. Die Veranstaltung sollte eine Generalprobe für die Bewerbung Venedigs für die Expo 2000 sein. Die Venedig in die Zukunft katapultieren könne.
Dass diese Stadt so schwach ist, nimmt mich sofort für sie ein. Mehr aber noch nimmt mich dieser für einen Italiener erstaunlich blasse Venezianer für sich ein. Dem ich auf der Stelle bis ans Ende der Welt gefolgt wäre. Ohne dass ich eigentlich weiß, wer er ist.
Wie deutsch bin ich?
Der Venezianer sieht seine Berufung darin, das Werk eines in Vergessenheit geratenen spanischen Designers wiederauferstehen zu lassen, der sein Leben in Venedig verbracht hat und von dem ich noch nie gehört habe: Mariano Fortuny. Wenn ich meiner Familie im Ruhrgebiet erzähle, dass der Venezianer in einem Palazzo unweit vom Markusplatz in Handarbeit gefältelte Seidenkleider und Seidenlampen herstellen lässt, die um die Jahrhundertwende in Mode waren, blickt man mich an, als sei ich einem besonders gewieften Mädchenhändler auf den Leim gegangen.
Im Stern ist Italien völlig aus dem Blick geraten, hier geht es nur noch um die Montagsdemonstrationen und die sprunghaft angestiegenen Ausreiseanträge von DDR-Bürgern. Ja, die Welt scheint sich zu bewegen. Allerdings ohne mich. Denn der Untergang der DDR, die für mich wesentlich aus alten Politbüro-Kadern mit Kassenbrillen und Strohhütchen besteht, gehört nicht in mein Ressort: Ich muss Kleintexte für ein Himalaja-Special machen und einen Kasten über die Trinkkultur des Buttertees schreiben, Tee mit gesalzener Yakbutter.
Keine zwei Monate nachdem wir uns kennengelernt haben, fällt die Mauer. Und keiner hat damit gerechnet, jedenfalls nicht ernsthaft. Ich sitze in meinem Appartement auf dem Klappsofa, freue mich, dass der Venezianer mir gerade seinen Besuch für den nächsten Tag angekündigt hat, und verfolge zerstreut die Tagesthemen, als der Moderator erklärt, dass die innerdeutschen Grenzübergänge geöffnet worden seien. Und das, weil ein italienischer Journalist in der Ostberliner Pressekonferenz in holprigem Deutsch eine Nachfrage zur Reisefreiheit gestellt hat.
Ich erstarre vor meinem tragbaren Minifernseher und bin fassungslos, als ich sehe, wie die Menschen in Berlin auf die Mauer klettern. Für mich war die DDR auf alle Ewigkeit einbetoniert in ihre Parteitage, Aufmärsche und Fahnen schwingenden FDJler in blauen Hemden. Sofort rufe ich den Italiener an und sage ihm, dass er unbedingt seinen Pass mitbringen soll, damit wir nach Berlin zur Mauer fahren können.
Mein Vorschlag ist mir etwas peinlich, denn ich erinnere mich noch daran, wie pathetisch ich den amerikanischen Präsidenten Reagan fand, als er in seiner Rede am Brandenburger Tor Tear down this wall! – Reißen Sie diese Mauer nieder! – sagte: Ein Satz, so wirksam, wie in die Luft zu boxen, dachte ich damals. Schauspieler halt.
Und jetzt ist genau das passiert, was Ronald Reagan gefordert und ich nie für möglich gehalten habe.
Der Italiener findet meinen Wunsch, nach Berlin zu fahren, überhaupt nicht peinlich, sondern normal. Menschlich. Natürlich. Man könne ein Volk nicht einfach teilen, das wäre doch so, als würde man eine Familie trennen. Ihr seid doch alle Deutsche, sagt er.
Und ich frage mich, wie deutsch ich eigentlich bin.
Dass ich im Ruhrgebiet geboren wurde, ist reiner Zufall, erkläre ich: Mein Name ist polnisch, und seit meinen Reportagen in Polen weiß ich sogar, dass ein Stanislas Reski Gesandter des polnischen Königs am Hof von Neapel war.
Also bist du eigentlich Polin, sagt der Venezianer.
Nein, Quatsch, Polin bin ich auch nicht, sage ich und suche nach der richtigen Übersetzung für Schlesien, Slesia, und Ostpreußen, Prussia orientale, wovon der Venezianer noch nie gehört hat. Er kennt nur die Geschichten der aus Istrien vertriebenen Italiener, die in Venedig in dem ehemaligen Kloster von San Pietro di Castello Zuflucht fanden.
Ich erkläre es dir morgen, wenn du kommst, sage ich.
Als wir uns am nächsten Tag in meinem Peugeot 205 auf den Weg von Hamburg nach Berlin machen, versuche ich dem Venezianer klarzumachen, wie ich mich in Polen anfangs gewundert habe, dass mir dieses fremde Land so seltsam vertraut war – obwohl ich seine Sprache nicht sprach, es nie bereist, nie seine Dichter gelesen habe. Und dass mir dieser Portier des Hotels Victoria kurz nach meiner Ankunft eine Nachricht überreicht, gelächelt und gesagt hat: Nu, Reski hejissen Sie, ist aber doch polnischer Name! Sind Sie nicht Polin? Und ich ganz schnell geantwortet habe: Meine Mutter kommt aus Schlesien, und mein Vater kommt aus Ostpreußen, so automatisch wie als Kind, wenn mich jemand nach der Herkunft meiner Familie gefragt hat. Und dass ich einen Herzschlag lang unsicher war: Ob er mich nun für eine Heim-ins-Reich-Deutsche halten würde? Für eine Revanchistin, eine Unbelehrbare?
Ich erzähle dem Venezianer, wie erleichtert ich war, als der Portier nicht sagte: Sie meinen wohl das ehemalige Ostpreußen!, sondern mich vielmehr zu meinen Wurzeln beglückwünschte und mich seither ganz besonders freundlich grüßte. Freundlicher als die französischen Fotografen, die amerikanischen Fernsehteams und die polnischen Geheimdienstler, mit denen ich im Hotel Victoria in einer Zwangsgemeinschaft lebte. Und dass ich, als ich von Warschau nach Danzig fuhr, um über die Schließung der Lenin-Werft zu berichten, irgendwann ein Schild passierte: Warmia i Mazury. Ermland und Masuren, woraufhin die Übersetzerin Hanna »Die Heimat deiner Familie« sagte und mir das Wort »Heimat« unangenehm war.
Auch jetzt schaffe ich es nicht, das Wort Heimat ins Italienische zu übersetzen: Patria passt nicht, weil ein Vaterland etwas anderes ist, und paese d’origine, Ursprungsland, klingt zu bürokratisch.
La terra della tua famiglia, schlägt mir der Italiener vor. Ich zucke zusammen, sage: No, no, no, terra no!, und versuche zu erklären, dass das Wort »Erde« in Verbindung mit dem Wort »Heimat« bei Deutschen sofort die schrecklichsten Assoziationen hervorruft.
Aber wie kann dir das Wort Heimat unangenehm sein?, fragt der Venezianer, als wir uns kurz vor dem Grenzübergang Helmstedt/Marienborn befinden.
Es ist kompliziert, sage ich.
Und während ich dem Italiener mein Verhältnis zu Deutschland samt meiner vielschichtigen Familiengeschichte darzulegen beginne, betrachtet er etwas verstört die Landschaft, die hier im Wesentlichen aus Kontrollbaracken, Wachtürmen, Grenz- und Sperrzäunen besteht, aus Stacheldraht und Abfertigungshallen, aus Anzeigetafeln mit »Transit Westberlin« und »Einreise DDR« und aus Vopos in grüngrauer Uniform, die uns einen Stempel in den Pass knallen. Auf der Gegenseite schiebt sich eine lange Zweitakter-Kolonne Richtung Westen.
Inzwischen auf DDR-Gebiet, halte ich mich an das Tempolimit von hundert Stundenkilometern und erzähle ihm weiter alles von Ostpreußen und Schlesien und Flucht und Heimat. Ich will ihm erklären, warum ich sowohl die Bindung an ein Stück Erde als auch das Deutschsein zutiefst skeptisch sehe, nicht nur wegen der Nazivergangenheit, sondern auch, weil das Land, aus dem meine Familie stammt, abhandengekommen ist nach dem Krieg.
Das Ruhrgebiet, in dem ich aufgewachsen bin, ist nur ein zufälliger Fleck, in dem meine Familie gelandet ist, sage ich.
Aber das ist doch auch Deutschland, sagt der Italiener.
Ja, aber anders, sage ich.
Wie anders?
Anders als Ostpreußen oder Schlesien.
Aber du kennst Ostpreußen oder Schlesien doch gar nicht.
Doch, sage ich, Ostpreußen und Schlesien waren immer da – in der Art, wie man in meiner Familie spricht und isst. Außerdem sagt meine Mutter bis heute »Bei uns zu Hause«, wenn sie Schlesien meint. Und in der Familie meines Vaters singen sie am Ende einer jeden Feier das Ostpreußenlied und fangen an zu weinen.
Tatsächlich?, sagt der Italiener, der den Deutschen solche Gefühlsausbrüche offenbar nicht zutraut.
Natürlich nur, wenn sie zu viel getrunken haben, füge ich hinzu.
Wenn wir uns hätten entscheiden können, wären meine Freundinnen und ich alle lieber Französinnen oder Italienerinnen gewesen, sage ich. Wir sind alle so schnell wie möglich ins Ausland gegangen, nach Spanien und England und Frankreich, eine sogar nach Australien, und das, obwohl die Familien meiner Freundinnen nicht geflüchtet, sondern seit Generationen ansässig waren in Ostwestfalen und in der niedersächsischen Tiefebene.
Der Venezianer ist jetzt gerade mehr Italiener denn je. Er hört meiner Selbstzerfleischung interessiert zu und versucht vergeblich zu verstehen, warum ich mich gerade sehr angestrengt von meinem Deutschtum distanziere, während die ganze Welt auf das sich in diesem Augenblick wiedervereinende Deutschland blickt und jubelt.
Er hat davon gehört, dass es in der DDR, also diesem Land rechts und links von der Transitstrecke, verboten war, frei zu reisen und frei zu sprechen, aber er kann es sich nicht wirklich vorstellen. Vor allem, dass alle die Verbote befolgt haben, übersteigt seine Vorstellungskraft. Und ich erzähle davon, wie ich im Jahr zuvor mit einem Fotografen im Zug von Prag nach Bratislava gefahren bin, im Abteil mit zwei DDR-Bürgern, die es geschafft haben, während der fünf Stunden Fahrtzeit kein einziges Wort mit uns zu wechseln.
Aus der kurzen Zeit, als ich in Berlin wohnte, habe ich noch die DDR-Stempel in meinem Pass. In den Augen des Italieners qualifiziert mich das zur Spezialistin für die deutsche Teilung. Er erwartet, dass ich ihm all die deutsch-deutschen Merkwürdigkeiten erkläre, etwa, dass diese Autobahn eine Art extraterritoriales Gebiet war, nur für den Transitverkehr gedacht, mehr oder weniger eine Art Tunnel, durch den man durch die DDR geleitet wurde. Ich versuche Begriffe wie »Zonenrandgebiet« und »Transitabkommen« zu übersetzen, das Schild, auf dem steht: pkw nur im schritttempo nähern, und von Grenzpolizisten dahingeschnarrte Sätze wie »Den Pass bitte« oder »Linkes Ohr freimachen«. Auf Französisch geht es, aber auf Italienisch fehlen mir die Worte.
Wir fahren durch ein beklemmendes Stück deutscher Geschichte, und der Italiener fängt an, sich Sorgen zu machen. Was, wenn die gleich auf die Idee kommen, hier alles wieder zuzumachen, die Grenzen zu schließen und uns auch einzusperren?
Ich muss aber wieder nach Venedig zurück, sagt er.
Und ich sage: Quatsch, die machen hier nicht wieder zu. Obwohl er natürlich recht hat. Was, wenn jetzt das geschieht, was die Schreckensvision meiner Kindheit war: Was, wenn die Russen jetzt tatsächlich kommen?
Wir schweigen eine ganze Zeit und winken ab und zu Menschen zu, die auf den Brücken stehen und uns jubelnd begrüßen.
Wie konnte es nur gelingen, ein ganzes Volk hinter einer Mauer einzusperren, im zwanzigsten Jahrhundert?, fragt der Italiener.