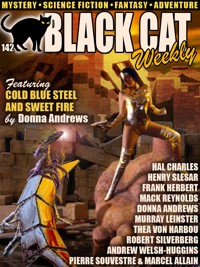4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein lustiger Cosy Crime Roman
- Sprache: Deutsch
"Bei Andrews verbinden sich Mord und ausgelassener Witz mit jeder Menge verschrobener Charaktere." Kirkus Reviews
Ein romantischer Kurztrip! Meg Langslow und ihr Freund Michael freuen sich schon sehr auf die einsame kleine Insel Monhegan vor der Küste von Maine, ein Paradies für Papageientaucher. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn Megs Eltern, ihr Bruder, ihre Tante und ein neugieriger Nachbar sind ebenfalls vor Ort. Als eine Leiche gefunden wird, verdächtigt man ihren Vater plötzlich des Mordes. Statt sich bei Spaziergängen am Meer zu erholen, sucht Meg nun fieberhaft nach Beweisen für seine Unschuld. Doch auch der Mörder ist währenddessen nicht untätig ...
Band 2 der Cosy-Crime-Reihe um Meg Langslow. Nächster Band: "Schräge Vögel sterben schneller".
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumDanksagungKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34Weitere Titel der Autorin:
Die humorvolle Meg-Langslow-Krimireihe:
Komische Vögel sterben tragisch
Schräge Vögel sterben schneller
Böse Vögel lassen Federn
Über dieses Buch
»Bei Andrews verbinden sich Mord und ausgelassener Witz mit jeder Menge verschrobener Charaktere.« Kirkus Reviews
Ein romantischer Kurztrip! Meg Langslow und ihr Freund Michael freuen sich schon sehr auf die einsame kleine Insel Monhegan vor der Küste von Maine, ein Paradies für Papageientaucher. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn Megs Eltern, ihr Bruder, ihre Tante und ein neugieriger Nachbar sind ebenfalls vor Ort. Als eine Leiche gefunden wird, verdächtigt man ihren Vater plötzlich des Mordes. Statt sich bei Spaziergängen am Meer zu erholen, sucht Meg nun fieberhaft nach Beweisen für seine Unschuld. Doch auch der Mörder ist währenddessen nicht untätig …
Über die Autorin
Donna Andrews wurde in Yorktown, Virginia, geboren – wie die Protagonistin ihrer humorvollen Vogel-Krimireihe, Meg Langslow. Andrews erster Roman, Komische Vögel sterben tragisch, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter die internationalen Krimipreise Agatha, Anthony und Barry Award, den St. Martin's Press Malice Domestic Award für den besten traditionellen Kriminalroman sowie den Romantic Times Award als bester Debütroman. Donna Andrews lebt in Reston, Virginia.
Website der Autorin: www.donnaandrews.com.
Donna Andrews
ALLE VÖGEL SIND SCHON TOT
Meg Langslows zweiter Fall
Aus dem amerikanischen Englisch von Frauke Meier
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2000 by Donna Andrews
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Murder with Puffins«
Originalverlag: St. Martin’s Press, New York
Published by arrangement with St. Martin’s Press. All rights reserved.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2008/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Alexander Huiskes
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Bplanet | Melinda Fawver | Mike Pellinni | Irina Chyda | Tom Nieuwenhuizen | PowerUp | Artyem Dzyuba
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6270-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
DANKSAGUNG
Ich danke
Dad, der mich zu Megs Dad inspiriert hat.Mom, weil sie nicht die geringste Ähnlichkeit mit Megs Mutter hat (nun ja, abgesehen von der Sache mit der Kokosnuss).Stuart und Elke, da ihr auf Monhegan geheiratet habt.Monhegan und seinen Bewohnern – obwohl ein Hurrikan und ein Mord ein erbärmlicher Dank für eure Gastfreundschaft zu sein scheinen.Ruth Cavin und den Leuten von St. Martin’s, und Ellen Geiger von Curtis Brown, weil sie mir geholfen haben, die gefährlichen Klippen des Verlagswesens zu umschiffen.meinen über die ganze Welt verstreuten Freunden und Familienangehörigen, einschließlich der Misfits, Queen Bees, Teafolk, Wombats, Mitautoren und Mitleser.KAPITEL 1
Ein Papageientaucher wird kommen
»Ich sehe Land voraus«, sagte Michael.
»Wetten, dass die Leute auf dem echten Fliegenden Holländer das auch öfter gesagt haben?«, fragte ich, die Augen fest geschlossen.
»Nein, wirklich; dieses Mal bin ich sicher«, insistierte er.
Ich ließ die Augen geschlossen und die Finger eisern um die Reling gespannt, während unter mir das Deck der Fähre auf und nieder ruckte. Regen und Gischt hatten mich bis auf die Knochen durchnässt, aber ich würde nicht in die Kabine gehen, ehe die Dünung wirklich gefährlich war. Viel zu viele seekranke Leute da drin. Natürlich waren diejenigen von uns, die auf Deck waren, ebenfalls seekrank. Aber hier draußen sorgte der Wind wenigstens für frische, wenn auch etwas feuchte Luft.
»Wenn ich das nächste Mal so eine Idee habe«, murmelte ich, »erschieß mich, und die Sache ist erledigt.«
»Was war das?«, brüllte Michael gegen einen Windstoß an.
»Nichts!«, brüllte ich zurück.
»Ich glaube wirklich, da vorn ist Land«, wiederholte Michael. »Es kann nicht wieder nur ein Nebelfeld sein.«
Ich erwog kurz, ob ich hinsehen sollte. Meine Seekrankheit schien etwas weniger schlimm, solange ich die Augen geschlossen hielt. Aber sollte wirklich ein Ende unserer Qualen in Sicht sein, so wollte ich das wissen.
Ich öffnete ein Auge einen Spalt weit und lugte in die Richtung, in die Michael deutete. Für mich sah das vage Etwas genauso aus wie die düstere Wolkenbank, die wir schon seit Stunden begafften. Vielleicht fühlte er sich einfach besser, wenn er Land zu sehen glaubte. Vielleicht versuchte er, etwas zu tun, damit ich mich besser fühlte.
»Das ist schön«, krächzte ich und klappte das Auge wieder zu, blendete den grauen Himmel aus, die graue See und das beunruhigende Fehlen einer klaren Demarkationslinie zwischen beidem. Ganz zu schweigen von den grauen Gesichtern der übrigen Passagiere, die sich an die Reling klammerten.
»Wir müssen schon ganz nahe dran sein«, sagte Michael, inzwischen schon weniger zuversichtlich. »Monhegan ist bei gutem Wetter doch nur eine Stunde von der Küste entfernt, nicht wahr?«
Ich antwortete nicht. Ja, normalerweise dauerte es nur eine Stunde, um mit der Fähre nach Monhegan zu gelangen, wo wir uns im Sommerhaus meiner Tante Phoebe einnisten wollten. Aber an dieser Reise war nichts normal. Sollte Michael immer noch glauben, wir würden bald wieder festen Boden erreichen, wollte ich ihm nicht die Hoffnung nehmen. Obwohl ich tief im Inneren wusste, dass wir in Wahrheit auf dem Fliegenden Holländer gelandet und dazu verdammt waren, bis in alle Ewigkeit die Küste auf und nieder zu segeln, oder zumindest so lange, bis der Treibstoff erschöpft war und wir von der Küstenwache gerettet werden mussten.
»Na ja, vielleicht doch nicht«, hörte ich Michael murmeln.
Mühsam klappte ich die Augen auf, um mir selbst ein Bild zu machen. Er starrte mit einem leichten Stirnrunzeln auf das Wasser. Bei seinem Anblick fühlte ich einen Anflug von Eifersucht. Während ich vermutlich genauso grässlich aussah, wie ich mich fühlte, war Michaels Äußeres selbst im Augenblick ärgster Seekrankheit einfach prachtvoll. Höchstens, dass er ein bisschen blasser als sonst war, und die hypnotischen blauen Augen wirkten ein wenig blutunterlaufen. Trotzdem, wäre ich ein Künstler auf der Suche nach dem richtigen, großen, dunkelhaarigen, attraktiven Model für das Titelblatt eines nautisch beherrschten Liebesromans, ich würde Michael nur ansehen und schreien: »Heureka!«
»Tut mir leid«, sagte ich stattdessen. »Das war keine gute Idee.«
»Es kommt schon alles in Ordnung«, sagte er mit einem Lächeln. Eigentlich war es nur ein blasser Abklatsch seines sonst so umwerfenden Lächelns, aber ich fühlte mich gleich besser. »Aber wenn wir das nächste Mal zu einem Abenteuer aufbrechen, dann sollten wir uns erst über die Wetterverhältnisse informieren, einverstanden?«
Tja, das war doch ermutigend. Wenigstens sprach er immer noch von einem »nächsten Mal«. Und ich versprach mir im Stillen, wenn ich das nächste Mal mit Michael zu einer Reise aufbräche, würde sie zu einem warmen, tropischen Ort führen, an dem das nächste größere Gewässer ein Schwimmbecken des Hotels und das größe Fortbewegungsmittel eine Luftmatratze wäre. Keinesfalls ein Boot und der Atlantik – wenn auch lediglich mehrere Meilen von der Küste von Maine entfernt. Hurrikan Gladys war inzwischen auf das Meer hinausgezogen und zu einem schlichten Tropensturm verkommen, aber hätte ich mich über die Wetterverhältnisse informiert, ehe Michael und ich zu unserem Wochenendausflug aufgebrochen waren, hätte ich vermutlich ein viel versprechenderes Ziel ausgewählt und nicht bloß blind eine Nadel in eine Karte gesteckt.
»Einverstanden«, sagte ich und erwiderte sein Lächeln, so gut ich konnte. Er legte für einige Sekunden seine Hand auf meine, bis eine weitere Woge das Boot traf und auch er wieder die Reling umklammern musste. Aber ich fühlte mich besser.
Jedenfalls mental.
Physisch … nun ja, ich versuchte, die Warnzeichen aus meinem Magen zu ignorieren.
»Meg Langslow? Sind Sie das?«
Ich schlug die Augen auf und drehte mich um. Links von mir sah ich zwei Gestalten, beide von Kopf bis Fuß in topmoderne Regenkleidung gewickelt. Sie sahen aus, als wären sie geradewegs aus einem L.L. Bean-Katalog entsprungen, und vermutlich hatten sie es unter dem Ölzeug angenehm warm und trocken. Ich bemühte mich, es ihnen nicht zu verübeln.
»Ja?«, fragte ich und versuchte durch den strömenden Regen die kleinen Ausschnitte ihrer Gesichter unter den Kapuzen zu einem größeren bekannten Bild auszuweiten. Vergeblich.
»Meg, Liebes, erinnerst du dich denn nicht an uns? Wir sind es, Winnie und Binkie!«
»Winnie und Binkie?«, echote Michael.
Endlich gelang es mir, die Namen zuzuordnen. Mr and Mrs Winthrop Saltonstall Burnham alias Winnie und Binkie besaßen ein Häuschen auf Monhegan Island und waren alte Freunde der Familie. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuschte, Freunde meiner Großeltern aus deren Kindheit, womit sie inzwischen ziemlich alt sein mussten. Und doch standen sie da, zwei stämmige, rundliche Gestalten in gelben Regenjacken, denen weder der peitschende Regen noch das wilde Schwanken des Bootes noch der beinahe in Sturmstärke wehende Wind etwas anzuhaben schienen.
»Belebend, nicht wahr?«, sagte Winnie, warf sich in die Brust und nahm einen tiefen Atemzug, der mindestens zu einem Viertel aus Wasser bestand.
»Achte gar nicht auf ihn, Liebes«, raunte mir Binkie zu, der meine Reaktion nicht entgangen war. »Bei schlechtem Wetter wird ihm immer übel. Er versucht nur, das mit Tapferkeit zu kaschieren.«
»Ach, die Überfahrt macht mir nichts aus«, sagte Winnie. »Ich hoffe nur, das Wetter kommt mir bei der Vogelbeobachtung nicht in die Quere.«
»Vogelbeobachtung?«, fragte Michael. »Sie reisen mitten in einem Hurrikan nach Monhegan, um Vögel zu beobachten?«
»Ja. Sie nicht?«, fragte Winnie kaum weniger erstaunt.
»Er wurde inzwischen zu einem Tropensturm heruntergestuft«, erklärte Binkie. »Und jetzt ist die herbstliche Überflugsaison.«
»Oh, ja, natürlich«, sagte ich.
»Die was?«, fragte Michael.
»Die herbstliche Überflugsaison«, erklärte Binkie. »Monhegan liegt genau auf der Strecke, die die Vögel nehmen, wenn sie nach Norden oder Süden ziehen. Jedes Frühjahr und jeden Herbst gibt es einen kurzen Zeitraum, zu dem die Vogelbeobachtung einen Höhepunkt erreicht, und die Vogelfreunde kommen von der ganzen Ostküste hierher.«
»Wir haben eine Hütte auf der Insel«, sagte Winnie. »Wir beobachten hier schon seit dreiundfünfzig Jahren die Vögel.« Er und Binkie tauschten ein zärtliches Lächeln aus.
»Aber wenn ihr nicht gekommen seid, um Vögel zu beobachten, was treibt euch dann nach Monhegan?«, fragte Binkie.
»Wir wollten nur einmal rauskommen«, kam Michael mir zuvor. »Ein bisschen Frieden und Ruhe finden.«
»Ein bisschen was?«, brüllte Winnie gegen den Wind an, der Michaels Worte offensichtlich fortgetragen hatte.
»Frieden und Ruhe!«, brüllte Michael zurück.
»Oh.«
Sie musterten uns immer noch mit recht perplexer Miene. Ich seufzte. Ich war nicht davon überzeugt, dass ich auch nur versuchen wollte, ihnen das zu erklären.
Vor ein paar Tagen schien der Ausflug ganz passend zu sein. Meine Beziehung zu Michael hatte einen Punkt erreicht, an dem wir einfach ein bisschen Zeit allein miteinander verbringen wollten – okay, eine Menge Zeit –, und einen Punkt, an dem keiner von uns einen Ort vorweisen konnte, den er als sein Eigen hätte bezeichnen können.
Als Assistenzprofessor für Schauspiel an einer Hochschule, deren Campus sich durch einen chronischen Mangel an Wohnraum auszeichnete, hatte Michael relativen Luxus genossen, indem er sich während der letzten paar Jahre stets in die Häuser von Fakultätsangehörigen eingemietet hatte, die zu einem Sabbatjahr aufgebrochen waren.
Dieses Jahr hatten seine Vermieter plötzlich erkannt, dass sie es sich nicht leisten konnten, ein Jahr in London zu verbringen – nicht, während gerade das siebte Kind unterwegs war. Sie waren so nett gewesen, Michael auf ihrem Sofa schlafen zu lassen, bis sich etwas anderes fände, aber das war kein geeigneter Ort für den logischen Abschluss eines romantischen Dinners bei Kerzenschein. Wir hatten bereits genug Verabredungen hinter uns, die mit Disneyvideos und dem geschickten Umgehen von Erdnussbutterklecksen zu Ende gegangen waren.
Ich war vorübergehend ebenfalls obdachlos. Mein Haus samt Kunstschmiedestudio für mehrere Monate einer am Hungertuch nagenden Bildhauerin unterzuvermieten schien zu Beginn des Sommers eine gute Idee gewesen zu sein. Ich hatte gewusst, dass ich selbst in meiner Heimatstadt Yorktown sein würde, um drei Hochzeiten innerhalb der Familie zu organisieren; und solange meine Karriere als Kunstschmiedin auf Eis läge, konnte ich die Einnahmen aus der Vermietung gut gebrauchen.
Aber als ich wieder in mein Haus wollte, konnte ich meine Mieterin nicht loswerden. Sie steckte mitten in der Arbeit an einem wichtigen Auftragsstück; sie würde die ganze Skulptur ruinieren, sollte sie sie jetzt bewegen müssen; sie brauchte nur noch eine Woche, um fertig zu werden. Sie brauchte schon seit sechs Wochen nur noch eine Woche.
Also wohnte ich immer noch im Haus meiner Eltern. Mutter und Dad waren allerdings nicht da; sie waren nach Europa abgehauen, um dort ausgedehnte zweite Flitterwochen zu verbringen. Aber das Haus war voll von ältlichen Verwandten. Sie waren wegen der Hochzeiten angereist und geblieben, um den Rechtszirkus zu verfolgen, der in Gang gekommen war, als das Land seinen Fall gegen den Mörder aufgebaut hatte, dessen Identität ich (mehr oder weniger versehentlich) hatte aufdecken können.
Das war auch so ein Problem. Ich war berühmt-berüchtigt. Ich konnte in Yorktown keinen Schritt tun, ohne dass irgendwelche Leute auf mich zukamen, um mir zu meiner hervorragenden Detektivarbeit zu gratulieren. Mehr als ein romantisches Dinner bei Kerzenschein mit Michael war von Leuten gestört worden, die darauf bestanden hatten, mir die Hand zu schütteln, sich mit mir fotografieren zu lassen, mir einen Drink auszugeben, uns zum Essen einzuladen – es war einfach unmöglich.
»Wie schade, dass wir nicht einfach zusammen auf eine verlassene Insel flüchten können«, hatte Michael nach einer dieser Störungen bekundet.
Und ich hatte eine Erleuchtung gehabt.
»Eigentlich können wir schon«, sagte ich. »Was hast du nächstes Wochenende vor?«
»Mit dir auf eine verlassene Insel flüchten, wie es scheint«, sagte Michael. »Schwebt dir da eine bestimmte Insel vor?«
»Monhegan!«, sagte ich.
»Nie gehört. Wo liegt sie?«
»Vor der Küste von Maine.«
»Ist es dort zu dieser Jahreszeit nicht ein bisschen kalt?«
»In dem Haus gibt es einen Kamin. Und einen Gasofen.«
»Haus?«
»Tante Phoebes Sommerhäuschen. Eigentlich ist es ein altes Haus. Und nach August bleibt kaum jemand auf der Insel. Sie ist zu schroff.« Was bedeutete, wir würden uns nicht damit herumschlagen müssen, dass uns Dutzende von Nachbarn und Verwandten über die Schultern gucken und uns darüber informieren würden, wer was zu wem gesagt hat und wie viele Schlafzimmer belegt seien.
»Was ist mit Tante Phoebe?«
»Es ist ein Sommerhaus, schon vergessen? Eines, das sie derzeit nicht benutzt, einerseits, weil der Sommer vorbei ist, andererseits, weil sie so viel Spaß daran hat, hier unten auf die Gerichtsverhandlung zu warten und mich mit ihrer Schnarcherei wachzuhalten.«
»Und sie hätte nichts dagegen, wenn wir ihr Haus nutzen?«
»Sie hätte nichts dagegen, wenn sie davon wüsste, und sie muss es nicht wissen. Dad hat einen Ersatzschlüssel. Sie lädt uns ständig ein, wir könnten jederzeit hinkommen. Das haben wir schon seit Jahren nicht getan, aber die ganze Familie weiß, dass die Einladung steht.«
»Und wie können wir sicher sein, dass nicht auch die ganze Familie dort sein wird?«
»Im September? Wie du schon sagtest, es ist ein bisschen kalt in dieser Jahreszeit. Außerdem ist es für die meisten meiner Verwandten etwas zu spartanisch. Mutter würde nie hinfahren. Sie weigert sich, irgendwohin zu gehen, wo es keinen elektrischen Strom, kein Delikatessengeschäft und keinen guten Friseur gibt. Michael, das ist kein tropisches Paradies. Aber das Haus steht leer, es kostet nichts, und da ist meilenweit kein Mensch, abgesehen von ein paar Dutzend Einheimischen, die dort überwintern.«
»Ich bin Feuer und Flamme«, sagte er. »Ich kann die Konferenz am Mittochabend nicht ausfallen lassen, aber ich werde jemanden auftreiben, der meinen Unterricht für den Rest der Woche übernimmt, und dich am Donnerstagmorgen abholen, dann fahren wir hin.«
Wie ich schon sagte, zu dem Zeitpunkt schien das eine gute Idee zu sein. Selbst die beiden platten Reifen, derentwegen wir in einem Motel Six in der Nähe der New Jersey Turnpike strandeten und dort die erste Nacht unseres Ausflugs zubringen mussten, konnte unsere Begeisterung nicht dämpfen. Aber jetzt, da ich auf dem Deck dieser Fähre stand, war ich nicht mehr sicher, ob das alles irgendeinen Sinn haben würde. Ich konzentrierte mich wieder auf die Gegenwart, in der Winnie und Binkie immer noch geduldig auf eine Antwort warteten. So, wie sie uns anschauten, dachten sie vermutlich, wir wären vor irgendetwas geflüchtet.
»Na ja, in Yorktown ist es ein bisschen hektisch zugegangen, und ich habe Michael erzählt, Monhegan wäre ein toller Platz, um all dem zu entkommen«, sagte ich schließlich. »Ich habe nicht allzu eingehend darüber nachgedacht, wie lange die Saison schon vorbei ist.«
»Ja, bei euch war ziemlich was los«, sagte Winnie. »Euer Vater hat uns aus Rom geschrieben und uns von deinem Detektivabenteuer berichtet. Du musst uns zum Abendessen besuchen und alles darüber erzählen.«
Michael zuckte zusammen. Ich konnte beinahe hören, was er dachte: So viel zu Anonymität und Privatsphäre.
»Ja, das ist eine wunderbare Idee«, sagte Binkie. Dann schwand ihr Lächeln plötzlich, und sie riss die Hand hoch, um über die Schulter ihres Mannes hinwegzudeuten.
»Vogel!«, schrie sie.
Winnie wirbelte um die eigene Achse, und beide zogen glänzende, wasserfeste Hightech-Feldstecher unter ihrer Regenkleidung hervor. Sie kleisterten sich an die Reling und nahmen ihre ferne Beute ins Visier.
Ich konnte überhaupt nichts erkennen und warf Michael einen fragenden Blick zu. Er zuckte mit den Schultern.
Ich hatte angenommen, die anderen Passagiere, die an der Reling klebten, wären seekrank wie wir und entweder so optimistisch zu hoffen, die frische Luft würde ihnen guttun, oder so pessimistisch, sich gleich dort aufzustellen, wo das Wetter ihr unweigerlich Erbrochenes entsorgen würde. Aber relingauf, relingab kamen plötzlich Ferngläser zum Vorschein, alle ausgerichtet auf einen Fleck in weiter Ferne.
»Nur eine gewöhnliche Seeschwalbe, fürchte ich«, sagte Binkie. »Wollt ihr trotzdem mal sehen?«
Mit Binkies Anleitung gelang es mir, einen kleinen schwarzen Punkt auf einer fernen Boje anzuvisieren. Selbst mit dem Fernglas war der Punkt nur als Vogel erkennbar, wenn man bereits wusste, was er darstellte.
»Armes Ding!«, sagte Binkie. »Stellt euch mal vor, so dem Wetter ausgesetzt zu sein.«
Das musste ich mir nicht vorstellen; wir waren dem Wetter ausgesetzt.
»Oh, da ist noch eine Schwalbe auf drei Uhr.«
Dutzende von Ferngläsern schwenkten mit der unheimlichen Treffsicherheit militärischer Scharfschützen herum zu einer anderen, näheren Boje. Auf dieser hockte unzweifelhaft ein missgestimmter Vogel. Ich schlussfolgerte aus dem Anblick, dass Seeschwalben nahe Verwandte der Seemöwen sein mussten; zumindest diese sah in meinen Augen aus wie eine.
Die Boje hüpfte auf einer Woge, und die Schwalbe musste die Schwingen spreizen und um ihren Halt kämpfen, ehe sie wieder herabsank. Dann legte sie den Kopf schief und schaute in Richtung des Boots. Durch das Fernglas schien es, als stiere sie mich direkt an. Schließlich schüttelte sie den Kopf, zog ihn tiefer zwischen die Schultern und sah dabei so elend und grantig aus, dass ich mich sogleich mit ihr identifizieren konnte.
»Armes Ding«, sagte ich.
»Ach, denen geht’s gut«, sagte Winnie. »Sind gut zurückgekommen.«
»Zurückgekommen? Woher?«
»Vom Aussterben, Liebes«, sagte Binkie. »Anfang des Jahrhunderts hat es für sie sehr schlimm ausgesehen, wirklich arme Dinger, aber wir haben es geschafft, das Ruder herumzureißen.«
»Wir haben mehrere Hundert Nester auf Egg Island und natürlich auch noch fast ein Dutzend Papageientaucherpaare«, sagte Winnie. »Wenn du Gelegenheit hast, solltest du die Tour mitmachen. Das Boot legt von Monhegan ab und ankert mehrere Stunden vor der Insel.«
»Im Frühjahr, Liebster«, sagte Binkie. »Ich nehme an, dass sie die Touren nach dem Labor Day einstellen. Die meisten Papageientaucher müssten inzwischen fort sein.«
»Richtig«, sagte Winnie. »Aber falls es noch ein paar hier gibt, könnten wir vielleicht eine Spezialtour für Meg arrangieren. Wenn das Wetter ein bisschen besser ist«, fügte er hinzu und blickte zum Himmel.
Ich rang mir ein Lächeln ab und gab Binkie ihr Fernglas zurück. Das Wetter würde mehr als nur ein bisschen besser werden müssen, ehe ich Monhegan in einem Boot verließe. Aber sollte es Winnie und Binkie durch irgendeinen unglücklichen Zufall gelingen, einen suizidalen Bootsführer zu überzeugen, mit ihnen zum Papageientaucherbeobachten aufzubrechen, dann würde ich mir eine Ausrede einfallen lassen.
»Was ist überhaupt ein Papageientaucher?«, fragte Michael.
Ich zuckte zusammen. Gefährliche Frage. Die Burnhams und etliche Vogelfreunde in der näheren Umgebung zogen ihre Handbücher hervor und fingen an, die enthaltene Papageientaucherkunde an uns zu übermitteln.
Hätte ich erklären sollen, worum es sich handelt, ich hätte gesagt, er möge Ausschau nach einem schwarzweißen Vogel halten, der aussieht wie ein Pinguin, etwa dreißig Zentimeter groß ist und eine enorme Clownsnase auf dem Schnabel und leuchtend orangefarbene Strümpfe an den Füßen trägt. Die Vogelfreunde lieferten eine gute Beschreibung des Schnabels – ein gelb-graues Dreieck mit einer breiten roten Spitze –, aber dann gingen sie allzu sehr auf die Details in Hinblick auf den untersetzten Körper, die Stummelflügel, die entschieden unbeholfene Flugweise und das präzise Muster der schwarzweißen Federn ein. Ich bezweifle, dass Michael derart genaue Informationen benötigte, um noch nicht ausgewachsene Papageientaucher von anderen Vögeln zu unterscheiden, von denen er noch nie gehört hatte, oder dass er auch nur im Mindesten an den Brut- und Nistgewohnheiten der Vögel interessiert war. Als Winnie und ein anderer Vogelfreund anfingen, darum zu wetteifern, wer das tief klingende, grollende Arr! besser imitieren könne, das die sonst schweigsamen Papageientaucher von sich gaben, wenn man ihren Nestern zu nahe kam, erging ich mich in einem verzweifelten Stöhnen.
»Keine Angst, Liebes«, beschied mir Binkie und klopfte mir auf die Schulter. »Es geht immer ein bisschen ruppig zu, wenn wir uns dem Hafen nähern.«
»Nähern? Dem Hafen?«, fragte ich. »Soll das heißen, wir legen bald an?«
»Gott sei Dank«, murmelte Michael. Ich war nicht sicher, ob das Meer oder die Vogelkunde seiner Äußerung diese Inbrunst verliehen.
Und tatsächlich, binnen weniger Minuten sahen wir den Fährenanleger, auf dem eine ganze Menge Leute mit großen Mengen an Gepäck wartete. Noch mehr Vogelkundler, nahm ich an, da zumindest die Hälfte dieser Leute mit Ferngläsern durch den Regen stierte. Wie die Vogelfreunde an Bord studierten auch sie die Möwen, die über uns kreisten – wie ich annehme in der Hoffnung, unter ihnen irgendeine besonders seltene Seemöwenspezies zu entdecken. Und die beiden Reihen der Vogelfreunde musterten auch einander.
Als wir uns dem Dock näherten, fingen sie an, mit Fingern auf uns zu zeigen, zu winken und lauthals zu grüßen.
»Guter Gott, Binkie, schau wer auf dem Dock ist«, sagte Winnie. »Gleich neben dem Andenkenladen.«
»Oh, nein, nicht Victor!«, rief Binkie. »Wie grässlich. Ich hatte so gehofft, wir müssten ihn nie wieder sehen.«
»So viel Glück haben wir nicht«, grollte Winnie. »Der ist wie ein falscher Fuffziger, der alle paar Jahre wieder auftaucht. Ich frage mich, was der Schei… Schuft jetzt wieder im Schilde führt.«
»Handele dir keinen Kummer ein«, mahnte Binkie. »Wir wissen nicht, ob er wirklich irgendetwas im Schilde führt.«
»Oh nein, bestimmt nicht.«
Ich betrachtete das Dock und fragte mich, wer Victor sein mochte und wie er es geschafft hatte, sich ein solches Maß an Abneigung seitens der sonst so milde gestimmten Burnhams einzuhandeln. Aber ohne Fernglas konnte ich nicht viel ausmachen; sollte sich auf den Docks ein finsterer Schurke herumtreiben, der seinen Schnurrbart zwirbelte oder einen gespaltenen Huf mit sich herumschleppte, so konnte ich ihn nicht sehen.
»Oh, sieh nur, Dr. und Mrs Peabody«, sagte Binkie – zweifellos, um Winnie von seinem Ärger angesichts des ruchlosen Victor abzulenken. »Was für ein Pech. Sie reisen ab, wenn wir ankommen.«
»Darauf würde ich mich nicht verlassen«, entgegnete Winnie, während er die Peabodys mit seinem Fernglas studierte. »Ich habe gehört, wie der Captain sich in ziemlich scharfem Ton über Funk mit jemandem unterhalten hat. Hat gesagt, er hätte nie abgelegt, wenn die Größe der Wellen genauer eingeschätzt worden wäre.«
Ich war froh, dass Winnie diese Kleinigkeit nicht erwähnt hatte, bevor der Anleger in Sicht gekommen war.
»Dann denkst du, er wird hier auf das Ende des Sturms warten?«, fragte Binkie.
»Wenn er irgendwas im Kopf hat«, antwortete Winnie.
»Dann habt ihr beide ja richtig Glück gehabt«, sagte Binkie und drehte sich zu Michael und mir um. »Ihr hättet womöglich das vorerst letzte Boot verpassen können.«
Das Boot ergriff die Gelegenheit, um sich im freien Fall in ein Wellental zu stürzen.
»Was für ein Glück für uns«, murmelte Michael.
KAPITEL 2
Der Papageientaucher ist gelandet
»Das also ist Monhegan«, stellte Michael fest, als er mitten auf dem Landesteg stand und sich in der Landschaft umblickte.
Ich stellte erleichtert fest, dass er schon etwas besser aussah. Was – da war ich mir sicher – allein daran lag, dass er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Unserer Umgebung jedenfalls unterstellte ich nichts, das geeignet gewesen wäre, die Stimmung des Betrachters zu heben. Hatte der Hafen von Monhegan immer schon so schäbig und heruntergekommen ausgesehen? Oder färbten das Wetter und mein gereizter Magen noch immer meine Wahrnehmung der Dinge?
Als das Boot angelegt hatte, hatten wir uns in den üblichen irren Kampf um die Zuordnung der Gepäckstücke gestürzt, die alle auf einem großen Haufen lagen. Michael und ich waren besser dran als die meisten anderen; viele der Vogelfreunde pflegten eine Vorliebe für abgenutzte Rucksäcke und uralte Koffer, die über und über mit sich ablösenden Reisestickern aus allerlei unaussprechlichen fremden Vogelbeobachtungsparadiesen übersät waren. Da war unser deutlich gesetzteres Stadtmenschengepäck schon viel einfacher auszumachen.
»Was jetzt?«, fragte Michael, als wir unser Zeug hatten.
»Jetzt suchen wir jemanden, der unser Gepäck zum Haus bringt.«
Ich deutete auf das Inselkontingent der Pick-ups, sechs Fahrzeuge, die Stoßstange an Stoßstange am Dock aufgereiht standen, die offenen Heckklappen der ankommenden Menge zugekehrt. Hinter den Trucks führte eine steile Schotterstraße, auf der sich schon jetzt die Vogelfreunde tummelten, zum Dorf.
»Die beiden Hotels haben je einen Pick-up, um das Gepäck ihrer Gäste zu transportieren«, erklärte ich. »Wenn man in einer Pension oder in einem Sommerhaus absteigt, muss man einen der anderen Pick-ups chartern, um sein Zeug befördern zu lassen.«
»Nur unser Zeug?«, fragte Michael. »Was ist mit uns?«
»Wir gehen zu Fuß«, sagte ich. »Es sei denn, du willst von Anfang an als fauler Städter verschrien sein.«
Michael und ich warteten, bis sich die Blockade aus Vogelfreunden aufgelöst hatte. Was nicht lange dauerte: Kaum hatten die Vogelfreunde begriffen, dass die Fähre nirgendwohin fahren würde, hasteten alle in Panik den Hügel hinauf. Leute, die hatten abreisen wollen, beeilten sich, die Zimmer wieder zu beanspruchen, die sie gerade erst verlassen hatten, ehe die Neuankömmlinge ihnen die Unterkunft streitig machen konnten. Die Neuankömmlinge hasteten hinter ihnen her und wedelten mit ihren Buchungsbestätigungen und Kreditkarten herum, ehe ihre gestrandeten Kollegen sich als Hausbesetzer betätigen konnten.
Nach wenigen Minuten war das Dock beinahe menschenleer. Die wenigen Reisenden, die, wie Winnie und Binkie, ein eigenes Häuschen auf der Insel hatten und sich keine Sorgen darüber zu machen brauchten, jemand anderes könnte sie aus ihren Hotelzimmern vertreiben, hatten sich in einen kleinen Laden am Fuß des Hügels verzogen, um sich einen heißen Tee zu gönnen und sich in Hinblick auf den hiesigen Klatsch auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Was für ein Glück, dass Michael und ich nicht in einem Hotel abzusteigen gedachten; nicht einmal ich wäre wohl in der Lage gewesen, auch nur den ältesten und arthritischsten Vogelkundler bei dem Wettrennen hangaufwärts zu schlagen.
Wir schlugen die Einladung aus, uns den Burnhams anzuschließen, und so fanden wir uns bald allein auf dem Anleger wieder, umgeben von Gepäckbergen, die uns deutlich überragten.
»Lassen die ihr Gepäck einfach hier?«, fragte Michael.
»Warum nicht«, antwortete ich. »Wer soll es schon stehlen, und selbst wenn es jemand täte, wo könnte er es verstecken? Solange der Fährbetrieb eingestellt ist, verlässt niemand die Insel.«
Wir trieben einen Lieferwagen auf, der Platz für unsere größeren Gepäckstücke hatte, und bezahlten die exorbitante Transportgebühr. Trotz meiner Warnung versuchte Michael, den Fahrer zu überreden, uns mitzunehmen.
»Kein Platz«, sagte der Fahrer. Sein breites Gesicht kam mir vage vertraut vor. Er war etwa in meinem Alter, was bedeutete, dass ich, falls es sich um einen Einheimischen handelte, als Kind vermutlich mit ihm gespielt hatte. Oder, was wahrscheinlicher war, dass ich ihn mit roher Gewalt auf den Pfad der Tugend zurückgeführt hatte, weil er sich an meinem kleinen Bruder vergriffen hatte, wenn meine Erinnerungen an einige der anderen Kinder noch zutrafen, mit denen wir auf der Insel spielten. Seine Kleidung roch nach Zigarettenrauch und Bier, und er hatte etwas Schäbiges an sich, etwas Hinterhältiges, das dazu führte, dass ich, nur für einen kurzen Moment, überlegte, ob es wirklich eine gute Idee war, ihm unser Gepäck anzuvertrauen.
»Wir könnten warten, bis Sie zurück sind«, sagte Michael.
»Ich komme nicht zurück«, sagte der Fahrer. »Jedenfalls nicht so bald. Zu Fuß sind Sie schneller dort.«
»Ich bin nicht sicher, ob meine Freundin für einen Spaziergang zu haben ist«, verkündete Michael und legte schützend den Arm um mich.
Ich gab mein Bestes, um möglichst zerbrechlich und schutzbedürftig auszusehen, als der Fahrer mich musterte. Ich konnte ihm ansehen, dass ich nicht sehr erfolgreich war. Was mich nicht überraschte; wenn man einsfünfundsiebzig groß ist, neigen die Leute dazu, einen automatisch für robust zu halten. Es sei denn, man ist so dürr wie ein Model. Was ich nicht bin. Selbst mit Michael an meiner Seite, der immerhin noch gute fünfzehn Zentimeter größer war als sich, sah ich offenbar nicht so aus, wie sich der Fahrer ein notleidendes Fräulein vorstellte.
»Sie erholt sich gerade von einem gebrochenen Fußgelenk«, erklärte Michael. »Sie sollte es nicht übertreiben.«
Ich schaltete von Zerbrechlichkeit auf stoische Duldsamkeit um. Der Fahrer ließ sich immer noch nicht in die Irre führen.
»Ist nur eine Viertelmeile«, sagte er. »Geht größtenteils nicht mal bergauf.«
Damit sprang er in die Fahrerkabine seines Trucks und startete den Motor.
Der Wagen fuhr davon, und die Räder drehten kurz durch, ehe die Reifen genug Griff hatten, um den steilen Hang vom Hafen aus hinaufzuklettern. Kleine Schlammspritzer hagelten auf uns ein.
»Verdammter hinterhältiger Mistkerl«, fauchte ich. »Schlimm genug, dass er uns nicht mitnehmen wollte …«
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Michael und wischte sich etwas Schlamm aus dem linken Auge. »Das hat sich längst rausgewaschen, bis wir das Häuschen erreicht haben.«
»Ja, es scheint inzwischen wieder stärker zu regnen, nicht wahr?«
»Folgen wir ihm?«
Ich sah mich um. Michael starrte den Hang hinauf.
»Seltsam«, bemerkte ich, »der Hang sah nicht so steil aus, als ich noch ein Kind war.«
Michael kicherte.
»Ich erinnere mich, dass es mich immer wahnsinnig gemacht hat, wie lange wir gebraucht haben, um vom Hafen aus zu dem Haus zu gelangen.«
»Na, toll.«
»Aber das lag vor allem daran, dass Dad darauf bestand, unterwegs ständig anzuhalten und mit jedem zu sprechen, der uns begegnete. Wir haben manchmal zwei oder drei Stunden gebraucht, aber eigentlich ist das nur ein Fünfzehn-Minuten-Spaziergang.«
»Je eher wir damit anfangen, desto eher haben wir es trocken und warm«, sagte Michael und schlang sich sein Handgepäck über die Schulter. »Nur nicht schwächeln. Wer zuerst ›Halt!‹ ruft, soll zur Hölle fahren.«
Wir trotteten den Hügel hinauf. Vor uns konnten wir die letzten beiden Vogelfreunde sehen, die beherzt auf die Kuppe zumarschierten. Die übrigen hatten ihre Hotels oder Pensionen zwefellos längst erreicht und beobachteten nun, was immer Vogelbeobachter beobachten, wenn das Wetter sie ihrer natürlichen Beute beraubt.
Auf der Kuppe wandten wir uns nach rechts und beschritten nun die Hauptstraße der Insel – eine weitere schmutzige Schotterstraße, wenn auch in geringfügig besserem Zustand. Sie schlängelte sich vorbei an Häusern, die scheinbar willkürlich das Land sprenkelten und überwiegend aus verwitterten grauen Holzplanken bestanden.
Ich versuchte, den Ort mit den Augen eines Fremden zu sehen, und erschrak. Im Lauf der Zeit vergisst man manche Details, beispielsweise, in wie vielen Höfen sich unordentliche Stapel mit Hummerfallen ausbreiteten, die dringend geflickt werden mussten. Oder die utilitaristischen PVC-Rohre am Rand jeder Straße, mit deren Hilfe das Wasser aus dem Zentralreservoir zu den Häusern gebracht wurde. Ich konnte sehen, wie Michaels Blick hin und her huschte, und ich hegte den Verdacht, dass er sich fragte, warum zum Teufel wir die ganze weite Reise gemacht hatten, um schließlich an einem so reizlosen Ort zu landen. Der pittoreske Charme der Insel kam eindeutig besser an einem sonnigen Sommertag zur Geltung als in den Nachwehen eines herbstlichen Hurrikans.
Der Nieselregen hatte sich zu einem gleichmäßigen Niederschlag gesteigert, als wir endlich in die Straße zu Tante Phoebes Häuschen einbogen. Was auch Zeit wurde; nur ein bisschen später, und wir wären durch tiefste Dunkelheit gestolpert. Monhegan verfügt über keine Straßenbeleuchtung. Und Tante Phoebe hielt die Ausbesserung der Spurrillen in ihrer Zufahrt für verstädtertes Gehabe, womit der Versuch, im Dunkeln den Weg zu finden, zu einem Alptraum wurde.
Nur war es gar nicht dunkel. Ich konnte Licht vor uns sehen – Licht, das aus dem Haus kam. Und hörte ich da Musik? Ich spürte einen Anflug von Panik. Bestimmt hatte Tante Phoebe das Haus nicht vermietet, oder doch? Sie hatte schließlich stets unnachgiebig darauf bestanden, das Haus bereitzuhalten, falls irgendwann irgendein Verwandter es nutzen wollte.
»Da ist schon jemand«, stellte Michael fest.
»Da sollte aber niemand sein«, sagte ich. »Vielleicht sind es nur Reinigungskräfte. Ich weiß, dass Tante Phoebe jemanden von den Einheimischen beauftragt hat, alle zwei Wochen oder so herzukommen und dafür zu sorgen, dass sich nicht zu viel Schmutz sammelt.«
Gelächter hallte aus dem Häuschen heraus.
»Ich wünschte, mir würde Putzen so viel Spaß machen«, bemerkte Michael und verlagerte das Gewicht seiner Tasche von einer Schulter zur anderen.
Mir fiel auf, dass der Rest unseres Gepäcks noch nicht eingetroffen war. Michaels Versuche, den Fahrer zu bestechen, damit er uns mitnahm, hatten ihn vermutlich ausreichend verärgert, weshalb er dafür gesorgt hatte, dass unser Gepäck bis zum Schluss in seinem Wagen blieb. Bei unserem Glück stand zu befürchten, dass er so tun würde, als hätte er es vergessen, und es erst am nächsten Morgen auslieferte. Ich seufzte.
»Tja, hier rumstehen und grübeln hat keinen Sinn«, sagte ich und marschierte die Stufen empor, bereit, mich allem zu stellen, was das Haus bereithielt – Einbrecher? Hausbesetzer? Reinigungspersonal, das die Bar gefunden und beschlossen hatte, eine Hurrikanparty zu improvisieren?
Ich drückte die Schultern durch und pochte entschlossen an die Tür.
KAPITEL 3
Alle meine Papageientaucher
Niemand öffnete. Ich wartete kurz, dann klopfte ich erneut.
Neuerliches Gelächter beantwortete mein Klopfen.
»Was ist da drinnen los?«, rief ich.
Wieder keine Reaktion.
»Also dann«, sagte ich.
Ich riss die Tür auf.
Das Häuschen war leer. Aber offensichtlich war jemand da gewesen, und das war nicht sehr lange her.
»Ich schätze, wir wurden erwartet«, sagte Michael.
Offensichtlich – aber von wem?
Wir sahen uns um. Im Kamin knisterte lebhaft ein Feuer. An diversen Stellen im Raum brannten genug Kerzen, um einen warmen, romantischen Lichtschein zu verbreiten. Auf beiden Sofas stapelten sich Daunenkissen und Webdecken. Zwei Teetassen standen auf dem Sofatisch, und ein Hauch von Dampf nebst einem schwachen Jasminduft deuteten an, dass sich in all der wattierten Behaglichkeit eine Kanne frisch gekochten Tees verbergen musste. Auf dem Kaminsims stand ein batteriebetriebenes Radio; während wir mit offenem Mund dastanden, ging mit einem letzten Gelächter eine Werbesendung zu Ende, und ein Ansager mit einem wundervollen Bariton wie gesponnene Seide versicherte uns, dass W-irgendwas oder so nun mit seinem Freitagabendprogramm sanfter Klassik fortfahren würde. Die Klänge des Donauwalzers füllten den Raum.
»Hallo?«, rief ich.
Ich trat ein. Ich konnte Kochgerüche wahrnehmen. Im Moment wies mein Magen jeglichen Gedanken an Essen energisch zurück, dennoch erkannte ich, dass, wenn ich mich erst einmal vollständig von der Überfahrt erholt hätte, die Vorgänge in der Küche von höchstem Interesse sein dürften. Eine Flasche Champagner stand auf dem Tisch. Schwitzwasserperlen liefen an den Seiten herab. In der Nähe wartete ein Korkenzieher nebst zweier Glasflöten.
»Weißt du, das ist weit weniger primitiv, als du es beschrieben hast«, sagte Michael und ließ seine Taschen neben der Tür fallen. »Jetzt, da wir nicht mehr auf dem Boot sind, fange ich tatsächlich an, diesen Ort zu mögen.«
Anerkennend sah er sich um.
Bei Kerzenschein sah der Raum in der Tat am besten aus. Das Wohnzimmer war zwei Stockwerke hoch. An einer Wand führte eine Treppe nach oben zu einer Empore, von der die drei Schlafzimmer abzweigten. Im Erdgeschoss fanden sich direkt unter den Schlafzimmern ein großes Badezimmer und eine noch größere Küche. In meiner Erinnerung war das Haus winzig und vollgestopft – was es im Sommer gewöhnlich auch war, wenn jedes Schlafzimmer belegt war, ein Teppich aus Schlafsäcken das Wohnzimmer ausfüllte und man stundenlang warten musste, um das Badezimmer zu benutzen. Aber für zwei Leute auf der Suche nach Frieden und Ruhe und einem Ort, um mal von allem wegzukommen, wirkte das Häuschen plötzlich wie ein Palast.
»Wir werden uns später um das Gepäck kümmern«, schlug Michael vor, setzte sich auf eines der Sofas und pochte auf das Polster neben sich. Ich setzte mich zu ihm, und für einige Minuten saßen wir nur schweigend da, genossen die Wärme, die Musik, die ganze Atmosphäre.
Trotzdem fragte ich mich, wer in das Haus gekommen war und alles für uns vorbereitet hatte. Hatten Winnie und Binkie von dem Andenkenladen aus ein Telefongespräch geführt, um irgendeinen hilfsbereiten Nachbarn herzuschicken? Oder hatte Tante Phoebe bemerkt, dass der Schlüssel fort war, eins und eins zusammengezählt und beschlossen, uns eine schöne Überraschung zu bereiten? Wer immer es war, ihm gebührte mein Dank.
Erschöpft wie ich war, musste ich ständig an die Version von »Die Schöne und das Biest« denken, in der Hände ohne Körper einen Tisch eindeckten und Essen servierten, und ich fragte mich, ob hier etwas Ähnliches geschehen war.
Wie auch immer, dachte ich und ließ mich in Michaels Arm sinken. Es ist himmlisch.
Mit lautem Knall flog die Tür auf.
»Ich bin zurück!«, jubilierte eine Stimme.
Michael und ich wirbelten verblüfft herum.
»Dad?«, fragte ich.
Mein Vater stand mit einer Ladung Feuerholz in den Armen in der Tür. Wassertropfen flogen in sämtliche Richtungen davon, als er sich schüttelte wie ein Hund.
»Meg!«, rief er. Er ließ das Holz mit dumpfem Schlag auf den Ofen fallen und verabreichte mir eine feucht-bärige Umarmung. »Was für eine schöne Überraschung.«
»Du denkst, du wärest überrascht«, murmelte ich. »Du hast ja keine Ahnung.«
»Und Michael«, fügte Dad hinzu. »Wie schön! Margaret, komm, schau; Meg und Michael sind gekommen, um uns zu besuchen.«
Mutter, geziert ein Gähnen verbergend, erschien am Kopf der Treppe, ausgestattet mit ihrer Stickarbeit und einem europäischen Modejournal.
»Meg, Liebes«, kreischte sie. Graziös schwebte sie die Stufen herunter und beugte sich zu mir herab, um mir einen Kuss auf die Wange zu hauchen. »Das ist ja so schön! Und wie nett es ist, Sie zu sehen, Michael.«
Nicht ein einziges der unwahrscheinlich blonden Haare lag nicht an seinem Platz, und sie sah, wie gewohnt, aus, als könnte sie jedes der Models in ihrer Zeitschrift im Handumdrehen ersetzen.
In diesem Moment hörte ich einen lauten Knall, und etwas sauste an meiner Nase vorbei und prallte von Michaels Kinn ab.
»Tut mir leid, Michael«, sagte Dad und wedelte mit der Champagnerflasche. »Nichts gebrochen, hoffe ich.«
»Nein, mir geht es gut«, sagte Michael und rieb sich das Kinn.
»Dann los«, sagte Dad und reichte Mutter ein Glas Champagner, ehe er von seinem eigenen nippte. »Wollt ihr beide auch was?«
»Nein, danke«, antworteten Michael und ich im Chor. Ich schloss die Augen. Ich war noch nicht ganz so weit, anderen Leuten beim Essen oder Trinken zusehen zu wollen.
Erneut öffnete sich mit lautem Krachen die Tür.
»Wie ich sehe, ist die Fähre eingetroffen«, verkündete Tante Phoebe, die mit einer tropfnassen Segeltuchtasche in jeder Hand auf der Schwelle stand. »Ihr habt das Abendessen verpasst, aber es ist noch genug übrig. Smithfield Ham, Kartoffelsalat …«
»Nein, danke«, sagte ich.
»Vielleicht später«, fügte Michael hinzu.
»Zum Teufel, sie kommen gerade erst von der Fähre; vermutlich fühlen sie sich hundeelend«, gackerte Mutters beste Freundin, Mrs Fenniman, die hinter Tante Phoebe mit einem eigenen Satz Segeltuchtaschen in Erscheinung getreten war. »Lasst ihnen ihre Ruhe, bis sich ihr Gedärm beruhigt hat.«
»Legt die Fähre heute Abend wieder ab?«, ertönte eine Stimme über unseren Köpfen. Ich blickte auf und sah meinen Bruder Rob, der am Ende der Treppe stand und sich die Augen rieb, als sei er gerade erst erwacht.
»Mein Gott«, sagte ich. »Ist denn ganz Yorktown hier? Igitt!«
Ich erschrak, als etwas Feuchtes, Nasses meinen Fuß berührte.
»Was zum Teufel macht Spike hier?«, fragte Michael und blickte hinab auf den kleinen schwarzweißen Fellball zu meinen Füßen. Obwohl Spike der Hund von Michaels Mutter war, hatte er Michael nie leiden können. Er blickte kurz auf, fletschte die Zähne und widmete sich hernach wieder seinem Lieblingszeitvertreib, der darin bestand, mir wie besessen die Füße zu lecken. Der Schlamm schien ihn nicht zu stören.
»Deine Mutter hat mich gebeten, über das Wochenende auf ihn aufzupassen«, erklärte Rob, »und als ich dann hierherfahren musste, blieb mir nichts anderes übrig, als ihn mitzunehmen. Willst du dich lieber um ihn kümmern?«
»Danke, aber du wirst vermutlich vor mir wieder in Yorktown sein«, sagte Michael. Er mochte Spike genauso sehr wie dieser ihn. Natürlich konnte Spike eigentlich niemanden außer Michaels Mutter und mir leiden. Und ich habe nie genau herausgefunden, warum er mich mochte. Es war jedenfalls keine wechselseitige Zuneigung.
»Stimmt. Ich werde so bald wie möglich nach Hause fahren«, sagte Rob. »Da wir gerade davon sprechen, ich sollte mir vermutlich besser meine Tasche schnappen und zur Fähre gehen.«
»Ich bezweifle, dass die Fähre heute Abend irgendwohin fährt«, sagte ich. »Und glaub mir, selbst wenn, würdest du nicht an Bord sein wollen. Für einen tropischen Wirbelsturm, der auf das Meer hinauszieht, um dort zu sterben, ist dieser noch ziemlich lebendig.«
»Das liegt daran, dass er nicht auf das Meer hinauszieht, um zu sterben«, erklärte Mrs Fenniman und schenkte sich Tee ein. »Er bleibt nur so lange über dem Meer, bis er genug Kraft getankt hat. Dann baut er sich wieder zu einem Hurrikan auf und stürzt sich noch einmal auf die Küste.«
»Was?«
»Das stimmt; ich habe es gerade erst im Radio gehört«, bestätigte Mrs Fenniman mit der vergnügten Miene, die sie stets zur Schau trug, wenn es ihr gelang, alle anderen mit Neuigkeiten über einen Skandal oder eine Katastrophe in ihren Bann zu schlagen.
»Na, toll«, sagte Rob. »Ich schätze, das bedeutet, dass ich so lange hier festsitze.«
Er warf sich auf eines der Sofas und umgab sich mit der Ausstrahlung eines Märtyrers. Neben Mutters schmaler, groß gewachsener Gestalt und dem aristokratisch blonden Aussehen hatte er auch ihr Talent zur Selbstinszenierung geerbt.
»Sei nicht traurig«, sagte Dad. Er stand vor der Feuerstelle und versuchte offensichtlich, die Rückseite seiner Hose in Brand zu stecken. Mit seiner kleinen, rundlichen Gestalt und dem Feuerschein, der auf seinem kahlen Kopf tanzte, sah er aus wie ein bösartiger Gnom. »Sieh es einfach von der anderen Seite«, fügte er hinzu. »Nach all diesen Jahren werden wir endlich erleben, was wirklich während eines Hurrikans passiert.«
»Jippieh«, brummte Rob ohne rechte Begeisterung.
»Oje«, murmelte Mutter.
»Keine Sorge, Margaret«, sagte Tante Phoebe. Sie hatte ihre tropfnasse Regenkleidung abgelegt und war dabei, sich eine geblümte grün-orangefarbene Schürze über den stämmigen, in Khaki gehüllten Leib zu binden. »Wir haben genug Essen und Brennmaterial. Es wird vielleicht ein bisschen derb werden, aber wir werden es gut überstehen.«
Mutter sah erleichtert aus. Immerhin wusste niemand besser als sie, dass Tante Phoebes Vorstellung von »derb« bedeutete, wir würden uns mit den karierten Ginganservietten anstelle des gestärkten Linnens begnügen müssen und anstelle von frischem Kaviar müsste der aus der Dose herhalten.
»Zeit, an die Arbeit zu gehen«, verkündete Mrs Fenniman. Sie hatte eine identische geblümte Schürze angelegt, auch wenn die über den üblichen schwarzen Klamotten an ihrem hageren Leib ein wenig sonderbar aussah. Die beiden stemmten ihre Einkaufstaschen und verschwanden in der Küche.
»Wir können zu den Klippen am Green Point gehen und zusehen, wie der Sturm zuschlägt!«, fuhr Dad fort. »Wäre das nicht fantastisch?«
»Oh, James, das muss doch nicht sein«, protestierte Mutter.
»Wäre das nicht gefährlich?«, erkundigte sich Michael. Ich sah ihn ein wenig verblüfft und mehr als nur ein wenig bestürzt an. Er hörte sich an, als würde er Dads Vorschlag wirklich in Erwägung ziehen.
Sosehr ich meinen Vater liebte, ich habe mir stets geschworen, mich nie mit jemandem einzulassen, der zu der Art von Verrücktheiten neigte, die meinen Vater auszeichneten. Und doch, da war es wieder: In Michaels Gesicht konnte ich den gleichen Ausdruck liebenswerter und vollkommen bescheuerter Begeisterung erkennen. Oje, dachte ich. Dad hatte eine kleine Karte von Monhegan auf dem Tisch ausgebreitet und kritzelte wie wahnsinnig darin herum – offensichtlich bemüht, sich auszurechnen, welche Stelle am besten geeignet wäre, um auf das Eintreffen des Hurrikans zu warten. Michael beugte sich über den Tisch, um ihm zuzusehen.
»Auf mich braucht ihr nicht zu zählen«, sagte Rob. »Ich muss an den Höllenanwälten arbeiten.«
Mutter seufzte. Die ganze Familie wartete immer noch ungeduldig darauf zu erfahren, ob Rob – durch irgendeinen bizarren Zufall – seine Anwaltsprüfung im Juli bestanden hatte. Da Rob und seine Lerngruppe ihre Zeit im Sommer mit einem Rollenspiel namens »Höllenanwälte« vergeudet hatten, statt irgendetwas zu tun, das wenigstens ansatzweise an Lernen erinnert hätte, standen die Chancen nicht sonderlich gut.
»Ich sollte wirklich in Yorktown sein und daran arbeiten«, bekundete Rob. Gemeint hatte er, er wünschte in Yorktown zu sein, um mit Red und seiner neuen Freundin, die ihnen dabei half, aus den Höllenanwälten ein Computerspiel zu machen, über Bits und Bytes zu reden.
»Wie um alles in der Welt bist du überhaupt hierhergekommen?«, fragte ich und zog Rob ein wenig zur Seite.
»Wir sind gestern mit der Fähre eingetroffen«, sagte er.
»Tja, darauf bin ich auch schon gekommen«, schnaubte ich. »Ich meine: Was macht ihr überhaupt alle hier?«
»Dad hat mich angerufen, um mir zu sagen, dass sie von Paris aus heimfliegen würden und ich sie am Dulles Airport abholen könnte«, erzählte Rob. »Ihr Flugzeug ist sehr früh gestern Morgen gelandet. Und Tante Phoebe und Mrs Fenniman haben die Gelegenheit wahrgenommen, sich von mir nach Washington mitnehmen zu lassen, weil sie von dort aus zum Vogelbeobachten nach Maine fliegen wollten. Aber der Flug wurde wegen des Hurrikans gestrichen, und statt nach Yorktown zurückzufahren, hat Tante Phoebe Mutter und Dad überredet, mit ihr hierherzukommen. Und was tust du hier?«
»Ein bisschen Privatsphäre suchen«, kam Michael mir zuvor.
»Viel Glück«, sagte Rob mit einem leisen Kichern, ehe er zur Tür hinausschlüpfte – vermutlich, um Red anzurufen und sich ein wenig in Ferngegreine zu üben. Oder Gestöhne.
Tja, Rob ist nicht der Einzige, der in Hinblick auf die unmittelbare Zukunft zu einem enttäuschenden Liebesleben verdammt war. Ich sah Michael an, während ich neben ihm Platz nahm. Hier saß ich nun mit dem Mann meiner Träume auf einem dick gepolsterten, weichen Sofa vor einem lodernden Feuer, genau wie ich es mir für dieses Wochenende zurechtfantasiert hatte. Dass aber meine ganze Familie an dem Erlebnis teilhaben musste, minderte den Spaß an der Sache erheblich.
Ich fühlte mich schuldig, weil ich ihnen ihre Anwesenheit verübelte. Sie gaben sich alle so viel Mühe, uns aufzumuntern. Natürlich bedeutete das, dass alle fünf Minuten jemand mit einem neuen Mittel gegen Seekrankheit oder einer neuen Taktik zur Verhinderung einer Lungenentzündung auftauchte. Außerdem hatte ich bereits die Anzahl der Köpfe mit der der Schlafzimmer abgeglichen und festgestellt, dass ich vermutlich auf einem der Sofas schlafen würde.
»Jetzt ist das Telefon ausgefallen«, verkündete Rob, als er wieder ins Zimmer schlurfte und sich auf das andere Sofa fallen ließ.
»Das passiert gewöhnlich bei einem Sturm«, sagte Tante Phoebe und drückte mir eine Tasse Kräutertee in die Hand.
»Es würde mir weniger ausmachen, wenn ich wenigstens meinen Laptop benutzen könnte«, lamentierte Rob.
»Kannst du den nicht über den Akku laufen lassen?«, fragte Michael.
»Könnte ich, wenn der Akku nicht so alt wäre; eine Ladung hält geschätzte fünfzehn Minuten lang«, sagte Rob. »Und es dauert zehn Minuten, ihn hochzufahren und herauszufinden, wie ich mein Textverarbeitungsprogramm aufrufen kann.«
»Ich sag dir was«, meldete sich Dad zu Wort. »Ich lege eine Verlängerungsschnur zum Haus der Dickermans. Ich bin sicher, sie haben nichts dagegen.«
Ob sie etwas dagegen hatten oder nicht, war irrelevant; ich bezweifelte, dass sie sich wehren konnten, wenn Dad sich etwas in den Kopf gesetzt hatte.
»Bäh«, machte Rob und nieste. Ein offenkundig vorgetäuschtes Niesen, wie ich in Gedanken feststellte; zweifellos als Ausrede dafür gedacht, nicht zusammen mit Dad draußen durch den Regen plantschen zu müssen. Aber es erfüllte seinen Zweck. Mutter, Tante Phoebe und Mrs Fenniman widmeten ihre Aufmerksamkeit sogleich der medizinischen Versorgung meines Bruders. Ich nutzte den Vorzug der allgemeinen Ablenkung, um meinen Kräutertee einer so oder so todgeweihten Topfpflanze zukommen zu lassen.
»Komm, Meg, du kannst mir mit dem Verlängerungskabel helfen«, sagte Dad und griff zur Taschenlampe. »Sie auch, Michael. Frische Luft wird euch guttun.«
Ich wollte eigentlich nicht wieder hinaus in den Regen. Ich wollte mich an einem ruhigen Platz zusammenrollen und ein paar Jahre schlafen. Aber es sah nicht so aus, als sollte ich in diesem Haus in nächster Zeit Ruhe oder Frieden finden, nicht, solange Tante Phoebe und Mrs Fenniman über das Wetter debattierten und versuchten, mir ihre Elixiere und Zaubertränke einzuflößen. Ganz zu schweigen davon, wie mein Magen auf all die Essensgerüche reagierte. Vielleicht war frische Luft doch keine so üble Idee.
Seufzend erhob ich mich und folgte Dad und Michael zu dem Garderobenschrank neben der Küchentür, wo wir uns durch eine willkürlich zusammengestellte Kollektion von Regenkleidung wühlten. Schließlich fanden wir Regenanzüge für jeden von uns, wenn auch Michaels zu kurz war, meiner beinahe über den Boden schleifte und Dads eine Farbmischung aufwies, die aus im Dunkeln leuchtendem Pink, Limonengrün und Gelb zusammengesetzt war.
Danach wiederholten wir die Wühlerei, dieses Mal im Geräteschuppen. Unter einer Eismaschine mit Handkurbel, einer Sammlung antiker Rettungswesten, einem Gasgrill, gemischten Einzelteilen dreier verschiedener Crocketausrüstungen und etlichen Dutzend modernden Stapeln des Life Magazine aus den Vierzigern und Fünfzigern, holten wir schließlich drei leuchtend orangefarbene Verlängerungskabel hervor, sämtlichst zur gewerblichen Nutzung geeignet.
»Das sollte reichen«, sagte Dad, und wir machten uns auf zum Haus der Dickermans.
Ich hatte verdrängt, wie dunkel die Nächte auf Monhegan sein konnten. Bei klarem Himmel konnte man hier dreimal so viele Sterne sehen wie in der Stadt, und der Anblick des Mondes, der über dem Meer aufstieg, förderte sogar bei mir eine poetische Ader zutage. Aber wenn Wolken Mond und Sterne verdeckten, wie es heute der Fall war, konnte man die tief verwurzelte Neigung der Menschen, sich vor der Dunkelheit zu fürchten, wahrhaftig verstehen.
Die Finsternis wurde nur wenig gemildert, als wir die nächsten Gebäude passierten, die sich die schmutzige, schmale Zufahrt mit Tante Phoebes Haus teilten. Wie Tante Phoebe hatten auch die Nachbarn nur Öllampen und Gasgerätschaften in Betrieb genommen. Einige der Bewohner besaßen ihre eigenen kleinen Stromgeneratoren – die Dickermans gehörten offenbar dazu –, aber diese Notfallmaßnahme war laut und üblicherweise weniger verlässlich als die altmodischeren Alternativen – ganz zu schweigen davon, dass die Dinger so teuer waren, dass ihre Eigner dazu tendierten, die Wattleistung möglichst gering zu halten, um nicht bankrott zu gehen.
Die Taschenlampe war nicht allzu hilfreich, und ich empfand den leuchtenden Schimmer, der von Dads Regenkleidung ausging, als sonderbar beruhigend, während er vor uns durch die Nacht tänzelte.
Plötzlich, als wir das Ende der Zufahrt erreicht hatten, verschwand der Lichtschein.
»Dad?«, rief ich und hastete voran zu der Stelle, an der ich den im Dunkeln leuchtenden Regenmantel zum letzten Mal gesehen hatte. Gleich darauf stürzte ich über etwas Großes und Hartes und fiel mit dem Gesicht in den Straßenschlamm.
»Euer Gepäck ist angekommen«, sagte Dad. Das Leuchten war nicht vollständig verschwunden, wie mir nun aufging, es war nur – wie ich – horizontal.
»Ist mit euch beiden alles in Ordnung?«, fragte Michael, als er neben uns auftauchte.
»Das wird es sein, wenn du deinen Fuß von meiner Hand nimmst«, sagte ich, bemüht, nicht anklagend zu klingen.
»Tut mir leid«, sagte er. »Ich kann nichts sehen.«
»Verdammtes kleines Wiesel«, fluchte ich. »Er hätte das Gepäck wenigstens bis zum Haus bringen können.«
»Vielleicht hatte er Angst, im Schlamm stecken zu bleiben«, versuchte Michael eine Erklärung zu finden.
»Tja, wir können es ja auf dem Rückweg mitnehmen«, schlug Dad vor. »Lasst uns zu den Dickermans gehen, ehe sie zu Bett gehen.«
Die Dickermans waren, zu meiner gelinden Verwunderung, geradezu begeistert, Dad ein Verlängerungskabel zu unserem Haus legen zu lassen. Natürlich hatte Dad vergessen zu erwähnen, dass dies ein geschäftliches Arrangement war, da die Dickermans die Gründer und Eigner der Central Monhegan Power Company waren.
»Ich wusste nicht, dass es auf Monhegan überhaupt ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen gibt«, sagte ich. »Allerdings sind auch schon einige Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal länger auf der Insel war«, fügte ich eilends hinzu, als mir der waidwunde Ausdruck in Mr Dickermans breitem, freundlichem Gesicht auffiel.
»Na ja, eigentlich ist es nur ein Generator«, sagte Mr Dickerman. »Ein bisschen größer als die der einzelnen Häuser und natürlich für gewerbliche Zwecke gedacht.«
»Und offensichtlich auch ein bisschen leiser, sollte er irgendwo in der Nähe stehen.«
»Oh, der ist laut genug, aber wir haben ihn auf den Knob Hill gebracht«, sagte Mr Dickerman. »Da oben ist es ziemlich abgelegen, und der Lärm stört die Leute nicht mehr so sehr. Jim kümmert sich größtenteils darum; er war immer sehr geschickt in solchen Dingen, unser Jim.«
»Und es ist so schön, dass er eine Beschäftigung gefunden hat, ohne die Insel zu verlassen«, fügte Mrs Dickerman hinzu. Sie war eine goldige, mütterliche Person; ich hatte nie herausgefunden, wie sie und ihr sanftmütiger Ehemann es geschafft hatten, so viele rauflustige und widerwärtige Söhne zu produzieren. Sie hatten mindestens ein halbes Dutzend davon. »All meine anderen Vögelchen sind längst ausgeflogen, aber Jimmy ist froh wie ein Fisch im Wasser, dass er bei uns bleiben und an dem Generator herumbasteln kann. Es tut so gut zu sehen, wie glücklich er dort oben beim E-Werk ist, wenn er an seinen Maschinen arbeitet.«
»Vergiss Fred nicht«, mahnte Mr Dickerman.