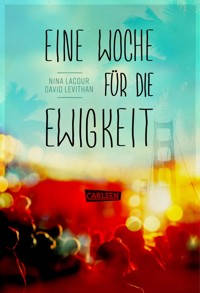Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Poetisch und einfühlsam schreibt Nina LaCour über Einsamkeit, Freundschaft und "über eine zerbrechliche, aber zutriefst menschliche Welt" (New York Times).
Ein Roman über das Erwachsenwerden, so berührend und großartig, dass man kaum atmen kann. Eine schmerzlich schöne Darstellung von Trauer und ein Lobgesang auf die Kraft der Wahrheit. Marin hat alles hinter sich zurückgelassen, ist Tausende Kilometer geflohen vor ihrem alten Leben, vor dem Verlust ihres geliebten Großvaters. Doch eines Tages steht plötzlich ihre beste Freundin Mabel vor der Tür. Und mit ihr all die Erinnerungen an zu Hause, an Sommernächte am Strand. Mit ihrer Beharrlichkeit gelingt es Mabel, Marin aus ihrem Kokon der Einsamkeit zu befreien. Und Marin begreift, dass sie eine Wahl hat: weiter im Verdrängen zu verharren oder zu ihren Freunden und ins Leben zurückzukehren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein Roman über das Erwachsenwerden, so berührend und großartig, dass man kaum atmen kann. Eine schmerzlich schöne Darstellung von Trauer und ein Lobgesang auf die Kraft der Wahrheit. Marin hat alles hinter sich zurückgelassen, ist Tausende Kilometer geflohen vor ihrem alten Leben, vor dem Verlust ihres geliebten Großvaters. Doch eines Tages steht plötzlich ihre beste Freundin Mabel vor der Tür. Und mit ihr all die Erinnerungen an zu Hause, an Sommernächte am Strand. Mit ihrer Beharrlichkeit gelingt es Mabel, Marin aus ihrem Kokon der Einsamkeit zu befreien. Und Marin begreift, dass sie eine Wahl hat: weiter im Verdrängen zu verharren oder zu ihren Freunden und ins Leben zurückzukehren.
Nina LaCour
Alles okay
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz
Carl Hanser Verlag
Für Kristyn, mehr denn je,
und in Erinnerung an meinen Großvater Joseph LaCour, der für immer in meinem Herzen wohnt
Kapitel eins
Bevor Hannah ging, fragte sie noch einmal, ob wirklich alles okay sei. Sie hatte schon eine Stunde vertrödelt, seit das College über Weihnachten für vier Wochen seine Pforten schloss, und bis auf den Hausmeister waren längst alle weg. Sie hatte einen Stapel Wäsche gefaltet, eine E-Mail geschrieben, in ihrem dicken Psychologie-Buch die Antworten auf die letzten Prüfungsfragen nachgeschlagen. Irgendwann hatte sie keine Ausreden mehr, und als ich sagte: »Ja, es ist wirklich alles okay«, blieb ihr nichts anderes übrig, als mir zu glauben.
Ich half ihr, das Gepäck nach unten zu tragen. An der Tür umarmte sie mich kurz und förmlich und sagte: »Am 28. kommen wir von meiner Tante zurück. Steig doch in den Zug und besuch mich, dann gehen wir ins Theater.«
Ich sagte Ja, ohne zu wissen, ob ich es tatsächlich so meinte. Dann ging ich in unser Zimmer zurück und fand den Briefumschlag, den sie mir aufs Kissen gelegt hatte.
Und jetzt, allein im Wohnheim, starre ich meinen Namen in Hannahs hübscher Handschrift an und versuche, mich von so einer Kleinigkeit nicht aus der Fassung bringen zu lassen.
Ich schätze, mit Umschlägen habe ich ein Problem. Ich will ihn nicht öffnen. Nicht mal anfassen. Obwohl ich genau weiß, dass er etwas Nettes enthält. Eine Weihnachtskarte. Mit eingedrucktem Gruß oder mit einer persönlichen Nachricht. Auf jeden Fall völlig harmlos.
Eigentlich ist auch das Wohnheim vier Wochen geschlossen, aber meine Betreuerin hat mir geholfen, eine Sondererlaubnis zu bekommen, damit ich hierbleiben darf. Die College-Leitung war nicht sehr begeistert. Haben Sie keine Familie?, haben sie gefragt. Oder Freunde, bei denen Sie die Ferien verbringen können? — Ich wohne jetzt hier, habe ich geantwortet. Bis ich meinen Abschluss habe, ist das mein Zuhause. Irgendwann haben sie nachgegeben, und vor ein paar Tagen lag ein Brief der Hausverwaltung vor der Tür, in dem stand, dass der Hausmeister während der Ferien da sei, und seine Telefonnummer. Falls Sie irgendetwas brauchen, melden Sie sich bei ihm.
Was ich brauche: die Sonne Kaliforniens. Ein glaubwürdigeres Lächeln.
Ohne die Geräuschkulisse wirkt das Wohnheim seltsam und fremd — ohne die Stimmen der anderen, die laufenden Fernseher und Wasserhähne, die rauschenden Toiletten, die summenden und piependen Mikrowellen, das Poltern von Schritten und das Schlagen von Türen. Ich bin seit drei Monaten hier, und zum ersten Mal nehme ich das Geräusch der Heizung wahr.
Es klickt: ein Schwall Wärme.
Heute Nacht bin ich allein. Morgen kommt Mabel für drei Tage, und danach bin ich wieder allein, bis Mitte Januar.
»Wenn ich einen Monat lang allein wäre«, hat Hannah gestern gesagt, »würde ich Meditieren üben. Es ist klinisch erwiesen, dass Meditieren den Blutdruck senkt und die Hirnaktivität erhöht. Meditieren stärkt sogar die Abwehrkräfte.« Ein paar Minuten später hatte sie ein Buch aus dem Rucksack gezogen. »Das habe ich neulich in der Buchhandlung entdeckt. Wenn du willst, kannst du es zuerst lesen.« Sie warf es auf mein Bett. Es war eine Essay-Sammlung über die Einsamkeit.
Ich weiß, warum Hannah sich Sorgen macht. Als ich hier auftauchte, war mein Großvater erst seit zwei Wochen tot. Ich trat durch die Tür — eine verstörte, verwahrloste Fremde —, und jetzt bin ich jemand, den sie kennt, und das soll auch so bleiben. Ihretwegen und meinetwegen.
Erst eine Stunde vergangen, und schon ist die erste Versuchung da: Das Bett lockt mit der warmen Decke, den Kissen und der Kunstpelzstola, die Hannahs Mutter nach einem Wochenendbesuch hier vergessen hat. Sie flüstern: Komm rein. Keiner merkt, wenn du den ganzen Tag im Bett bleibst. Keiner merkt, wenn du den ganzen Monat dieselbe Jogginghose anhast, vor dem Fernseher isst und das T-Shirt als Serviette benutzt. Wenn du denselben Song auf Repeat hörst, bis der Klang sich auflöst, und du den Winter verschläfst.
Ich muss nur noch Mabels Besuch hinter mich bringen, dann kann ich genau das tun. Twitter durchscrollen, bis alles vor meinen Augen verschwimmt, ins Bett fallen wie eine schwindsüchtige Romanheldin. Ich kann mir eine Flasche Whiskey besorgen (auch wenn ich Gramps versprochen habe, dass ich die Finger davon lasse), mich von innen aufwärmen, die Grenzen des Zimmers aufweichen und die Erinnerungen von der Leine lassen.
Vielleicht höre ich ihn wieder singen, wenn alles andere still ist.
Genau davor wollte Hannah mich retten.
Die Essay-Sammlung ist ein Taschenbuch mit indigoblauem Umschlag. Ich schlage das Motto auf, ein Zitat von Wendell Berry: Im Kreise des Menschlichen erschöpft uns das ewige Streben und lässt uns nie zur Ruhe kommen. Mein persönlicher Kreis des Menschlichen hat vor der beißenden Kälte Reißaus genommen, hat sich in Elternhäuser, vor prasselnde Kamine und an tropische Ziele geflüchtet, von wo sie in Bikini und Nikolausmütze Weihnachtsgrüße verschicken. Ich bemühe mich, Mr Berry beim Wort zu nehmen und in ihrer Abwesenheit eine Chance zu sehen.
Im ersten Essay geht es um die Natur, von einem Autor, den ich nicht kenne und der seitenlang über einen See schreibt. Zum ersten Mal seit langer Zeit vertiefe ich mich in eine Landschaftsbeschreibung. Er beschreibt die Wellen, das Glitzern auf dem Wasser, die Kiesel am Strand. Dann spricht er von Auftrieb und Schwerelosigkeit; damit kenne ich mich aus. Wenn ich den Schlüssel zum Schwimmbad hätte, würde ich der eisigen Kälte trotzen. Der einsame Monat wäre viel leichter zu überstehen, wenn ich morgens und abends ein paar Bahnen ziehen könnte. Aber das Schwimmbad ist geschlossen. Also lese ich weiter. Der Autor schlägt vor, dass wir die Natur als einen Weg verstehen, allein zu sein. Er sagt, die Seen und Wälder liegen in unserem Kopf. Wir müssen nur die Augen schließen, um zu ihnen zu gelangen.
Ich schließe die Augen. Die Heizung klickt und schaltet sich aus. Ich warte ab, was mir in den Sinn kommt.
Langsam taucht etwas auf: Sand. Strandgras und Strandglas. Möwen und Sanderlinge. Das Rauschen und dann — schneller — der Anblick der Wellen, die brechen, sich zurückziehen, sich im Meer und im Himmel auflösen. Ich schlage die Augen auf. Es ist zu viel.
Vor dem Fenster scheint silbern der Mond. Die Schreibtischlampe, die mein Blatt beleuchtet, ist das einzige Licht in den hundert Zimmern dieses Gebäudes. Ich mache eine Liste für die Zeit nach Mabels Besuch.
Jeden Morgen New York Times online lesen
Lebensmittel einkaufen
Suppe kochen
Mit dem Bus ins Einkaufszentrum / zur Bibliothek / zum Café fahren
Über Einsamkeit lesen
Meditieren
Dokumentarfilme im Internet sehen
Podcasts hören
Neue Musik finden …
Ich fülle den Wasserkocher im Bad, um mir eine japanische Tütensuppe zu machen. Beim Essen lade ich ein Hörbuch über Meditieren für Anfänger herunter. Ich drücke auf Play. Meine Gedanken schweifen ab.
Später versuche ich zu schlafen, aber ich kann meine Gedanken nicht abstellen. Alles vermischt sich: Hannah, die über Meditieren und Broadway-Shows spricht. Der Hausmeister, und ob ich etwas brauche. Mabel, die plötzlich hier auftaucht und irgendwie wieder Teil meines Lebens wird. Ich weiß nicht einmal, wie ich das Wort Hallo über die Lippen bringen soll. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Gesicht machen soll: ob ich ein Lächeln hinkriege, ob ein Lächeln überhaupt angebracht ist. Und die ganze Zeit klickt die Heizung, geht an und aus, immer lauter, je müder ich werde.
Ich mache die Nachttischlampe wieder an und greife nach dem Buch.
Vielleicht versuche ich es noch einmal mit der Übung und bleibe diesmal auf festem Boden. Ich denke an die Redwood-Bäume, die so riesig sind, dass wir es kaum zu fünft mit ausgestreckten Armen geschafft haben, einen Stamm zu umfassen. Unter den Bäumen wuchsen Blumen und Farne, und die Erde war feucht und schwarz. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Gedanken bei den Redwoods bleiben. Die Bäume hier, draußen unter dem Schnee, habe ich noch nie umarmt. Hier ist meine Geschichte erst drei Monate alt. Besser, ich bleibe in der Gegenwart.
Also stehe ich auf und ziehe mir eine Jogginghose über die Leggings und einen dicken Pullover über den Rollkragenpulli. Dann nehme ich den Schreibtischstuhl, trage ihn zum Aufzug und drücke den obersten Knopf. Oben im Turm ist es immer still, selbst wenn das Wohnheim voll ist. Ich stelle den Stuhl vor eins der großen Bogenfenster und setze mich, Handflächen auf die Knie, Füße flach auf dem Teppich.
Draußen ist der Mond zu sehen, die Umrisse der Bäume und der Gebäude auf dem Campus, die von Laternen gesäumten Wege. All das ist jetzt mein Zuhause, und es ist immer noch mein Zuhause, wenn Mabel wieder abgereist ist.
Ich lasse die Stille wirken, spüre der stechenden Wahrheit nach. Meine Augen brennen. Ich habe einen Kloß im Hals. Ich wünschte, es gäbe etwas, das die Einsamkeit mildert. Ich wünschte, einsam wäre ein treffenderes Wort. Es ist viel zu schön. Aber besser, ich stelle mich dem jetzt, als später wie gelähmt zu sein und nicht mehr zu mir selbst zu finden.
Ich atme ein. Ich atme aus. Mit offenen Augen sehe ich die neuen Bäume an.
Ich weiß, wo ich bin, und ich weiß, was das heißt. Ich weiß, dass Mabel morgen kommt, ob ich will oder nicht. Ich weiß, dass ich immer allein sein werde, selbst wenn Leute um mich sind, also lasse ich die Leere herein.
Der Himmel ist tief dunkelblau und jeder Stern hell und klar. Meine Hände auf meinen Beinen sind warm. Es gibt viele Arten, allein zu sein. Ich weiß es. Ich atme ein (Sterne und Himmel). Ich atme aus (Bäume und Schnee).
Es gibt viele Arten, allein zu sein, und diesmal ist es anders als letztes Mal.
Der Morgen fühlt sich neu an.
Ich habe fast bis zehn geschlafen, dann hat mich der Truck des Hausmeisters geweckt, der unter meinem Fenster den Schnee von der Auffahrt geräumt hat.
Jetzt bin ich geduscht und angezogen. Durchs Fenster fällt der Tag. Ich suche mir eine Playlist aus und verbinde den Laptop mit Hannahs Lautsprechern. Bald sind Gitarrenklänge zu hören, dann setzt die Frauenstimme ein. Ich lasse die Tür offen und gehe mit dem Wasserkocher ins Bad. Die Musik begleitet mich um die Ecke. Auch im Bad lasse ich die Tür auf. Solange ich allein hier bin, muss ich die Räume mehr zu meinen Räumen machen.
Der Kocher füllt sich mit Wasser. Ich sehe mich im Spiegel an. Übe mein Lächeln für Mabels Ankunft. Ein Lächeln, das sowohl Wiedersehensfreude als auch Zerknirschung ausdrückt. Ein Lächeln voller Bedeutung, das alles sagt, was zu sagen ist, damit ich es nicht sagen muss. Ich drehe den Wasserhahn zu.
Zurück im Zimmer, schalte ich den Wasserkocher an und nehme die gelbe Schale, die ich gestern Abend kopfüber zum Trocknen aufgestellt habe. Ich gebe Müsli hinein und den Rest der Milch aus dem Mini-Kühlschrank, der zwischen unseren Schreibtischen steht. Den Tee trinke ich heute Morgen schwarz.
Noch siebeneinhalb Stunden, bis Mabel kommt. Ich gehe zur Tür und versuche, das Zimmer durch ihre Augen zu sehen. Zum Glück hat Hannah ein bisschen Farbe reingebracht, aber zwischen ihrer Seite und meiner Seite ist ein krasser Unterschied. Bis auf den Blumentopf und die Schalen ist mein Schreibtisch leer. Ich habe die Lehrbücher vom ersten Semester vor zwei Tagen weiterverkauft, und ich will lieber nicht, dass Mabel das Buch über Einsamkeit sieht. Also verstecke ich es im Schrank, wo jede Menge Platz ist. Als ich mich wieder umdrehe, fällt mein Blick auf das Schlimmste: meine leere Pinnwand, an der kein einziger Zettel hängt. Aber im Gegensatz zu meinem Lächeln kann ich die Pinnwand noch retten.
Ich kenne genug Wohnheimzimmer, um zu wissen, was fehlt. Ich habe lange genug auf Hannahs Wand gestarrt. Ich brauche Songtexte, Zitate, Promi-Bilder. Ich brauche Fotos und Souvenirs, Konzertkarten, Zettel mit Nachrichten. Weil ich so gut wie nichts davon besitze, mache ich mich mit Stiften, Papier und dem Drucker ans Werk, den Hannah und ich uns teilen. Es gibt einen Song, den Hannah und ich jeden Morgen hören. Mit lila Kuli schreibe ich den Refrain auf ein Blatt und schneide ihn quadratisch aus.
Dann verbringe ich einige Zeit damit, im Internet nach Fotos vom Mond zu suchen.
Zwei Türen weiter wohnt Keaton, die uns ständig von ihren Kristallen erzählt. Sie hat eine Sammlung auf der Fensterbank, in der sich das Licht bricht. Im Netz stoße ich auf den Blog einer Frau namens Josephine, die über die Heilkräfte von Edelsteinen und ihre Anwendung schreibt. Dann suche ich nach Bildern von Pyrit (Schutz), Hämatit (Erdung), Jade (Gelassenheit). Der Farbdrucker rattert und summt.
Inzwischen bereue ich, dass ich meine Lehrbücher so schnell losgeworden bin. Sie waren voller gelber Zettel und Notizen. In Geschichte haben wir das Arts and Crafts Movement durchgenommen, und viele der Ideen haben mich beeindruckt, die Rückbesinnung auf das Handwerk zum Beispiel. Ich suche im Netz nach William Morris, lese verschiedene Artikel, fahnde nach schönen Zitaten. Ich schreibe ein paar ab, jedes in einer anderen Farbe, und drucke sie in verschiedenen Schriftarten aus — vielleicht wirken sie abgetippt ja besser. Ich suche nach Bildern von Redwood-Bäumen, die meiner Erinnerung möglichst nahekommen, und lande bei einem Dokumentarfilm über das Redwood-Ökosystem, aus dem ich erfahre, dass die kalifornischen Riesenmammutbäume im Sommer den Großteil des Wassers, das sie brauchen, über den Nebel beziehen und dass sie von einer lungenlosen Salamander-Art bewohnt werden, die durch die Haut atmet. Ich drucke das Foto eines lungenlosen Salamanders auf einem hellgrünen Mooskissen aus, und als der Drucker damit fertig ist, beschließe ich, dass es reicht.
Mit einer Handvoll von Hannahs Reißzwecken arrangiere ich alles, dann trete ich zurück, um mein Werk zu bewundern. Aber das Ganze wirkt viel zu sauber, viel zu neu. Jeder Zettel dasselbe Papier. Egal wie interessant die Zitate und wie schön die Motive sind — die Pinnwand sieht verzweifelt aus.
Inzwischen ist es fast drei, und ich habe wertvolle Stunden verloren, und ich kriege kaum Luft, weil es bis halb sieben gar nicht mehr so lang hin ist.
Mabel kennt mich besser als jeder andere auf der Welt, selbst wenn wir vier Monate lang nicht miteinander gesprochen haben. Ich habe ihre Nachrichten nicht beantwortet, bis sie es irgendwann aufgegeben hat. Ich weiß nicht, wie ihr neues Leben in Los Angeles ist. Sie weiß nicht, wer Hannah ist, oder was ich studiere, oder ob ich nachts schlafe. Aber ein Blick von ihr genügt, und sie weiß, wie es mir geht.
Ich nehme alles von der Pinnwand runter, trage die Zettel in ein anderes Stockwerk und verteile sie dort unauffällig auf die Mülleimer im Waschraum.
Mabel kann ich nichts vormachen.
Die Fahrstuhltür gleitet auf, aber ich steige nicht ein.
Ich weiß nicht, wieso ich bisher keine Angst vor dem Fahrstuhl hatte. Doch jetzt, bei Tageslicht, kurz vor Mabels Ankunft, wird mir klar: Falls etwas schiefgeht, falls der Fahrstuhl stecken bleibt, falls mein Telefon keinen Empfang hat, falls keiner auf den Notrufknopf antwortet, würde ich ziemlich lange hier sitzen, bis der Hausmeister mich findet. Tage, mindestens. Und wenn Mabel kommt, würde sie niemand reinlassen. Ich würde sie nicht mal hören, wenn sie gegen die Tür hämmert. Dann würde sie wieder ins Taxi steigen, zum Flughafen zurückfahren und auf den nächsten Flug nach Hause warten.
Sie würde denken: War ja klar. Dass ich sie enttäusche. Dass ich sie nicht sehen will.
Also mache ich einen Bogen um den Fahrstuhl und nehme die Treppe.
Das Taxi, das ich gerufen habe, wartet mit laufendem Motor, und ich hinterlasse eine eisige Spur im Schnee — dankbar für Hannahs alte Stiefel, die sie mir aufgezwungen hat, als der erste Schnee fiel (Du hast keine Ahnung, hat sie gesagt), und die mir nur ein bisschen zu klein sind.
Der Taxifahrer steigt aus und hält mir die Tür auf. Ich nicke ihm dankend zu.
»Wohin?«, fragt er, als wir beide sitzen, bei voll aufgedrehter Heizung und dem Geruch von Kaffee und altem Aftershave.
»Zum Supermarkt«, sage ich. Meine ersten Worte seit vierundzwanzig Stunden.
Die Neonröhren, die Leute und die Einkaufswagen, weinende Babys, Weihnachtsmusik — das alles wäre mir zu viel, wenn ich nicht genau wüsste, was ich brauche. Aber das Einkaufen ist kinderleicht. Mikrowellen-Popcorn mit Buttergeschmack. Extradünne Salzstangen. Milchschokotrüffel. Kakao. Mineralwasser mit Grapefruit-Note.
Als ich wieder ins Taxi steige, habe ich genug für eine ganze Woche eingekauft, drei schwere Tüten mit Lebensmitteln, obwohl Mabel nur drei Tage bleibt.
Im ersten Stock gibt es eine Gemeinschaftsküche. Ich wohne im zweiten und habe sie noch nie betreten. Ich stelle mir vor, dass sich dort Mädchen, die in Clubs sind, treffen, um Brownies für ihre Filmabende zu backen, oder eingefleischte Cliquen, die zusammen kochen, weil sie zu cool für die Mensa sind.
Jetzt ist der Kühlschrank leer, wahrscheinlich wurde vor den Ferien hier Großputz gemacht. An der Wand hängt ein Zettel, der mahnt, dass alle Lebensmittel mit Initialen, Zimmernummer und Datum beschriftet sein müssen. Ich greife nach Kreppband und Stift, obwohl ich in nächster Zeit ganz allein hier bin. Kurz darauf sind zwei der drei Fächer mit Lebensmitteln gefüllt, die meinen Namen tragen.
Im Zimmer stelle ich die Knabbereien auf Hannahs Tisch. Die Auswahl wirkt üppig, genau wie ich gehofft habe. Und dann kommt plötzlich eine Nachricht.
Ich bin da.
Es ist noch nicht mal sechs — ich müsste noch mindestens eine halbe Stunde haben.
Ich kann dem Drang nicht widerstehen, durch Mabels alte Nachrichten zu scrollen, auch wenn es Folter ist. Wie es mir geht. Dass sie an mich denkt. Wo zum Teufel ich abgeblieben bin, ob ich sauer bin, ob wir reden können, ob sie mich besuchen kann, ob ich sie vermisse. Denkst du noch an Nebraska?, steht in einer, ein Plan, den wir mal hatten, auch wenn er nie realistisch war. Da sind so viele unbeantwortete Nachrichten, die mir ein schlechtes Gewissen machen, bis mich das Telefonklingeln aus den Gedanken reißt.
Ich zucke zusammen und gehe dran.
»Hey«, sagt sie. Zum ersten Mal, seit all das passiert ist, höre ich ihre Stimme. »Ich stehe vor der Tür und frier mir den Arsch ab. Lässt du mich rein?«
Und dann bin ich unten. Nur durch die Glastür von ihr getrennt, als ich mit zitternder Hand nach dem kalten Türknauf greife. Ich sehe Mabel an. Sie bläst Luft in ihre Hände, um sich aufzuwärmen. Schaut in die andere Richtung. Dann dreht sie sich um, und unsere Blicke treffen sich, und ich weiß nicht, wie ich glauben konnte, dass ich ein Lächeln zustande brächte. Ich kriege ja kaum die Tür auf.
»Ich weiß nicht, wer es bei dieser Kälte aushalten soll«, schnaubt sie, als ich endlich die Tür aufziehe und sie ins Haus tritt. Auch in der Eingangshalle ist es eiskalt.
Ich sage: »Oben in meinem Zimmer ist es wärmer.«
Umständlich greife ich nach ihrer Tasche, vorsichtig, damit unsere Hände sich nicht berühren. Das Gewicht beruhigt mich, als wir im Fahrstuhl stehen.
Schweigend gehen wir durch den Flur, dann sind wir an der Tür, und sie steht im Zimmer, stellt den Koffer auf den Boden und zieht den Mantel aus.
Da ist sie, Mabel, hier bei mir, fünftausend Kilometer entfernt von dem Ort, der einst mein zu Hause war.
Ihr Blick fällt auf das Knabberzeug, das ich gekauft habe. All ihre Lieblingssorten.
»Aha«, sagt sie. »Ich schätze, ich bin doch willkommen.«
Kapitel zwei
Endlich ist Mabel warm genug. Sie wirft die Mütze auf Hannahs Bett und wickelt sich den rot-gelb gestreiften Schal vom Hals. Ich zucke zusammen, als ich die vertrauten Sachen sehe. Meine Kleider sind alle neu.
»Ich würde eine Campus-Tour verlangen, aber bei der Kälte, vergiss es.«
»Ja, tut mir leid«, sage ich, wie hypnotisiert von ihrem Schal und ihrer Mütze. Sind sie immer noch so weich wie früher?
»Du entschuldigst dich für das Wetter?«, sagt Mabel spöttisch und zieht die Brauen hoch. Als mir keine schlagfertige Antwort einfällt, steht ihre Frage im Raum und erinnert mich an die Entschuldigung, wegen der sie gekommen ist.
Fünftausend Kilometer sind ein weiter Weg, um sich ein Tut mir leid abzuholen.
»Und, wie sind deine Professoren so?«
Zum Glück kann ich von dem Geschichtsprofessor erzählen, der in den Vorlesungen flucht, Motorrad fährt und eher in eine Bar passt als in den Hörsaal. Das Thema ist zwar nicht weltbewegend, aber wenigstens bleibe ich nicht stumm.
»Am Anfang dachte ich, alle Professoren würden wie Mönche leben«, sage ich. Mabel lacht. Ich habe sie zum Lachen gebracht. »Aber die Illusion hat er mir genommen.«
»In welchem Gebäude hast du Geschichte? Wir können die Campus-Tour durchs Fenster machen.« Sie sieht aus dem Fenster auf den Campus. Ich brauche einen Moment zu lange, bevor ich neben ihr stehe.
Mabel.
Hier. In Dutchess County, Upstate New York. In meinem Zimmer.
Draußen liegt Schnee, auf den Bänken, den Bäumen und dem Pick-up des Hausmeisters. Laternen beleuchten die Wege, obwohl keiner da ist. Irgendwie wirkt alles noch verlassener dadurch. So viel Licht und nichts als Stille.
»Da drüben.« Ich zeige auf das letzte Gebäude in der Dunkelheit, das kaum zu erkennen ist.
»Und wo hast du Literatur?«
»Gleich hier.« Ich zeige auf das Gebäude neben uns.
»Und was hast du sonst noch?«
Ich zeige auf den Sportkomplex, wo ich jeden Morgen Bahnen ziehe und erfolglos versuche, Butterfly zu lernen. Ich schwimme auch spätabends, aber das erzähle ich ihr nicht. Das Wasser hat immer 27 Grad. Wenn man hineinspringt, fühlt es sich an, als gleite man ins Nichts, ganz anders als der eisige Schock, den ich von früher gewohnt bin. Keine eiskalten Wellen, die den Körper taub werden lassen und stark genug sind, einen nach unten zu ziehen. Abends ist der Pool leer, und ich schwimme erst meine Bahnen, dann lasse ich mich treiben, starre die Decke an oder schließe die Augen, die Geräusche gedämpft und weit entfernt, während der Bademeister aufpasst.
Das beruhigt mich, wenn die Panik kommt.
Aber wenn es zu spät ist, wenn der Pool schon geschlossen ist und ich meine Gedanken nicht bremsen kann, dann ist es Hannah, die mich erdet.
»Ich habe hier was Interessantes gelesen«, sagt sie zum Beispiel, im Bett sitzend mit dem Lehrbuch auf dem Schoß. Und dann liest sie mir von den Honigbienen vor, von sommergrünen Bäumen, von der Evolution.
Meistens brauche ich eine Weile, bis ich zuhören kann. Doch dann weiht sie mich ein in die Geheimnisse der Bestäubung, und ich erfahre, dass Honigbienen zweihundert Mal pro Sekunde mit den Flügeln schlagen. Dass Bäume nicht wegen des Wechsels der Jahreszeit, sondern wegen des Niederschlags ihre Blätter abwerfen. Dass vor uns Menschen etwas anderes war. Dass nach uns etwas anderes kommt.
Ich erfahre, dass ich ein winziger Teil einer wundersamen Welt bin.
Dann mache ich mir wieder bewusst, dass ich in einem Wohnheimzimmer am College bin. Was geschehen ist, ist geschehen. Und jetzt ist es vorbei. Zweifel drängen herein, aber ich nehme die Betten und Tische und Schränke, die vier Wände um uns herum, die Mädchen in den Nachbarzimmern und die daneben, das ganze Wohnheim, den Campus und den Staat New York, um die Zweifel zu vertreiben.
Wir sind real, sage ich mir beim Einschlafen.
Und um sechs Uhr morgens, wenn das Schwimmbad aufmacht, stehe ich wieder auf.
Eine Geste ruft mich in die Gegenwart zurück. Mabel, die sich das Haar hinters Ohr klemmt. »Wo ist die Mensa?«
»Die sieht man von hier aus nicht. Sie ist hinter dem Wohnheim auf der anderen Seite des Hofs.«
»Und wie es ist da?«
»Erträglich.«
»Ich meine die Leute. Wie sind die andern?«
»Ganz entspannt. Meistens sitze ich mit Hannah und ihren Freunden zusammen.«
»Hannah?«
»Meine Mitbewohnerin. Siehst du das Gebäude mit dem spitzen Dach? Hinter den Bäumen?«
Mabel nickt.
»Da haben wir Anthropologie. Ich glaube, das ist mein Lieblingsfach.«
»Wirklich? Nicht Literatur?«
Ich schüttele den Kopf.
»Wegen der Professoren?«
»Nein, sie sind beide gut«, sage ich. »Aber Literatur ist mir irgendwie zu … vieldeutig, schätze ich.«
»Das war doch genau das, was du so daran mochtest. Die vielen möglichen Interpretationen.«
Wirklich? Ich erinnere mich nicht.
Ich zucke die Schultern.
»Aber Englisch ist immer noch dein Hauptfach?«
»Nein. Im Moment habe ich kein Hauptfach«, sage ich. »Ich glaube, ich wechsele zu Naturwissenschaften.«
Ich bilde mir ein, Enttäuschung in ihrem Gesicht zu sehen, aber dann lächelt sie.
»Wo ist das Bad?«, fragt sie.
»Komm mit.«
Ich zeige ihr, wo der Waschraum ist, dann gehe ich zurück ins Zimmer.
Drei Tage kommen mir plötzlich sehr lang vor. Unfassbar viele Minuten, die Mabel und ich füllen müssen. Aber dann fällt mein Blick auf ihren Schal auf dem Bett und die Mütze daneben. Ich nehme sie in die Hand. Sie sind noch weicher als in meiner Erinnerung, und sie duften nach dem Rosenwasser, mit dem Mabel und ihre Mutter alles einsprühen. Sich selbst und das Auto. Die hellen Zimmer im ganzen Haus.
Ich klammere mich daran fest und halte ihre Mütze und ihren Schal immer noch in der Hand, als Mabels Schritte über den Flur kommen. Ich inhaliere den Rosenduft, den erdigen Geruch von Mabels Haut, die vielen Stunden, die wir bei ihr verbracht haben.
Drei Tage sind nie genug.
»Ich muss meine Eltern anrufen«, sagt Mabel, die in der Tür steht.
Ich lege ihre Sachen zurück aufs Bett. Falls sie gemerkt hat, dass ich sie in der Hand hatte, sagt sie nichts dazu.
»Ich habe ihnen eine Nachricht vom Flughafen geschickt, aber du weißt ja, wie besorgt sie immer sind. Sie haben mir tausend Ratschläge gegeben, worauf man achten muss, wenn man bei Schnee Auto fährt, dabei habe ich ihnen tausendmal gesagt: Ich fahre doch gar nicht.«
Sie hält sich das Telefon ans Ohr, und selbst vom andern Ende des Zimmers höre ich Anas und Javiers erleichterte, glückliche Stimmen.
Flüchtig blitzt eine Fantasie auf: Mabel steht in der Tür. Dann setzt sie sich zu mir aufs Bett, nimmt mir die Mütze aus der Hand und legt sie weg. Nimmt den Schal und legt ihn mir um den Hals. Greift nach meinen Händen und wärmt sie mit ihren.
»Ja«, sagt sie ins Telefon. »Der Flug war okay … Ich weiß nicht, es war ziemlich groß … Nein, es gab nichts zu essen.« Sie sieht zu mir herüber. »Ja«, sagt sie. »Marin ist hier.«
Wollen ihre Eltern mit mir sprechen?
»Ich muss kurz raus«, sage ich schnell. »Grüß sie von mir.«
Ich husche aus der Tür und gehe runter in die Küche. Ich öffne den Kühlschrank. Alles ist genau so, wie ich es hinterlassen habe, ordentlich beschriftet und geordnet. Wir könnten Ravioli und Knoblauchbrot machen oder Quesadillas mit Bohnen und Reis oder Gemüsesuppe oder Spinatsalat mit Cranberrys und Roquefort oder Chili mit Maisbrot.
Ich bleibe lange genug weg, dass Mabel aufgelegt hat, als ich zurückkomme.
Kapitel drei
Mai
Ich hatte den Wecker nicht gehört und wachte erst auf, als Gramps im Wohnzimmer für mich sang. Ein Lied von einem Matrosen, der von einem Mädchen träumt, das Marin heißt. Gramps hatte nur einen leichten Akzent — er lebte in San Francisco, seit er neun war —, aber wenn er sang, klang er unverkennbar irisch.
Er klopfte an meine Tür und sang lauthals noch eine Strophe.