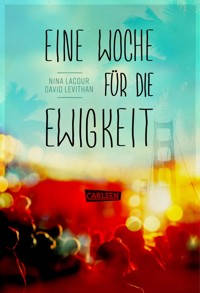8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Tagebuch der besten Freundin ist tabu. Es sei denn, diese Freundin hat sich das Leben genommen und das Buch unter deinem Bett versteckt. Dann musst du es lesen. Am Abend hatte Ingrid noch gesagt: »Ich werde immer da sein, wo du auch bist, Caitlin.« Am nächsten Morgen war sie fort. Für immer. Ihre beste und einzige Freundin hat sich umgebracht. Caitlins Welt bricht auseinander und ihr Herz gleich mit. Warum hat sie nicht gemerkt, dass es Ingrid so schlecht geht? Warum hat Ingrid nicht mit ihr geredet? Dafür sind Freunde doch da: Sie verstehen, was Eltern nicht verstehen. Doch dann macht Caitlin eine Entdeckung und erfährt Dinge über ihre Freundin, von denen sie nicht einmal geahnt hat. Fast mehr, als sie ertragen kann. Endlich kann sie Abschied nehmen. Ein realistisches Jugendbuch ab 14 über Freundschaft, Verlust, Trauer und das Erwachsenwerden. Perfekt für alle Fans von »Am Ende sterben wir sowieso« oder »Tote Mädchen lügen nicht«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Ähnliche
Nina LaCour
Hold still
Über dieses Buch
Das Tagebuch der besten Freundin ist tabu. Es sei denn, diese Freundin hat sich das Leben genommen und das Buch unter deinem Bett versteckt. Dann musst du es lesen.
Am Abend hatte Ingrid noch gesagt: »Ich werde immer da sein, wo du auch bist, Caitlin.« Am nächsten Morgen war sie fort. Für immer. Ihre beste und einzige Freundin hat sich umgebracht. Caitlins Welt bricht auseinander und ihr Herz gleich mit. Warum hat sie nicht gemerkt, dass es Ingrid so schlecht geht? Warum hat Ingrid nicht mit ihr geredet? Dafür sind Freunde doch da: Sie verstehen, was Eltern nicht verstehen. Doch dann macht Caitlin eine Entdeckung und erfährt Dinge über ihre Freundin, von denen sie nicht einmal geahnt hat. Fast mehr, als sie ertragen kann. Endlich kann sie Abschied nehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Nina LaCour ist Dozentin für Kinder- und Jugendliteratur an der Hamline University in Saint Paul und unterrichtet Kreatives Schreiben. Früher arbeitete sie in einem unabhängigen Buchladen und war Lehrerin für Englisch an einer High School. Sie lebt mit ihrer Familie in San Francisco, USA.
Inhalt
Widmung
Sommer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Herbst
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Winter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Frühling
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Der nächste Sommer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Danksagung
Für meine Familie und für Krystin
Sommer
1
Ich sehe den Wassertropfen zu, wie sie von meinen Haarspitzen perlen. Sie rinnen am Handtuch entlang und bilden eine Pfütze auf dem Sofakissen. Mein Herz klopft so laut, dass es in meinen Ohren dröhnt.
»Schätzchen. Hör mal.«
Mom spricht Ingrids Namen aus, und ich beginne zu summen, keine Melodie von einem Lied, sondern nur einen langgezogenen Ton. Ich weiß, dass ich dadurch wie gestört wirke, und ich weiß auch, dass es nichts ändert, aber es ist besser als heulen, es ist besser als schreien, es ist besser, als sich anzuhören, was sie mir sagen wollen.
Irgendwas zertrümmert meine Brust – ein Anker, etwas Schweres. Demnächst werde ich einfach einstürzen.
Ich stolpere nach oben und zerre mir die alte Jeans und das Tanktop von gestern über. Dann bin ich draußen auf der Straße, um die Ecke zur Bushaltestelle. Dad ruft meinen Namen, aber ich antworte nicht. Stattdessen springe ich in den Bus, als sich die Türen gerade schließen. Ich suche mir hinten einen Platz und fahre einfach weg, durch Los Cerros und durch die nächste Stadt, bis ich in einer unbekannten Straße aussteige. Ich setze mich auf die Bank bei der Bushaltestelle und versuche, langsamer zu atmen.
Das Licht hier ist anders, blauer. Eine lächelnde Mutter mit einem Kinderwagen schwebt an mir vorbei. Ein Zweig bewegt sich im Wind. Ich versuche, mich so leicht wie Luft zu machen.
Aber meine Hände sind unruhig, sie müssen sich bewegen, also pule ich an einem Splitter in der Bank herum und breche mir einen Fingernagel ab. Jetzt ist er noch kürzer als vorher, aber ein kleines Stück Holz reißt ab. Es fällt in meine geöffnete Hand, und ich versuche, noch einen Splitter abzubrechen.
Während der ganzen vergangenen Nacht habe ich meiner Stimme zugehört, wie sie in Endlosschleife biologische Fakten abspulte. Das Band läuft auch jetzt wieder in meinem Kopf, ein Katastrophen-Soundtrack, und übertönt alles andere.
Wenn ein braunäugiger Mann und eine braunäugige Frau ein Kind bekommen, hat es wahrscheinlich braune Augen. Aber wenn beide Elternteile ein Gen für blaue Augen haben, dann kann ihr Kind auch blaue Augen haben.
Ein alter Mann in einer Strickjacke setzt sich neben mich. Meine Hand ist nun halbvoll mit Holzsplittern. Ich merke, dass er mich beobachtet, aber ich kann nicht aufhören. Ich möchte fragen: Warum starren Sie mich an? Es ist heiß, es ist Juni, und Sie haben eine Jacke mit Weihnachtssternmuster an.
»Brauchst du Hilfe?«, fragt der alte Mann. Sein Bart ist flaumig und weiß.
Ohne aufzusehen, schüttele ich den Kopf.
Nein.
Er holt ein Mobiltelefon aus der Tasche. »Soll ich dir mein Handy leihen?«
Mein Herz setzt einen Schlag lang aus, und ich muss husten.
»Soll ich deine Eltern anrufen?«
Ingrid ist blond. Sie hat blaue Augen, und das bedeutet, dass ihr Vater trotz seiner braunen Augen ein rezessives Blaue-Augen-Gen hat.
Ein Bus kommt. Der alte Mann steht auf, er ist unschlüssig.
»Ach, armes Kind«, sagt er.
Er hebt die Hand, als wollte er mir auf die Schulter klopfen, aber dann lässt er es bleiben.
Meine linke Hand ist jetzt voll, und die ersten Holzsplitter fallen auf die Erde.
Ich bin ein Mensch, gleich werde ich ins Nichts explodieren.
Der alte Mann entfernt sich, steigt in den Bus, und dann ist er fort.
Autos fahren an mir vorbei. Ein verschwommener Farbfleck nach dem anderen. Manchmal halten sie bei der Ampel oder am Zebrastreifen, aber irgendwann sind sie immer weg. Ich werde wohl für immer hier bleiben und an der Bank herumpulen, bis sie als Splitterhaufen auf dem Gehsteig liegt. Einfach vergessen, wie es sich anfühlt, wenn man jemanden gernhat.
Ein Bus kommt, aber ich mache ein Zeichen, dass ich nicht einsteigen will, und er hält nicht an. Ein paar Minuten später schauen mich zwei kleine Mädchen durch das Rückfenster eines Autos an – eines ist blond, eines dunkelhaarig. Sie haben bunte Spangen im Haar. Es könnte sein, dass sie Schwestern sind. Sie drehen die Köpfe, um mich genauer zu betrachten. Sie glotzen. Als die Ampel auf Grün schaltet, strecken sie ihre Händchen durch das offene Dach und winken so heftig und schnell, dass es aussieht, als würden Schmetterlinge aus ihren Handgelenken blühen.
Einige Zeit später hält mein Vater neben mir. Er beugt sich über den Beifahrersitz und stößt die Tür auf. Der Geruch nach Leder. Dünne, kühle, klimatisierte Luft. Ich steige ein und lasse mich von ihm nach Hause fahren.
2
Ich verschlafe den nächsten Tag. Wenn ich ins Bad gehe, bemühe ich mich, nicht in den Spiegel zu schauen. Einmal passe ich nicht richtig auf: Es sieht aus, als hätte mir jemand zwei Veilchen gehauen.
3
Über den folgenden Tag kann ich nicht sprechen.
4
Wir schleichen den Highway 1 hoch, weil mein Vater ein vorsichtiger Autofahrer ist, außerdem hat er Höhenangst. Unter uns sind auf der einen Seite Felsen und das Meer, auf der anderen dichtbelaubte Bäume und Schilder, die uns in Städten mit geschätzten vierundachtzig Einwohnern willkommen heißen. Mom hat ihre komplette Sammlung klassischer CDs dabei, und gerade hören wir Beethoven: »Für Elise«, das sie auch immer auf ihrem Klavier spielt. Ihre Finger tanzen leicht über ihren Schoß.
Am Rand einer Kleinstadt halten wir an, um zu Mittag zu essen. Wir packen unser Picknick aus und sitzen auf einem alten Quilt. Mom und Dad sehen mich an, und ich betrachte den mürben Stoff, die von Hand aufgenähten Muster.
»Es gibt ein paar Dinge, die du wissen solltest«, sagt Mom.
Ich höre die vorbeifahrenden Autos, von weit unten die Wellen und das Knistern des Butterbrotpapiers. Trotzdem dringen einige Worte durch: klinisch depressiv; Medikamente; seit ihrem neunten Lebensjahr. Das Meer ist tief unter uns, aber die Wellen wummern so laut, als wären sie ganz nah und könnten uns ertränken.
»Caitlin?«, fragt Dad.
Mom berührt mein Knie. »Süße? Hörst du zu?«
Die Nacht verbringen wir in einer Hütte mit Schlafkojen und Wänden aus zersägten Baumstämmen. Ich drehe dem Spiegel beim Zähneputzen den Rücken zu, klettere die Leiter zu einer der oberen Kojen hoch und tu so, als würde ich schlafen. Meine Eltern gehen in der Hütte hin und her, die Dielen knarren, sie drehen den Wasserhahn auf und zu, spülen die Toilette und öffnen die Reißverschlüsse ihrer Reisetaschen. Ich ziehe die Knie hoch an die Brust und versuche, mich so klein wie möglich zu machen.
Sie löschen das Licht, und die Hütte liegt im Dämmerlicht.
Ich starre auf die Baumstammwand. Ich habe mal gelernt, dass Bäume von innen nach außen wachsen. Ein Holzring für jedes Jahr. Ich zähle sie mit meinen Fingern.
»… das wird ihr guttun«, sagt Dad leise.
»Hoffentlich.«
»Wenigstens ist sie mal weg von Zuhause. Hier ist es so friedlich.«
Mom flüstert: »Sie hat seit Tagen kaum ein Wort gesagt.«
Ich rühre mich nicht und höre auf zu zählen. Ich möchte mehr hören, aber Minuten vergehen, und dann fängt mein Vater an zu schnarchen, gefolgt von den gleichmäßigen Atemzügen meiner Mutter.
Meine Hand weiß nicht mehr, wie viele Jahre sie gezählt hat. Es ist zu dunkel, um noch einmal von vorn zu beginnen.
Um drei Uhr morgens schrecke ich hoch.
Ich fixiere die Sternbilder, die jemand mit Leuchtfarbe an die Zimmerdecke gemalt hat. Ich bemühe mich, ganz lange nicht zu blinzeln, denn wenn ich das tue, sehe ich Ingrids Gesicht, die Augen geschlossen, die Lippen erstarrt. Lautlos bete ich Biologie-Fakten herunter, um einen klaren Kopf zu bewahren. Es gibt zwei Stadien der Zellteilung, und dann werden vier Tochterzellen produziert, flüstere ich fast lautlos, weil ich meine Eltern nicht aufwecken will. Jede Tochterzelle hat die halbe Chromosomenzahl der Elternzellen.
Draußen fährt ein Auto vorbei. Scheinwerferlicht gleitet über die Decke, über die Sterne. Ich wiederhole die Lehrsätze, bis alle Wörter ineinander übergehen.
Zwei-Stadien-der-Zellteilung-und-dann-werden-vier-Tochterzellen-produziert-Jede-Tochterzelle-hat-die-halbe-Chromosomenzahl-der-Elternzellen-Zwei-Stadien-der-Zellteilung …
Je öfter ich das aufsage, desto komischer hört es sich an. Ich muss lächeln. Dann vergrabe ich meinen Kopf im Kissen, damit meine Eltern nicht davon wach werden, wie ich mich in den Schlaf lache.
5
An einem heißen Julimorgen fährt Dad nach Hause, weil er wieder arbeiten muss. Mom und ich bleiben in Nordkalifornien, als wäre es der einzige Ort, den wir kennen. Ich sitze vorn und mache den Navigator, sorge dafür, dass wir innerhalb der Grenzen der Landkarte bleiben – nicht nördlicher als höchstens ein paar Meilen nach Oregon hinein und nicht südlicher als Chicco. Wir verbringen den Sommer mit Wanderungen durch Höhlen und Wälder, wir überleben die Schlaglöcher und essen gegrillte Käsesandwichs in Restaurants am Straßenrand. Wir reden nur über die Dinge direkt vor unserer Nase – die Redwoodbäume, die Kellnerinnen, wie übersüß unser Eistee ist.
Eines Abends entdecken wir mitten in der Pampa ein winziges altes Kino. Wir schauen uns einen Kinderfilm an, den einzigen, den sie im Programm haben, und achten mehr auf die lachenden und kreischenden Kinder im Zuschauerraum als auf die Leinwand. Zweimal befestigen wir Taschenlampen an unseren Köpfen und tasten uns im Lassen-Nationalpark durch Lavahöhlen. Mom stolpert und schreit auf. Das Echo ihrer Stimme hallt endlos lange wider.
Ich träume ein paarmal vom Strickjackenmann. Mitten im Wald schwebt er im Smoking mit roter Fliege auf mich zu. Hier, sagt er und hält mir sein Mobilfon hin. Ich weiß, dass Ingrid am anderen Ende darauf wartet, dass ich mit ihr rede. Wenn ich danach greife, sehe ich um mich herum grüne Bäume und braune Erde, aber ich bin in Schwarzweiß.
Morgens darf ich jetzt immer Kaffee trinken, und Mom sagt: »Süße, du bist so blass.«
6
Und auf einmal ist September. Wir müssen zurückfahren.
Herbst
1
Es ist drei Uhr morgens. Nicht die beste Zeit, um ohne Blitz oder hochempfindlichen Film zu fotografieren, aber ich kauere auf der Kühlerhaube von meinem Auto, das ich mittlerweile eigentlich fahren können müsste, richte die Kamera auf den Himmel und möchte gern den Mond erwischen, bevor eine Wolke ihn verdeckt. Ich knipse mit Langzeitblende ein Bild nach dem anderen, bis der Mond verschwindet und der Himmel schwarz ist.
Als ich von der Kühlerhaube rutsche, ächzt das Auto; es stöhnt, als ich die Tür öffne und auf den Rücksitz klettere.
Ich verriegele die Tür und rolle ich mich auf dem Sitz zusammen. Mir bleiben fünf Stunden, bis ich wieder funktionieren muss.
Eine Viertelstunde verstreicht. Ich zupfe an den Kunstpelzbezügen der Vordersitze, die ich sehr mag. Ich kann meine Finger nicht stillhalten, überallhin fallen weiße Flocken.
Um halb fünf habe ich hämmernde Kopfschmerzen und mehrere Trampelanfälle überstanden, mir die Faust in den Mund gesteckt und geschrien. Ich muss den Druck aus meinem Körper lassen, damit ich endlich schlafen kann. Im Haus geht das Licht in meinem Zimmer an. Dann das Licht in der Küche. Die Tür schwingt auf, und Mom erscheint, sie hält sich den Morgenrock vor der Brust zu. Ich strecke den Arm zwischen den Vordersitzen durch und drücke auf die Warnblinkanlage, lasse sie zweimal aufleuchten und sehe, wie Mom zurück ins Haus schlurft.
Eine Aufnahme ist noch übrig, deshalb fotografiere ich durch die Windschutzscheibe das dunkle Haus mit den zwei erleuchteten Fenstern.
Ich werde es Mein Zuhause um 5 Uhr 25 nennen. Vielleicht werde ich es mir eines Tages anschauen, wenn ich keine Kopfschmerzen mehr habe, und versuchen zu verstehen, warum ich mich seit unserem Urlaub jede Nacht in ein kaltes Auto eingeschlossen habe, nur wenige Schritte von meinem warmen Zuhause entfernt, während sich meine Eltern solche Sorgen machen, dass sie auch nicht schlafen können. Manchmal fange ich so gegen sechs Uhr an zu träumen.
Mein Vater weckt mich, indem er mit den Fingerknöcheln an das Fenster klopft. Ich öffne die Augen und sehe das Morgenlicht. Dad ist schon im Anzug.
»Sieht aus, als hätte es hier drin einen Blizzard gegeben«, sagt er.
Die Rückseiten der Sitzbezüge sind kahl. Meine Hand tut weh.
2
Ich gehe zu Fuß den langen Weg zur Schule, meinen neuen Stundenplan miniklein zusammengefaltet ganz tief in der Hosentasche. Ich komme am Einkaufszentrum vorbei, am Supermarkt und seinem riesigen Parkplatz; an dem zum Verkauf stehenden Grundstück, wo die Bowling-Halle stand, bevor die Stadt befand, Bowling wäre nicht wichtig, und sie abreißen ließ.
An einem Freitagabend vor zwei Jahren bin ich auf eine der Bahnen gesprungen und habe Ingrid fotografiert, wie sie eine schwere rote Kugel auf mich zurollen ließ. Sie donnerte zwischen meinen Füßen hindurch, die links und rechts in den Ablaufbahnen standen. Der Besitzer brüllte uns an und warf uns raus. Das Foto klebt an meiner Schranktür: ein unscharfer roter Fleck, Ingrids grimmig entschlossener Blick. Hinter ihr: Lichter, Fremde, Reihen von Bowlingschuhen.
Ich bleibe an einer Ecke stehen und lese durch das Glas eines Zeitungskastens die Schlagzeilen. Irgendwas muss doch in der Welt passieren: Überschwemmungen, medizinische Durchbrüche, Krieg? Aber heute Morgen hat die Los Cerros Tribune wie meistens nur Lokalpolitik und Hitze zu bieten.
Sobald ich kann, verdrücke ich mich in eine Seitenstraße, weil ich nicht will, dass jemand mich sieht, anhält und mir eine Mitfahrgelegenheit anbietet. Wahrscheinlich würden sie dann über Ingrid reden, und ich würde wie eine Idiotin auf meine Hände stieren. Oder sie würden nicht über Ingrid reden, und stattdessen würde ein immer zäher werdendes Schweigen herrschen.
Auf dem Pfad zwischen den Wohnblöcken knirschen Räder über Kies, dann taucht Taylor Riley auf seinem Skateboard auf und sieht viel größer aus als früher. Er sagt nichts. Meine Schuhe wirbeln Staub auf. Er überholt mich, dann wartet er darauf, dass ich ihn einhole. Das macht er immer wieder, schweigt und schaut mich nicht an.
Sein Haar ist von der Sonne gebleicht, er ist braun gebrannt und voller Sommersprossen. Er könnte in einer Fernsehserie mitspielen – der beliebteste Junge der Schule, der sich seiner Vollkommenheit gar nicht bewusst ist. Im Fernsehen würde er das Skateboard gegen ein Fußballtrikot eintauschen. Statt herumzusitzen und gelangweilt aus der Wäsche zu kucken, würde er Trophäen sammeln. Er käme in einem teuren Auto und mit einer lächelnden Schönheit auf dem Beifahrersitz zur Schule und würde nicht auf dem Trampelpfad neben einem schweigenden Mädchen herfahren.
Hinter der nächsten Ecke fahren alle auf den Parkplatz der Highschool. Ich möchte umkehren und nach Hause rennen.
»Das mit Ingrid tut mir leid«, sagt Taylor.
Automatisch antworte ich: »Danke.«
Ein Auto nach dem anderen fährt an uns vorbei und biegt auf den Parkplatz ein. Alle Mädchen kreischen und umarmen sich, als hätten sie sich seit Jahren nicht gesehen. Die Jungs hauen sich zur Begrüßung gegenseitig die Pranken auf die Rücken. Ich versuche, nicht hinzusehen. Taylor und ich stehen uns gegenüber, wir sehen auf sein Skateboard runter. Eine Autotür knallt zu. Schritte. Alicia McIntosh kommt mit weitausgebreiteten Armen auf mich zu.
»Caitlin«, flüstert sie.
Ihr blumiges Parfüm ist mir zu viel. Ich kämpfe gegen ein Würgen an.
Sie macht einen Schritt zurück und hält mich dabei an den Ellbogen fest. Sie trägt enge Jeans und ein gelbes Tanktop, auf ihrer Brust steht in blauen Pailletten QUEEN. Die offenen roten Haare fallen ihr bis auf die Schultern.
»Du bist so stark«, sagt sie. »Dass du zur Schule kommst! An deiner Stelle würde ich … ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde ich mich immer noch unter der Bettdecke verstecken.«
Sie glotzt mich an, dieser Blick soll wohl bedeutungsschwer sein. Ihre grünen Augen weiten sich noch mehr. In der Theater-AG hat die Lehrerin uns erklärt, wenn man die Augen lange genug aufreißt, fängt man zu heulen an. Ich frage mich, ob Alicia vergessen hat, dass wir zusammen in dieser AG waren. Sie drückt immer noch meine Ellbogen, und endlich kullert ein Tränchen über ihre Sommersprossen.
Alicia, möchte ich sagen. Irgendwann kriegst du bestimmt den Oscar.
Stattdessen sage ich: »Danke.«
Sie nickt, runzelt die Stirn und quetscht sich noch eine letzte Träne ab.
Dann konzentriert sich ihr Blick auf etwas in der Ferne. Ihre Clique kommt auf uns zu. Sie tragen alle Variationen des gleichen Tanktops. PRINCESS, ANGEL, SPOILED. Wahrscheinlich ist Alicia dieses Jahr der Boss. Ich sollte mich freuen, dass ihre Hände nicht länger meine Blutzirkulation unterbrechen.
»Du kommst wegen mir noch zu spät zum Unterricht. Aber bitte denk daran: Falls du was brauchst, kannst du auf mich zählen. Wir haben zwar schon seit längerem nichts mehr zusammen unternommen, aber wir waren mal echt gute Freundinnen. Ich bin für dich da. Tag und Nacht.«
Unvorstellbar, dass ich jemals Alicias Freundin war. Nicht weil wir uns inzwischen völlig auseinanderentwickelt haben, sondern weil ich überhaupt nicht an die Zeit vor der Highschool denken kann, an eine Zeit ohne Fotografieren und Prüfungen und den Druck, aufs richtige College zu kommen.
Eine Zeit vor Ingrid.
Ich kann mich an Alicia als kleines Kind erinnern, wie sie im Sandkasten stand, die Hände in die Hüften gestemmt, und behauptete, sie wäre das letzte Einhorn. Und ich kann mich an ein Mädchen mit braunen Zöpfen und hellen Cordhosen erinnern, das über den Asphalt galoppierte und sich einbildete, es wäre ein Pferd, und ich weiß, dass ich dieses Mädchen war, aber das ist weit weg, als wäre es die Erinnerung einer Fremden.
Alicia drückt meine Ellbogen ein letztes Mal, und dann lässt sie mich frei.
»Taylor«, sagt sie. »Kommst du mit?«
»Klar, gleich.«
»Wir kommen zu spät.«
»Dann geh schon vor.«
Sie verdreht die Augen. Ihre Freundinnen sind da, und sie führt sie zum Englisch-Trakt.
Taylor räuspert sich. Er wirft mir einen kurzen Blick zu, dann schaut er wieder auf sein Skateboard. »Ich hoffe, du findest mich nicht unhöflich oder so, aber … wie hat sie es getan?«
Meine Knie zittern. Wenn ein braunäugiger Mann und eine braunäugige Frau ein Kind bekommen, hat das Kind wahrscheinlich braune Augen.
Der Haupteingang ist vor uns, der Fußballplatz links von uns. Ich stecke die Hand in die Tasche und berühre meinen Stundenplan. Wie in den letzten beiden Jahren habe ich in der ersten Stunde Fotografie. Ich befehle meinen Beinen zu funktionieren, und wunderbarerweise gehorchen sie. Ich trete weg von Taylor und murmele: »Ich muss los.« Im Geiste sehe ich Ms Delani auf mich warten, wie sie bei meinem Hereinkommen von ihrem Stuhl aufsteht und an den anderen Schülern vorbei auf mich zukommt. Bei der Vorstellung, wie sie meinen Arm berührt, werde ich von Erleichterung durchflutet.
3
Ich habe mit Ms Delani nicht gesprochen, seitdem es passiert ist. Vielleicht entschuldigt sie sich bei den anderen und geht mit mir in ihr Büro, wo wir uns hinsetzen und darüber reden, wie beschissen das Leben ist. Sie wird mich nicht fragen, ob mit mir alles in Ordnung ist, weil sie weiß, dass für uns die Frage: Ist alles in Ordnung mit dir?, eine absurde Frage ist. Sie wird die Unterrichtsstunde dazu nutzen, um mit den anderen im Kurs darüber zu reden, wie traurig dieses Schuljahr sein wird.
Sie wird erklären, dass unser erstes Projekt sich mit dem Thema Verlust auseinandersetzen wird, und alle werden wissen, dass meine Fotografie die herzzerreißendste sein wird.
Ich dränge mich mit den anderen durch die Türöffnung. Der Klassenraum ist heller und kälter, als ich ihn in Erinnerung habe. Ms Delani steht an ihrem Pult und sieht so makellos und schön aus wie immer: Sie trägt Hosen mit Bügelfalte und einen ärmellosen schwarzen Pulli. Ingrid und ich haben oft versucht uns vorzustellen, wie sie Alltagsdinge erledigt, den Müll rausbringt oder sich die Achselhöhlen rasiert. Wenn wir allein waren, haben wir sie immer bei ihrem Vornamen genannt. Stell dir Veena vor, sagte Ingrid, in Jogginghosen und einem gammeligen T-Shirt, wie sie mittags um eins total verkatert aufsteht. Ich versuchte mir das vorzustellen, aber es klappte nie, stattdessen sah ich sie in einem Seidenpyjama in einer sonnendurchfluteten Küche Espresso trinken.
Ein paar von den anderen sitzen schon verstreut im Klassenzimmer. Als ich reinkomme, sieht Ms Delani zur Tür, als würde ein Blitz so grell aufleuchten, dass es ihr weh tut. Ich warte eine Sekunde und gebe ihr die Chance, noch mal herzuschauen, aber sie tut es nicht. Vielleicht erwartet sie, dass ich zu ihr hingehe? Jetzt drängeln die Nächsten hinter mir, deshalb gehe ich ein paar Schritte in ihre Richtung und bleibe vorn bei den Bücherregalen stehen, während ich überlege, wie ich mich verhalten soll.
Sie hat mich ganz bestimmt gesehen.
Die anderen strömen jetzt an mir vorbei, und Ms Delani begrüßt sie und lächelt und tut so, als gäbe es mich nicht, obwohl ich fast vor ihr stehe. Ich habe keine Ahnung, was gerade geschieht, aber mir ist, als würde ich mitten in dem Pulk ertrinken, deshalb stelle ich mich direkt vor sie hin und weiche nicht von der Stelle.
»Hi«, sage ich.
Sie schaut mich mit ihren dunklen Augen durch die Gläser in dem roten Brillengestell an.
»Schön, dass du wieder da bist.«
Aber sie hört sich gleichgültig an, als wäre ich eine, die sie nur flüchtig kennt.
Ich stolpere zu dem Tisch, an dem ich im letzten Jahr gesessen habe, schlage mein Heft auf und tu so, als würde ich etwas lesen. Vielleicht wartet sie, bis alle sich hingesetzt haben und die Stunde offiziell beginnt, bevor sie etwas über Ingrid sagt. Die Letzten kommen herein, und ich lasse mir den Schmerz nicht anmerken, Ingrids früherer Platz neben mir bleibt leer.
Es klingelt.
Ms Delani lässt ihre Blicke durch die Klasse wandern. Ich warte darauf, dass sie mich ansieht, dass sie lächelt oder nickt oder irgendwas tut, aber anscheinend endet der Raum kurz vor meinem Platz. Sie lächelt alle anderen an, aber ich existiere nicht. Offensichtlich will sie mich nicht hierhaben, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich könnte meine Sachen zusammenpacken und hinausgehen, aber ich wüsste nicht, wohin. Am liebsten würde ich unter den Tisch kriechen und mich dort verstecken, bis alle wieder weg sind.
An den Wänden hängen die Fotos vom letzten Projekt des vergangenen Schuljahrs. Ingrid ist die Einzige, von der drei Fotos aufgehängt wurden. Sie hängen nebeneinander vorn im Klassenraum, genau in der Mitte. Eine Landschaftsaufnahme – zwei von Geröll bedeckte und von Dornensträuchern überwucherte Hügel, zwischen denen sich ein Bach hindurchschlängelt. Ein Stillleben von einer Vase mit Sprung. Und ein Porträt von mir. Die Beleuchtung ist ziemlich grell, und ich habe einen seltsamen Gesichtsausdruck, fast eine Grimasse. Ich blicke nicht in die Kamera. Als Ingrid in der Dunkelkammer den ersten Abzug davon gemacht hatte, sind wir einen Schritt zurückgetreten und haben zugesehen, wie mein Gesicht auf dem nassen Papier Konturen annahm, und Ingrid sagte: Das bist du, das bist genau du. Und ich sagte: Meine Güte, ja, stimmt, obwohl ich mich kaum erkannte.
Ich verfolgte, wie sich unter meinen Augen Schatten bildeten, wie eine mir unbekannte Kurve an meinem Mundwinkel dunkler wurde. Es war eine härtere Version von mir, eine mutigere Version. Dann starrte ich auf ein Gesicht, das mir total unbekannt war, überhaupt nicht das Mädchen, das in einem reichen Vorort von San Francisco bei liebenden Eltern aufwächst und sogar ein eigenes Badezimmer hat.
Vielleicht war es eine Vorahnung oder so was Ähnliches, denn wenn ich es jetzt betrachte, hat es doch viel Ähnlichkeit mit mir.
Zunächst kann ich keines meiner eigenen Fotos entdecken, aber dann erkenne ich eins. Ms Delani muss es verabscheuen, weil sie es in der einzigen dunklen Ecke des Klassenraums aufgehängt hat, über einem Heizkörper, der vor der Wand steht und die Sicht auf einen Teil des Fotos versperrt.
Ingrid war unglaublich gut in Kunst – sie konnte alles zeichnen und malen, und das sah dann oft besser aus als in Wirklichkeit –, aber ich hatte gedacht, in Fotografie wären wir beide gut gewesen.
Als ich das Foto machte, war ich mir ganz sicher, dass es unglaublich gut würde. Ingrid und ich waren mit der Bahn zu ihrem älteren Bruder gefahren, der in San Francisco lebt. Es war eine lange Fahrt, weil wir so weit draußen in einem Vorort wohnen. Als wir durch Oakland fuhren, gab es irgendeine Verzögerung, und unser Zug hielt mitten auf der Strecke. Die Lok brummte nicht mehr. Die Leute rutschten auf ihren Sitzplätzen rum und richteten sich auf eine längere Wartezeit ein. Ich sah aus dem Fenster über die Autobahn zum Himmel, der unglaublich blau über traurigen, verwohnten Häusern und verwitterten Fabrikgebäuden leuchtete. Ich machte das Foto. Aber wahrscheinlich waren die Farben das Schönste. In Schwarzweiß sieht es nur traurig aus, und Ms Delani hat wahrscheinlich recht – wer will sich so was schon ankucken? Trotzdem ist es schrecklich peinlich, dass es nun in einer düsteren Ecke hängt. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich es heimlich dort verschwinden lassen kann.
Von der ersten Minute bis zum Ende der Stunde lächelt Ms Delani, während sie von den hohen Erwartungen spricht, die sie an ihre fortgeschrittenen Schüler stellt. Sie lächelt so sehr, dass ihr die Wangen weh tun müssen. Die alte Wanduhr hinter mit tickt ganz langsam. Ich starre sie an und wünsche mir, die Stunde wäre vorbei. Dabei fallen mir die Regalfächer auf. Ich bin im letzten Schuljahr nicht dazu gekommen, mein Fach zu leeren, weil ich in der letzten Woche gefehlt habe.
Ms Delani schreibt zur Wiederholung Begriffe an die Tafel – Blende, Belichtungsmesser, Belichtungszeit.
Ich werde unruhig bei dem Gedanken an all das, was noch in meinem Fach liegt. Ich weiß, es sind alte Fotos, und es könnten auch ein paar von Ingrid dabei sein. Ich sehe wieder auf die Uhr, doch der Minutenzeiger hat sich kaum bewegt. Ich sollte warten, bis die Stunde vorbei ist, aber im Augenblick ist mir Höflichkeit ziemlich egal. Ms Delani ist ja auch nicht höflich. Deshalb rutsche ich mit meinem Stuhl nach hinten und kümmere mich nicht um das Quietschen auf dem Linoleum. Dann stehe ich auf. Ein paar Leute drehen sich um und wollen wissen, was los ist, aber als sie sehen, dass ich es bin, schauen sie schnell wieder nach vorn, als ob Blickkontakt tödlich wäre. Ms Delani redet weiter, als wäre nichts geschehen, und ignoriert total, dass Ingrid nicht hier ist. Sie hält nicht mal inne, als ich zu meinem Fach gehe und die Fotos heraushole. Weil ich mich so mutig fühle, kehre ich nicht sofort zu meinem Platz zurück. Stattdessen nehme ich mir alle Zeit der Welt und blättere den Stapel Fotos durch. Tatsächlich sind ein paar von Ingrid dabei, Aufnahmen, von denen ich Abzüge wollte, und ich suche so lange, bis ich mein Lieblingsbild gefunden habe – ein grasbewachsener Abhang mit kleinen Wildblumen vor blauem Himmel. Es ist bestimmt das friedlichste Foto der Welt. Es ist eine Märchenkulisse, es ist ein Ort, den es nicht mehr gibt.
Mit all diesen Fotos aus meinem alten Leben in den Händen drehe ich mich um und will auf einmal nur noch schreien. Ich sehe mich schreien, so laut schreien, dass Ms Delanis perfekte Brille zersplittert, alle Fotos von den Wänden fallen und alle im Klassenraum taub werden. Dann müsste sie mich endlich anschauen.
Stattdessen gehe ich zu meinem Platz und lege den Kopf auf die kalte Tischplatte.
Als es klingelt, stehen alle auf und gehen. Ms Delani verabschiedet sich von einigen, aber nicht von mir, weil ich ja unsichtbar bin.
4
Heute Morgen muss ich an unser Freshman-Jahr denken, das erste Jahr auf der Highschool. Erste Stunde. Ich saß neben einem Mädchen, das ich noch nie gesehen hatte. Sie zeichnete lauter Schnörkel in ihr Heft.
Als ich mich neben sie setzte, sah sie kurz zu mir rüber und lächelte. Mir gefielen ihre Ohrringe. Sie waren rot und sahen aus wie Knöpfe.
Den Morgen hatten wir zusammengepfercht in der Turnhalle verbracht und uns Direktor Nelsons aufmunternde Rede angehört. MrNelson hat ein rundes Gesicht, einen kleinen Mund und runde Kulleraugen. Er hat schütteres Haar, und diese letzten paar Strähnen waren ganz zerzaust. Wenn ein Mensch wie eine Eule aussehen kann, dann er.
Ich hatte mich in der riesengroßen Turnhalle verloren gefühlt, sogar meine früheren Schulkameraden hatten wie Fremde ausgesehen. Später saßen wir im Fotografiekurs, und obwohl ich noch nie richtig fotografiert und kaum Ahnung von Kunst hatte, fühlte ich mich im Fachraum von Ms Delani viel wohler als in der Halle. Sie rief die Namen von ihrer Liste auf, machte sich Notizen und brauchte unendlich lange dafür. Das Mädchen neben mir riss eine Seite aus ihrem Heft und schrieb etwas darauf. Sie schob den Zettel zu mir rüber. Vier Jahre immer solche Scheiße? Der Herr möge uns davor bewahren.
Ich schnappte mir ihren Stift und suchte nach einer coolen Antwort. Plötzlich ein neuer Mensch. Mutiger. Ich trug Glasarmreifen, die bei jeder Armbewegung klirrten.
Ich schrieb: Wenn du mit irgendeinem Typen von der Schule knutschen müsstest, wen würdest du dir aussuchen?
Sie schrieb sofort zurück: Direktor Nelson, natürlich. Er ist ja so ein Süßer!
Als ich das las, musste ich lachen. Ich versuchte, das Geräusch in ein Husten zu verwandeln, und Ms Delani sah von ihrer Liste auf, um uns mitzuteilen, dass wir ihrer Meinung nach alle erwachsen wären und nicht um Erlaubnis bitten müssten, wenn wir rauswollten, um einen Schluck zu trinken oder aufs Klo zu gehen.
Also tat ich es.
Ich verließ den Raum und spürte, wie glatt mein Haar war, wie toll meine Hose saß und wie hübsch meine Armreifen klirrten. Ich beugte mich über den Trinkbrunnen, trank das kühle Wasser, und es fühlte sich an wie: Das ist es! Mein Leben fängt an. Und als ich wieder zu meinem Platz ging, stand da auf dem Zettel: Ich bin Ingrid.
Ich bin Caitlin, schrieb ich zurück.
Danach waren wir Freundinnen. So einfach war das.
5
In der letzten Stunde habe ich Englisch bei MrRobertson. Als ich hereinkomme, glotzt er mich nicht blöd an, sondern nickt mir zu, lächelt und sagt: »Schön, dass du wieder da bist, Caitlin.«
Henry Lucas, wahrscheinlich der beliebteste Junge unseres Jahrgangs und deshalb wahrscheinlich der fieseste, sitzt in der hintersten Ecke und tut so, als sähe er die beiden Mädels aus Alicias Clique nicht. ANGEL fährt ihm mit rosalackierten Fingernägeln durch die schwarzen Haare, und SPOILED sagt: »Du schmeißt also Freitag eine Party, ja?«
Henry gibt dauernd Partys, weil seinen Eltern eine Immobilienfirma gehört und sie ständig verreist sind, auf Kongressen reden und immer reicher werden. Wenn sie mal hier sind, organisieren sie Wohltätigkeitsveranstaltungen, die meine Eltern meiden. Ihre Gesichter sieht man immer am Schwarzen Brett und auf dem Briefkopf vom Elternverein – seine Mutter in ihren gutsitzenden schwarzen Kostümen und sein Vater mit Golfschlägern und einem selbstgefälligen Grinsen.
Jetzt zupft auch SPOILED an Henrys Haaren herum. Henry starrt genervt geradeaus, aber er sagt ihnen nicht, dass sie aufhören sollen. Ich suche mir einen Platz auf der anderen Seite des Fachraums, vorn bei der Tür.
MrRobertson geht die Anwesenheitsliste durch.
»Matthew Livingston?«
»Hier.«
»Valerie Watson?«
»Anwesend!«, zwitschert ANGEL.
»Dylan Schuster?«
Diesen Namen kenne ich nicht. Niemand antwortet. MrRobertson sieht auf.
»Kein Dylan Schuster?«
Die Tür vor mir öffnet sich, und ein Mädchen streckt den Kopf rein. Ich habe sie noch nie gesehen, und in dieser ziemlich kleinen Schule kennt jeder jeden. Ihre Haare sind dunkelbraun, fast schwarz, und zerzaust, viel zerzauster als der Wuschellook, den manche Mädchen toll finden. Sie sieht aus, als stünde sie unter Strom. Schwarzer Eyeliner umrahmt verschmiert ihre Augen, die den Raum scannen. Sie sieht aus wie jemand, der nicht weiß, ob er reinkommen soll oder draußen bleiben will.
»Dylan Schuster?«, fragt MrRobertson noch einmal in den Raum.
Die Neue sieht ihn mit weitaufgerissenen Augen an.
»Mann!«, sagt sie. »Sie sind echt gut.«
Er lacht, und sie schlendert herein, mit einer Messenger-Bag über der Schulter und einem Becher Kaffee in der Hand. Ihr T-Shirt ist an einer Seite zerrissen und wird von Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Ihre Jeans sind die engsten, die ich jemals gesehen habe, und sie ist unglaublich lang und dünn. Ihre Stiefel bummern zwischen den Tischen durch, bis in die letzte Reihe. Ich drehe mich nicht um, weil ich sie nicht angaffen will, ich stelle mir nur vor, wie sie in die hinterste Ecke geht und sich auf den Stuhl lümmelt.
Als MrRobertson mit seiner Liste fertig ist, geht er zwischen den Tischreihen auf und ab und erzählt uns, was wir in diesem Jahr alles durchnehmen werden.
6
Ich bin allein im Trakt, wo die Naturwissenschaftsräume sind, stehe auf dem abgetretenen Fußboden und atme die muffige Luft ein. Die Spinde bei den Englischräumen sind wie üblich von Taylor und den übrigen Stars unserer Schule belegt.
Letztes Jahr hatten Ingrid und ich uns für Spinde im Fremdsprachenflur entschieden, direkt neben den Englischräumen, zwar noch sichtbar, aber weit genug von den Strebern weg. Niemand sucht sich einen Spind im Naturwissenschaftstrakt. Der ist weg von allem – außer von den Naturwissenschaften –, auf dem sozialen Radar quasi nicht vorhanden. Ich wünschte, er würde ewig so leer bleiben.
Es fühlt sich falsch an, einen Spind zu besetzen, wenn man nichts zum Wegschließen hat. Ich überlege, ob ich mit der Spindwahl so lange warten soll, bis ich irgendetwas habe, das lohnt, weggeschlossen zu werden – aber der hier ist wirklich gut: Es ist der nördlichste Spind im nördlichsten Gebäude der Vista Highschool. Wenn ich hier durch die Tür ginge, würde ich auf dem Gehweg stehen. Wenn ich die Straße überqueren würde, wäre ich von hier verschwunden. Vielleicht ist die Möglichkeit, jederzeit abhauen zu können, der Grund, weshalb dies für mich der perfekte Spind ist.
Ich habe kein Klebeband dabei, deshalb beiße ich die Hälfte von meinem Kaugummi ab und klebe ihn auf die Rückseite von Ingrids Hügelfoto. Im Spind hängt ein blinder, verkratzter rechteckiger Spiegel. Ich vermeide sorgfältig jeden Blickkontakt mit mir, aber aus den Augenwinkeln sehe ich glatte braune Haare und ein paar Sommersprossen. Mein Gesicht ist undeutlicher und schmaler als früher. Ich drücke das Foto auf den Spiegel und bin verschwunden. Übrig bleibt nur der hübsche, stille Ort.
Jemand lehnt sich gegen den Nachbarspind. Dylan. Aus der Nähe sehen ihre Haare noch verstrubbelter aus, einzelne Strähnen umrahmen wie Stacheln ihr Gesicht.
»Hey«, sagt sie.
»Hi.«
Sie schaut mich so lange an, dass ich mich schon frage, ob mit meinem Aussehen etwas nicht stimmt, ob ich einen Tintenfleck auf der Stirn habe oder so. Dann grinst sie mich an, mit einem etwas rätselhaften Lächeln. Sie wirkt irgendwie belustigt, aber nicht überheblich. Bevor sie geht, wühlt sie in ihrer Tasche herum und lässt ihr Vorhängeschloss mit einem Knall an dem leeren Spind neben meinem einrasten. Sie stiefelt davon, und ich bin wieder allein. Langsam schließe ich die Tür, die Scharniere quietschen. Als ich das Schloss zuschnappen lasse, verkündet ein leiser, deutlich hörbarer Klick: Das ist mein Spind.