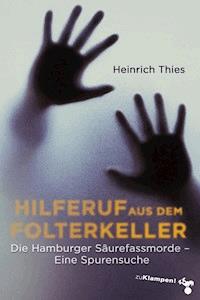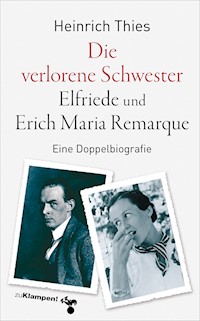10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leuchten über der Heide.
1943: In den Wirren des Krieges wächst die Bäuerin Hanna über sich hinaus. Als ihr Bruder Franz eingezogen wird, führt sie den Hof allein weiter – unterstützt von dem französischen Kriegsgefangenen Robert. Trotz aller Widerstände verlieben sich die beiden ineinander. Alma wird schwanger und damit im Dorf noch mehr zur Außenseiterin. Als der Krieg vorbei ist, kehrt Robert nach Frankreich zurück. Alma führt ihren Hof auch allein durch die Nachkriegszeit – bis ihr Bruder heimkehrt und sie wieder in den Hintergrund drängt. Doch damit will sie sich nicht mehr abfinden ...
Die berührende Geschichte einer unangepassten Frau und ihrer verbotenen Liebe – basierend auf der Familiengeschichte des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Als der Zweite Weltkrieg die Lüneburger Heide erreicht und Almas Bruder eingezogen wird, stehen der Bäuerin drei Kriegsgefangene zur Seite, darunter der Franzose Robert. Er verliebt sich in Alma, und bald erwartet sie ein Kind von ihm. Mit dem Ende des Krieges kehrt Robert nach Frankreich zurück, und Almas Bruder kommt aus der französischen Kriegsgefangenschaft nach Hause. Er beansprucht den Hof wieder für sich, doch so leicht lässt Alma sich nicht mehr in ihre alte Rolle zurückdrängen – und insgeheim hofft sie, dass Robert den Weg zu ihr zurückfindet. Aber dann hält das Leben eine Überraschung für sie bereit.
Über Heinrich Thies
Heinrich Thies, geboren 1953 als Bauernsohn in Hademstorf in der Lüneburger Heide, studierte Germanistik, Politik, Philosophie und Journalistik, war von 1989 bis 2015 Redakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und trat als Autor von Biographien, Romanen, Sach- und Kinderbüchern hervor. 1991 wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet.
Im Aufbau Taschenbuch liegt ebenfalls sein Buch „Die verlorene Schwester – Elfriede und Erich Maria Remarque. Die Doppelbiographie“ vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Heinrich Thies
Alma und der Gesang der Wolken
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil I — Die Heide im Krieg
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Teil II — Danach
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Teil III — Amerika
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Teil IV — Das Wiedersehen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Nachwort
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Prolog
Die Insel verlor sich im Dunst. Die Dünen waren nur noch zu erahnen. Der Strand von Langeoog war das Letzte, was sie erkennen konnte. Dann war dieser Streifen Deutschland nur noch eine ferne Nebelbank am Horizont. So unwirklich wie die anderen ostfriesischen Inseln, an denen das Schiff schon vorbeigezogen war: Wangerooge mit seinem hohen Westturm, Spiekeroog und eben jetzt Langeoog. Sie kannte die Namen noch aus dem Erdkundeunterricht. Nun steuerte das Schiff auf für sie unbekannte Gestade zu, pflügte durch die hohen Nordseewellen, nahm Kurs auf den Ärmelkanal, auf den Nordatlantik, auf Amerika, New York. Ein Ort, der ihr so fremd war wie der Mond.
Das ganze Deck vibrierte, so dass sich die Vibrationen auf ihren Körper übertrugen und sie in ein beständiges Beben versetzten. Schwerölgeruch stieg ihr in die Nase. Die salzige Nordseeluft mischte sich mit Abgaswolken, die zu ihr von den Turbinen herüberwehten.
Nicht mehr viele standen mit ihr auf der Backbordseite des Achterdecks, um noch einen letzten Blick auf die Heimat zu erhaschen. Die meisten waren schon dabei, das große Schiff zu erkunden.
Dicht neben ihr stand ein junger Mann in Zimmermannskluft an der Reling, der ihr schon am Kai aufgefallen war. Der großgewachsene stämmige Kerl hatte außergewöhnlich viel gelacht, während er sich von seinen Eltern und Freunden, mit Umarmungen und Schulterklopfen verabschiedet hatte. Geradezu übermütig war ihr der Mann vorgekommen mit seinem Lachen inmitten der zumeist bedrückten Menschen in den letzten Minuten des Abschieds. Jetzt wirkte er vollkommen still, geradezu in sich versunken unter dem großen Hut, den er tief ins Gesicht gezogen hatte. Was wohl in ihm vorging?
Die Frage lenkte sie ein wenig ab von ihren eigenen Gefühlen, von dem Tosen in ihrem Innern, das sich in erträglichen Momenten aufzulösen schien in das Schwanken, bisweilen auch sanfte Wiegen des Schiffes. Dann wieder fragte sie sich, was sie auf diesem Schiff überhaupt verloren habe. Warum sie ihrem bisherigen Leben Adieu gesagt hatte und nach neuen Ufern strebte. Warum sie sich in dieses Abenteuer des Ungewissen stürzte, das ihr vor allem Angst machte. Unsagbare Angst, die ihr die Kehle zuschnürte. Am liebsten wäre sie über Bord gesprungen und zurückgeschwommen. Aber sie konnte ja nicht mal schwimmen.
So klammerte sie sich an ihre Handtasche, griff nach dem Hut, der ihr immer vom Kopf zu wehen drohte, und starrte in Richtung Heimat, von der sie sich gerade entfernte. Wie durch einen Nebel drangen die Lautsprecherdurchsagen zu ihr vor, die auf die verschiedenen Orientierungspunkte hingewiesen hatten: den Leuchtturm Roter Sand, den Übergang von der Außenweser in die Nordsee.
Die Strahlen der späten Oktobersonne glitzerten auf den Wellen. Bald schon würde die Sonne untergehen und das Wasser in die schönsten Rot- und Goldtöne tauchen. Das wollte sie auf jeden Fall noch abwarten. Sie beugte sich über die Reling und blickte in das aufgewühlte Wasser.
Als sie sich aufrichtete, fiel ihr Blick wieder auf den Zimmermann neben ihr. Jetzt bemerkte sie, dass er am ganzen Körper zuckte, als würde er gegen einen Krampf ankämpfen. Mit der einen Hand hielt er sich den Hut, mit der anderen wischte er sich etwas aus dem Gesicht. Tränen vermutlich. Kein Zweifel: Der Mann, der sich am Kai noch so stark und gutgelaunt gegeben hatte, weinte – weinte zitternd in sich hinein. Es war, als hätten sich alle Schleusen in ihm geöffnet. Wie zum Hohn gackerten die Möwen, die das Schiff begleiteten.
Am liebsten hätte sie dem Mann eine Hand auf die Schulter gelegt, aber es war nicht zu übersehen, dass er sich seiner Tränen schämte. So tat sie, als gäbe es den Kerl mit seinem Abschiedsschmerz gar nicht, und irgendwie erfüllte sie die Hoffnung, dass es gut für ihn war, endlich seinen Tränen freien Lauf zu lassen. Bald schon, davon war sie überzeugt, bald würde die Welt für den Jungen wieder in fröhlichen Farben leuchten. Wie ein Sommerhimmel nach einem Gewitter. Vielleicht würde es bei ihr selbst ja ähnlich sein. Plötzlich konnte sie wie innerlich gestärkt durchatmen.
Ein langgezogenes Tuten riss sie aus ihren Grübeleien. Als sie aufblickte, sah sie, dass in nicht allzu weiter Ferne ein großer Frachter vorbeizog, offenbar in entgegengesetzter Richtung auf dem Weg zu einem deutschen Hafen. Das Passagierschiff erwiderte den Gruß mit einem noch lauteren Hornsignal, das jetzt auch den Zimmermann aus seiner Versenkung riss. Nachdem er sich mit dem Handrücken über die Wangen gewischt hatte, blickte er nun sogar in Almas Richtung, und blinzelte mit tapferem Lächeln die letzten Tränen weg. »Tut-tuuut«, wiederholte er. »So begrüßen sich alte Pötte auf großer Fahrt.«
»Das können wir auch«, erwiderte sie keck. »Ich bin Alma. Und wer bist du?«
Teil I
Die Heide im Krieg
April 1943 – April 1945
1. Kapitel
Irgendwo tief im Dorf krähte ein Hahn, die ersten Vögel stimmten ihren Morgengesang an. Es war noch dunkel, als er den Kuhstall ansteuerte. Müde, aber zielstrebig ging er seinen gewohnten Gang, zog die Streichhölzer aus der Hosentasche und zündete die Petroleumlampe an. Doch viel heller wurde es nicht. Immerhin konnte er erkennen, wie die Kühe schlaftrunken die Köpfe reckten. Die wussten, dass es zu fressen gab. Schrot und Heu. Wie jeden Morgen. Sie schnauften, zerrten an ihren Ketten, ruckelten an den Stangen, erhoben sich schwerfällig von ihrem Strohlager und begannen ungeduldig zu muhen. Franz Wiese enttäuschte seine sieben Schwarzbunten nicht. Er schüttete ihnen Schrot in die langgezogenen Tröge, holte mit der Schubkarre Heu aus der Scheune und verteilte es in der jetzt schon blankgeleckten Futterrinne. Auch die Rinder in den Nachbarställen vergaß er nicht.
Friedliches Wiederkäuen vereinte das Vieh, während die Hühner von ihrem Zwischenboden herabtrippelten, die Schwarzdrossel zu flöten begann und der Morgen graute.
Oft schon war er dieser Arbeit nachgegangen, eine Ewigkeit, wie es schien; mit traumwandlerischer Selbstverständlichkeit. Das morgendliche Füttern hatte ihm immer ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt, innere Ruhe.
An diesem Montagmorgen war er davon weit entfernt. Ein beständiges Beben durchrieselte seinen Körper, Unruhe und Abschiedsschmerz wühlten in seinen Gedärmen. Ihm war, als sähe er sich zu bei der Arbeit; er meinte, selbst die Kühe würden ihn mit ihren großen Augen anglotzen, ihn anders betrachten als sonst – irgendwie mitleidig, schwermütig.
Er selbst starrte meist ins Leere, so dass er die Katze übersah, die seinen Weg kreuzte, und stolperte. Fluchend stand er gleich wieder auf und schleppte sich weiter.
Es war der 19. April 1943, der Beginn der Karwoche. Es war aber auch der Tag, an dem er einrücken musste. Schon um acht Uhr ging der Zug, der ihn nach Celle befördern sollte – zu seiner Ausbildungseinheit beim Grenadier-Ersatzbataillon 590 in der Heidekaserne, seiner Stammkompanie. In den nächsten Wochen sollte er dort schießen, kämpfen, kriechen, marschieren und das ABC der Kriegsführung lernen, und dann – dann würde es ernst werden, richtig ernst, dann ging es an die Front, wo die auch immer sein mochte. Der Krieg hatte sich mittlerweile von der Sahara bis zum Nordkap ausgeweitet und den ganzen Globus mit seinen Blutlinien und Schlachtfeldern überzogen.
Mit Bangen hatte er in den vergangenen Wochen verfolgt, wie die Stimmung umschlug. Obwohl die Zeitungen immer noch Siege bejubelten und Parolen der Zuversicht nachbeteten, war zwischen den Zeilen zu lesen, dass die deutschen Truppen plötzlich von allen Seiten unter Beschuss gerieten. Der Russland-Feldzug war gestoppt, Zehntausende hatten schon in der Schlacht um Stalingrad ihr Leben verloren, und von Frankreich her griffen die Amerikaner in den Krieg ein. Mütter und Väter weinten um ihre Söhne, Ehefrauen um ihre Männer, und über vielen Familien lastete die Ungewissheit, was aus vermissten Angehörigen geworden war.
Von seinem Bruder Karl hatte er schon seit zwölf Wochen keine Nachricht mehr erhalten. Keine Karte, keinen Feldpostbrief. Da auch Karl am Russlandfeldzug teilgenommen hatte, musste mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Dabei war er noch so jung – erst neunzehn war er gewesen, als sie ihn im September 1939 eingezogen hatten. Eine Frohnatur mit den besten Aussichten: klug, witzig, gut aussehend und, anders als sein älterer Bruder Franz, gesellig und trinkfest. Und weil er Pferde liebte und gut reiten konnte, hatte er sich beim Celler Landgestüt beworben – und war genommen worden. Als Reiter bei der Hengstparade! Franz und seine Schwestern waren stolz auf ihn. In den zurückliegenden Wochen dagegen hatten sie gefürchtet, dass sie wie schon andere im Dorf auch so eine Nachricht bekommen würden, in der von »Heldentod« und »Vaterland« die Rede war. Das zumindest war ihnen noch erspart geblieben. Jeden Tag, wenn die Briefträgerin kam, hofften sie, dass doch noch endlich eine Karte oder ein Brief von Karl dabei sein würde. Aber sie hofften vergebens.
Schon im Ersten Weltkrieg hatte es die Wieses hart getroffen. Gleich zwei Söhne hatten auf den Schlachtfeldern Flanderns und Frankreichs den Tod gefunden: Wilhelm und Heinrich – beide älter als Franz, dem damit das Hoferbe zugefallen war. Mit auf dem Hof lebte zwar seine zwei Jahre jüngere Schwester Alma, aber die war eben jünger und kam als Frau sowieso nicht infrage.
Seine Mutter Margarete Luise war schon vor vierzehn Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, sein Vater Heinrich Karl zwei Jahre später – beim Holzhacken hatte er sich mit der Axt ins Bein gehauen, die Wunde war vereitert und hatte eine Blutvergiftung nach sich gezogen. Nur sechsundsechzig Jahre alt war Heinrich Karl Wiese geworden.
Nach dem frühen Tod seiner Eltern hatte Franz Wiese schon mit fünfundzwanzig den Hof übernehmen müssen, als Vertreter des Reichsnährstandes, wie das inzwischen hieß. Darum hatte er gehofft, vom Wehrdienst befreit zu werden – schließlich hatten ja schon zwei seiner Brüder ihr Leben dem Vaterland geopfert, und der Jüngste war vielleicht auch bereits tot. Aber je mehr Menschenleben der Krieg fraß, desto größer wurde der Bedarf an menschlichem Nachschub. Da war es egal, ob einer Bauer war oder Baumeister.
Ob er seine Mundharmonika mitnehmen konnte? Vielleicht ein kleiner Trost, wenn er in der Fremde die vertrauten Lieder darauf spielte. Aber wahrscheinlich würde er sich bei den Kameraden nur lächerlich machen.
Als er aus dem Kuhstall ins Freie trottete, sah er, wie eine Taube mit dünnen Zweigen im Schnabel in Richtung Scheune flog. Wahrscheinlich würde die wieder versuchen, auf einem der vorstehenden Dachbalken ein Nest zu bauen, obwohl ihr das schon etliche Male misslungen war. Aber Tauben waren einfach zu blöde – unbelehrbar, dumm und hässlich. Nur alles vollscheißen konnten sie. Eigentlich gar keine richtigen Vögel, dieses ewige Gurren konnte man ja wohl nicht als Singen bezeichnen. Rucke di gu, Rucke di gu, Blut ist im Schuh, Blut ist im Schuh. Dabei hatte so eine Taube mit Ölzweig im Schnabel Noah einst auf seiner Arche angekündigt, dass die Sintflut überstanden war. Aber das hier war keine Friedenstaube, und Land war noch lange nicht in Sicht.
Zu allem Überfluss trippelte eine zweite über den Scheunenvorplatz und machte in einem fort ruckartige Kopfbewegungen, so sinnlos hektisch, als hätte sie den Rest ihres Verstands verloren. Aber was gingen ihn diese komischen Tauben an? Bald würden ihm Bomben um die Ohren fliegen.
Er starrte auf das Leichentuch des trüben Morgenhimmels und atmete tief ein, um wieder zur Ruhe zu kommen. Aber er spürte, dass er zitterte.
Als er in die große Küche kam, hatte Alma den Kaffee, natürlich Muckefuck, schon gekocht und den Frühstückstisch gedeckt. Auch für die beiden Kriegsgefangenen, den Franzosen Robert und den Russen Alexei, der strenggenommen kein Kriegsgefangener, sondern ein sogenannter Ostarbeiter war. Alexei, der auf dem Wiese-Hof der Einfachheit halber Alex genannt wurde, war wie so viele seiner Landsleute während des Russlands-Feldzugs als Zivilist von den Deutschen gefangen genommen und zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert worden. Im Unterschied zu den echten Kriegsgefangenen durfte er darum auf dem Hof übernachten. Im alltäglichen Sprachgebrauch spielten solche Feinheiten aber keine Rolle. Auch über manche Vorschriften setzte man sich bei den Wieses großzügig hinweg. Alex und Robert saßen zum Beispiel mit an der großen Tafel, obwohl eigentlich vorgeschrieben war, dass Kriegsgefangene und Ostarbeiter an einem gesonderten Tisch zu sitzen hatten – deutlich getrennt von der Bauernfamilie. Aber damit nahm man es nicht so genau. Wenn man zusammen arbeitete, konnte man wohl auch zusammen essen.
Alle blickten mit ernsten Gesichtern auf Franz. Sie spürten, was in dem fast festlich gekleideten Bauern vorging, der sich beim Rasieren offenbar geschnitten hatte, wie ein Pflaster im Gesicht verriet. Das Scharren eines Stuhls nahm sich in der beklemmenden Stille aus wie Donnergrollen.
Alma durchbrach das Schweigen, indem sie einen harten Alltagston anschlug: »Du bist ja wohl mit deinem Anzug nicht im Kuhstall gewesen! Was sollen deine Kameraden denken, wenn du nach Kuhscheiße stinkst?«
»Ist doch egal. Hauptsache die Kühe haben was zu fressen.«
»Die Kühe hätte Alex füttern können. Das muss er jetzt sowieso machen.«
Franz ließ die Bemerkung unbeantwortet und fläzte sich wie üblich ächzend auf seinen Stuhl an der Stirnseite mit Blick auf die Straße. Achtlos schnitt er sich einige Scheiben von der Mettwurst ab und legte sie sich aufs Butterbrot. Alma hatte die Mettwurst eigens für ihn aus dem Räucherschrank geholt. Doch er schmeckte gar nicht, was er kaute. Minutenlang sagte er kein einziges Wort. Aber sein Schweigen sprach Bände.
Stumm stand Alma auf, schob ein Holzscheit in den Herd und rührte mit einem Schürhaken in der aschebedeckten Glut, bis wieder kleine Flammen aufzüngelten.
Plötzlich stand die kleine Marie in der Küche. Der Sechsjährigen, die alle nur Mariechen nannten, war anzusehen, dass sie gerade erst aus dem Bett geklettert war. Sie trug noch ihr Nachtkleid und rieb sich die Augen, bevor sie sich neben ihre Mutter auf den Stuhl setzte.
Alma goss ihr Milch in die Tasse. »Schon utslopen?«
Marie schüttelte gähnend den Kopf. »Ich wollte Onkel Franz Wiedersehen sagen. Der zieht doch heute in den Krieg.«
Niemand lächelte über die Wortwahl. Fast schien es, als würde Franz dem Mädchen die deutlichen Worte übelnehmen.
»Erst mal kommt Onkel Franz zur Ausbildung nach Celle«, entgegnete Alma. »Vielleicht ist der Krieg schon vorbei, wenn er mit der Ausbildung fertig ist.«
»Hoffentlich«, erwiderte Marie. »Aber Ostern darf er bestimmt nach Hause kommen.«
»Mol kieken«, antwortete ihre Mutter nachdenklich. »Is jo nich mehr lang hen.«
Der gusseiserne Wasserkessel auf dem Herd stieß, getrieben von seinem köchelnden Inhalt, heisere Pfeiflaute aus. Es klang wie ein wimmerndes Tier.
Franz versetzte die Vorstellung, die Ostertage in der Kaserne verbringen zu müssen, wieder in dumpfes Brüten. Davor lag aber noch der Karfreitag, und die Leiden Jesu standen ihm in diesen Apriltagen näher als dessen Auferstehung von den Toten.
An diesem 19. April 1943 begann auch die jüdische Festwoche Pessah, gewidmet der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Die Menschen im Warschauer Getto hatten in diesen Tagen wenig Grund zum Feiern. Von den deutschen Besatzern hinter hohen Mauern eingesperrt, drangsaliert und gedemütigt, litten sie Hunger, hausten zerlumpt und zusammengepfercht in viel zu engen Wohnungen. Vor allem aber lebten sie in ständiger Angst, von der SS zusammengetrieben und ins Vernichtungslager Treblinka deportiert zu werden wie viele vor ihnen schon. An diesem Tag hatte die SS das Getto bereits um drei Uhr in der Frühe umstellt, um sechs Uhr marschierten achthundertfünfzig SS-Männer in den jüdischen Wohnbezirk ein, um weitere Bewohner in die Gaskammern zu befördern oder einfach auf der Straße zu ermorden. Aber sie kamen nicht weit. Sie wurden von jüdischen Widerstandskämpfern beschossen – und sie mussten sich zurückziehen. Auch der zweite Versuch der Deutschen, das Lager einzunehmen, scheiterte. Mit Molotowcocktails und nur wenigen Pistolen gelang es den Widerstandskämpfern, die schwer bewaffneten SS-Leute und Wehrmachtssoldaten in die Flucht zu schlagen. Am Abend hissten sie im Getto die polnische Fahne und die Flagge mit dem Davidstern. Am 19. April 1943 begann der verzweifelte Aufstand im Warschauer Getto.
Im Vergleich dazu herrschte in Hademstorf tiefer Frieden. »Gut, dass sie uns wenigstens die Pferde nicht weggenommen haben«, sagte Franz, als wollte er seine trüben Gedanken niederkämpfen.
Tatsächlich hatte ihn die Wehrbereichsverwaltung in der vergangenen Woche aufgefordert, ein, zwei Pferde für den »Heimatdienst« abzutreten. Vor allem ging es wohl um den Transport der vielen russischen Kriegsgefangenen, wie der Bürgermeister gesagt hatte. Aber dagegen hatte Franz sich aufgebäumt, ins Feld geführt, dass ohne seine drei Pferde die Arbeit auf dem Hof nicht zu schaffen sei – wo schon der Bauer fehle. Mit Erfolg.
Eher konnte er sich vorstellen, selbst ein Pferd mitzunehmen, wenn er denn schon einrücken musste. Aber Alma hatte nur den Kopf geschüttelt, als er die Idee geäußert hatte. »Auf deine Ackergäule haben die gerade noch gewartet. Die sind doch gar nicht schussfest.«
Er hing an seinen drei Pferden. Seine Hannoveraner spannte er gelegentlich auch vor die Kutsche, die in der Remise stand. Das schwarz lackierte Gefährt mit den roten Samtpolstern diente bei Beerdigungen im Dorf als Leichenwagen und kam in der Familie bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Taufen oder akuten Krankheitsfällen zu Ehren. Manchmal fuhr Franz damit in den Nachbarort, um Besorgungen zu machen. Gleich beide Hannoveraner spannte er dann vor sein Luxusgefährt, das sogar richtige Glasfenster hatte. Wie ein großer Herr mit prächtiger Kutsche und ebenso prächtig geschirrten Pferden. Mit zwei Pferden! Ja, er war stolz auf seine Rösser, zu denen auch noch ein Norweger gehörte.
Nach dem Frühstück ging er denn auch gleich noch mal in den Pferdestall, um den Tieren Hafer und Heu vorzugeben und sie ein letztes Mal zu striegeln. Ein weiterer stummer Abschied, der ihm die Brust zusammenschnürte. Ihm war, als sähe er all die vertrauten Dinge auf dem Hof zum letzten Mal. Ein Abschied vom Leben.
Mit ihm ging der letzte Wiese-Bauer vom Hof, kein männlicher Hoferbe blieb zurück. Sein altes Bauerngeschlecht war damit dem Untergang geweiht.
Eine halbe Stunde später saß er im Zug, neben sich auf der Holzbank sein abgestoßener Holzkoffer mit Wechselsachen, Rasierzeug und etwas Proviant. Alma hatte ihm Butterbrote geschmiert, eine halbe Mettwurst, eine Flasche Apfelsaft und eine Tüte Kekse mitgegeben. Die »Marschverpflegung« steckte mit seinem Ausweis und dem Einberufungsbefehl in seinem alten Lederbeutel. Der Koffer war noch von seinem Bruder Heinrich, einen eigenen besaß er nicht. Wozu auch? Er war ja bisher nie auf Reisen gegangen. Sein Dorf hatte er nur verlassen, um die Ackerbauschule im achtzehn Kilometer entfernten Walsrode zu besuchen.
Als der Zug über die Allerbrücke ratterte, ließ er seinen Blick über die Marschwiesen schweifen. Wie verödet dösten die unter einem wolkenverhangenen Himmel. Nicht weit entfernt war auch eine seiner Wiesen. Bald kamen die Kühe auf die Weide. Alma würde sie hinaustreiben und unter freiem Himmel melken. Aber wer reparierte die Zäune? Wer mähte das Gras? Die Kriegsgefangenen? Auch die Kartoffeln und Rüben mussten noch gepflanzt werden. Wie das wohl gehen sollte? Immerhin hatte er es noch geschafft, den Sommerroggen zu drillen und Mist und Jauche auszubringen.
Als er in Schwarmstedt umstieg, fiel Sprühregen. Es war mild, etwa zwölf Grad; trotzdem behielt er seinen dunkelgrünen Lodenmantel an.
Ein leicht bekleideter Mann mit Lederkoffer trat auf ihn zu. »Na, auch auf dem Weg an die Front?«
Franz schrak zusammen. »Erst mal nach Celle in die Kaserne.«
Der Mann lächelte. »Da haben wir ja denselben Weg.«
Kurze Zeit später saßen die beiden im Zug, der zwischen Verden und Celle verkehrte. Franz ließ sich von seinem Reisebegleiter ein Zigarillo schenken. Da er das Rauchen nicht gewohnt war, musste er husten, bis ihm Tränen in die Augen traten. Sein Begleiter, der sich als Helmut vorgestellt hatte, klopfte ihm kameradschaftlich auf den Rücken und lachte.
»Wohl nichts Gutes gewöhnt? Immer bloß gearbeitet, was? Da ist es vielleicht ganz gut, dass du mal rauskommst und was anderes siehst.«
»Ick wör leiber tohuus bleeben.«
Ganz unwillkürlich war Franz zum Plattdeutsch übergegangen, zu der Sprache, die ihm vertraut war – die er mit seiner Schwester und fast allen im Dorf sprach. Zu seiner Freude stieg sein Banknachbar darauf ein, wenngleich dessen Plattdeutsch etwas vornehmer klang. Hannöversch. Helmut war Landwirt wie er, und so tauschten sich beide bald über ihre Höfe, die Bodenqualität und die Frühjahrsbestellung aus, als gäbe es gar keinen Krieg.
Der Regen wurde stärker. Die dicken Tropfen schlugen gegen das Zugfenster und liefen in Schlieren herab, so dass die vorbeifliegende Landschaft verschwamm und immer entrückter, geheimnisvoller anmutete – wie auf einem dieser komischen Ölgemälde.
Als sie sich dem Zielort näherten, erzählte Franz von seinem Bruder Karl, der in Celle beim Landgestüt gewesen war und jetzt vielleicht schon im fernen Russland unter der Erde lag.
»Hoffentlich schicken sie uns da nicht auch noch hin.«
Er nickte und starrte seufzend aus dem regenverschleierten Fenster.
Auf einmal verlangsamte der Zug sein Tempo und blieb ruckartig auf offener Strecke stehen. In Windeseile ging ein Wispern durchs Abteil: »Fliegeralarm.«
Wenig später sah Franz auch schon die silbernen Silhouetten der Kampfbomber, die sich dem Zug näherten.
2. Kapitel
Es war warm geworden, richtig heiß. Nur wenige weiße Wolken schwebten vor dem blauen Himmel. Das Thermometer zeigte neunundzwanzig Grad. Dabei war es erst Mitte Mai. Ein Sonnabend. Alma wischte sich den Schweiß von der Stirn, griff in ihren Drahtkorb, um eine weitere Kartoffel einzusetzen. Die schnurgerade Furche, die Alexei gerade mit der Norwegerstute Wilma und dem einscharigen Hunspflug gezogen hatte, schien endlos. Vom ständigen Bücken schmerzte ihr der Rücken, ihre Kehle war wie ausgedörrt, trotzdem war sie zufrieden, fast sogar glücklich. Die Arbeit ging voran. Zwei Felder waren schon mit Kartoffeln bepflanzt; wenn sie mit diesem Acker fertig war, würden alle Kartoffeln in der Erde sein. Es war das erste Mal, dass sie diese schwierige Feldarbeit ohne ihren Bruder bewältigen musste. Aber immerhin hatte Franz ihr in mehreren Briefen von seiner Ausbildungskompanie in Celle geschrieben, was sie zu tun hatte. Zuerst musste der Boden gedüngt werden. Mist hatte er zum Glück noch selbst gestreut, aber auch etwas Kunstdünger musste noch auf den kargen Sandboden. Das hatten die beiden Kriegsgefangenen für sie übernommen, Alex und Robert. Sie hatten die Felder auch noch mal geeggt, wie Franz es verlangt hatte.
Ohne die beiden wäre all das nicht zu schaffen gewesen. Auch Hans, der fünfzehn Jahre als Knecht auf dem Hof gearbeitet hatte, war ja schon eingezogen worden; die älteren Brüder waren gefallen, die andern im Krieg, und Almas Schwester Ida, die früher mitgeholfen hatte, war verheiratet und lebte jetzt mit ihren beiden Töchtern in Stöckse, einem knapp zwanzig Kilometer entfernten Dorf. Ja, der Russe und der Franzose waren für Alma unverzichtbar. Von morgens bis abends standen ihr die beiden zur Seite. Allein hätte sie es nie geschafft, die Ställe auszumisten oder die schweren Kartoffelsäcke aus dem Keller zu schleppen und auf den Ackerwagen zu wuchten. Besonders das Pflügen und Eggen wäre ihr schwergefallen.
Alexei schien es sogar Spaß zu machen, mit den Pferden zu arbeiten. Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, wenn er die Ackergäule striegelte, ihnen auf den Hals klopfte oder Zaumzeug anlegte. Der Russe war neben der Schweineküche in dem früheren Knechtszimmer untergebracht und fütterte auch die Schweine. Der stämmige Bauernsohn kam aus einem Dorf an der Wolga und hatte in einem Kolchosbetrieb gearbeitet. Robert dagegen war eigentlich eher ein Kopfmensch und hatte zwei linke Hände, wie er selbst sagte. Ein Lehrer aus der Bretagne, der mit Ackerbau und Viehzucht vor dem Krieg nicht das Geringste zu tun gehabt hatte. Aber der jungenhafte Franzose ersetzte seine fehlende Erfahrung durch Fleiß und Einfallsreichtum – und er lachte viel und heiterte auch die anderen durch seine Scherze auf. Verteilt auf mehrere Bauernhöfe arbeiteten insgesamt sechzehn französische Kriegsgefangene in Hademstorf in der Landwirtschaft. Abends hatte sich Robert im »Herzog von Celle« einzufinden, der besseren der beiden Hademstorfer Gaststätten. Im Saal war für die französischen Kriegsgefangenen ein Nachtlager eingerichtet worden, das von einem SS-Mann überwacht wurde. Strenggenommen musste Robert spätestens um zweiundzwanzig Uhr dort sein, aber an diesen langen Arbeitstagen im Mai und Juni nahm niemand Anstoß daran, wenn es später wurde. Alma war selig, wenn Robert nach Feierabend noch zur Mundharmonika griff und seine schönen Lieder spielte. Die Mundharmonika gehörte eigentlich Franz, aber die nahm ja keinen Schaden dadurch, dass jemand anders auf ihr blies, außerdem war es seine alte, die er selbst kaum mehr benutzt hatte.
Jetzt schritt Robert wie Alma eine Furche mit einem Drahtkorb ab, um Kartoffeln einzusetzen. Das war zwar eigentlich Frauenarbeit, aber dem Franzosen war das egal. Wegen der Hitze war er nur mit einem Unterhemd bekleidet, so dass Alma sehen konnte, wie sich die Muskeln seiner Oberarme spannten, wenn er von dem Ackerwagen einen weiteren Kartoffelsack hob, um für Nachschub zu sorgen. Wenn er sie mit seinen braunen Augen ansah, ging es ihr durch und durch. Ihr gefiel sein Deutsch mit französischem Zungenschlag, es hörte sich an, als würde er singen. Dass er überhaupt Deutsch sprach, war ja schon was Besonderes.
»Du bist sehr schön. Jolie femme«, hatte er neulich mal gesagt, als er hereingekommen war, während sie im Unterrock vor dem großen Waschbecken in der Küche gestanden und sich eingeseift hatte. Sie hatte ihm mit dem Zeigefinger gedroht, dabei aber gelacht.
»Du bist hier nicht in Frankreich. Und ich weiß, dass ich keine schöne Madame bin. Treib also keine Scherze mit einer Bauersfrau.«
»Kein Scherz«, hatte er geantwortet. »Und du bist auch nicht nur irgendeine Bauersfrau. Du bist schön, Alma. Wie eine kleine Madonna. Und du kannst noch schöner sein, wenn du andere Kleider ausführst.«
»Kleider ausführst! Wie du immer redest. Kleider anziehst, heißt das.«
Eigentlich hätte sie gar nicht so mit dem Franzosen sprechen dürfen. Offiziell war jeder Privatkontakt mit den Kriegsgefangenen untersagt. Wenn es intim wurde, drohten sogar Gefängnisstrafen. Aber wenn man den ganzen Tag miteinander arbeitete, blieb es ja wohl nicht aus, dass man auch mal ein persönliches Wort wechselte, und zu Robert, wie sie den Franzosen in deutscher Aussprache nannte, fühlte sie sich hingezogen, auch wenn ihr klar war, dass sie sein Gerede nicht allzu ernst nehmen durfte. Trotzdem betrachtete sie sich neuerdings öfter im Spiegel und überlegte manchmal schon, ob sie anstelle ihres Dutts nicht lieber Dauerwelle tragen sollte wie die eleganten Frauen im Dorf.
Schminken musste sie sich nicht. Ihr Gesicht war von der Sonne bronzefarben gebräunt, anders als ihre rotgesichtigen Schwestern musste sie keinen Sonnenbrand fürchten. Ihr dunkler Teint, ihre Gesichtszüge, das schwarze Haar verliehen ihr ein fast südländisches Aussehen, so dass sich manch einer im Dorf schon hinter ihrem Rücken gefragt hatte, ob sie wirklich die Tochter von Heidebauern war. Aber im Alltag spielte das keine Rolle. Sie wurde als Einheimische akzeptiert und genoss jetzt sogar die Stellung einer Bäuerin. Natürlich, sie hätte mehr aus sich machen können. Aber wozu? Sie hatte keine Zeit, zum Schützenfest zu gehen. Tanzen war was für andere. Sie schaffte es nicht mal sonntags zum Kirchgang, obwohl sie durchaus religiös war und hin und wieder auch betete. Ihre christliche Moral ließ sich in einem Satz von Wilhelm Busch zusammenfassen, ihrem Lieblingsdichter: »Das Gute – dieser Satz steht fest – ist stets das Böse, das man lässt.«
Nein, auf die Kirche konnte sie gut verzichten. Ihr Gottesdienst spielte sich in der freien Natur ab. Was gab es Erhabeneres als den Himmel? Das Schauspiel eines heraufziehenden Gewitters. Das Feuerwerk der aufgehenden Sonne. Die Abenddämmerung in ihren zarten Pastelltönen.
Sie musste nicht in Ausstellungen, Theater oder Konzerte gehen, und sie hatte auch gar keine Zeit dazu. Um Himmels willen, nein! Die Arbeit fraß ihre Tage, und gerade jetzt im Mai waren sie besonders lang. Wenn sie kurz vor Sonnenuntergang vom Kartoffelpflanzen nach Hause kam, musste sie noch die Kühe melken, die morgens auf die Weide getrieben, abends aber wieder in den Stall geholt wurden. Meist von Robert, der oft die kleine Marie zum Kühetreiben mitnahm.
Jetzt baute Mariechen am Waldrand Häuser aus bunten Steinen, die sie auf dem Feld gesammelt hatte. Sie langweilte sich. Ihre größte Freude war es, wenn Alex oder Robert sie Huckepack nahmen oder – besser noch – aufs Pferd setzten. Im nächsten Jahr würde sie zur Schule kommen. Wenn der Krieg das zuließ. Es machte ihr Angst, wenn die Sirenen heulten und alle sich im Keller verkriechen mussten. Alma hatte ihr erzählt, dass die Flieger, die dann über das Dorf donnerten, manchmal auch Bomben abschmissen und Häuser kaputt machten und sogar unvorsichtige Menschen trafen. Zum Glück war Hademstorf bisher verschont geblieben.
Hier gaben die Bauern seit jeher den Takt an, der Rhythmus von Aussaat und Ernte beherrschte auch den Rhythmus des Dorflebens mit seinen Arbeits- und Ruhephasen, seinem Alltag, seinen Festen. Für die Schulkinder war klar, dass sie ihren Eltern in den Sommerferien bei der Heuernte helfen mussten und in den Herbstferien bei den Kartoffeln, und die Alten starben vorzugsweise im Herbst und Winter, weil ihre Angehörigen dann Zeit hatten, sie unter die Erde zu bringen und zu beweinen. Zu Beginn des Krieges im Jahre 1939 zählte Hademstorf exakt vierhundertdreizehn Einwohner. Während des Krieges verringerte sich anfangs die Einwohnerzahl aufgrund der Gefallenen, stieg dann aber mit dem Zustrom der Flüchtlinge wieder stark an.
An diesem Mainachmittag schien der Krieg weit weg zu sein. Kein Kampfbomber donnerte über das Dorf, die Bienen blieben ungestört mit ihrem Summen, und von morgens bis abends war die Luft erfüllt vom ewigen Trillern der Feldlerchen. Aber dieses durchgängige Gezwitscher der unsichtbaren Feldbewohner gehörte so selbstverständlich zu den Frühlingstagen, dass man es gar nicht mehr hörte.
So ähnlich war es auch mit dem gleichförmigen Stampfen der Fördertürme, die seit einigen Jahren Öl aus dem Marschboden pumpten. Eine richtige kleine Siedlung war da westlich des Bauerndorfes entstanden – mit Werkstätten, Büros für die Verwaltung und Baracken für die Arbeitskräfte. Da die Männer im wehrfähigen Alter eingezogen worden waren, hatte jetzt der Reichsarbeitsdienst seine Leute geschickt – junge Männer und Frauen, sogenannte Arbeitsmänner und Arbeitsmaiden, die gerade die Schule verlassen hatten. »Vakuum« wurde die Erdöl-Siedlung genannt, nach der Firma, die die Bohrtürme aufgestellt hatte, die »Deutsche Vacuum Öl AG«.
Die Gemeinde profitierte von der Ölförderung durch einen stattlichen Förderzins. Die Bauern erhielten eine Art Standgebühr für die Türme, die auf ihren Wiesen errichtet worden waren. Immerhin. Um diese Dinge hatte Franz sich immer gekümmert. Alma wusste gar nicht, welche Summe ihr da von der »Vacuum« zufloss, mit der sie auch sonst nichts zu tun hatte. Der Bauernhof war ihre Welt, dort spielte sich ihr gesamtes Leben ab.
Vor dem Krieg war das anders gewesen. Da hatte sie sich mit anderen Frauen in der kalten Jahreszeit zum Spinnen und Weben getroffen und war auch mal zum Tanzen gegangen. Und wie es so ging, hatte sie sich sogar verliebt – in Willi, einen Bauernsohn aus dem Nachbardorf. Als sie dann schwanger geworden war, hatte Willi sich eine andere gesucht. Neun Monate später hatte sie Mariechen zur Welt gebracht. Eine Entbindung zwischen Melken und Ausmisten an einem kühlen Märztag. Aber Alma war dankbar für ihre Tochter, die sie auch ohne Vater durchbringen konnte, wenngleich sie nicht viel Zeit für das Kind hatte. Nur an den langen Winterabenden schaffte sie es, Mariechen Märchen vorzulesen. Sie genoss es, wenn das Mädchen an ihren Lippen hing.
Am folgenden Tag war Muttertag, »Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter«, wie die Nationalsozialisten diesen Tag jetzt nannten, an dem sie ihre »Mutterkreuze« verliehen. Aber was sollte der Quatsch? Alma legte darauf keinen Wert. Vielleicht schenkte Marie ihr einen Strauß Feldblumen, Margeriten mochte sie besonders gern.
Am 16. Mai 1943 wurde nicht nur Muttertag gefeiert, es war auch der Tag, an dem der Aufstand im Warschauer Getto nach vier Wochen endgültig niedergeschlagen wurde. Gegen zwanzig Uhr fünfzehn sprengte die SS die Große Synagoge und erklärte damit die Erhebung für beendet. Die meisten Aufständischen waren vorher schon erschossen worden. Viele nahmen sich das Leben, die meisten starben, als die Deutschen Gas in den Bunker leiteten. Mindestens hundertzwanzig jüdische Widerstandskämpfer verloren dabei ihr Leben. Nur einigen wenigen gelang es, aus dem Bunker zu flüchten. Insgesamt starben bei den Kämpfen mehr als zehntausend Menschen, weitere dreißigtausend wurden später erschossen. Nach dem Aufstand begannen die Deutschen mit der systematischen Zerstörung des jüdischen Wohnbezirks. Die einstigen Bewohner deportierten sie in die Vernichtungslager von Treblinka und Auschwitz. Manche kamen auch in die Heide, in das Konzentrationslager Bergen-Belsen – rund dreißig Kilometer von Hademstorf entfernt.
Von all dem bekam Alma nicht viel mit. Sie hatte aber von Alexei erfahren, was den russischen Kriegsgefangenen blühte, die in Bergen-Belsen oder im nahegelegenen Oerbke interniert waren. Zu Tausenden waren diese armen Menschen an Hunger, Typhus und Entkräftung gestorben. Auch Alexei war anfangs in so einem Lager gewesen; er dankte Gott, dass er als Ostarbeiter auf einen Bauernhof entsandt und so der Hölle entronnen war. Vielen seiner Kameraden war das nicht vergönnt gewesen.
Alma musste vor allem an ihre beiden Brüder denken, wenn vom Krieg die Rede war – an Karl, von dem sie jetzt schon seit drei Monaten kein Lebenszeichen mehr erhalten hatten, und an Franz. Der sollte in zwei Tagen an die Front verlegt werden. Es war noch unklar, ob es in Richtung Osten oder nach Westen ging. Auf jeden Fall zweifelte er stark daran, dass er lebend zurückkommen würde. Als kleinen Trost wollte sie ihm am nächsten Tag schreiben, dass die Kartoffeln jetzt drin waren – die Post würde er ja irgendwann kriegen, auch wenn er noch keine Feldpostnummer hatte.
Dabei würde sie selbst jemanden brauchen, der ihr Mut zusprach. Wenn sie an die Zukunft dachte, wurde ihr angst und bange. Bald begann die Heuernte, dann musste das Korn gemäht und eingefahren werden. Wie sollte sie das alles schaffen?
3. Kapitel
Aus der Küche stieg Bratenduft. Ein Duft, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Vor dem Herd mit den glühenden Eisenringen stand Ida und wendete Kartoffelscheiben, die zusammen mit Zwiebeln und Speckstückchen in der Pfanne brutzelten. Almas drei Jahre ältere Schwester war heimgekehrt auf den elterlichen Hof – zusammen mit ihren beiden Töchtern Emma und Hilde. Der Vater der Kinder war wie fast alle anderen Männer im wehrfähigen Alter im Krieg, und weil auf dem Hof jetzt jede Hand gebraucht wurde und hier zumindest an Grundnahrungsmitteln kein Mangel herrschte, war Ida nach Hademstorf zurückgekommen. Sie war mit ihren Töchtern in das frühere Backhaus eingezogen. Das kleine, aus rotem Ziegelstein gemauerte Nebengebäude, das an den Schweinestall grenzte, hatte lange leer gestanden und musste darum gründlich geputzt und wohnlich gemacht werden. Ein älterer Zimmermann aus dem Dorf hatte gemeinsam mit Alex und Robert eine ganze Woche lang Hand angelegt, und jetzt war es hier fast gemütlicher als im großen Wohnhaus. Die wenigen Möbel, die in den beiden Zimmern und der kleinen Küche Platz fanden, hatte Alma ihrer Schwester überlassen. An Betten und anderem Mobiliar herrschte im Hauptgebäude ja kein Mangel, denn die Schlafzimmer der gefallenen Brüder und verstorbenen Eltern standen schon lange leer. Ida hatte ihre eigenen Möbel darum einstweilen noch in ihrem früheren Wohnort zurückgelassen.
Jetzt schlug sie drei Eier auf, verrührte sie in einer Schüssel mit etwas Milch und goss das Rührei über die Bratkartoffeln. Dadurch nahm der Bratengeruch ein noch verführerischeres Aroma an. Der Duft stieg auch der kleinen Marie in die Nase, die an diesem Juliabend mit ihren Cousinen vor dem Haus Hinkeln spielte. Sie war geschickt darin, den kleinen Stein von einem Kästchen ins andere zu kicken – Kästchen, die nur mit Strichen in die Erde geritzt waren.
Ihre Mutter war noch mit den beiden Kriegsgefangenen dabei, das Fuder Heu abzuladen, das sie gerade geholt hatten. Alma stand mit Robert in der Scheune und beförderte das trockene Gras weiter, das Alex vom Wagen aus mit der Forke durch die Luke warf. Robert hatte die Aufgabe, es im hinteren Teil der Scheune zu verstauen und festzutreten, damit weitere Fuder hineinpassten. Alle schwitzten. Obwohl es schon auf sieben Uhr zuging, zeigte das Thermometer noch vierundzwanzig Grad. Der lange Tag der Heuernte hatte alle erschöpft, trotzdem wurde hin und wieder gelacht, wenn jemand einen Scherz machte.
»Gut für die Liebe«, hatte Alex gerade mit seiner kräftigen Stimme gerufen. »Besser als ein Bett.«
»Schweinkram«, hatte Alma erwidert und Robert erklärt, worauf ihre Bemerkung bezogen war; denn der Franzose im hintersten Winkel der Scheune konnte nicht verstehen, was draußen auf dem Heuwagen gesprochen wurde. Daraufhin hatte Robert ihr einen seiner eindringlichen Blicke zugeworfen und erwidert: »Alex hat recht. Ein Bett im Heu ist besser als ein Bett im Haus – weich und duftend. Formidable.«
Als Alma mit gespielter Entrüstung lächelnd den Kopf schüttelte, warf er ihr eine Kusshand zu. Fast hätte sie die kecke Geste erwidert, aber sie war schließlich die Chefin. In diesem Moment spürte sie wieder, wie sie den Franzosen ins Herz geschlossen hatte, und prickelndes Verlangen durchströmte sie. Schon dieser schöne Akzent. Dass er kein »H« sagen konnte, trotz seiner großen Sprachbegabung und aller Bemühungen nicht, sondern von Eu sprach und Ademstorf sagte, wenn er Hademstorf meinte. Das klang in ihren Ohren irgendwie vornehm.
Das Heu duftete nach getrocknetem Ruchgras, und dieser betörende Geruch versetzte Alma in Wallung. Weiter entfernt quakten Frösche, untermalt von dem monotonen Stampfen der Fördertürme, die unermüdlich das schwarze Gold aus dem Marschboden pumpten.
Die Abendsonne fiel schräg durch die Ritzen der Scheunenwände, und ihre Strahlen bildeten in der dunklen Scheune leuchtende Schneisen; zwischen Staubpartikeln tanzten auf dieser Straße aus Licht winzige Mücken in der Gesellschaft von Motten und kleinen Faltern. Luftgeister, die sonst wie so vieles dem menschlichen Auge verborgen blieben.
Der Krieg schien immer noch weit weg. Aber das täuschte, und manchmal bekam das Bild des ländlichen Friedens Risse, und die Sicherheit erwies sich als trügerisch. Das Sirenengeheul und das Sirren der herannahenden Kampfbomber versetzten Alma immer wieder in Angst und Schrecken; nicht mal im Keller, in dem ein Raum mit Tisch und Stühlen als Behelfsbunker eingerichtet war, fühlte sie sich sicher. Doch jetzt war es schon einige Wochen ruhig geblieben, und an die abendliche Verdunkelung hatte sie sich längst gewöhnt. Im Sommer spielte das sowieso keine Rolle. Wenn sie spätabends mit dem Rad vom Melken nach Hause kam, fiel sie gleich wie tot ins Bett. Gut, dass Ida jetzt wieder da war und sich auch um Marie kümmern konnte. Während der Erntezeit hätte Alma dafür gar keine Zeit gehabt.
Traurig war, dass sich eine langgehegte Befürchtung allmählich zur Gewissheit verdichtete: Mariechen hatte ihren Vater verloren. Willi galt zwar nach der Schlacht um Stalingrad immer noch als vermisst, seine Mutter im Nachbarort Eickeloh konnte aber kaum mehr daran glauben, dass er noch lebte. Schon länger als ein halbes Jahr wartete die Bäuerin auf einen Brief ihres Ältesten. Vergebens. Alma hatte zwar schon vor dem Krieg mit Willi abgeschlossen, aber um die kleine Marie tat es ihr leid. Doch selbstverständlich sprach sie mit ihrer Tochter nicht über diese Dinge. Immerhin hielt Willis Mutter Kontakt. Nie vergaß sie, ihrer Enkeltochter in Hademstorf zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Geschenk zu bringen. Das Mädchen wusste, dass ihr unsichtbarer Vater wie die Väter anderer Kinder im Krieg war, aber da sie ihn nie kennengelernt hatte, vermisste sie ihn auch nicht.
Eher schon vermisste sie ihren Onkel. Franz. Der immerhin schrieb noch Briefe – zuletzt aus Südfrankreich. Darin beteuerte er meist, dass die Lage ruhig sei, berichtete aber auch von gelegentlichen Partisanenanschlägen. Vor allem wollte er wissen, wie es auf dem Hof weiterging, und gab seiner Schwester Ratschläge und manchmal auch Anweisungen. Zwischen den Zeilen war herauszulesen, dass er Heimweh hatte.
Es war deutlich, wie er seinen Hof, seine Wiesen und Felder, seine Pferde, Kühe und die vertrauten Menschen vermisste. Weniger Sehnsucht verspürte er offenbar nach dem Dorfleben. Er war immer schon ein Außenseiter gewesen. Ein Sonderling, wie gesagt wurde.
Auch Alma hielt sich von aller Geselligkeit im Dorf fern – abgesehen davon, dass ihr dafür die Zeit fehlte, fehlte ihr auch der innere Drang, sich einem Verein anzuschließen oder die klassischen Dorffeste wie Schützen- oder Erntefest zu besuchen. Die Geburtstage und anderen Feiern ihrer Schwestern und Schwesternkinder reichten ihr vollkommen. Sie war auch nicht der NS-Frauenschaft beigetreten, die ständig irgendwelche Sammlungen für die deutschen Soldaten im Krieg veranstaltete oder dem Führer huldigte, indem sie an seinem Geburtstag vaterländische Lieder sangen oder Fahrten zu seinen umjubelten Auftritten veranstalteten. Nein, darüber konnte sie nur den Kopf schütteln. Nicht mehr als ein spöttisches Lächeln entrang ihr auch die sogenannte »Heldenpforte«, die der Bund deutscher Mädels mit den Arbeitsmaiden auf dem Dorfplatz errichtet hatte, ein großer Torbogen aus Eisenstangen bekränzt mit Blumen der Saison, Efeu oder immergrünen Tannenzweigen sowie einer Schnur mit Fähnchen. Dahinter wehte die Hakenkreuzfahne.
Hademstorf bestand in jenen Tagen aus drei, vier Dutzend Großfamilien, die sich innerhalb der Gemeindegrenzen verzweigt und wieder miteinander vermischt hatten. Frisches Blut kam selten in die Kirchengemeinde, und kaum jemand musste die Dorfgrenzen verlassen, um seiner Arbeit nachzugehen. Bevor Ende 1941 die Vacuum damit begann, Öl aus den Tiefen des Hademstorfer Marschlandes zu fördern, und Mitarbeiter in die Siedlung am Hansadamm lockte, bevölkerten fast ausschließlich Bauern und Handwerker das Dorf. Schuster, Schneider, Schlachter und Tischler bildeten neben den kleinen und großen Landwirten die Säulen des Dorflebens. Der Pastor der Kirchengemeinde residierte im Nachbarort Eickeloh, wo auch die große Backsteinkirche stand und die Toten begraben wurden. Nur der Schulmeister, der alle acht Jahrgänge gleichzeitig in dem einzigen Klassenraum der Dorfschule unterrichtete, hob sich durch seinen Bildungsstand von den praktisch tätigen Dorfbewohnern ab. Aber der Lehrer hielt ebenso wie alle übrigen Dorfbewohner Hühner, Schweine und Kaninchen und erntete in seinem Schulgarten eigene Gurken, Erbsen, Bohnen, Möhren und Radieschen – natürlich fehlten auch die dorfüblichen Johannis- und Stachelbeeren nicht. Im Laufe des Krieges war eine Lehrerin ins Schulhaus eingezogen, die einen Volksempfänger angeschafft hatte. Auf diese Weise konnte sie frühzeitig erfahren, wenn Fliegerangriffe drohten, und die Kinder vorsorglich nach Hause schicken.
Ein Laden, Kolonialwarenhandlung genannt, versorgte die Dorfbewohner mit den Dingen, die sie nicht selbst erzeugten. Während des Krieges war das Angebot immer knapper geworden. Ob Mehl, Stoffe, Schnaps oder Kohle – fast alles war rationiert und nur noch mit Bezugsscheinen, sogenannten Marken, zu haben. Da war es gut, an der Quelle zu sitzen. Auf Almas Hof jedenfalls musste keiner hungern. Frei verfügen allerdings konnte die Bäuerin über ihre Erträge auch nicht. Alles wurde genau erfasst, und der Großteil der Ernteerträge musste zu einem staatlich festgelegten Preis abgeführt werden – Korn und Kartoffeln ebenso wie Fleisch, Milch und Butter. Natürlich konnte man das eine oder andere abzweigen und als Handwerkerlohn oder Vorrat für noch schlechtere Zeiten zurückbehalten. Darüber hatte eigentlich der Ortsbauernführer zu wachen. Aber Franz Wiechmann, der auch als Bürgermeister amtierte, war selbst Bauer und drückte bei seinen Berufskollegen in der Regel ein Auge zu. Der Bürgermeister repräsentierte die Partei im Dorf gemeinsam mit seinem Nachbarn, Schneidermeister Beike, der als Schriftführer amtierte und die männlichen Dorfbewohner mit braunen SA-Uniformen ausstattete. Auch Franz Wiese war Mitte der dreißiger Jahre wie die anderen Bauern der SA beigetreten, weniger aus Überzeugung als dem Bestreben, nicht noch mehr aus der Reihe zu tanzen. Die SA-Uniform hatte für ihn keine größere Bedeutung als die Schützenfestjacke. Sie hing eingemottet im Kleiderschrank.
Endlich war das Heufuder abgeladen. Alma eilte schnell ins Haus, um das Abendessen auf den Tisch zu bringen. Dazu rief sie auch Marie. Aber die hatte schon mit ihrer Tante und den beiden Cousinen im Backhaus gegessen, war längst satt und freute sich darauf, dass Ida gleich das abendliche Märchen vorlesen würde.
Alma war das recht. Sie musste ja noch zum Melken und war froh, dass ihre Schwester auf Mariechen achtgab. Gut möglich, dass es doch noch wieder einen Tieffliegeralarm gab oder ein Trupp Soldaten sich im Dorf einquartierte.
4. Kapitel
Der Himmel war an diesem letzten Junitag wie ein nasses Blechdach; die Sonne, wenn sie sich überhaupt einmal sehen ließ, bleich wie ein Fischbauch. Es regnete von morgens bis abends an diesem kühlen Sommertag, leichter, aber beharrlicher Nieselregen. Das bereits gemähte Gras auf der Wiese wurde davon so nass, dass es erst trocknen musste, bevor es eingefahren werden konnte. Aber die Sonne versteckte sich hinter den grauen Wolken. Alma und ihre Leute nutzten den Regentag, um Kartoffeln zu hacken und Rüben zu verziehen, außerdem war jetzt endlich Zeit, die Schweineställe auszumisten. Alexei, der die Aufgabe übernommen hatte, roch nach vier Ställen schon selbst wie ein Schwein. Am Abend warteten wie jeden Tag die Kühe auf der Weide darauf, gemolken zu werden.
Als Alma gegen halb elf mit Alexei und Robert vom Melken nach Hause kam und ihr Rad in die Scheune schob, hörte sie, dass es im Heu raschelte. Eine Igelfamilie? Eine Eule? Mäuse oder Ratten? Sie horchte in die Dunkelheit. Zuerst wurde es still, gespenstisch still, dann hörte sie diesen schweren, röchelnden Atem, der wie unterdrücktes Seufzen klang. »Hallo, ist da einer?«, stieß sie ängstlich hervor. Aber sie erhielt keine Antwort. Sie wagte es nicht, länger nach dem unsichtbaren Besucher zu forschen, lief hinaus und bat Alex, nach dem Rechten zu sehen.
Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis der wieder aus der Scheune zurückkam. Alma sah ihm an, dass er bedrückt war und einen inneren Kampf mit sich ausfocht. Ungeduldig stellte sie ihn zur Rede.
»Was ist denn los? Hat sich einer in die Scheune geschlichen?«
Alexei stammelte etwas von einem »armen Menschen«, einem russischen Landsmann offenbar, und da erinnerte sich Alma sofort an den Trupp der Kriegsgefangenen, der durchs Dorf gezogen war – irgend so ein Arbeitskommando. Jetzt fiel ihr auch ein, dass sie einen gesucht hatten. Da war offenbar jemand geflüchtet. Um Himmels willen! Was sollte sie bloß machen? Sie konnte den Kerl doch nicht auf dem Hof verstecken. Das wurde schwer bestraft. Aber konnte sie den armen Teufel der SS ausliefern? Sicher bedeutete das sein Todesurteil.
Trotzdem ließ sie ihrer Angst freien Lauf und machte Alex Vorwürfe, dass der sich für den Kerl einsetzte. »Du stürzt uns alle noch ins Verderben. Das geht doch nicht. Ich muss doch auch an den Hof und Mariechen denken, mein Gott noch mal.«
Alexei flehte sie an, die Ruhe zu bewahren. Er werde alle Schuld auf sich nehmen, falls jemand den Mann entdeckte. Erst einmal müsse der Kerl etwas zu essen und zu trinken bekommen, sonst würde er die Nacht vielleicht schon nicht mehr überleben. Alma rief sich die Bilder der ausgemergelten Männer ins Gedächtnis, die vor wenigen Tagen über die Landstraße getrieben worden waren, und stimmte widerstrebend zu. »Aber ich weiß nichts davon, hörst du, Alex?«
Nach einer unruhigen Nacht ging sie am Morgen in die Scheune und sah, wie der Russe im Heu schlief. Abgemagert, bleich und zerlumpt, aber doch ganz friedlich. Sie atmete tief durch und beschloss, noch einmal ein ernstes Wort mit Alex zu sprechen. Vielleicht konnte man den Mann noch einige Tage dabehalten und so weit mit Essen und Trinken aufpäppeln, dass er wieder zu Kräften kam, um sich anderswo vor seinen Verfolgern zu verkriechen.
Der Russe hieß Viktor. Alexei überließ dem erschöpften Mann sein Bett in der Knechtskammer am Rande des Schweinestalls. Nachdem er sich halbwegs satt gegessen hatte, schlief er fast zwei Tage durch. Alexei verbrachte die kurzen Sommernächte auf einem Sofa im Wohnhaus. Das war zwar verboten, aber darauf kam es jetzt auch nicht mehr an.
Die kleine Marie gruselte sich vor dem spindeldürren, blassen Kerl in der Knechtskammer, wenn sie durchs Fenster spähte. Der Russe mit den tiefliegenden Augenhöhlen und vorstehenden Wangenknochen, der auf so heimliche Art auf den Hof gekommen war, machte ihr schon deshalb Angst, weil er nur Russisch sprach. Sie verstand gerade mal, dass es »ja« hieß, wenn er »da« sagte – meistens »da, da«. Aber sonst blieb ihr diese Sprache fremd.
Alma dagegen gewöhnte sich allmählich an die Anwesenheit des Schattenmannes, und nach einer Woche saß Viktor schon mit am Tisch. Alexei übersetzte in seinem gebrochenen Deutsch, was Viktor im Lager in Wietzendorf erlebt hatte. »Wir haben in Erdhöhlen gehaust und Gras gegessen. So groß war der Hunger. Die Bäume im Lager hatten alle keine Rinde mehr, weil die Menschen sie abgerissen und aufgegessen haben. Man glaubt ja nicht, was man alles …«
Seine brüchige Stimme erstarb, er schüttelte den Kopf und hielt sich die Hände vor die Augen. »Sogar unsere Gürtel haben wir aufgegessen, Hosengürtel, wissen Sie. Ledergürtel. Ekelhafter Geschmack, scheußlich, aber es half gegen diesen schrecklichen Hunger, verstehen Sie.«
»Ja, in der Not frisst der Teufel fliegen«, warf Alma lakonisch ein, um ihrer Beklemmung irgendwie Ausdruck zu verleihen.
»Ganz schlimm war es im Winter«, fuhr Viktor fort. »Kälter sind wohl die Winter auch in Sibirien nicht, alles gefroren. Ganz steif vor Kälte waren wir, wenn wir wieder eine Nacht überstanden hatten und uns frühmorgens auf dem Appellplatz versammeln mussten. Jeden Tag sind einige gestorben. Manche lagen tagelang tot auf ihren Pritschen oder irgendwo auf der kalten Erde, bis man sie auf Karren geladen und zu dem großen Friedhof gebracht hat. Uns allen war klar, dass wir die nächsten sein konnten. Zu dem Hunger, dem Durst und der Kälte kamen ja noch die Seuchen. Typhus und Ruhr, wissen Sie. Viele hatten Fieber, hohes Fieber, der kalte Schweiß brach ihnen aus, und weil wir alle so kraftlos waren, hatten wir der Krankheit nichts mehr entgegenzusetzen. Auch ich hatte dieses Fieber, aber irgendwie habe ich es überstanden. Wie durch ein Wunder. Vielleicht haben meine Gebete geholfen.«
Er starrte ins Leere, als würde er dort seinen unsichtbaren Retter erspähen, er atmete schwer und schwieg. Alle schwiegen, bis er allmählich in seinem schleppenden Russisch fortfuhr. »Auch andere haben gebetet, aber vergebens. Kameraden, die es nicht mehr schafften, aus eigener Kraft hochzukommen, wurden einfach von den Wachleuten erschossen. Einfach abgeknallt, wissen Sie? Wie Vieh haben sie uns behandelt, nein, schlimmer.«
In den vergangenen Monaten sei es etwas besser geworden, weil die Kriegsgefangenen zu Arbeitseinsätzen in der Umgebung gebracht wurden. Zum Bunkerbau, in unterirdischen Munitionsfabriken, aber eben auch in der Landwirtschaft. Wer dafür ausgewählt wurde, genoss den ungeheuren Vorzug, wenigstens eine warme Suppe am Tag zu bekommen – wie dünn die auch immer sein mochte. Die Arbeit aber war so hart, dass die Kraftreserven schnell aufgebraucht waren. Viktor erzählte von einem Kameraden, mit dem er bei Wegebauarbeiten in der Nähe eingesetzt gewesen war. Der Mann mit den fiebrigen Augen habe sich nach fünf, sechs Stunden schon nicht mehr auf den Beinen halten können, sei vor Erschöpfung immer wieder gestürzt und schließlich gar nicht mehr hochgekommen. Als ihn die Wachleute als faulen Hund beschimpften und mit der Peitsche schlugen, flehte er sie an, ihn zu erschießen. »Gnade«, habe er auf Deutsch hervorgestoßen. »Gnade. Ich kann nicht mehr.« Irgendwann hätten sie ihm dann wirklich den Gefallen getan und ihn abgeknallt.
Alma stockte der Atem. Was sie hörte, überstieg ihre Vorstellungskraft. Je länger sie Viktor zuhörte, desto fester formte sich ihr Entschluss, ihn auf dem Hof zu behalten. Man konnte diesen armen Mann doch nicht einfach wieder fortjagen und neuen Qualen aussetzen. Nein, der sollte ruhig dableiben. Den würde man auch noch satt kriegen, außerdem war es jetzt ja in der Erntezeit gut, noch eine Arbeitskraft mehr zu haben. Bei der bevorstehenden Kornernte war doch jede zusätzliche Hand Gold wert. Und bei den vielen Kriegsgefangenen und Ostarbeitern im Dorf fiel es sicher nicht auf, wenn ein weiterer Russe bei ihr auf dem Feld stand. Zusätzlich bestätigt sah sie sich in ihrem Entschluss, als Alex ihr sagte, dass sein Landsmann Ingenieur war und bestimmt die eine oder andere Maschine reparieren konnte, die ausfiel. In diesen Kriegstagen war es fast unmöglich, Landmaschinen auf reguläre Weise instand setzen zu lassen. Auch der Schmied aus dem Nachbarort war im Krieg.
Sie erlaubte Viktor, sich am großen Waschbecken in der Küche zu waschen, und gab ihm Kleidung von Karl – die Größe musste wohl ungefähr hinkommen. Da der Russe bis auf die Knochen abgemagert war, rutschte ihm die Hose zwar anfangs noch, aber wozu gab es Hosenträger? Alma musste unwillkürlich schlucken, als sie Viktor in dem Arbeitszeug ihres jüngsten Bruders sah – der Manchesterhose, dem karierten Baumwollhemd, der dunkelgrünen Lodenjacke. Was, wenn Karl doch noch aus dem Krieg heimkehrte? Egal, ganz egal. Auch wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintrat, ging sicher die Welt nicht unter, wenn er den Russen in seiner Arbeitskleidung sah. Der hatte nie viel Aufheben von solchen Dingen gemacht. Franz war da anders. Der hatte schon Einspruch erhoben, als Alma den beiden Kriegsgefangenen die Sachen von Heinrich und Wilhelm geben wollte – dabei waren die schon ein Vierteljahrhundert tot. Unsinn! Wie zum Trotz gegen ihren abwesenden Bruder holte sie dessen Gummistiefel aus dem Keller und forderte Viktor auf, sie anzuprobieren. Tatsächlich: Die Stiefel passten. Wie angegossen.
Drei Brüder hatte ihr der Krieg genommen, drei Männer hatte er ihr zurückgegeben. Manchmal kam ihr schon der Gedanke, wie es wohl wäre, wenn auch noch Franz fallen würde. War es dann nicht ihr gutes Recht, den Mann zum Bauern zu machen, der ihr am nächsten stand?
5. Kapitel
Irgendwo in Südfrankreich. Ein milder Oktobertag des Jahres 1943. Nebel lag noch über dem Land, gerade erst war die Sonne aufgegangen. Gras und Sträucher waren bereits vom langen Sommer ausgebleicht, einzelne Blätter segelten durch die Luft. Auch die alten Eichen verloren schon ihr Laub, wie Franz wehmütig bemerkte. Eichen. Eichen, die etwas anders aussahen als die Eichen in Hademstorf. Knorriger, mit hellerem Stamm.
Vieles war hier anders als in Hademstorf. Die Landschaft war nicht flach wie in der Heide, sondern hügelig, und Franz trug nicht seine abgewetzte Manchesterhose und seinen zerschlissenen dunkelgrünen Baumwollpullover mit der Drillichjacke obendrüber, sondern Uniform. Graue Kampfuniform, Lederstiefel statt Gummistiefel. Der Stahlhelm immerhin blieb ihm erspart. Ein feindlicher Angriff war nicht zu erwarten – zumindest drohte nicht die Gefahr einer militärischen Offensive. Aber der Tod lauerte im Verborgenen. Schüsse aus dem Hinterhalt waren jederzeit möglich. In den Wäldern der Umgebung, hieß es, hielten sich französische Partisanen verschanzt, die jede Gelegenheit nutzen, die verhassten Besatzer abzumurksen. Erst am Vortag hatte es einen Kameraden aus Pommern erwischt, den Gefreiten Otto Baum. Beim Morgenappell wurde seiner in Ehren gedacht.
Am Nachmittag schon wurde er begraben. Da kein Militärgeistlicher in der Nähe war, leitete der Hauptmann die Trauerzeremonie. Dazu las er Gebete aus der Miniaturausgabe des Gesangbuchs, das alle Soldaten bekommen hatten. Franz faltete die Hände und sang innbrünstig mit.
Damit war die Sache nicht abgetan. Das Oberkommando der Wehrmacht hatte einen Sühnebefehl erlassen. Wenn der Täter nicht ermittelt werden konnte, wurden Geiseln erschossen – für einen getöteten deutschen Soldaten mindestens fünf Franzosen. Jetzt warteten zehn französische Männer auf ihre Hinrichtung – zur Hälfte gefangene Partisanen, zur anderen Hälfte Zivilisten aus einem der Dörfer in der Umgebung. Wehrmachtssoldaten hatten sie am Abend aus ihren Häusern geholt, darunter ein Junge, der kaum fünfzehn sein dürfte, wie Franz schätzte.
Zum Glück war er diesmal nicht dem Erschießungskommando zugeteilt worden. Seine Aufgabe war es, die zehn Männer gemeinsam mit Kameraden aus ihrem Drahtverhau zu holen und zum achthundert Meter entfernten Exekutionsplatz in einer Waldlichtung zu führen.
»Aufstehen. Abmarsch.«
Die Kommandos überließ er anderen, aber er musste die Franzosen mit vorgehaltener Maschinenpistole dazu bringen, den Aufforderungen Folge zu leisten. Notfalls mit Tritten oder Schlägen mit dem Gewehrlauf. Es sollte ihnen nicht weh tun, aber klarmachen, dass er seine Aufgabe ernst nahm, als braver Soldat seine Pflicht tat.
Das fiel ihm an diesem Morgen nicht leicht. Die Augen der Geiseln drückten Angst und Entsetzen aus, vielleicht sogar ein verzweifeltes, verstohlenes Flehen um Gnade.
Aber Gnade war etwas für den Sonntagsgottesdienst, hier ging es um Rache, um Abschreckung – um die ehernen Gesetze der Kriegsführung.
Nach anfänglicher Weigerung ging bald alle von selbst, schicksalsergeben, apathisch, vielleicht auch in der heimlichen Hoffnung, die Deutschen durch ihren Gehorsam doch noch milde stimmen zu können.
Aber der Exekutionsbefehl war unumstößlich. Gegen seinen Willen sah Franz einem der Geiseln in die Augen, ausgerechnet dem Jungen. Tränen glitzerten darin, man sah, wie der Junge dagegen ankämpfte, tapfer erscheinen möchte. Dabei war er eigentlich noch ein Kind. Woran er wohl gerade dachte? An seine Mutter? Oder an sein Gegenüber in der deutschen Uniform? Ganz sicher flammte Hass in dem Jungen auf, der nie ins heiratsfähige Alter kommen würde – zumindest Wut, hilflose Wut.
Als der Trupp sein Ziel erreicht hatte, erhielten die Geiseln Spaten, wurden aufgefordert, eine Grube auszuheben. Es war ihnen anzusehen: Sie ahnten, was das bedeutete, zogen es aber dennoch vor, den Spaten in die Hand zu nehmen und zu graben, anstatt sich noch einmal treten oder schlagen zu lassen.
Als die Grube schließlich tief genug war, erteilte ein Oberstleutnant ein neues Kommando: »Aufstellen. Alle der Reihe nach am Grubenrand aufstellen!«
Da kaum einer das deutsche Kommando verstand, legten Wehrmachtssoldaten Hand an die Geiseln, indem sie sie unsanft zu der geforderten Reihe ausrichteten. Unterdessen hatte schon das Erschießungskommando Aufstellung genommen – zehn Wehrmachtssoldaten mit Maschinengewehren im Anschlag. Darunter Franz. Und auf einen kaum hörbaren Befehl hin erschütterte im nächsten Moment schon das Getacker der vielen gleichzeitigen Schüsse die herbstliche Waldlichtung, und die Geiseln stürzten von der Wucht der Einschläge in die Vertiefung. Manche rissen noch beim Sturz die Arme hoch.
Wie bei der letzten Geiselerschießung war Franz wieder wie erstarrt, wie innerlich vereist vor Entsetzen, obwohl er im letzten Moment die Augen geschlossen hatte. Aber ebenso stark wie das Mitleid mit den Exekutierten kämpfte in ihm das Bestreben, sich nichts anmerken zu lassen. Bloß keine Schwäche zeigen und als Waschlappen auffallen! Der Spott seiner Kameraden, die ihn für keinen richtigen Soldaten hielten, machte ihm ohnehin schon zu schaffen. Er war froh, dass er dabei helfen konnte, die Leichen der Erschossenen mit Erde zu bedecken.
Zum Abschluss der »Aktion« erhielt jeder der Beteiligten eine Schachtel Zigaretten, und obwohl Franz eigentlich gar kein Raucher war, ließ er sich Feuer geben. Währenddessen verstärkte sich das Geschrei von Wildgänsen, die über das Feldlager hinweg in Richtung Süden flogen. Vielleicht, ging es Franz durch den Kopf, vielleicht kommen die ja aus der Lüneburger Heide – aus unserer Marsch.