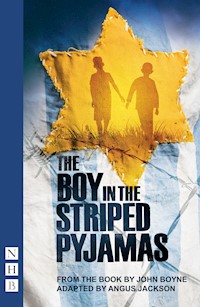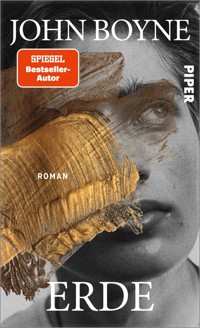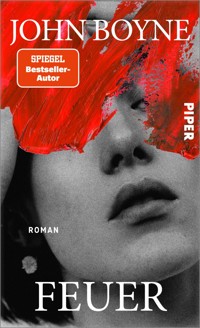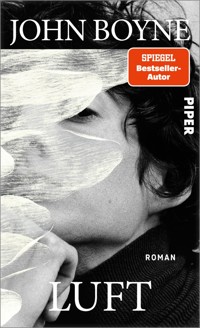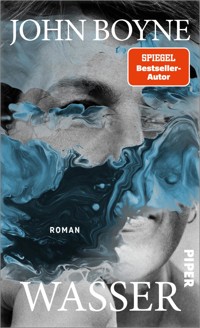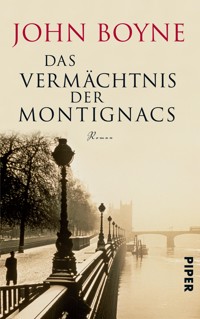10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Weltbestsellers »Der Junge im gestreiften Pyjama« Gretel Fernsby lebt seit Jahrzehnten in ihrer Londoner Wohnung. Sie führt ein ruhiges Leben, trotz ihrer dunklen Vergangenheit. Über ihre Flucht aus Deutschland vor über siebzig Jahren spricht sie nicht. Vor allem aber verliert sie kein Wort über ihren Vater, der Kommandant in einem Konzentrationslager war. Als eine junge Familie in die Wohnung unter ihr zieht, weckt der neunjährige Henry Erinnerungen, die sie lieber vergessen würde. Eines Nachts wird sie Zeugin eines Streits zwischen Henrys Mutter und dem jähzornigen Vater. Ein Streit, der Gretels hart erkämpfte, zurückgezogene Existenz bedroht. Sie bekommt die Chance, ihre Schuld zu sühnen und den Jungen zu retten. Doch dazu muss sie offenbaren, was sie ein Leben lang verschwiegen hat ... John Boyne erzählt in seinem Roman vom Leben mit der Schuld und dem Ende der Zeitzeugenschaft. »Der Roman, in dem mosaiksteinhaft ein Leben bilanziert wird, wandelt sich am Ende noch rasant zum Krimi.« rbb Kultur, Der Morgen »John Boyne ist ein Meister der historischen Fiktion.« John Irving »Boynes Buch ist sowohl Geschichtsstunde als auch die fesselnde Biografie einer Frau, die exemplarisch für so viele Menschen einer Generation in Deutschland steht, die es bald nicht mehr gibt.« Madame
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
((bei fremdsprachigem Autor:))
Übersetzung aus dem Englischen von Michael Schickenberg und Nicolai von Schweder-Schreiner
© John Boyne 2022
Titel der englischen Originalausgabe:
»All the Broken Places«, Doubleday, einem Imprint von Transworld Publishers, London 2022
((immer))
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München, nach einem Entwurf von Marianne Issa El Khoury/TW
Covermotiv: vorne: Valerie Loiseleux/Getty Images; STOCKFOLIO® / Alamy Stock Foto | hinten: andylid/iStock/Getty Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Teil 1
Die Tochter des Teufels
London 2022/Paris 1946
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Zwischenspiel
Der Zaun
London 1970
Teil 2
Schöne Narben
London 2022/Sydney 1952
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Zwischenspiel
Der Junge
Polen 1943
Teil 3
Die Endlösung
London 2022/London 1953
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Markus Zusak
Teil 1
Die Tochter des Teufels
London 2022/Paris 1946
1
Wenn jeder Mensch, wie Voltaire behauptet, die Schuld an all dem Guten trägt, das er nicht getan hat, dann habe ich fast ein Leben lang damit verbracht, mich selbst davon zu überzeugen, dass ich keine Schuld an all dem Schlechten trage. Dies zu tun war eine angenehme Art, die Jahrzehnte der selbst auferlegten Verbannung aus der Vergangenheit zu ertragen und mich als Opfer historischer Amnesie zu betrachten, freigesprochen von Mittäterschaft, von keiner Verantwortung belastet.
Die letzte Episode meines Lebens beginnt und endet jedoch ganz trivial mit einem Teppichmesser. Meines war ein paar Tage zuvor kaputtgegangen, und da ich ein solches Werkzeug in der Küche für nützlich hielt, stattete ich dem Haushaltswarenladen um die Ecke einen Besuch ab und kaufte ein neues. Bei meiner Rückkehr fand ich den Brief eines Maklers vor, der mich und alle anderen Bewohner von Winterville Court höflich darüber informierte, dass die Wohnung im Erdgeschoss – jene unter meiner – demnächst verkauft werde. Mr Richardson, der vorherige Eigentümer von Apartment eins, hatte gut dreißig Jahre dort gelebt und war kurz vor Weihnachten gestorben. Seitdem stand die Wohnung leer. Seine Tochter lebte als Logopädin in New York und hatte meines Wissens nicht vor, nach London zurückzukehren, weshalb ich mich bereits mit der Vorstellung abgefunden hatte, mich demnächst in der Lobby mit einem fremden Menschen unterhalten zu müssen, womöglich sogar Interesse an seinem oder ihrem Leben zu heucheln und Details über mein eigenes preiszugeben.
Mr Richardson und ich hatten das perfekte nachbarschaftliche Verhältnis gepflegt, schließlich hatten wir seit 2008 kein einziges Wort mehr miteinander gewechselt. In den ersten Jahren nach seinem Einzug hatten wir uns eigentlich gut verstanden, und er war gelegentlich zu uns heraufgekommen, um mit meinem inzwischen verstorbenen Mann Edgar eine Partie Schach zu spielen, aber irgendwie hatten er und ich es nie bis zum Du geschafft. Er redete mich mit »Mrs Fernsby« an, ich nannte ihn »Mr Richardson«. Das letzte Mal, dass ich seine Wohnung betreten hatte, war vier Monate nach Edgars Tod gewesen, als ich eine Einladung zum Abendessen von ihm angenommen hatte. Allerdings entpuppte sich diese als amouröser Annäherungsversuch, den ich zurückwies. Er nahm mir die Ablehnung übel, und wir wurden zu Fremden, soweit das eben möglich ist für zwei Menschen, die im selben Haus wohnen.
Unser Haus im Stadtteil Mayfair wird offiziell als »Mehrfamilienhaus« geführt, aber das ist in etwa so, als würde man Windsor Castle als den Wochenendbungalow der Queen bezeichnen. Jede der Wohnungen in unserem Gebäude – es gibt insgesamt fünf, eine im Erdgeschoss und je zwei in den beiden Etagen darüber – erstreckt sich über einhundertvierzig Quadratmeter allerfeinster Londoner Wohnlage, hat drei Schlafzimmer, zweieinhalb Bäder und einen Blick über den Hyde Park, der den Kaufpreis auf zwei bis drei Millionen Pfund treibt, wie ich aus sicherer Quelle weiß. Einige Jahre nach unserer Hochzeit hatte Edgar überraschend eine beträchtliche Summe Geld von einer unverheirateten Tante geerbt, und obwohl er es vorgezogen hätte, in eine ruhigere Gegend außerhalb Londons zu ziehen, war ich nach einigen im Stillen eingeholten Erkundigungen zu dem Entschluss gekommen, unbedingt in Mayfair wohnen zu wollen – und nicht bloß in Mayfair, sondern genau in diesem Haus, sofern möglich. Aus Geldgründen hatte dies lange unwahrscheinlich geschienen, aber dann, eines Tages, wie ein Deus ex Machina, war Tante Belinda von uns gegangen, und alles änderte sich. Ich hatte Edgar immer erklären wollen, warum ich so versessen darauf war, hier zu wohnen, aber irgendwie tat ich es nie. Heute bereue ich das.
Mein Mann war ein Kindernarr, aber ich wollte höchstens eins, und so kam 1961 unser Sohn Caden zur Welt. Seit einigen Jahren, in denen der Wert der Wohnung stetig gestiegen ist, ermutigt mich Caden dazu, sie doch zu verkaufen und mir etwas Kleineres in einem weniger exklusiven Stadtteil zu suchen. Er tut das vermutlich, weil er fürchtet, dass ich hundert werden könnte, und weil er einen Teil seines Erbes gern jetzt schon hätte, solange er noch jung genug ist und ihn genießen kann. Er war dreimal verheiratet und ist jetzt zum vierten Mal verlobt, allerdings habe ich es aufgegeben, mich mit den Frauen in seinem Leben näher zu beschäftigen. Kaum hat man sie kennengelernt, so mein Eindruck, werden sie entsorgt, und ein moderneres Modell wird installiert, dessen Marotten man erst zeitaufwendig herausfinden muss, fast wie bei einer neuen Waschmaschine oder einem Fernseher. Als Kind ist Caden mit seinen Freunden ähnlich skrupellos umgesprungen. Wir telefonieren regelmäßig, und er besucht mich alle zwei Wochen zum Abendessen, aber unser Verhältnis ist kompliziert und leidet teilweise unter dem Schaden, den es durch meine einjährige Abwesenheit genommen hat, als er neun war. Um ehrlich zu sein, bin ich einfach kein Kindertyp, und besonders kleine Jungen finde ich schwierig.
Bei meinen potenziellen neuen Nachbarn war meine Sorge nicht so sehr, dass sie Lärm machen könnten – die Wohnungen sind trotz einiger Schwachstellen hier und da sehr gut gedämmt, außerdem habe ich mich über die Jahre an die Palette seltsamer Geräusche gewöhnt, die durch Mr Richardsons Decke zu mir nach oben gedrungen sind –, aber ich hasste die Aussicht, dass mein geordnetes Leben aus dem Tritt geraten könnte. Am liebsten wäre mir jemand gewesen, der sich für die über ihm wohnende Frau gar nicht interessierte. Ein kranker alter Mensch vielleicht, der fast nie das Haus verließ und zu dem jeden Morgen der Pflegedienst kam. Oder eine junge Karrierefrau, die freitagnachmittags ins Wochenendhaus verschwand, sonntags erst spät wiederkam und ihre Zeit ansonsten im Büro oder Fitnessstudio verbrachte. Im Haus hatte kurzzeitig das Gerücht kursiert, dass ein bekannter Popmusiker, der in den Achtzigerjahren den Höhepunkt seiner Karriere erlebt hatte, die Wohnung als möglichen Alterssitz ins Auge gefasst hätte, aber glücklicherweise wurde daraus nichts.
Jedes Mal, wenn der Makler draußen hielt und Kunden ins Haus führte, um ihnen die Wohnung zu zeigen, zuckten meine Vorhänge, und ich machte mir Notizen zu meinen möglichen Nachbarn. Unter den Interessenten waren: ein vielversprechendes Ehepaar Anfang siebzig mit leisen Stimmen, das Händchen haltend fragte – ich lauschte im Treppenhaus –, ob denn Tiere im Haus erlaubt seien, und enttäuscht wirkte, als die Antwort Nein lautete; zwei Homosexuelle um die dreißig, garantiert unverschämt reich, jedenfalls nach ihrer zerfetzten Kleidung und dem insgesamt ungepflegten Eindruck zu schließen, die aber erklärten, dass der Space vermutlich etwas klein für sie sei und sein Narrativ sie nicht anspreche; und eine junge Frau mit schlichtem Gesicht, die nichts über ihre Absichten verlauten ließ, außer dass jemand namens Steven die hohen Decken sicher toll fände. Natürlich hoffte ich auf die beiden Schwulen – Schwule sind gute Nachbarn und Nachwuchs ist bei ihnen unwahrscheinlich –, doch sie zeigten sich von allen leider am wenigsten begeistert.
Nach ein paar Wochen schließlich brachte der Makler keine Interessenten mehr vorbei, die Anzeige verschwand aus dem Internet, und ich nahm an, dass man sich einig geworden war. Ob es mir gefiel oder nicht, eines Morgens würde ich aufwachen, vor dem Haus einen Umzugswagen sehen, und jemand oder eine Gruppe von Jemands würde einen Schlüssel ins Haustürschloss stecken, um die Wohnung unter mir zu beziehen.
Oh, wie ich die Vorstellung hasste!
2
Mutter und ich flohen Anfang 1946 aus Deutschland, nur wenige Monate nach Kriegsende, ein Zug brachte uns aus den Trümmern von Berlin nach Paris. Ich war fünfzehn, wusste wenig vom Leben und tat mich immer noch schwer damit, dass die Achsenmächte besiegt worden waren. Vater hatte immer mit solch einer Überzeugung von der genetischen Vorherrschaft unserer Rasse und dem unvergleichlichen strategischen Talent des Führers gesprochen, dass der Sieg stets eine Gewissheit gewesen war. Und doch hatten wir aus irgendeinem Grund verloren.
Die mehr als tausend Kilometer weite Reise quer über den Kontinent stimmte nicht gerade optimistisch für die Zukunft. Die Städte, durch die wir kamen, waren gezeichnet von der Zerstörung der letzten Jahre. In den Gesichtern der Leute auf den Bahnhöfen und in den Waggons sah ich keine Freude über das Ende des Kriegs, sondern bloß seine Wunden. Überall spürte man Erschöpfung und die zunehmende Einsicht, dass Europa nicht einfach in den Zustand von 1938 zurückkehren konnte, sondern vollständig neu aufgebaut werden musste, genau wie der Lebensmut seiner Einwohner.
Die Stadt meiner Geburt lag fast vollständig in Schutt und Asche, und vier unserer Eroberer teilten nun die Beute unter sich auf. Zu unserem Schutz hatten wir uns in den Kellern der wenigen wahren Getreuen versteckt, deren Häuser noch standen, bis man uns die gefälschten Papiere beschafft hatte, die uns die sichere Ausreise aus Deutschland ermöglichten. In unseren Pässen stand nun der Name Guéymard, dessen Aussprache ich immer wieder übte, damit es so französisch wie möglich klang. Mutter musste ich ab sofort Nathalie nennen, nach meiner Großmutter, ich aber blieb Gretel.
Täglich kamen neue Details über die Vorgänge in den Lagern ans Licht, und Vaters Name wurde zum Inbegriff von Verbrechen abscheulichster Natur. Obwohl niemand behauptete, wir seien genauso schuldig wie er, glaubte Mutter, es würde uns ins Unglück stürzen, sollten wir uns den Behörden stellen. Ich stimmte ihr zu, weil auch ich Angst hatte, aber der Gedanke, man könnte mich zur Mittäterin an den Gräueltaten erklären, schockierte mich. Es stimmte, dass ich seit meinem zehnten Geburtstag Mitglied im Jungmädelbund gewesen war – wie aber auch jedes andere Mädchen in Deutschland. Es war schließlich Pflicht, genau wie der Eintritt ins Deutsche Jungvolk es für alle zehnjährigen Jungen gewesen war. Allerdings hatten mich weit mehr als die Parteiideologie die regelmäßigen Freizeitaktivitäten mit meinen Freundinnen interessiert. Und nach unserem Umzug an jenen anderen Ort hatte ich mich nur ein einziges Mal auf der anderen Seite des Zauns aufgehalten, an dem Tag, als mein Vater mich mit ins Lager genommen hatte, um mir seine Arbeit zu zeigen. Ich redete mir ein, nur Zuschauerin gewesen zu sein, nichts weiter, dass mein Gewissen rein sei, aber die Frage nach meiner Mitschuld an den Taten, deren Zeugin ich geworden war, ließ mich nicht los.
Als unser Zug Frankreich erreichte, machte ich mir plötzlich Sorgen, dass unser Akzent uns verraten könnte. Die kürzlich befreiten Bürger von Paris waren, so rechnete ich mir aus, nach ihrer beschämend raschen Kapitulation 1940 sicher nicht gut auf Menschen zu sprechen, die redeten wie wir. Meine Sorge erwies sich als begründet, denn bei der Zimmersuche wies man uns in fünf verschiedenen Pensionen einfach ab, und das, obwohl wir mehr als genug Geld für einen längeren Aufenthalt vorweisen konnten. Erst als sich eine Frau an der Place Vendôme gnädig zeigte und uns die Adresse einer nahe gelegenen Unterkunft mitteilte, deren Vermieterin keine Fragen stelle, fanden wir Unterschlupf. Ohne sie wären wir vermutlich die wohlhabendsten Obdachlosen der ganzen Stadt geworden.
Das Zimmer, das wir mieteten, lag im östlichen Teil der Île de la Cité. In jenen frühen Tagen blieb ich am liebsten in der Nähe und beschränkte mich darauf, in endlosen Schleifen die kurze Strecke vom Pont de Sully bis zum Pont Neuf abzuspazieren, stets ängstlich darauf bedacht, keine der Brücken zu überqueren, die mich auf unbekanntes Terrain geführt hätten. Ab und zu dachte ich an meinen Bruder, der so gern Forscher geworden wäre, und daran, mit wie viel Freude er die unbekannten Straßen durchstreift hätte, aber wie immer in solchen Momenten schob ich die Erinnerung an ihn rasch beiseite.
Mutter und ich lebten schon seit zwei Monaten auf der Île, als ich endlich den Mut aufbrachte, mich zum Jardin du Luxembourg zu wagen. Beim Anblick der Pflanzenpracht hatte ich das Gefühl, im Paradies gelandet zu sein. Was für ein Unterschied, dachte ich, zu unserer Ankunft an jenem anderen Ort, wo uns die trostlose Ödnis fast erdrückt hatte. Hier atmete man den Duft des Lebens; dort erstickte man am Gestank des Todes. Wie benommen ging ich vom Palais zur Fontaine Médicis und von dort in Richtung des zentralen Bassins, wandte mich allerdings ab, als ich eine Bande kleiner Jungen sah, die Holzboote ins Wasser setzten und sie von der leichten Brise zu ihren Kameraden auf der anderen Seite treiben ließen. Ihr Lachen und aufgeregtes Geplapper klangen nach der bedrückenden Stille der Not, an die ich mich gewöhnt hatte wie eine verstörende Musik. Es schien unfassbar, wie ein und derselbe Kontinent solche Extreme von Schönheit und Hässlichkeit in sich vereinen konnte.
Eines Nachmittags, als ich auf einer Bank neben dem Boulodrome Schutz vor der Sonne suchte, überwältigten mich plötzlich Trauer und Schuldgefühle, und mir liefen die Tränen übers Gesicht. Ein hübscher Junge, vielleicht zwei Jahre älter als ich, blieb mit besorgter Miene vor mir stehen und fragte, was los sei. Ich sah auf und spürte sofort ein leises Sehnen in mir, wünschte mir, er würde mich in die Arme schließen oder mir erlauben, meinen Kopf an seine Schulter zu lehnen. Doch als ich antwortete, fiel ich zurück in alte Sprachmuster, mein deutscher Akzent überwältigte mein Französisch, und der Junge wich einen Schritt zurück, offene Verachtung im Gesicht, ehe er all seiner Wut auf mich und meinesgleichen freien Lauf ließ und mir heftig ins Gesicht spuckte. Dann marschierte er davon. Seltsamerweise minderte seine Tat meine Sehnsucht nach Berührung keineswegs, sondern verstärkte sie noch. Nachdem ich mir die Wangen abgewischt hatte, rannte ich ihm nach, packte ihn am Arm und bot ihm an, mit mir ins Dickicht der Bäume zu gehen, wo er mit mir machen dürfe, was immer er wolle.
»Du darfst mir wehtun, wenn du willst«, flüsterte ich und stellte mir mit geschlossenen Augen vor, wie er mich hart ohrfeigte, mir die Faust in den Magen stieß, mir die Nase brach.
»Warum willst du das?«, fragte er, in seiner Stimme eine Unschuld, an die man angesichts seiner Schönheit kaum glauben mochte.
»Damit ich spüre, dass ich am Leben bin.«
Er wirkte erregt und angewidert zugleich und blickte sich nach möglichen Zuschauern um, ehe er zu dem Wäldchen hinübersah, auf das ich gezeigt hatte. Kurz fuhr er sich mit der Zunge über die Lippen und betrachtete die Rundung meiner Brüste, aber als ich nach seiner Hand griff, empfand er dies offensichtlich als Beleidigung und nannte mich eine Putain. Dann rannte er aus dem Park und verschwand in der Rue Guynemer.
Bei gutem Wetter lief ich schon frühmorgens durch die Straßen und kehrte erst in unsere Wohnung zurück, wenn Mutter schon zu betrunken war, um mich nach meinem Tag zu fragen. Die Eleganz, die ihr in ihrem früheren Leben zu eigen gewesen war, verblasste mittlerweile. Aber sie war immer noch eine attraktive Frau, und ich fragte mich, ob sie sich insgeheim nach einem neuen Mann sehnte, jemandem, der für uns beide sorgen könnte. Allerdings wirkte es auf mich nicht so, als wäre sie auf Liebe oder auch nur Gesellschaft aus, eher schien sie mit ihren Gedanken allein bleiben zu wollen, während sie von Bar zu Bar zog. Wenn sie trank, wurde sie still. Sie saß mit ihrer Weinflasche stets in einer düsteren Ecke und kratzte an unsichtbaren Kerben im Holz der Tischplatte herum, immer darauf bedacht, auf keinen Fall eine Szene zu machen, wegen der man sie hätte hinauswerfen können. Einmal kreuzten sich unsere Wege, als gerade die Sonne über dem Bois de Boulogne unterging. Sie schwankte auf mich zu, griff meinen Arm und fragte mich nach der Uhrzeit, wobei sie gar nicht zu bemerken schien, dass sie mit ihrer eigenen Tochter sprach. Als ich antwortete, lächelte sie erleichtert, da die Bars noch ein paar Stunden offen sein würden, und ging dann in Richtung der verführerisch hellen Lichter weiter, die auf der Île funkelten. Ob sie wohl merken würde, fragte ich mich, wenn ich plötzlich aus ihrem Leben verschwände?
Wir schliefen im selben Bett, und ich hasste es, neben ihr aufzuwachen und ihren stinkenden Atem zu riechen, eine widerliche Mischung aus Alkohol und Schlaf. Sobald sie die Augen öffnete, setzte sie sich kurz verwirrt auf. Dann kehrten die Erinnerungen zurück, sie schloss die Augen wieder und ließ sich, wenn es ihr gelang, erneut in den Zustand der Besinnungslosigkeit hinabgleiten. Wenn sie das unsägliche Tageslicht schließlich nicht länger ignorieren konnte und sich unter der Decke hervorquälen musste, wusch sie sich flüchtig im Waschbecken, zog sich ein Kleid über und ging aus dem Haus, glücklich, den neuen Tag genau so zu verleben wie den davor und den davor und den davor.
Unser Geld und unsere Wertsachen bewahrte sie in einem alten Ranzen hinten im Schrank auf, und ich musste mitansehen, wie unser kleines Vermögen langsam schwand. Eigentlich ging es uns gut – dafür hatten die wahren Getreuen gesorgt –, aber Mutter weigerte sich, mehr Geld für unsere Unterbringung auszugeben, und schüttelte somit jedes Mal den Kopf, wenn ich vorschlug, dass wir uns eine eigene kleine Wohnung in einem günstigeren Stadtteil suchen sollten. Es schien, als folgte sie in ihrem Leben jetzt einem einfachen Plan: sich die Albträume wegzutrinken. Solange sie ein Bett zum Schlafen und eine Flasche Wein hatte, war ihr der Rest egal. Was für ein Unterschied zu der Frau, in deren Arme ich mich in meinen ersten Lebensjahren so gern geworfen hatte, jene bezaubernde Dame der gehobenen Gesellschaft, die wie ein Filmstar stets die angesagteste Frisur und die feinsten Kleider trug.
Diese beiden Frauen hätten verschiedener nicht sein können. Sie hätten sich gegenseitig verachtet.
3
Jeden Dienstagmorgen überquere ich den Hausflur, um meine Nachbarin Heidi Hargrave zu besuchen, die in Apartment drei wohnt. Heidi wird im Dezember neunundsechzig, am Tag von Mariä Empfängnis, was ein reichlich ironisches Datum ist, da sie ihre leiblichen Eltern nie kennengelernt hat und sofort nach der Geburt adoptiert wurde. Heidi ist die einzige Bewohnerin von Winterville Court, die ihr gesamtes Leben hier verbracht hat. Von der Entbindungsstation kam sie direkt nach Mayfair, wo der Hyde Park für sie in ihrer Kindheit ein einziger großer Spielplatz war. Als Teenagerin wurde sie schwanger, heiratete aber nie, und nach dem Tod ihrer Adoptiveltern erbte sie ihr Vermögen.
Obwohl dreiundzwanzig Jahre jünger als ich, ist sie weit weniger fit, und das körperlich wie geistig. Sie hat dreißig Jahre lang am Londoner Marathon teilgenommen, bis sie mit dem Laufen aufhören musste, weil sie am linken Fuß eine schmerzhafte Läuferferse entwickelte, wegen der sie noch heute nachts eine Schiene trägt und regelmäßig Kortisonspritzen bekommt. Ein schwerer Schlag für eine so aktive Frau, und ich frage mich, ob dies zu dem schleichenden Verfall ihrer geistigen Kräfte beigetragen hat. Schließlich stand sie zuvor voll im Leben und war eine hoch angesehene Augenärztin, aber jetzt neigt sie im Gespräch zum Abschweifen. Ihr Zustand ist Gott sei Dank nicht so schlimm wie bei Demenz oder Alzheimer, aber sie agiert mitunter etwas wirr, vergisst, worüber wir gerade eigentlich reden, verwechselt Namen und Orte oder springt so abrupt zum nächsten Thema, dass man kaum mitkommt.
An diesem Dienstagmorgen blätterte sie gerade einige alte Fotoalben durch, als ich kam, und ich hoffte, sie nicht zusammen mit ihr ansehen zu müssen. Ich selbst besitze keine solchen Alben, und ich habe auch nie recht verstanden, warum Menschen sich die Wohnung mit Familienbildern vollstellen. Bei mir stehen nur zwei: ein silbergerahmtes Foto von Edgar und mir, aufgenommen an unserem Hochzeitstag, und ein Bild von Caden bei seinem Abschluss an der Uni. Und auch diese beiden habe ich wohlgemerkt nicht aus emotionalen Gründen aufgestellt, sondern weil man es so von mir erwartet.
Davon abgesehen versteckt sich in einem Fach meines Kleiderschranks ganz hinten eine antike Seugnot-Schmuckschatulle aus Obstholz mit polierten Messingkanten und funktionierendem Schloss, die ich 1946 auf einem Markt in Montparnasse gekauft habe. Ich bewahre ein einziges Foto darin auf, und obwohl ich es mir seit mehr als fünfundsiebzig Jahren nicht angeschaut habe, glaube ich mich gut an das Bild zu erinnern. Ich bin darauf zwölf Jahre alt, und meine Augen sind zum Fotografen gerichtet, mit dem ich nach Kräften kokettiere, denn hinter der Kamera steht Kurt, den Finger auf dem Auslöser, den Blick auf mich geheftet, während ich versuche, meine Leidenschaft für ihn zu verbergen. Er steht ganz aufrecht da, in Uniform, und ich bin hin und weg von seiner schlanken, muskulösen Statur, den blonden Haaren und blassblauen Augen. Ich spüre sein zögerliches Interesse und bin wild entschlossen, es anzufachen.
»Schau mal, Gretel«, sagte Heidi und zeigte mir das Bild eines intelligent aussehenden Mannes am Strand, die Hände in die Hüften gestemmt, im Mund lässig eine Holzpfeife. »Das ist Billy Sprat. Tänzer und russischer Spion.«
»Ach ja?«, sagte ich und schenkte uns Tee ein. Ich fragte mich, ob diese Geschichte wohl ihrer Fantasie entsprungen war – vielleicht hatte sie gestern Abend einen alten James-Bond-Film gesehen und war im Agentenfieber –, allerdings konnte es angesichts der Zeit, aus der das Foto stammte, durchaus der Wahrheit entsprechen. Damals scheint es in England vor russischen Spionen nur so gewimmelt zu haben.
»Billy war ein Freund von meinem Vater. Sie haben ihn dabei erwischt, wie er dem KGB Informationen verkauft hat«, fügte sie aufgeregt hinzu. »Der Geheimdienst wollte ihn schon hochnehmen, aber Billy hat gemerkt, dass seine Tarnung aufgeflogen war, und ist nach Moskau abgehauen. Aufregend, nicht wahr?«
»O ja«, stimmte ich zu. »Und wie.«
»Man hätte darauf bestehen sollen, dass er sich hier vor Gericht verantwortet. Es gibt nichts Schlimmeres als Verbrecher, die ohne Strafe davonkommen.«
Ich erwiderte nichts und sah zum Kaminsims, auf dem eine eckige Uhr aus glänzendem Messing stand, daneben ein paar kleine Porzellanfiguren, die Heidi zu ihren Schätzen zählte.
»Mochtest du die Russen früher?«, fragte sie und nippte an ihrer Tasse. »In den Sechzigern fand ich ja, dass die Idee vom brüderlichen Teilen was hatte. Aber als sie dann angefangen haben, ihre Atomraketen in unsere Richtung zu drehen, fand ich die Sache nicht mehr so toll. Einen weiteren Krieg braucht ja wohl keiner, oder?«
»Ich halte mich aus der Politik raus«, antwortete ich und strich Butter auf zwei warme Scones, von denen ich eins Heidi gab. »Ich habe gesehen, was Krieg mit den Menschen macht.«
»Stimmt, du warst ja damals schon auf der Welt.«
»In den Sechzigern?«, fragte ich. »Ja. Du aber auch, Heidi.«
»Nein, ich meinte, davor. Im Krieg. Im … Wie heißt der noch?«
»Im Zweiten Weltkrieg.«
»Genau.«
»Ja.« Wir hatten uns schon öfter über den Krieg unterhalten, sogar sehr oft, aber ich hatte selten im Detail aus meiner Vergangenheit erzählt, und wenn doch einmal, waren die Sachen meist erfunden. »Aber ich war damals noch ein Mädchen.«
Heidi legte das Album beiseite und drehte sich mit einem schelmischen Blitzen in den Augen zu mir. »Irgendwas Neues von unten?«
Ich schüttelte den Kopf. In Momenten wie diesem war ich froh über ihre plötzlichen Themensprünge.
»Noch nicht«, sagte ich und wischte mir mit einer Serviette die Krümel vom Mund. »Im Süden nichts Neues.«
»Da werden doch wohl keine Farbigen einziehen?«, fragte sie, worauf ich die Stirn runzelte. Heidis zunehmende Verwirrung äußert sich bisweilen auf verstörende Weise darin, dass sie Ausdrücke verwendet, die mittlerweile zu Recht als unangemessen gelten und die sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte wohl nie benutzt hätte. Ich vermute, es ist die Sprache ihrer Jugend, die sich in den sich langsam auflösenden Teilen ihres Gehirns breitmacht. Es ist erstaunlich: Sie kann nicht enden wollende Geschichten aus ihrer Kindheit erzählen, aber sobald man sie fragt, was sie letzten Mittwoch gemacht hat, senkt sich der Nebel.
»Es könnten alle möglichen Leute einziehen«, erwiderte ich. »Wir werden es erst wissen, wenn sie da sind.«
»Viele Jahre hat ein wunderbarer Mann da gewohnt.« Sie strahlte jetzt. »Ein Historiker. Er hat an der University of London gelehrt.«
»Nein, Heidi, das ist Edgar, den du meinst. Mein Mann. Er hat zusammen mit mir gleich gegenüber gewohnt.«
»Ach ja.« Sie zwinkerte mir zu, als teilten wir ein Geheimnis. »Du hast recht. So ein Gentleman. Und immer elegant gekleidet. Ich habe ihn nie ohne Hemd und Krawatte gesehen, glaube ich.«
Ich musste lächeln. Es stimmte, dass Edgar stets sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt und sich selbst an Feiertagen nur ungern »leger« angezogen hatte. Wegen seines Menjoubärtchens hatten manche behauptet, er sähe aus wie Clark Gable. Ein durchaus gerechtfertigter Vergleich.
»Ich wollte ihn mal küssen«, fuhr sie mit Blick zum Fenster fort, und an der Art, wie sie es sagte, merkte ich, dass sie vergessen hatte, mit wem sie sprach. »Natürlich war er deutlich älter als ich, aber das war mir egal. Er hatte eh kein Interesse. Hat mich abblitzen lassen. Weil er seine Frau liebe, wie er gesagt hat.«
»Ach wirklich?«, sagte ich leise und stellte mir die Szene vor. Es überraschte mich nicht, dass Edgar sich nie die Mühe gemacht hatte, mir von dem Zwischenfall zu erzählen.
»Er hat mich sehr höflich zurückgewiesen, und ich war ihm dankbar dafür. Mein Verhalten war ganz und gar schamlos.«
»Hat Oberon dich diese Woche eigentlich schon besucht?« Jetzt war es an mir, das Thema zu wechseln. Oberon ist Heidis Enkel. Er ist um die dreißig, attraktiv, aber mit diesem lächerlichen Namen gestraft. (Heidis Tochter, die vor ein paar Jahren tragischerweise an Krebs gestorben ist, hatte eine Leidenschaft für Shakespeare.) Er arbeitet nicht weit von hier bei Selfridges, wo er irgendein hohes Tier ist, soweit ich weiß, und geht sehr lieb mit seiner Großmutter um. Allerdings irritiert es mich sehr, dass er in meiner Anwesenheit jedes Mal fast schreit und die Silben überdeutlich artikuliert, als wäre ich taub. Dabei bin ich keineswegs taub. Tatsächlich ist bei mir fast alles völlig in Ordnung, was angesichts meines fortgeschrittenen Alters gleichermaßen überraschend und beunruhigend ist.
»Er kommt morgen Abend«, antwortete sie. »Mit seiner Freundin. Es gibt Neuigkeiten, sagt er.«
»Vielleicht wollen sie heiraten«, mutmaßte ich.
»Vielleicht«, stimmte sie nickend zu. »Das hoffe ich. Es ist an der Zeit, dass er zur Ruhe kommt. Wie dein Caden.«
Ich hob eine Augenbraue. Caden war schon so oft zur Ruhe gekommen, dass er zu den entspanntesten Männern Englands hätte zählen müssen, aber ich beschloss, sie nicht mit dem recht unverbindlichen Bindungsverhalten meines Sohnes zu belästigen.
»Wenn du was hörst, gibst du mir Bescheid, ja?«, sagte sie zu mir gebeugt, und mein Gehirn hangelte sich zurück durchs Gespräch, auf der Suche nach der Stelle, an der sie jetzt ihr Lager aufgeschlagen hatte, zumindest bis auf Weiteres.
»Wenn ich was höre, Liebes?«, fragte ich.
»Wenn du was über die neuen Nachbarn hörst. Wir könnten eine Party für sie schmeißen.«
»Ich glaube nicht, dass sie das gut fänden.«
»Oder wenigstens einen Kuchen für sie backen.«
»Das scheint mir angemessener.«
»Was ist mit Juden?«, fragte sie nach einer ausgedehnten Pause. »Es gab Zeiten, da durften in Häusern wie diesem hier keine Juden einziehen. Aber mir ist das gleich. Ich bin allen gegenüber offen. Wenn ich ehrlich bin, fand ich Juden immer sehr freundlich. Überraschend fröhlich, wenn man mal bedenkt, was die alles durchgemacht haben.«
Ich erwiderte nichts. Als ihr kurz darauf die Augen zufielen, nahm ich ihr die Tasse aus der Hand und wusch das Geschirr ab. Ehe ich ging und die Tür hinter mir zuzog, gab ich ihr noch einen zarten Kuss auf die Stirn. Im Hausflur sah ich kurz die Treppe hinunter zu der Wohnung unter meiner. Noch war sie still wie ein Grab.
4
Der Mann hieß Rémy Toussaint und trug eine mit der Trikolore geschmückte Klappe über dem rechten Auge, das er verloren hatte, als eine von ihm platzierte Bombe zu früh explodiert war. Trotz dieser Verunstaltung war er auf brutale Weise attraktiv, mit vollem schwarzen Haar und einem spöttischen Grinsen, das sich als Lächeln tarnte. Er war acht Jahre jünger als Mutter und hätte jede Frau haben können, aber er hatte sich offenbar für sie entschieden, und zum ersten Mal seit dem Tod meines Bruders schien sie sich dem Leben und seinen Möglichkeiten wieder zu öffnen. Sie schränkte ihr Trinken ein und kümmerte sich wieder mehr um ihr Äußeres. Oft saß sie vor dem fleckigen Spiegel in unserem Zimmer und bürstete sich die Haare. Einmal deutete sie an, Gott wolle ihr mit dem neuen Liebesglück vielleicht zeigen, dass er sie nicht verantwortlich mache für die Verbrechen, die an jenem anderen Ort begangen worden waren. Ich war mir da nicht so sicher.
»Bedenk bitte bei Monsieur Toussaint«, sagte sie zu mir und sprach den Namen dabei so präzise aus, als säße sie in einem Auswahlgespräch für die Académie française, »dass er ein Mann von Klasse ist. Seine Ahnentafel ist voller Vicomtes und Marquis, auch wenn er als Égalitariste natürlich nichts auf derlei Titel gibt. Er spielt Klavier und singt, kennt fast alle wichtigen Werke der Literatur, und letzten Sommer waren sogar einige seiner Malereien in einer Ausstellung in Montmartre zu sehen.«
»Und was will er dann von dir?«, fragte ich.
»Er will gar nichts, Gretel«, entgegnete sie, verärgert über meinen Ton. »Er hat sich in mich verliebt. Ist das so schwer zu glauben? Französische Männer bevorzugen nun einmal Frauen eines gewissen Alters und keine unreifen Küken. Sie wissen die Erfahrung und Weisheit zu schätzen. Sei nicht eifersüchtig – in zwanzig Jahren wirst du dankbar sein, dass es so ist.«
Sie drehte sich wieder zum Spiegel, während ich auf dem Bett saß und mich fragte, ob das stimmte. Mir schien eher, dass Männer vor allem Wert auf Attraktivität legten. Und obwohl Mutter früher eine große Schönheit gewesen war, hatte sie seit Ende des Kriegs viel von ihrer Strahlkraft verloren. Ihr schwarzes Haar glänzte weniger, hier und da drängten sich graue Strähnen hinein wie ungebetene Gäste, und die Wangen waren mittlerweile überzogen mit einem Netz winziger Adern, eine Folge ihrer Liebe zum Wein. Allerdings schlugen ihre leuchtend azurblauen Augen nach wie vor jeden in ihren Bann, der ihr gegenübersaß. Es war noch nicht ausgeschlossen, dass ein Mann ihr verfiel, das musste ich zugeben. Außerdem hatte sie recht damit, dass ich eifersüchtig war. Wenn sich schon eine Romanze anbahnte, dann doch bitte mit mir als Protagonistin.
»Ist er reich?«, fragte ich.
»Er zieht sich gut an«, antwortete sie. »Und er isst in teuren Restaurants. Sein Gehstock ist von Fayet und trägt das Familienwappen am Griff. Also ja, ich gehe davon aus, dass er vermögend ist.«
»Und was hat er im Krieg gemacht?«
Sie gab vor, mich nicht gehört zu haben, während sie zum Schrank ging. Dann nahm sie das rote Seidenkleid heraus, das Vater ihr an dem Abend geschenkt hatte, an dem er uns eröffnet hatte, dass wir Deutschland verlassen würden, und zog es an. Früher hatte es sich an ihren Körper geschmiegt und jede Kurve betont, jetzt aber sah es nicht mehr ganz so schmeichelhaft an ihr aus.
»Da fehlt noch ein Gürtel«, sagte sie, während sie sich im Spiegel begutachtete. Sie durchwühlte die Schubladen, bis sie einen fand, dessen Farbe gut mit dem satten Rot kontrastierte.
»Wann lerne ich ihn denn mal kennen?«, fragte ich und schaute zum Fenster hinaus auf die Leute, die unten auf der Straße entlanggingen. Gegenüber war eine Kurzwarenhandlung, in der ein Junge arbeitete, der kaum älter war als ich und mir aufgefallen war. Ich sah ihm oft zu. Wie Kurt hatte er blonde Haare, doch seine fielen ihm in die Stirn, und er schien ständig über irgendetwas zu stolpern, wie ein ungeschicktes Kind. Ich fand ihn süß. Er war kein Tänzer, aber er war schön.
»Sobald er die Einladung ausspricht«, sagte Mutter.
»Aber er weiß, dass du eine Tochter hast?«
»Ich habe es erwähnt.«
»Und hast du auch erwähnt, wie alt ich bin?«
Sie zögerte und runzelte die Stirn. »Warum sollte ihn das interessieren, Gretel? Außerdem hat er selbst eine Tochter. Sie ist natürlich viel jünger als du. Erst vier. Sie lebt bei ihrer Mutter in Angoulême.«
»Also ist er verheiratet?«
»Das Mädchen ist unehelich. Aber als Ehrenmann kommt er natürlich für sie auf.«
»Vielleicht könnte ich abends irgendwann mal mit euch beiden ausgehen«, schlug ich vor, während sie sich etwas Parfum auf Hals und Handgelenke sprühte. Den Flakon mit Guerlain Shalimar hatte sie sieben Jahre zuvor von Großmutter zum Geburtstag bekommen, und der Inhalt ging mittlerweile gefährlich zur Neige. Der Duft trug mich zurück zu unserer Abschiedsparty in Berlin, als der Sieg zum Greifen nah gewirkt hatte und dem Reich eine tausendjährige Zukunft bevorzustehen schien. Ich sah meinen Bruder am Geländer stehen und die Offiziere und ihre Frauen betrachten, wie sie sich zum Empfang versammelten. Wir waren beide fasziniert von den Uniformen und Kleidern, die durch die Eingangshalle rauschten, ein Meer aus Farben. War das wirklich erst vier Jahre her? Es fühlte sich an, als wären seither mehrere Leben vergangen, und die zweihundert Wochen, die das Damals vom Heute trennten, trieften vor Blut.
»Wohl kaum«, erwiderte sie und prüfte sich ein letztes Mal im Spiegel, ehe sie das Zimmer verließ, bereit für alle Abenteuer, die die Nacht für sie bereithalten mochte.
Ich blickte wieder aus dem Fenster und sah, wie der Kurzwarenhändler Monsieur Vannier hinaus auf den Bürgersteig trat, wo ein Auto gehalten hatte. Der Chauffeur öffnete den Kofferraum, und der Junge, den ich so mochte, kam mit mehreren wackelig aufeinandergestapelten Kartons aus der Ladentür. Wie nicht anders zu erwarten, rutschte er auf dem Weg zum Wagen aus, sodass eine der Kisten herunterfiel, rasch gefolgt von den anderen. Zum Glück war es ein trockener Abend, und nichts kam zu Schaden, aber Monsieur Vannier beschimpfte und ohrfeigte den Jungen trotzdem, worauf dieser sich die Wange rieb. Vielleicht spürte er, dass ihn jemand beobachtete, jedenfalls blickte er auf, sah mich und wurde knallrot. Rasch drehte er sich um und verschwand just in dem Moment im Laden, als Mutter über einen der heruntergefallenen Kartons stieg und in einer Nebenstraße verschwand.
5
Ich bin seit vielen Jahren Mitglied in der Stadtbibliothek Mayfair in der South Audley Street. Von meiner Wohnung aus sind es zu Fuß zehn Minuten bis dorthin, ein angenehmer Spaziergang, den ich oft unternehme, um mir Bücher auszuleihen. Auch Edgar war ein leidenschaftlicher Leser, und viele seiner Bücher stehen immer noch in den Regalen seines ehemaligen Arbeitszimmers, das jetzt das Gästezimmer ist, doch unsere Vorlieben waren grundverschieden. Er war von Beruf Historiker, aber las in seiner Freizeit vornehmlich zeitgenössische Romane, ich dagegen bevorzuge in der Regel Sachbücher und greife immer wieder zu diesen, wenn ich die Bestände der Bibliothek ablaufe. Ich meide alles, was mit der Zeit meiner Kindheit zu tun hat, bin aber fasziniert von den alten Griechen und Römern. Besonders interessieren mich auch Autobiografien von Astronauten, vielleicht, weil ich den exzentrischen Wunsch, dem Planeten zu entfliehen, gut nachempfinden kann. Ich bin nicht ganz so lesebegierig, wie Edgar es war, aber die Bücherliebe ist auf jeden Fall ein Charakterzug, den Vater, ebenfalls ein passionierter Bibliophiler, an beide seiner Kinder vererbt hat.
Mein Bruder las natürlich am liebsten Bücher über Forscher, denn er war überzeugt, eines Tages selbst einer zu werden. Einmal hörte ich, wie er Pavel, einem unserer Bediensteten an jenem anderen Ort, von unserem Haus in Berlin erzählte und wie er und seine Freunde es stundenlang erforscht hätten: den riesigen Dachboden, vollgestellt mit dem Gerümpel vieler Jahre, das dunkle Kellerlabyrinth und auch die anderen verwinkelten Etagen, in denen der Architekt seiner Leidenschaft für unübersichtliche Ecken und Winkel freien Lauf gelassen hatte. Pavel dürfte das alles kaum interessiert haben, aber mein Bruder schwatzte mit der ihm eigenen Ignoranz einfach weiter.
»Kannst du denn hier nicht auch ein bisschen forschen?«, fragte Pavel mit gesenkter Stimme, da Kurt, der ihm explizit verboten hatte, mit uns Kindern zu reden, gerade draußen in der Sonne seine Stiefel polierte. Du würdest dich doch nicht mit einer Ratte unterhalten, oder?, hatte Kurt mich gefragt, und um ihm zu gefallen, hatte ich laut losgelacht und seinen Humor gelobt.
»Ich darf nicht«, antwortete mein Bruder traurig.
»Und du hältst dich an solche Regeln?«, fragte Pavel mit erschöpfter Resignation in der Stimme. »Vielleicht hast du Angst vor den Dingen, die du entdeckst, wenn du über den Zaun schaust.«
»Ich habe vor gar nichts Angst«, erwiderte mein Bruder empört und setzte sich auf.
»Das solltest du aber.«
Es folgte eine längere Stille. Ich blickte meinem Bruder hinterher, als er die Treppe hinauf in sein Zimmer ging und über Pavels Worte nachdachte. Vom Morgen unserer Ankunft an hatten Mutter und Vater ihm eingebläut, er müsse immer in der Nähe des Hauses bleiben. Sie hätten wissen müssen, dass er nicht hören würde. Das tun kleine Jungs schließlich fast nie.
Als ich an diesem Morgen aus der Bibliothek zurückkehrte, unter dem Arm eine jüngst erschienene Biografie über Marie Antoinette, fiel mir ein unbekannter Wagen auf, der vor unserem Haus parkte. Ich starrte ihn mit unbehaglichem Gefühl an. In unserer Straße gibt es nur eine Handvoll Parkplätze, und für die werden so hohe Gebühren verlangt, dass sie nie jemand benutzt. Die Anwohner haben Parkplaketten für eine nahe gelegene Tiefgarage, und nur jemand, der ein Idiot oder Millionär oder beides ist, würde heutzutage noch mit dem Auto ins Zentrum von London fahren. In der Lobby blieb ich vor Apartment eins stehen und drückte mein Ohr an die Tür. Ich hörte Bewegungen, aber keine Stimmen.
Behutsam klopfte ich ans Holz, wollte zwar gehört werden, aber gleichzeitig nicht stören. Die Tür öffnete sich, und mir gegenüber stand eine junge Frau, höchstens fünfunddreißig, mit einer pinken Strähne im platinblonden Haar und einem Kleidungsstil, der sich wohl am besten als eklektisch beschreiben ließ. Ihr Elan beeindruckte mich auf der Stelle.
»Hallo«, grüßte sie mich. Ihr Gesicht drückte Offenheit aus, und ich erwiderte diese, indem ich ihr die Hand hinstreckte.
»Gretel Fernsby«, sagte ich. »Ihre Nachbarin von oben. Wie ich sehe, ziehen Sie ein.«
»O nein«, sagte sie kopfschüttelnd. »Ich bin nur die Innenarchitektin. Ich messe gerade den Space aus.«
Schon wieder dieses Wort. Der Space. Warum bezeichnete niemand mehr die Dinge als das, was sie waren? Sprache verwandelte sich in meinen Augen immer mehr in ein Minenfeld, selbst einfachste Wörter galten nun als anstößig und wurden verbannt. Womöglich durfte man »Wohnung« nicht mehr sagen, weil es zu bürgerlich war. Oder zu proletarisch. Am sichersten war es, man hielt den Mund. Was bedeutete, dass die Welt sich vielleicht doch nicht so sehr verändert hatte.
»Alison Small«, stellte sie sich vor. »Von Small Interiors.«
»Angenehm«, sagte ich und horchte in mich hinein, ob ich nun enttäuscht war oder nicht. Ich verfüge durchaus über Menschenkenntnis, und die Frau schien mir ein angenehmer Mensch, weshalb ich vollkommen einverstanden gewesen wäre, wenn sie unter mir gewohnt hätte. Allein schon ihre Kleidung hätte mich bestens unterhalten. »Sie nehmen vermutlich Maß für die Vorhänge und so was? Schauen, wie man die Sofas am besten stellt?«
»Genau«, sagte sie, trat zurück und winkte mich herein. »Möchten Sie mal gucken?«
Ich dankte ihr und betrat die Wohnung. Sie hätte wohl nicht jeden einfach so hereingebeten, aber älteren Herrschaften vertrauen die Menschen nun einmal instinktiv. Wie gefährlich konnte jemand wie ich schon sein? Es fühlte sich jedenfalls seltsam an, in Mr Richardsons Apartment zu stehen, jetzt, da all seine Sachen fortgeschafft worden waren. Seine Wohnung war exakt genauso geschnitten wie meine eigene im Stock darüber, und plötzlich sah ich mit erschreckender Klarheit vor mir, wie es dort aussehen würde, wenn ich eines Tages tot wäre, mein ganzer Besitz im Container oder bei Oxfam, sämtliche Dinge, die ich über die Jahre angesammelt hatte, jeder Beweis meiner Existenz, angefangen bei dem Gemälde, das Edgar mir zur Hochzeit geschenkt hatte, bis zu dem Silikonpfannenwender, den ich beim Braten benutzte. Caden, da war ich mir sicher, hätte die Wohnungsanzeige geschaltet, noch ehe die Leichenstarre bei mir eingesetzt hätte.
»Wohnen Sie schon lange hier?«, fragte Miss Small, und ich nickte, überrascht vom Echo, nun, da es keine Polster oder Möbel mehr gab, die den Schall schluckten.
»Mehr als sechzig Jahre«, antwortete ich.
»Sie Glückspilz! Ich würde meinen linken Arm dafür geben, in diesem Teil von London wohnen zu können.«
»Darf ich fragen …« Ich machte eine kurze Pause, unsicher, ob ich zu weit ging. »Ihr Kunde. Oder Ihre Kunden. Ziehen die bald ein?«
»Ja, sehr bald, soweit ich weiß«, antwortete sie und zielte mit einem elektronischen Gerät auf eine der Wände. Ein roter Punkt leuchtete dort auf, und sie las etwas auf der Anzeige ab. Ich hatte keine Ahnung, was der Punkt bedeutete oder was sich daraus ableiten ließ, aber ihrer gerunzelten Stirn nach zu schließen, war es etwas sehr Wichtiges. »Deshalb müssen mein Team und ich uns auch ranhalten. Gott sei Dank weiß ich genau, was sie wollen. Ich habe schon mal für sie gearbeitet.«
»Sie?«, fragte ich und klammerte mich an das Wort wie ein Ertrinkender an einen Rettungsring. »Also ist es ein Paar?«
Sie zögerte. Mir fiel auf, wie dick ihr Lippenstift aufgetragen war. Man hörte ein schmatzendes Geräusch, wenn sie die Lippen öffnete.
»Darüber sollte ich besser nicht mit Ihnen sprechen, Mrs Fernsby. Sie wissen schon, wegen Diskretion und so.«
»Oh, ich bin sicher, sie hätten nichts dagegen«, erwiderte ich und tat mein Bestes, nicht wie jemand zu klingen, der seine Nase ständig in die Angelegenheiten seiner Nachbarn steckte. »Schließlich wohnen sie ja demnächst direkt unter mir.«
»Trotzdem. Ich weiß, wie viel Wert sie auf Privatsphäre legen. Und wie gesagt, sie ziehen ja bald ein, dann lernen Sie sie kennen.«
Ich nickte enttäuscht.
»Ich weiß, wie belastend das ist«, fügte sie hinzu, wahrscheinlich, weil sie sah, dass ich mir Sorgen machte. »Neue Nachbarn, mit denen man plötzlich klarkommen muss, obwohl man schon so lange in einem Haus wohnt. Der Voreigentümer dieser Wohnung hat auch viele Jahre hier gewohnt, nehme ich an?«
»Eigentlich nicht. Er ist erst 1992 hier eingezogen.«
Sie lachte. Warum, verstand ich nicht.
»Seien Sie unbesorgt, mit meinen Kunden werden Sie keine Probleme haben. Sie sind sehr …« Sie brach ab, suchte nach den richtigen Worten. »Wie sage ich das? Sie sind … Sie interessieren sich also für die Französische Revolution?«
Perplex von dem plötzlichen Themenwechsel starrte ich sie an. Die Verwirrung stand mir anscheinend ins Gesicht geschrieben, weshalb sie in Richtung des Buches nickte, das ich bei mir trug.
»Marie Antoinette«, ergänzte sie.
»O ja«, sagte ich mit einem Schulterzucken. »Mächtige Männer und Frauen faszinieren mich seit jeher. Mich interessiert, wie sie mit ihrer Macht umgehen, ob sie sie für das Gute oder Schlechte einsetzen und wie sie sich selbst dadurch verändern.«
Meine Antwort schien ihr etwas unangenehm zu sein, vielleicht, weil sie ausführlicher ausgefallen war als erwartet. Dann hob sie wieder ihren Apparat und richtete ihn auf die Wand zur Straße hin. Auf dem Fensterrahmen erschien ein weiterer roter Punkt und tat was auch immer, und ich fragte mich, ob sie das Gerät auf mich richten würde, wenn ich noch länger bliebe.
»Also, ich mach dann mal weiter«, sagte sie schließlich.
Ich drehte mich nickend um und ging Richtung Tür, startete dann aber doch noch einen Versuch, in der Hoffnung, dass sie mir zumindest diese Ungewissheit nehmen konnte. »Eine letzte Frage. Ihre Kunden – die haben doch keine Kinder, oder?«
Sie wirkte verlegen. »Es tut mir leid, Mrs Fernsby.«
Frustriert winkte ich zum Abschied und ging dann die Treppe hinauf. Erst als ich mir kurze Zeit später eine Kanne Tee kochte, wurde mir klar, dass ich nicht sicher sein konnte, was ihre Antwort bedeutete. Tat es ihr leid, weil sie meine Frage nicht beantworten durfte? Oder weil, ja, es war ein Kind dabei? Oder nein, kein Kind, und es tat ihr leid, die alte Dame enttäuschen zu müssen, die sich womöglich darauf gefreut hatte, dass es bald wieder etwas mehr Leben im Haus geben würde? Wer konnte das wissen.
6
An einem schönen Morgen, als auf der Île das Sonnenlicht durch das dichte Blätterdach der Bäume tröpfelte, ging ich über den Pont Marie zur Place des Vosges, um dort, wie ich es gelegentlich tat, auf einer Bank ein Buch zu lesen und die wohlhabenderen Pariser dabei zu beobachten, wie sie herausgeputzt vorbeiflanierten. Ich bewunderte ihre schamlose Heuchelei, die Art, mit der diese Schar ehemaliger Bonzen vorgab, an Égalité zu glauben, gleichzeitig aber mit Kleidung und Schmuck ihre vermeintlich angeborene Supériorité zum Ausdruck brachte.
Der Krieg hatte sich für die Franzosen als großer Gleichmacher erwiesen, trotzdem hatte man den Eindruck, die unteren Schichten hätten dem Vichy-Regime mehr entgegengesetzt als die oberen, sodass die Zeit der Abrechnung gekommen war. Nun war das Wort »Kollaborateur« so gefürchtet wie das Wort »Aristokrat« anderthalb Jahrhunderte zuvor. In den Gesichtern der Reichen las ich Angst, und ich vermutete, dass die Mienen damals ähnlich ausgesehen haben mussten, als die Versammlung der Generalstände einberufen worden war. Jetzt war es allerdings die Épuration légale, die juristisch betriebene Säuberung, die diese Leute vor Gericht brachte, wo das Urteil entweder auf Tod oder milder auf Dégradation nationale, also den Verlust von Bürgerrechten, lautete.
Es war in Momenten wie diesem, in denen ich allein war mit meinen Gedanken, dass mir mein Gewissen am meisten zusetzte. Drei Jahre waren seit dem Tod meines Bruders vergangen, und sechs Monate, seit man meinen Vater gehängt hatte, und ich vermisste beide. An den Verlust meines Bruders erlaubte ich mir fast nie zu denken, während der Tod meines Vaters mich tagtäglich beschäftigte. Denn allmählich begann ich zu begreifen, woran er beteiligt gewesen war – woran wir beteiligt gewesen waren –, und die Unmenschlichkeit seiner Taten standen in so scharfem Kontrast zu dem Mann, den ich zu kennen geglaubt hatte, dass es ebenso gut zwei verschiedene Menschen hätten sein können. Ich redete mir ein, dass nichts davon meine Schuld gewesen sei, dass ich nur ein Kind gewesen war, aber eine leise Stimme in meinem Kopf fragte, warum ich unter falschem Namen lebte, wenn ich doch so unschuldig war.
Während ich das Treiben auf dem Platz beobachtete, erschien auf der anderen Seite des Brunnens ein Mann von eindrucksvoller Statur. Als er auf mich zukam, erkannte ich in ihm Monsieur Toussaint, Mutters Geliebten. Ich schaute weg und hoffte, dass er nicht stehen bleiben würde, um sich mit mir zu unterhalten. Wir waren einander noch nicht vorgestellt worden – ich hatte ihn nur durch die Fenster der Bars gesehen, in denen er und Mutter saßen und etwas tranken –, und ich verspürte auch keine große Lust, seine Bekanntschaft zu machen. Aber hier stand er nun, zog den Hut und verbeugte sich galant. Seine Dämlichkeit ärgerte mich. War er wirklich so borniert, dass er sich für einen modernen Musketier und mich für eine verzweifelte Jungfrau auf dem Weg nach Versailles hielt?
»Habe ich die Ehre, mit Mademoiselle Gretel Guéymard zu sprechen?«, fragte er. Die Silben unseres erfundenen Nachnamens klangen in meinen Ohren immer noch fremd.
»Haben Sie«, antwortete ich. »Und Sie sind dann wohl Monsieur Toussaint?«
Er lächelte, und ich erkannte, warum eine Frau ihm leicht verfallen konnte. Sein faltenloses Gesicht war glatt rasiert, lediglich über die Oberlippe zog sich ein schmaler Schnurrbart, der ihm etwas Schelmisches verlieh und seine dicken, unnatürlich roten Lippen betonte. Der Blick seines stechend blauen Auges – das andere lag verborgen hinter der Augenklappe – ruhte auf mir, aber ich wusste nicht recht, ob ich das schmeichelhaft oder unangenehm finden sollte. Ich war in dem Alter, in dem sich mein Kopf auf der Straße jeden Tag ein Dutzend Mal wie von selbst nach hübschen Jungen umdrehte, aber in Monsieur Toussaints Starren erahnte ich etwas Beunruhigendes. Er war attraktiv, keine Frage, aber irgendwie kam mir das Ganze wie die Verkehrung des griechischen Mythos vor, als wäre er Medusa und ich Perseus, weshalb es wohl besser war, ihn nicht allzu lange anzuschauen.
»Dann hat Ihre Mutter also von mir gesprochen«, sagte er.
»Ein- oder zweimal vielleicht«, erwiderte ich und bereute sogleich, seinem Narzissmus geschmeichelt zu haben.
»Madame Guéymard ist eine vornehme Frau, und ich bin hocherfreut, endlich ihre Tochter kennenzulernen. Sie spricht oft von Ihnen.«
Ich fragte mich, ob er log, denn es war kaum vorstellbar, dass Mutter mich überhaupt erwähnt hatte. Eine fünfzehnjährige Tochter hätte sie in den Augen eines jeden Mannes altern lassen, und es war auch nicht so, dass ich Dinge geleistet hatte, mit denen sie hätte prahlen können.
»Das bezweifele ich«, forderte ich ihn heraus und sah im selben Moment Interesse in seinem Blick aufflackern, einen Anflug von Überraschung darüber, dass ich nach dem Kompliment nicht in ein albernes Grinsen verfiel. Ich hatte das Gefühl, ihn ein Stück weit in der Hand zu haben, solange ich mich nur anders verhielt als erwartet. Ich spürte die erwachende Macht der Frau in mir.
»Wie haben Sie mich erkannt?«, fragte ich.
Er zuckte mit den Schultern, als wäre ich nun mal in ganz Paris bekannt. »Sie ähneln ihr. Außerdem habe ich Sie manchmal abends gesehen, als Sie uns nachspioniert haben, wahrscheinlich aus Sorge, dass Ihrer Frau Mama auf der Straße etwas passieren könnte. Sie spielen die Mutter für sie, wie mir scheint, sorgen dafür, dass sie sicher nach Hause kommt. Oder bin womöglich ich derjenige, dem Sie nachstellen?«
Mir gefiel es nicht, dass er mich ohne mein Wissen beobachtet hatte.
»Ich sehe ganz anders aus als sie«, hielt ich dagegen, seine Frage ignorierend. »Ich komme nach meiner Großmutter väterlicherseits, in ihren jungen Jahren. Das sagen alle.«
»Dann muss sie eine große Schönheit gewesen sein«, bemerkte er, worauf ich die Augen verdrehte.
»Treffen Ihre Pfeile eigentlich auch mal ins Ziel? Sie müssen mich für furchtbar naiv halten.«
Er wirkte mit einem Mal verunsichert, wohl nicht daran gewöhnt, dass man ihn verspottete, und das bereitete mir solches Vergnügen, dass ich nicht aufhören konnte.
»Darf ich fragen, Monsieur Toussaint, ob Sie Schriftsteller sind?«
»Bin ich nicht«, antwortete er und runzelte die Stirn. »Weshalb glauben Sie das?«
»Weil Sie wie einer reden. Und zwar wie ein schlechter. Wie einer, der Groschenromane schreibt.«
Dann stand ich auf und wollte gehen, aber er hielt mich am Handgelenk fest, sein Griff weder sanft noch aggressiv.
»Sie sind eine junge Frau von außergewöhnlicher Grobheit, Mademoiselle Gretel«, erklärte er, offensichtlich zufrieden mit der Bemerkung. »Fühlen Sie sich nicht schuldig?«
Ich starrte ihn an. »Schuldig für was?«
»Schuldig für Ihre Grausamkeit.«
Die Stille zwischen uns schien ewig anzuhalten.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte ich schließlich. »Grausamkeit gegenüber wem?«
»Gegenüber mir. Was dachten Sie denn?«
Ich schwieg. Ich wollte weglaufen, so weit wie möglich.
»Sie sind nicht wie andere Mädchen in Ihrem Alter«, fuhr er fort. »Es wäre spannend, Sie privat kennenzulernen, glaube ich. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Jungen und Männern, und den würde ich Ihnen nur zu gern zeigen.« Er strich mir mit den Fingern der anderen Hand so zart über die Wange, dass ich unwillkürlich die Augen schloss. Es war, als würde er mich verzaubern. Ich konnte in diesem Spiel nicht gegen ihn gewinnen, seine Erfahrung machte ihn zu einem überlegenen Gegner.
Zufrieden mit seiner Machtdemonstration ließ er mein Handgelenk endlich los und ging, während ich mich dafür verfluchte, ihm so einfach den Sieg geschenkt zu haben. Nach ein paar Metern blickte er sich noch einmal um. Als er sah, dass ich ihm immer noch nachschaute, lachte er.
7
Am frühen Abend kam unerwartet Caden zu Besuch, und kaum hatte er die Wohnung betreten, fiel mir auf, dass er zugenommen hatte. Er war nie ein zartes Kind gewesen, aber solange er als Erwachsener auf dem Bau gearbeitet hatte, war er in Form gewesen. Kurz nach seinem dreißigsten Geburtstag jedoch hatte er, finanziert mit Geld von Edgar und mir, eine eigene Firma gegründet, was augenblicklich dazu geführt hatte, dass es mit seiner Figur bergab ging. Wahrscheinlich lag es daran, dass er nun die meiste Zeit am Schreibtisch verbrachte und die körperliche Arbeit anderen überließ. Ich ertrug es kaum mitanzusehen, wie sein Bauch mittlerweile fast das Hemd sprengte.
»Ich bin angerufen worden«, sagte er und ließ sich mit einem Stöhnen in einen Sessel fallen. Die Tasse Tee, die ich ihm anbot, lehnte er ab, er wollte lieber einen Whisky. Ich brachte ihm ein Glas Macallan.
»Und worum ging es?«, fragte ich.
»Um die Wohnung.«
»Welche Wohnung?«
»Diese Wohnung. Deine Wohnung.« Er sah sich mit ausgebreiteten Armen um, als wäre er der König dieses Reichs und nicht bloß der Kronprinz. »Man hat uns ein Angebot gemacht.«
Ich brauchte einen Augenblick, um mich zu fassen und nicht an die Decke zu gehen.
»Wieso, bitte schön, macht uns jemand ein Angebot«, fragte ich, »wenn die Wohnung gar nicht zum Verkauf steht?«
»Manchmal fragen Leute halt an«, erklärte er gelassen, wagte aber nicht, mich dabei anzusehen. »Die Nachfrage nach Eigentum in diesem Teil von London ist riesig. Sie bieten drei Komma eins.«
»Drei Komma eins was?«
»Drei Komma eins Millionen.«
»Kann nicht sein«, erwiderte ich und ging zum Barschrank, um mir selbst auch einen Whisky einzuschenken. Ich würde ihn brauchen, wenn wir dieses Gespräch weiterführen wollten.
»Das ist deutlich mehr, als ich erwartet hätte«, sagte er. »Es wäre dumm, nicht wenigstens darüber zu sprechen.«
»Wir sprechen ja darüber«, bemerkte ich spitz. »Das tun wir just in diesem Moment.«
»Ich habe mich mal umgesehen, was es so gibt«, fuhr er fort und ignorierte meine Bemerkung. »Wir bekämen für rund eins Komma fünf etwas sehr Passendes für dich, damit blieben uns noch eins Komma sechs als Spielgeld.«
»Uns?«, entfuhr es mir. »Du meinst doch wohl mir, oder? Und was soll ich dann mit diesen eins Komma sechs Millionen Pfund machen? Sie auf ein Pferd setzen?«