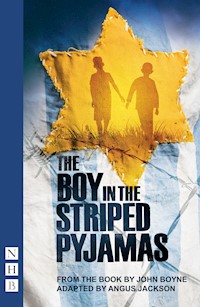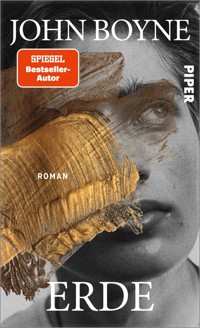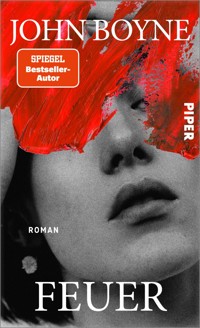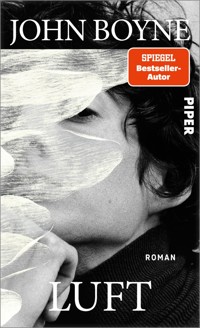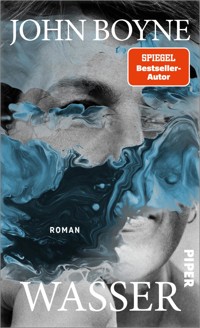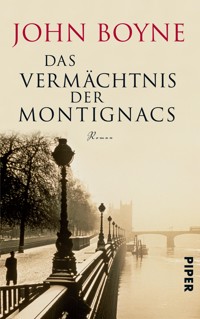9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Odran Yates kommt 1972 an das renommierte Dubliner »Clonliffe Seminary«, um Priester zu werden. Voller Hingabe widmet er sich seinen Studien. Er kann es kaum erwarten, endlich Gutes zu tun. Vierzig Jahre später ist sein Vertrauen in die katholische Kirche jedoch zutiefst erschüttert. Er muss dabei zusehen, wie Priester vor Gericht stehen, wie einstige Würdenträger ins Gefängnis kommen und wie das Leben zahlreicher Kollegen zerstört wird. Odran zieht sich zurück – aus Angst vor den missbilligenden Blicken seiner Umwelt. Erst als bei einem Familientreffen alte Wunden aufgerissen werden, sieht er sich gezwungen, sich den Ereignissen zu stellen und seine Komplizenschaft zu erkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Sonja Finck
ISBN 978-3-492-97103-4
Oktober 2015
© John Boyne 2014
Die englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »A History of Loneliness« bei Doubleday, einem Imprint von Transworld Publishers (A Random House Group Company).
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Manoj Shah/ gettyimages, Shutterstock
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Über das Leben zu schreiben ist leicht – es zu leben ist sehr viel schwieriger.
E. M. Forster
Erstes Kapitel
2001 Erst spät in meinem Leben begann ich mich dafür zu schämen, dass ich Ire bin.
Vielleicht sollte ich mit dem Abend beginnen, an dem ich meine Schwester zum Essen besuchte und sie sich nicht daran erinnern konnte, mich eingeladen zu haben. An jenem Abend bemerkte ich zum ersten Mal, dass etwas mit ihr nicht stimmte.
Gegen Mittag war George W. Bush in Washington für seine erste Amtszeit als Präsident vereidigt worden, und als ich in der Grange Road im Süden von Dublin ankam, saß Hannah vor dem Fernseher und schaute sich einen Bericht über die Zeremonie an.
Mein letzter Besuch lag ein knappes Jahr zurück. Es war mir etwas unangenehm, dass ich, nachdem ich in den Monaten nach Kristians Tod häufiger bei ihr vorbeigeschaut hatte, in alte Gewohnheiten zurückgefallen war und nur selten anrief und mich noch seltener mit ihr zum Mittagessen im Bewley’s Café in der Grafton Street verabredete. Das Bewley’s erinnerte uns beide an unsere Kindheit, denn dorthin hatte Mam uns immer mitgenommen, wenn wir in der Adventszeit in die Innenstadt fuhren, um das Weihnachtsschaufenster von Switzer’s zu bewundern. Im Bewley’s hatten wir auch zu Mittag gegessen – Würstchen mit Bohnen und Pommes –, nachdem der Schneider des Clerys bei uns Maß genommen hatte, erst für meinen Kommunionsanzug und ein paar Jahre später für Hannahs Kommunionskleid. Wir hatten dort wunderbare Nachmittage verbracht, hatten Buttercremetorte gegessen und Fanta getrunken. Vor der Kirche von Dundrum stiegen wir in den Bus 48A, der uns in die Innenstadt brachte. Hannah und ich rannten hoch aufs Oberdeck, setzten uns ganz nach vorn und umklammerten die Eisenstange, während der Bus durch Milltown und Ranelagh fuhr, über die Charlemont Bridge und bis zum alten Metropole-Kino hinter der Tara Street Station, wo wir uns Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando und Trevor Howard angeschaut hatten. Allerdings hatten wir den Film nur bis zur Hälfte gesehen, denn als die Tahitianerinnen mit ihren entblößten Brüsten, die lediglich von Blumengirlanden bedeckt waren, in Kanus auf das Schiff zuruderten, auf dem sich eine Horde lüsterner Matrosen befand, zerrte Mam uns aus dem Saal. Noch am selben Abend schrieb sie einen Brief an die Evening Press und forderte, der Film solle aus den Kinos verbannt werden. »Ist dies ein katholisches Land oder nicht?«, empörte sie sich.
In den fünfunddreißig Jahren, die seitdem vergangen waren, hatte sich das Bewley’s Café nicht großartig verändert, und ich ging immer noch gern hin. Ich bin ein nostalgischer Mensch, was nicht immer gut ist. Kindheitserinnerungen werden wach, sobald mein Blick auf die Sitzbänke mit den hohen Rückenlehnen fällt, in denen nach wie vor Menschen aller Couleur Platz nehmen: Rentner mit schlohweißem Haar, echte Gentlemen, glatt rasiert und nach Old Spice duftend, lesen in feinen Anzügen den Wirtschaftsteil der Irish Times, obwohl das rein gar nichts mehr mit ihrem Leben zu tun hat. Hausfrauen genießen ihren Vormittagskaffee und sind froh, einen Moment für sich zu haben, während sie der wunderbaren Stimme von Méav lauschen, die aus den Lautsprechern dringt. Studenten des Trinity College essen Wurstsandwiches, trinken Unmengen von Kaffee, lachen laut und stoßen sich gegenseitig an, weil sie jung sind und die Gesellschaft genießen. Ein paar arme Schlucker erkaufen sich mit einer Tasse Tee ein oder zwei Stunden Wärme. Es ist ein großes Glück für Dublin, dass das Bewley’s jedem seine Türen öffnet, und hin und wieder nutzten Hannah und ich diese Gastfreundschaft – ein Mann mittleren Alters und seine verwitwete Schwester, beide gepflegt gekleidet, die sich leise unterhielten und immer noch gern Buttercremetorte aßen, deren Magen aber keine Fanta mehr vertrug.
Hannah hatte mich ein paar Tage zuvor angerufen und mich zum Abendessen eingeladen, und ich hatte sofort zugesagt. Nach ihrem Anruf hatte ich mich gefragt, ob sie sich vielleicht einsam fühlte. Ihr ältester Sohn, mein Neffe Aidan, arbeitete in London auf dem Bau und kam fast nie nach Hause. Ich wusste, dass er sogar noch seltener anrief als ich. Allerdings war er in jenen Jahren auch kein besonders umgänglicher Mensch. Als Kind war er fröhlich und offenherzig gewesen und hatte gern den Alleinunterhalter gespielt, aber eines Tages hatte er sich schlagartig verändert und war zu einem zornigen, verschlossenen Jungen geworden, der Hannah und Kristian das Leben schwer machte. Als er heranwuchs, wurde die Wut, die ihn von innen vergiftete, nicht weniger – im Gegenteil, sie wurde immer größer und zerstörte alles, was mit ihr in Berührung kam. Aidan war groß und breitschultrig und hatte die helle Haut und das blonde Haar seines norwegischen Vaters geerbt. Die Frauen lagen ihm zu Füßen. Leider hatte er auch ein schier unstillbares Verlangen nach ihnen. So hatte er ein Mädchen geschwängert, als die beiden nicht einmal alt genug zum Autofahren waren, und eine Zeit lang gab es deswegen großen Ärger. Nach einem furchtbaren Streit zwischen Kristian und dem Vater des Mädchens, bei dem sogar die Polizei anrücken musste, beschlossen sie, das Kind zur Adoption freizugeben.
Bei mir hatte sich Aidan schon lange nicht mehr gemeldet. Wenn wir uns begegneten, lag Verachtung in seinem Blick. Einmal, als er nicht mehr ganz nüchtern war, baute er sich auf einer Familienfeier vor mir auf und stützte eine Hand an der Wand ab, sodass ich zwischen seinem Arm und seinem Oberkörper gefangen war. Er roch so sehr nach Zigaretten und Alkohol, dass ich den Kopf abwandte, woraufhin er süffisant bemerkte: »Ich hätte da mal eine Frage. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass dein Leben für die Katz ist? Wünschst du dir nie, du könntest die Zeit zurückdrehen und noch mal von vorn beginnen? Alles anders machen? Willst du nicht manchmal ein normales Leben führen?« Ich schüttelte den Kopf und antwortete, dass ich sehr zufrieden mit meinem Leben sei und dass ich zu meiner Entscheidung stünde, obwohl ich sie in sehr jungen Jahren getroffen hätte. Ich stünde zu meiner Entscheidung, wiederholte ich, und auch wenn er sie sinnlos finde, verleihe sie meinem Leben Klarheit und ein Ziel, Dinge, die ihm offenbar fehlten. »Damit könntest du recht haben, Odran«, sagte er, trat einen Schritt zurück und gab mich frei. »Aber ich könnte so nicht leben. Lieber würde ich mir eine Kugel in den Kopf jagen.«
Nein, Aidan hätte meine Entscheidungen niemals treffen können, und heute bin ich dafür dankbar. Er ist einfach nicht so arglos und konfliktscheu wie ich. Schon als Junge hatte er mehr Mut, als ich jemals haben werde. Jetzt lebte er in London mit einer Frau zusammen, die einige Jahre älter war als er und schon zwei Kinder hatte, was ich merkwürdig fand, schließlich hatte er ein paar Jahre zuvor nichts von seinem eigenen Kind wissen wollen.
In Hannahs Haus wohnte jetzt nur noch ihr jüngerer Sohn Jonas, ein stiller Junge, mit dem man kein richtiges Gespräch führen konnte, weil er immer auf seine Schuhe starrte oder die Finger bewegte wie ein rastloser Klavierspieler. Wenn man ihn ansah, errötete er, und meist verkroch er sich zum Lesen in sein Zimmer, aber wenn ich ihn nach seinem Lieblingsschriftsteller fragte, gab er mir nur widerwillig Auskunft oder nannte aus Trotz einen Namen, den ich noch nie gehört hatte – meist einen Ausländer, einen Japaner, Italiener oder Portugiesen. Auf der Beerdigung seines Vaters hatte ich die Stimmung auflockern wollen und ihn gefragt, ob er hinter seiner verschlossenen Tür wirklich lese oder nicht etwas ganz anderes treibe. Ich hatte mir nichts dabei gedacht – es sollte ein Scherz sein –, aber als ich die Worte aussprach, hörte ich selbst, wie anzüglich sie klangen. Ich glaube, es waren noch drei oder vier andere Leute dabei, und der Junge wurde knallrot und verschluckte sich an seiner 7Up. Ich wollte ihm sagen, wie leid es mir tue und dass ich ihn nicht in Verlegenheit hätte bringen wollen, aber das hätte alles nur noch schlimmer gemacht, und so ließ ich die Sache auf sich beruhen und wandte mich rasch ab. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns von dieser Szene nie mehr erholt haben, denn er muss gedacht haben, dass ich ihn absichtlich bloßstellen wollte, obwohl mir nun wirklich nichts ferner lag.
Jonas war zu der Zeit, von der ich erzähle, sechzehn Jahre alt und stand kurz vor der Mittleren Reife. Die Prüfung würde ihm keine Schwierigkeiten bereiten, denn er war von klein auf sehr klug gewesen und hatte lange vor anderen Kindern seines Alters sprechen und lesen gelernt. Kristian sagte gern, dass Jonas mit seinem Verstand Arzt, Anwalt, Premierminister von Norwegen oder Präsident von Irland werden könne, aber immer wenn ich ihn das sagen hörte, dachte ich, nein, das ist nicht der Weg dieses Jungen. Ich wusste nicht, was sein Weg war, aber dieser war es nicht.
Manchmal dachte ich, dass Jonas ein hoffnungsloser Fall war. Er erzählte nie von Gleichaltrigen, hatte keine Freundin und nahm kein Mädchen mit auf den Weihnachtsball der Schule. Er ging nicht einmal hin. Er war in keinem Verein und trieb keinen Sport. Jonas ging zur Schule und kam wieder nach Hause. Am Sonntagnachmittag setzte er sich allein ins Kino und sah sich irgendeinen ausländischen Film an. Er half seiner Mutter im Haushalt. Ich fragte mich, ob er vielleicht einsam war. In seinem Alter hatte ich mich jedenfalls oft allein gefühlt.
So lebten also nur noch Hannah und Jonas in dem Haus. Der Ehemann und Vater war tot und der Sohn und Bruder ausgezogen, und auch wenn ich nicht viel vom Familienleben verstand, eins wusste ich: Eine Frau Mitte vierzig und ein unsicherer Jugendlicher hatten sich vermutlich nicht viel zu sagen. Vielleicht herrschte in ihrem Haus oft Schweigen, und deshalb hatte Hannah zum Hörer gegriffen, ihren Bruder angerufen und ihn zum Abendessen eingeladen. Wir bekommen dich so selten zu Gesicht, Odran!
An jenem Abend fuhr ich in meinem neuen Auto zu ihr. Besser gesagt, in dem Gebrauchtwagen, den ich soeben erstanden hatte, einem Ford Fiesta Baujahr 1992. Ich hatte ihn erst seit einer Woche und war äußerst angetan von seiner Wendigkeit. Ein richtiger kleiner Flitzer. Ich parkte auf der Straße vor Hannahs Haus und stieg aus. Dann öffnete ich das Gartentor, das schief in den Angeln hing, und strich mit dem Finger über die abgeblätterte schwarze Farbe. Darum müsste sich Jonas bei Gelegenheit mal kümmern, dachte ich, schließlich war er nun, da Kristian verstorben und Aidan ausgezogen war, der Mann im Haus, auch wenn er noch ein halbes Kind war. Der Garten wirkte hingegen gepflegt. Die Pflanzen hatten den Winter gut überstanden, und ein frisch geharktes Beet sah aus, als warteten unzählige Blumenzwiebeln nur darauf, aus der Erde hervorzubrechen und in die Höhe zu schießen, sobald es Frühling wurde – was für meinen Geschmack nicht schnell genug passieren konnte, denn ich liebe die Sonne, auch wenn ich wenig Erfahrung mit ihr habe, denn ich habe mein ganzes Leben in Irland verbracht.
Wann hat Hannah denn ihren grünen Daumen entdeckt?, fragte ich mich, während ich durch den Vorgarten ging. Das ist ja ganz was Neues.
Ich klingelte an der Tür, trat ein paar Schritte zurück und sah zum Fenster im ersten Stock hoch. Dort brannte Licht, und ich sah einen Schatten. Jonas musste den Motor gehört und einen Blick nach draußen geworfen haben, während ich den Vorgarten durchquerte. Ich hoffte, dass ihm der Fiesta aufgefallen war. Man konnte es mir doch nicht etwa verübeln, dass ich von meinem Neffen ein wenig bewundert werden wollte? Kurz kam mir der Gedanke, dass ich mich mehr um den Jungen kümmern sollte, schließlich war sein Vater tot und sein großer Bruder aus dem Haus, und er brauchte vielleicht einen Mann in seinem Leben.
Die Tür wurde geöffnet, und Hannah spähte durch den Spalt. Wie sie so dastand und mich leicht nach vorn gebeugt anstarrte, erinnerte sie mich an unsere verstorbene Großmutter. Sie schien sich zu fragen, warum um Himmels willen jemand um diese Uhrzeit bei ihr vor der Tür stand. In ihrem Gesicht sah ich die Frau, die sie in fünfzehn Jahren sein würde.
»Ach, du bist es«, sagte sie und nickte zufrieden, als sie mich erkannte. »Von den Toten auferstanden.«
»Du übertreibst«, sagte ich grinsend und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Sie roch nach einer dieser Cremes, die Frauen in ihrem Alter benutzen. Ich nehme diesen Geruch jedes Mal wahr, wenn Frauen auf mich zugeeilt kommen, um mir die Hand zu schütteln und mich zu fragen, wie es mir geht, ob ich in den nächsten Tagen nicht mal zum Abendessen vorbeikommen wolle und wie sich ihre Söhne so machten, sie bereiteten mir doch hoffentlich keine Schwierigkeiten? Ich habe keine Ahnung, wie diese Cremes heißen. Vermutlich ist Creme nicht einmal das richtige Wort. In der Fernsehwerbung heißt das sicher anders. Lotion oder so. Aber woher soll ich das wissen? Meine Unwissenheit über Frauen würde genug Bücher füllen, um damit die antike Bibliothek von Alexandria neu zu bestücken.
»Schön, dich zu sehen, Hannah.«
Ich trat in den Flur, zog meinen Mantel aus und hängte ihn auf einen freien Haken neben ihren alten dunkelblauen Mantel von Primark und eine braue Wildlederjacke, die Jonas gehören musste. Ich sah die Treppe hinauf und konnte es plötzlich kaum erwarten, ihm zu begegnen.
»Komm rein, komm rein«, sagte Hannah und ging voraus ins Wohnzimmer, in dem es gemütlich warm war. Im Kamin loderte ein Feuer, und ich bekam Lust, den ganzen Abend mit Hannah und Jonas vor dem Fernseher zu sitzen. Anne Doyle würde berichten, was unser Premierminister Bertie Ahern so trieb, und darüber spekulieren, ob Jon Bruton ihn bei den nächsten Wahlen schlagen und was der arme Al Gore nach seiner Niederlage tun würde.
Auf dem Fernseher stand ein gerahmtes Foto von Cathal. Auf dem Bild lachte er aus vollem Hals, als hätte er das ganze Leben noch vor sich, der arme kleine Kerl. Ich hatte das Foto noch nie gesehen und starrte es an. Cathal trug Shorts, hatte strubbeliges Haar und grinste, dass es mir das Herz brach. Im Hintergrund war ein Strand zu sehen. Mir wurde schwindelig. Cathal war nur einmal in seinem Leben an einem Strand gewesen. Warum hatte Hannah das Bild aufgestellt? Warum wollte sie an jene furchtbare Woche erinnert werden? Und wo hatte sie das Bild überhaupt her?
»War viel los auf den Straßen?«, fragte sie mich von der Tür her, und ich fuhr herum und starrte sie einen Moment lang verwirrt an.
»Nein, gar nicht«, sagte ich dann. »Ich habe übrigens ein neues Auto. Es fährt sich sehr gut.«
»Ein neues Auto? Nicht schlecht! Ist so was denn erlaubt?«
»Es ist ja nicht fabrikneu.« Ich musste wirklich aufhören, das Auto als neu zu bezeichnen. »Es ist gebraucht, aber für mich ist es neu.«
»Na, dann wird es ja wohl erlaubt sein.«
»Natürlich.« Ich lachte unsicher, weil ich nicht genau wusste, was sie damit meinte. »Ich muss ja schließlich irgendwie von A nach B kommen.«
»Sicher. Wie spät ist es eigentlich?« Sie warf einen Blick auf ihre Uhr und sah mich an. »Setz dich doch. Du machst mich ganz nervös, wenn du so rumstehst.«
Ich setzte mich, und da schlug sie die Hand vor den Mund und starrte mich an.
»Du meine Güte. Ich hatte dich zum Abendessen eingeladen.«
»Ja, klar.« In diesem Moment fiel mir auf, dass es in der Wohnung eher nach einer schon verspeisten Mahlzeit roch als nach kochenden Töpfen. »Hattest du das vergessen?«
Sie wandte sich ab und kniff verwirrt die Augen zusammen, sodass ich ihr Gesicht kaum wiedererkannte. Dann schüttelte sie den Kopf. »Natürlich nicht. Es ist nur … Na gut, um ehrlich zu sein, hatte ich es vergessen. Ich dachte … Hatten wir nicht Donnerstag gesagt?«
»Nein«, entgegnete ich, denn ich war mir sicher, dass sie mich für den Samstag eingeladen hatte. »Aber vielleicht habe ich es mir ja falsch gemerkt«, fügte ich hinzu, weil ich nicht wollte, dass sie sich Vorwürfe machte.
»Nein, du hast es dir nicht falsch gemerkt.« Sie schüttelte den Kopf und wirkte verärgerter, als es der Situation angemessen war. »Ich weiß in letzter Zeit wirklich nicht, wo mir der Kopf steht, Odran. Ich bin furchtbar zerstreut. Mir passieren ständig irgendwelche Fehler. Mrs Byrne hat mich schon verwarnt und gesagt, ich müsse mich zusammenreißen. Aber sie hat auch Haare auf den Zähnen. Ihr kann man es einfach nicht recht machen. Ach, Odran, es tut mir leid. Jonas und ich haben schon vor einer halben Stunde zu Abend gegessen. Ich hatte es mir gerade vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Kann ich dir ein Sandwich mit Bratwürstchen machen?«
Ich nickte und bedankte mich. Als mir einfiel, wie sehr mein Magen auf dem Weg hierher geknurrt hatte, fügte ich hinzu, dass ich auch zwei Sandwiches nehmen würde, wenn es nicht zu viel Mühe bedeute. Sie sagte, es mache ihr überhaupt nichts aus, schließlich habe sie ihren beiden Jungs da oben jahrelang Würste gebraten.
»Deinen beiden Jungs da oben?«, fragte ich. War der Schatten am Fenster vielleicht doch nicht Jonas gewesen, sondern sein Bruder? »Ist Aidan hier?«
»Aidan?«, fragte sie verwundert und drehte sich mit der Pfanne in der Hand zu mir um. »Nein, er arbeitet in London auf dem Bau. Das weißt du doch!«
»Aber du hast von deinen beiden Jungs gesprochen.«
»Ich meinte Jonas.«
Ich ließ sie in Ruhe und starrte auf den Fernseher.
»Hast du dir heute Nachmittag die Vereidigung des Präsidenten angeschaut?«, rief ich in die Küche hinüber. »Machen die Amis nicht furchtbar viel Aufhebens um die Sache?«
»Ja, das ist schon verrückt«, antwortete sie. Ich hörte das Öl spritzen, als sie die Würstchen in die Pfanne legte. »Ich habe den Nachmittag vor dem Fernseher verbracht. Wie findest du ihn? Glaubst du, er wird seine Sache gut machen?«
»Er ist noch keinen Tag im Amt, und schon hassen ihn alle.« Auch ich hatte mir die Berichterstattung angeschaut und mich darüber gewundert, wie viele Leute in Washington gegen Bush auf die Straße gegangen waren. Man warf ihm vor, er habe die Wahl gar nicht gewonnen, aber selbst wenn das stimmte, war das Ergebnis so knapp, dass Al Gore wohl kaum eine größere Legitimität als Präsident gehabt hätte.
»Weißt du, wen ich toll fand?«, fragte Hannah so verträumt, als wäre sie wieder ein junges Mädchen.
»Wen denn?«
»Ronald Reagan. Erinnerst du dich noch an seine Filme? Manchmal laufen sie samstags auf BBC2. Vor ein paar Wochen habe ich einen gesehen, in dem Ronald Reagan einen Gleisarbeiter spielt. Er hat einen Unfall, und als er wieder aufwacht, hat man ihm beide Beine amputiert. ›Wo ist der Rest von mir?‹, schrie er. ›Wo ist der Rest von mir?‹«
»Ah, ja«, sagte ich, obwohl ich mir noch nie einen Film mit Ronald Reagan angesehen hatte. Ich wunderte mich immer, wenn Leute ihn als Schauspieler bezeichneten. Seine Frau soll im Übrigen ein richtiger Drachen gewesen sein.
»Bei ihm hatte ich immer das Gefühl, er habe alles im Griff«, sagte Hannah. »Das mag ich bei einem Mann. Kristian war auch so.«
»Da hast du recht«, pflichtete ich ihr bei.
»Wusstest du, dass er in Mrs Thatcher verliebt war?
»Kristian?«, fragte ich stirnrunzelnd. Das konnte ich mir nicht vorstellen.
»Nein, nicht Kristian«, sagte sie gereizt. »Ronald Reagan. Ich habe gehört, dass die beiden ineinander verliebt waren.«
»Ich weiß nicht, ich habe da so meine Zweifel«, sagte ich achselzuckend. »Man nannte sie ja nicht umsonst die Eiserne Lady.«
»Jedenfalls bin ich froh, dass ich Clinton, diesen schmierigen Kerl, nicht mehr sehen muss«, rief sie zu mir herüber.
Ich nickte. Auch ich hatte die Nase voll von Bill Clinton. Seine Politik war nicht schlecht gewesen, aber er hatte alles Vertrauen verspielt. Am Ende hatte er nur noch seine Haut retten wollen. Ich konnte seinen erhobenen Zeigefinger und sein unbewegtes Gesicht, mit dem er alles abstritt, nicht mehr sehen. Er hatte uns nach Strich und Faden belogen.
»Er hat sich tatsächlich von dieser Frau einen blasen lassen«, fuhr Hannah fort, und ich fuhr herum und starrte sie fassungslos an. Solch ein Wort hatte sie in meiner Gegenwart noch nie verwendet, und ich überlegte, ob ich mich verhört hatte, aber ich wollte nicht nachfragen. Sie wendete die Würstchen in der Pfanne und summte vor sich hin. »Was magst du lieber, Ketchup oder braune Soße?«, rief sie mir zu.
»Ketchup.«
»Ketchup ist alle.«
»Dann eben braune Soße. Ich habe seit Ewigkeiten keine braune Soße mehr gegessen. Weißt du noch, wie Dad sie zu allem gegessen hat? Sogar zu Lachs?«
»Lachs?«, fragte sie und brachte mir einen Teller mit zwei köstlich aussehenden Bratwurstsandwiches. »Bei uns gab es früher keinen Lachs.«
»Hin und wieder schon.«
»Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.« Sie setzte sich in den zweiten Sessel und sah mich an. »Wie schmeckt dir die Wurst?«
»Sehr gut.«
»Ich hätte dir ein richtiges Abendessen kochen sollen.«
»Nein, nein. Die Würstchen reichen mir völlig.«
»Ich weiß in letzter Zeit wirklich nicht, wo mir der Kopf steht.«
»Das macht doch nichts, Hannah.« Ich hätte gern das Thema gewechselt. »Was habt ihr beiden denn zu Abend gegessen?«
»Hühnchen«, antwortete sie. »Mit Kartoffelpüree. Das mag Kristian lieber als Salzkartoffeln.«
»Jonas«, sagte ich.
»Was ist mit Jonas?«
»Du hast Kristian gesagt.«
Sie machte ein verwirrtes Gesicht und schüttelte verständnislos den Kopf. Ich setzte zu einer Erklärung an, aber in dem Moment ging im ersten Stock eine Tür auf, und auf der Treppe erklangen Schritte. Gleich darauf kam Jonas ins Wohnzimmer und begrüßte mich mit einem Nicken und einem schüchternen, aber liebenswürdigen Lächeln. Sein Haar war länger als beim letzten Mal, und ich fragte mich, warum er es sich nicht schneiden ließ. Der Junge hatte ein hübsches Gesicht. Hätte ich seine Wangenknochen gehabt, dann hätte ich sie der Welt zeigen wollen.
»Hallo, Onkel Odran. Wie geht’s?«, fragte er.
»Gut, danke. Bist du schon wieder gewachsen, Jonas?«
»Er schießt immer weiter in die Höhe«, sagte Hannah.
»Vielleicht ein kleines Stück«, murmelte Jonas.
»Und was ist mit deinem Haar?«, fragte ich und bemühte mich um einen freundlichen Ton. »Ist das jetzt die neueste Mode?«
»Er muss dringend zum Friseur«, sagte Hannah und drehte sich zu ihm um. »Nicht wahr, Sohnemann? Wann gehst du zum Friseur?«
»Sobald du mir drei Pfund fünfzig gibst. Ich bin völlig pleite.«
»Da kann ich dir leider nicht helfen.« Hannah wandte sich wieder ab. »Das Geld reicht auch so vorne und hinten nicht. Weißt du was, Odran? Mrs Byrne hat mich verwarnt. Eigentlich könnte mir das ja egal sein, aber ich arbeite schon acht Jahre länger als sie in der Bank.«
»Ja, das hast du mir schon erzählt.« Ich schluckte den letzten Bissen des ersten Sandwichs hinunter und nahm das zweite in die Hand. »Willst du dich nicht setzen, Jonas?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich wollte mir nur was zu trinken holen«, sagte er und ging in die Küche.
»Und wie läuft’s in der Schule?«, fragte ich.
»Gut.« Er öffnete den Kühlschrank, blickte hinein und machte ein enttäuschtes Gesicht. Offenbar fand er nicht, auf was er gehofft hatte.
»Er steckt seine Nase ständig in irgendein Buch«, sagte Hannah. »Der Junge hat was im Kopf.«
»Und weißt du schon, was du mal werden willst, Jonas?«, fragte ich.
Er murmelte irgendwas Unverständliches. Es klang irgendwie neunmalklug.
»Jonas ist so schlau, dass ihm alle Türen offen stehen«, sagte Hannah und starrte auf George W. Bush, der seine Antrittsrede hielt.
»Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, was ich mal werden will«, sagte Jonas, kam zurück ins Wohnzimmer und fixierte den Fernseher. »Ich würde gern Englisch studieren, aber das bereitet einen nicht gerade auf einen Beruf vor.«
»In meine Fußstapfen willst du also nicht treten?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf und lachte, aber es klang nicht unfreundlich. Dann errötete er leicht. »Eher nicht, Onkel Odran. Tut mir leid.«
»Es gibt schlechtere Berufe«, sagte Hannah. »Hat dein Onkel nicht was aus einem Leben gemacht?«
»Schon«, sagte Jonas. »Ich wollte nicht …«
»Das war doch nur ein Scherz«, unterbrach ich ihn. Ich wollte nicht, dass er das Gefühl hatte, sich entschuldigen zu müssen. »Du bist doch erst sechzehn. Heutzutage würde es sich wohl jeder Sechzehnjährige, der meinen Beruf wählt, mit seinen Freunden verscherzen.«
»Das ist nicht der Grund«, sagte er und sah mich an.
»Wusstest du, dass Jonas in der Zeitung war?«, fragte Hannah.
»Mam«, sagte Jonas und wich zurück in Richtung Flur.
»Wirklich?« Ich löste den Blick vom Fernseher.
»Er hat einen Artikel veröffentlicht«, erklärte sie. »In der Sunday Tribune.«
»Einen Artikel?«, fragte ich stirnrunzelnd. »Was denn für einen Artikel?«
»Es war kein Artikel«, sagte Jonas und lief knallrot an. »Es war eine Kurzgeschichte. Nichts Besonderes.«
»Nichts Besonderes? Was redest du denn da?«, sagte Hannah, setzte sich aufrecht hin und warf ihm einen strafenden Blick zu. »Wann war einer von uns schon mal in der Zeitung?«
»Eine Kurzgeschichte?«, fragte ich nach, stellte meinen Teller ab und drehte mich zu ihm um. »Du schreibst?«
Er nickte und starrte zu Boden.
»Wann denn?«
»Vor ein paar Wochen.«
»Warum hast du mich nicht angerufen? Ich hätte sie gern gelesen. Trotzdem bravo, mein Junge! Ich bin stolz auf dich! Du schreibst also? Willst du vielleicht mal Schriftsteller werden?«
Er zuckte mit den Schultern und wirkte ebenso peinlich berührt wie auf der Beerdigung seines Vaters im Vorjahr, als ich die geschmacklose Bemerkung mit der geschlossenen Tür gemacht hatte. Ich wandte mich wieder dem Fernseher zu, um ihn nicht noch mehr in Verlegenheit zu bringen. »Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück«, sagte ich. »Das ist ein hehres Ziel.«
Nachdem er aus dem Zimmer getappt war, schüttelte ich lachend den Kopf. Ich sah zu Hannah hinüber, die mittlerweile in die Programmzeitschrift vertieft war. »Will er wirklich Schriftsteller werden?«
»Wer von Brow Head bis Banba’s Crown laufen will, ist lange unterwegs«, antwortete sie, und ich verstand nicht ganz, was sie damit sagen wollte. Sie legte die Zeitschrift beiseite und musterte mich, als wäre ich ein Fremder.
»Was ist eigentlich aus Mr Flynn geworden?«, fragte sie unvermittelt.
»Aus wem?« Der Name Flynn sagte mir beim besten Willen nichts.
Sie winkte ab, erhob sich und ging in die Küche. Ich blieb perplex im Wohnzimmer zurück.
»Ich koche mir einen Tee. Möchtest du auch einen?«
»Ja, gern.«
Als sie ein paar Minuten später ins Wohnzimmer zurückkam, brachte sie zwei Tassen Kaffee mit, aber ich verkniff mir eine Bemerkung. Ich glaubte, sie wäre so zerstreut, weil sie etwas auf dem Herzen hätte.
»Ist alles in Ordnung, Hannah?«, fragte ich. »Du scheinst ein wenig neben der Spur zu sein. Bedrückt dich irgendwas?«
Sie dachte kurz nach. »Ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen«, sagte sie dann und beugte sich verschwörerisch vor. »Aber jetzt, wo du es ansprichst … Du musst es aber für dich behalten. Kristian geht es nicht gut. Er hat in letzter Zeit häufig starke Kopfschmerzen, aber er weigert sich, zum Arzt zu gehen. Rede du doch mal mit ihm. Auf mich will er nicht hören.«
Ich starrte sie an. Was konnte sie damit meinen? »Kristian?«, brachte ich schließlich hervor. »Kristian ist tot.«
Sie sah mich an, als hätte ich sie ins Gesicht geschlagen. »Denkst du, das weiß ich nicht? Ich habe ihn doch selbst zu Grabe getragen. Warum sagst du so was?«
Ich war verwirrt. Hatte ich mich vielleicht verhört? Ich schüttelte den Kopf, ließ die Sache auf sich beruhen und trank stattdessen meinen Kaffee aus. Um neun Uhr kamen die Nachrichten. Ich hörte mir die Meldungen des Tages an und sah zu, wie Bill und Hillary einen Hubschrauber bestiegen und sich winkend von der Nation verabschiedeten. Dann sagte ich, dass ich mich allmählich auf den Weg machen müsse.
»Komm bald wieder«, sagte Hannah. Sie machte jedoch keine Anstalten, aufzustehen oder mich zur Tür zu bringen. »Bei deinem nächsten Besuch koche ich dir dann auch das versprochene Abendessen.«
Ich nickte, ging hinaus in den Flur und zog die Wohnzimmertür hinter mir zu. Als ich an der Haustür stand und meinen Mantel anzog, hörte ich wieder, wie im ersten Stock eine Tür geöffnet wurde. Im nächsten Moment stand Jonas barfuß oben an der Treppe und sah zu mir herunter.
»Gehst du schon, Onkel Odran?«
»Ja. Wir beide sollten uns öfter mal unterhalten, Jonas.«
Er nickte, kam langsam die Treppe herunter und hielt mir eine zusammengefaltete Zeitungsseite hin. »Für dich, wenn du willst«, sagte er und starrte zu Boden. »Meine Kurzgeschichte aus der Tribune.«
»Vielen Dank.« Ich war gerührt. »Ich werde sie heute Abend lesen und sie dir beim nächsten Mal zurückgeben.«
»Nicht nötig«, antwortete er. »Ich habe zehn Zeitungen gekauft.«
Ich lächelte und schob die zusammengefaltete Seite in meine Hosentasche. »Wenn du mir Bescheid gesagt hättest, dann hätte ich mir selbst eine Ausgabe gekauft.«
Er wippte auf den Zehen hin und her und warf einen Blick zur Wohnzimmertür. »Ist alles in Ordnung, Jonas?«, fragte ich.
»Ja.«
»Du siehst aus, als würde dich irgendwas beschäftigen.«
Er schnaubte und starrte zu Boden. »Ich wollte dich mal was fragen«, murmelte er.
»Nur zu.«
»Es geht um Mam.«
»Was ist mit ihr?«
Er schluckte und sah mir endlich in die Augen. »Glaubst du, dass es ihr gut geht?«
»Deiner Mam?«
»Ja.«
»Sie wirkt etwas müde.« Ich legte eine Hand auf die Türklinke. »Vielleicht muss sie sich nur mal richtig ausschlafen. Wir könnten wohl alle etwas Schlaf gebrauchen.«
»Warte«, sagte er und legte eine Hand auf den Türrahmen, um mich zurückzuhalten. »Sie erzählt viele Sachen doppelt und vergisst alles Mögliche. Neulich hat sie vergessen, dass Dad tot ist.«
»Das kommt vor, wenn man älter wird.« Ich öffnete die Tür, bevor er mich daran hindern konnte. »Irgendwann trifft es uns alle. Auch dir wird das passieren, aber bis dahin ist es noch eine Weile hin, also mach dir keine Sorgen. Oh, es ist ganz schön kalt geworden.« Ich trat nach draußen. »Mach schnell die Tür zu, bevor du dich erkältest.«
»Onkel Odran …«
Ich ließ ihn nicht ausreden, sondern wandte mich ab und ging auf das Gartentor zu. Er sah mir nach und schloss dann die Haustür. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, den Jungen einfach so stehen zu lassen, aber ich wollte nur noch nach Hause. Als ich auf meinen Ford Fiesta zuging, klopfte jemand von innen gegen das Wohnzimmerfenster. Ich drehte mich um und sah Hannah hinter der Scheibe stehen. Sie hatte die Vorhänge aufgezogen und rief mir etwas zu.
»Was?«, fragte ich und legte eine Hand ans Ohr. Sie winkte mir zu.
»Wo ist der Rest von mir?«, rief sie lachend. Dann wandte sie sich ab und zog die Vorhänge zu.
Ich wusste, dass mit Hannah irgendwas nicht in Ordnung war, aber aus purem Egoismus beschloss ich, das Problem zu ignorieren. Ich würde sie in einer Woche anrufen, nahm ich mir vor, sie ins Bewley’s Café in der Grafton Street ausführen, sie zum Mittagessen einladen und ihr einen Nachtisch und einen dieser neumodischen Kaffees mit Schaum spendieren. Ich würde mir in Zukunft mehr Mühe geben und öfter nach ihr sehen.
Ich würde ein besserer Bruder sein, als ich es bisher gewesen war.
Auf dem Nachhauseweg beschloss ich, einen Abstecher nach Inchicore zu machen – das war zwar ein Umweg, aber ich wollte die Kirche besuchen, in deren Garten sich eine Nachbildung der Grotte von Lourdes befindet. In Lourdes selbst war ich nie gewesen. Ich halte nicht viel von Wallfahrtsorten wie Lourdes, Fatima, Medjugorje oder Knock, die angeblichen Erscheinungen sind doch nichts als die Hirngespinste von Kindern oder Betrunkenen. Aber Inchicore war kein Wallfahrtsort, sondern nur eine Kirche mit einer Lourdesgrotte und einer Marienstatue. Ich kam manchmal spätabends her, um innere Einkehr zu halten.
Die Straßen waren leer, und so dauerte die Fahrt nicht lang. Ich stellte den Wagen ab und ging durch das offene Tor. Ein fleckiger Vollmond stand hoch am Himmel und beschien das Gelände. Als ich auf die Grotte zuging, hörte ich plötzlich lautes Stöhnen und Wimmern. Ich blieb stehen und versuchte, das Geräusch zu identifizieren. Wenn ein junges Paar hier irgendwelche schmutzigen Dinge trieb, wollte ich lieber nichts davon wissen. Ich wollte gerade kehrtmachen und zu meinem Auto zurückgehen, als mir dämmerte, dass es sich nicht um leidenschaftliches Stöhnen handelte, sondern um unkontrollierbares Weinen und Wehklagen.
Ich ging zögernd weiter, und als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich einen Menschen bäuchlings und mit ausgestreckten Armen vor der Grotte liegen. Er sah aus wie gekreuzigt. Im ersten Moment dachte ich, der Mann wäre Opfer eines Mordanschlags geworden. Jemand hatte diesen armen Kerl vor der Grotte von Inchicore umgebracht. Doch dann bewegte er sich, hievte sich auf die Knie, und ich sah, dass er nicht verletzt war, sondern betete. Der Mann trug ein langärmliges schwarzes Priestergewand, der Wind blähte den Stoff an seinen Knöcheln. Immer noch kniend erhob er die Hände zum Himmel, ballte sie zu Fäusten und versetzte sich schluchzend Schläge gegen den Kopf. Er schlug so fest zu, dass ich schon eingreifen wollte, auch wenn die Gefahr bestand, dass er sich in seiner Verzweiflung oder seinem Wahn auf mich stürzte. Er drehte sich leicht, und im Mondlicht sah ich sein Gesicht im Profil. Der Mann war noch jung – etwa zehn Jahre jünger als ich damals, also Anfang dreißig. Er hatte dichtes schwarzes Haar und eine breite, gebogene Nase. In diesem Moment sank er mit einem Schrei zu Boden. Nun lag er wieder in der Position da, in der ich ihn vorgefunden hatte, und obwohl er sich ein wenig beruhigt hatte, stöhnte und schluchzte er immer noch erbärmlich. Mein Blick wanderte ein Stück nach links, und ich sah, dass er nicht allein war. Mich überlief ein Schauer.
In einer Ecke der Grotte saß eine ältere Frau, die ich auf Mitte sechzig schätzte. Sie wiegte sich vor und zurück, Tränen liefen ihr über die Wangen, und ihre Züge waren schmerzverzerrt. Mondlicht fiel auf ihr Gesicht, und ich sah, dass sie große Ähnlichkeit mit dem jungen Priester hatte. Die Adlernase hatte er eindeutig von ihr. Sie musste seine Mutter sein.
Der junge Mann, der nun wieder bäuchlings auf dem Boden lag, schien die Welt anzuflehen, ihn von seinem Leid zu erlösen, und seine weinende Mutter sah aus, als hoffte sie inständig, Gott möge sie auf der Stelle zu sich holen.
Der Anblick der beiden erschütterte mich sehr. Vielleicht hätte ich hingehen und seelischen Beistand leisten sollen, aber ich wandte mich ab und ging hastig davon. Ich empfand eine unbestimmte Bedrohung, ein Grauen, mit dem ich nicht umgehen konnte.
Wenn ich jetzt, mehr als zehn Jahre später, an jenen Abend zurückdenke, entsinne ich mich dieser beiden Ereignisse, als wäre es gestern gewesen. George W. Bush ist längst im Ruhestand, aber ich weiß noch genau, wie Hannah in ihrem Sessel saß und mir erzählte, dass ihr toter Ehemann schlimme Kopfschmerzen habe, und ich erinnere mich, wie Mutter und Sohn in der Grotte von Inchicore gemeinsam weinten. Auf dem Weg nach Hause, wo mich mein leeres Bett erwartete, ahnte ich mit einem Mal, dass es die Welt, die mir vertraut war und an die ich mein Leben lang geglaubt hatte, bald nicht mehr geben würde. Die alte Welt lag im Sterben, und die neue war noch nicht geboren.
Zweites Kapitel
2006 Fünf Jahre später musste ich das Terenure College verlassen, die Schule, wo ich siebenundzwanzig Jahre gearbeitet und gelebt hatte. Hinter den hohen Mauern dieser Oase des Wissens war ich glücklich, daher war die Veränderung ein großer Schock für mich.
Ich hatte ursprünglich gar nicht so lange am Terenure College bleiben sollen. Als ich im Sommer 1979 aus Rom nach Dublin zurückkehrte und nach meiner siebenjährigen Ausbildung endlich die Priesterweihe empfangen hatte, auch wenn meinem Name ein gewisser Makel anhaftete, schickte man mich als Seelsorger an die Schule. Dort sollte ich bleiben, bis man mir eine Gemeinde zuwies, doch aus irgendwelchen Gründen kam es nie dazu. Stattdessen legte ich die Lehramtsprüfung ab und begann Englisch und hin und wieder auch Geschichte zu unterrichten. Außerdem kümmerte ich mich um die Bibliothek und las jeden Morgen um halb sechs die Messe. Zum Frühgottesdienst kamen immer dieselben paar Rentner aus der Nachbarschaft, die nie gelernt hatten auszuschlafen oder fürchteten, nicht mehr aufzuwachen, wenn sie nicht im Morgengrauen aufstanden. Ich war auch für das Seelenheil der Schüler verantwortlich, doch im Laufe der Jahre hatte ich immer weniger zu tun. Die Jungen hatten zunehmend andere Dinge im Kopf, als die Achtziger- in die Neunzigerjahre übergingen und schließlich das 21. Jahrhundert anbrach.
Das Terenure College war eine Rugbyschule, eine private Sportschule im Süden von Dublin, und die Schüler stammten allesamt aus reichen Familien – ihre Väter arbeiteten in der Immobilienbranche oder waren Topmanager von Banken und großen Firmen. Es waren Männer, die unerschütterlich an ihren Erfolg glaubten. Obwohl ich fast nichts über Rugby wusste, gab ich mir große Mühe, mich dafür zu interessieren. Im Allgemeinen verstand ich mich gut mit den Jungs, denn ich war nicht übermäßig streng, versuchte aber auch nicht, mich bei ihnen anzubiedern – zwei Fehler, die viele meiner Kollegen begingen. So war ich einigermaßen beliebt, auch wenn ich bei all den neuen Schülern und den älteren, die ihren Abschluss machten und an die Universität wechselten, manchmal den Überblick verlor. Viele Schüler waren extrem arrogant und verachteten jeden, der nicht aus ähnlich privilegierten Verhältnissen stammte wie sie, aber ich tat mein Bestes, um ihnen ein wenig Nächstenliebe beizubringen.
Pater Lomas, der Sekretär von Erzbischof Cordington, rief mich eines Dienstagmorgens an, und ich bekam einen Schreck, weil ich annahm, den Grund für die Vorladung zu kennen.
»Will er nur mich sprechen«, fragte ich, »oder lädt er noch andere Lehrer vom Terenure ein?«
»Nur Sie«, antwortete Pater Lomas kurz angebunden.
»Ist es dringend?«
»Seine Exzellenz empfängt Sie heute Nachmittag um zwei Uhr«, sagte er und legte auf. Das sollte wohl Ja heißen.
Mit einem flauen Gefühl im Magen fuhr ich zur Residenz des Erzbischofs in Drumcondra. Was, wenn er mich nach Pater Miles Donlan fragte und wissen wollte, ob ich etwas geahnt und warum ich ihm nichts von meinem Verdacht erzählt hatte? Was sollte ich antworten, wo ich mir diese Frage doch selbst immer wieder stellte und vergeblich nach einer Antwort suchte.
»Pater Yates.« Der Erzbischof hob den Blick und lächelte, als ich sein Arbeitszimmer betrat. Ich sah mich um und bemühte mich zu verbergen, wie sehr mir die prunkvolle Einrichtung gegen den Strich ging. An den Wänden hingen Gemälde, die der Nationalgalerie würdig gewesen wären. Vielleicht hatte er sie sich sogar aus dem Bestand der Nationalgalerie ausgesucht – das gehörte schließlich zu den Privilegien seines Amts. Der Teppich unter meinen Füßen war so dick, dass man darauf ein Nickerchen hätte halten können. Alles hier zeugte von Wohlstand und Verschwendungssucht, Laster, die in krassem Gegensatz zu dem Gelübde standen, das wir beide abgelegt hatten. Der opulente Bischofspalast erinnerte mich an den Vatikan, wenn auch in kleinerem Ausmaß, und wie so häufig musste ich an das Jahr 1978 zurückdenken, als ich in Rom drei verschiedenen Päpsten gedient hatte. Frühmorgens und spätabends hatte ich ihnen ihren Tee gebracht, tagsüber studiert und Abend für Abend unter einem offenen Fenster im Vicolo della Campana gestanden, erfüllt von einer brennenden Sehnsucht.
Warum ist dieser Gedanke nach achtundzwanzig Jahren immer noch so schmerzhaft?, fragte ich mich. Heilen die Wunden unserer Jugend denn nie?
»Exzellenz«, sagte ich, kniete nieder und küsste den schweren Goldring, den er an der rechten Hand trug. Er führte mich zu zwei Sesseln vor dem Kamin.
»Wie schön, dich wiederzusehen, Odran«, sagte er und sank schwer in einen der Sessel. Jim Cordington war am Priesterseminar von Clonliffe zwei Jahrgänge über mir gewesen, und er war der beste Mittelfeldspieler, den die Hurlingmannschaft von Dublin je an das Priesteramt verloren hatte. Mittlerweile hatte er vom guten Essen und Bewegungsmangel starkes Übergewicht. Ich weiß noch, wie er damals über das Spielfeld geflitzt war. Keiner hatte ihn stoppen können. Was war nur mit ihm passiert? Sein einst so muskulöser Körper war aufgedunsen, die Haut gerötet, der Nasenrücken von geplatzten Äderchen übersät. Wenn er lächelte und dabei nach unten sah, was er merkwürdigerweise häufig tat, hatte er ein Doppelkinn, das an aufgetürmte Schlagsahne erinnerte.
»Auch ich freue mich, Sie zu sehen, Exzellenz«, antwortete ich.
»Ach, Odran«, sagte er und wedelte abwehrend mit der Hand, »hör auf mit dem Exzellenz-Getue. Ich heiße Jim, das weißt du doch. Außer uns ist niemand hier. Lassen wir die Förmlichkeiten. Wie geht es dir?«
»Gut«, sagte ich. »Ich arbeite viel.«
»Wir haben uns lange nicht gesehen.«
»Ich glaube, zum letzten Mal auf der Konferenz in Maynooth im vergangenen Jahr«, erwiderte ich.
»Mag sein. Jedenfalls ist das keine schlechte Schule, an der du da bist, was?« Er kratzte sich am Kinn, und seine Fingernägel schabten über die Stoppeln, die seit dem Morgen nachgewachsen waren. »Wusstest du, dass ich auch auf dem Terenure College gewesen bin?«
»Ja, Exzellenz. Ich meine, Jim.«
»Seit ich dort Schüler war, muss sich einiges verändert haben.«
Ich nickte. Alles hatte sich seitdem verändert.
»Kennst du die Geschichte von Pater Richard Camwell?« Er beugte sich vor. »Wir hatten furchtbare Angst vor ihm. Er zerrte die Schüler am Ohr vom Stuhl hoch und schlug ihnen so fest ins Gesicht, dass sie durchs halbe Klassenzimmer flogen. Einmal hielt er einen Jungen an den Füßen aus dem Fenster im sechsten Stock, während andere unten im Hof riefen: ›Pater, bitte nicht! Lassen Sie nicht los!‹« Er schüttelte lachend den Kopf. »Natürlich hatten wir Angst vor den Priestern. Manche übten eine wahre Schreckensherrschaft aus.« Er runzelte die Stirn und sah mich an. »Aber sie waren fromme Männer«, fügte er hinzu und hob den Zeigefinger, »sehr fromme Männer.«
»Würde ein Priester heute so etwas tun, würden die Jungen sich wehren«, sagte ich. »Und das zu Recht.«
»Ach, ich weiß nicht.« Er lehnte sich zurück und starrte gedankenverloren in den Kamin.
»Meinst du das ernst?«
»Jungen sind schrecklich undiszipliniert. Sie brauchen eine harte Hand. Aber natürlich bin ich kein Fachmann. Du verbringst schließlich fünf Tage die Woche mit ihnen. Wenn ich daran denke, wie oft ich in dieser Schule grün und blau geprügelt worden bin, frage ich mich manchmal, wie ich das überlebt habe. Aber es war eine schöne Zeit. Eine sehr schöne Zeit.«
Ich nickte und biss mir auf die Lippe. Ich hätte ihm gern widersprochen, traute mich aber nicht. Im vorigen Jahr hatte ein Lehrer des Terenure College, ein Laie, kein Priester, einen vierzehnjährigen Schüler geohrfeigt, weil dieser ihn beleidigt hatte. Der Junge war aufgesprungen, hatte dem Lehrer einen Faustschlag versetzt und dem armen Kerl die Nase gebrochen. Der Schüler war ein kräftiger Junge und ziemlich eingebildet. Sein Vater leitete die irische Niederlassung einer internationalen Bank, und der Junge prahlte ständig damit, wie viele Bonusmeilen er schon gesammelt habe. Zu meiner Zeit wäre er der Schule verwiesen worden, aber heutzutage lief das natürlich anders. Der Lehrer, ein netter Mann, aber vollkommen ungeeignet für den Beruf, bekam die Kündigung, die Eltern zeigten ihn wegen Körperverletzung an, und die Schule zahlte dem Jungen viertausend Euro Schmerzensgeld.
»Meine Großmutter lebte ganz in der Nähe des Terenure College, gleich an der Dodder Bridge«, fuhr der Erzbischof fort. »Ich wohnte mit meinen Eltern weiter stadteinwärts in der Nähe von Harold’s Cross, aber ich war oft bei meiner Oma. Sie konnte unglaublich gut kochen. In sechzehn Jahren hat sie vierzehn Kinder geboren. Unfassbar, nicht? Aber sie hat sich nie beklagt. Sie zog ihre Kinder in einem Haus mit zwei Schlafzimmern groß. Heute fragt man sich, wie das möglich war. Sie, ihr Mann und vierzehn Kinder in zwei Schlafzimmern. Wie die Ölsardinen.«
»Dann musst du ja viele Cousins und Cousinen haben«, meinte ich.
»Jede Menge. Ein Cousin arbeitet bei der Formel 1 in der Boxengasse. Er ist für den Reifenwechsel zuständig und hat mir mal erzählt, dass er dafür nur vierzig Sekunden Zeit hat. Wenn es länger dauert, verliert er seinen Job. Unglaublich, oder? In so kurzer Zeit hätte ich nicht mal den Schraubenschlüssel gefunden. Aber ich sehe meine Verwandten nicht oft. Mein Amt nimmt mich zu sehr in Anspruch. Du kannst dich glücklich schätzen, Odran, dass du nie zum Bischof ernannt wurdest.«
Was sollte ich darauf sagen? Ich hatte mein Examen am Priesterseminar von Clonliffe mit Bestnoten bestanden und durfte anschließend als Einziger meines Jahrgangs das Päpstliche Irische Kolleg in Rom besuchen. Das war 1978, und der Aufenthalt in Rom war für mich Segen und Fluch zugleich. Hätte man mich nicht vorzeitig von meinem Posten entfernt, wäre ich sicher rasch in der Kirchenhierarchie aufgestiegen, aber so war mein Name mit einem Makel behaftet.
Einige meiner Kommilitonen im Priesterseminar waren sehr ehrgeizig gewesen, aber auf mich hatte das nie zugetroffen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals hoch hinausgewollt hatte. Von Anfang an schien festzustehen, wer Bischof werden würde und wer nicht. Ein Seminarist aus dem Jahr über uns schaffte es sogar bis zum Kardinal. Ich wollte immer nur ein guter Priester werden und den Menschen helfen, so gut ich konnte. Das reichte mir.
»Bist du an der Schule eigentlich glücklich?«, fragte der Erzbischof.
Ich nickte. »Ich verstehe mich gut mit den Jungen, mit den meisten zumindest. Ich bemühe mich, das Beste aus ihnen herauszuholen.«
»Daran habe ich keinen Zweifel, Odran. Ich höre immer nur Gutes über dich.« Er warf einen Blick zur Wanduhr. »Schon so spät? Trinken wir einen Schluck?«
Ich schüttelte den Kopf. »Danke, ich nicht.«
»Komm schon, du kannst mich doch nicht alleinlassen. Nur ein kleines Glas. In Gesellschaft trinkt es sich besser.«
»Ich bin mit dem Auto da, Exzellenz.«
»Na dann.« Er winkte ab, als wäre es eine neumodische Unsitte, beim Autofahren nüchtern sein zu wollen, hievte sich aus dem Sessel und trottete zu einem Schränkchen, auf dem eine Bronzestatue von John Charles McQuaid stand. 1973 hatten ich und die anderen Seminaristen die Totenmesse für den früheren Erzbischof von Dublin in der Pro-Kathedrale besucht. Erzbischof Cordington öffnete das Schränkchen – das Sortiment konnte es mit der Bar des Slattery’s auf der Rathmines Road aufnehmen –, holte eine Flasche heraus, schenkte sich ordentlich ein, füllte das Glas mit Wasser auf, kam zu mir zurück und ließ sich mit einem vernehmlichen Seufzer in den Sessel fallen.
»Das hilft mir durch den Nachmittag«, sagte er augenzwinkernd und nahm einen kräftigen Schluck. »Nach dir habe ich einen Termin mit einer Delegation Nonnen, Gott bewahre! Sie wollen neue Waschräume für ihr Kloster. Aber ich habe kein Geld für sie. Hier rufen jeden Tag Priester an und wollen Internet in ihrem Pfarrhaus. Das kostet mich ein Vermögen.«
»Du könntest das Geld aufteilen«, schlug ich vor. »Die Hälfte für die Priester, die andere Hälfte für die Nonnen.«
Er brach in schallendes Gelächter aus, und ich lächelte, um nicht unhöflich zu wirken. »Sehr gut, Odran, wirklich, sehr gut. Du warst schon immer ein Witzbold. Aber kommen wir zur Sache. Was hältst du von einer kleinen Veränderung?«
Mein Magen zog sich zusammen. Ich hatte gedacht, er hätte mich herbestellt, weil er mit mir über diese unselige Sache reden wollte, aber nun stellte sich heraus, dass es um etwas ganz anderes ging. Wollte er mich wirklich versetzen? Nach all den Jahren? Ich liebte die hohen Mauern um die Rugbyfelder, die lange Einfahrt, die vom Tor zum Hauptgebäude führte, die Stille meines Flurs, meine Kammer und die Sicherheit der Klassenzimmer. Ich hatte das Gespräch mit dem Erzbischof gefürchtet, aber jetzt kam alles noch schlimmer. Viel schlimmer.
»Ich bin an der Schule glücklich.« Ich musste es versuchen, vielleicht hätte er ja Mitleid. »Meine Arbeit dort ist noch nicht beendet. Die Jungen brauchen mich.«
»Ach, unsere Arbeit ist doch nie zu Ende«, entgegnete der Erzbischof, »aber irgendwann muss man sich trotzdem zurückziehen und anderen den Vortritt lassen. Es gibt da einen jungen Priester, den ich ans Terenure College schicken möchte. Ein guter Mann. Ich glaube, die Stelle wäre genau das Richtige für ihn. Pater Mouki Ngezo. Bist du ihm schon mal begegnet?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich kannte kaum jemanden von den jungen Priestern. Nicht, dass es viele gegeben hätte.
»Ein Schwarzer«, sagte der Erzbischof. »Du hast ihn bestimmt schon mal gesehen.«
Ich starrte ihn an, weil ich mir nicht sicher war, ob es sich um eine Tatsachenfeststellung handelte oder ob sein Ton abfällig gewesen war. Durfte man heutzutage überhaupt noch Schwarzer sagen, oder war das rassistisch?
»Nein, ich …«, begann ich und wusste dann nicht mehr, was ich hatte sagen wollen.
»Ein guter Mann«, wiederholte der Erzbischof. »Er ist vor ein paar Jahren aus Nigeria hergekommen. Ist das nicht absurd? Früher haben wir unsere jungen Priester in die Missionsgebiete geschickt, und jetzt schicken sie uns ihre Leute.«
»Vielleicht sind wir ja mittlerweile die Missionsgebiete?«, merkte ich an. Er dachte über meine Worte nach und nickte dann.
»So habe ich das noch nie gesehen. Mag sein. Ironie des Schicksals, was? Weißt du, wie viele Kandidaten für das Priesterseminar sich in diesem Jahr aus der ganzen Diözese Dublin bei mir beworben haben?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Einer! Ein einziger! Unglaublich, nicht? Ich habe den Jungen herbestellt, und er war völlig ungeeignet. Nicht gerade helle. Er hat die ganze Zeit auf seinen Fingernägeln herumgekaut und gegrinst wie ein Honigpferd.«
»Wie ein Honigkuchenpferd.«
»Sag ich doch. Wie auch immer, ich habe ihn weggeschickt und ihm gesagt, er solle darüber nachdenken, ob er sich tatsächlich zum Priester berufen fühlt. Dann würden wir weitersehen. Da hat er angefangen zu flennen, und ich musste ihn praktisch aus meinem Arbeitszimmer tragen. Draußen wartete seine Mutter. Sie ist diejenige, die unbedingt will, dass er Priester wird, das habe ich gleich gesehen.«
»War das bei uns und unseren Müttern nicht auch so?«, sagte ich spontan und bereute sofort, den Gedanken ausgesprochen zu haben.
»Ach, Odran«, sagte er seufzend. »Was soll das denn heißen?«
»Ich meinte doch nur …«
»Schon gut, schon gut.« Er trank einen weiteren Schluck Whiskey und schloss genießerisch die Augen. Dann sagte er: »Ich wollte mit dir auch noch über Pater Miles Donlan sprechen.«
Ich sah zu Boden. Das war das Gespräch, mit dem ich ursprünglich gerechnet hatte. »Pater Miles Donlan«, wiederholte ich leise.
»Du hast Zeitung gelesen, nehme ich an? Nachrichten geschaut?«
»Ja, Exzellenz.«
»Sechs Jahre«, sagte er und stieß einen Pfiff aus. »Glaubst du, das überlebt er?«
»Er ist nicht mehr ganz jung«, sagte ich. »Und im Gefängnis ist man offenbar nicht gerade zimperlich mit …« Ich brachte das Wort nicht über die Lippen.
»Und dir ist nie etwas zu Ohren gekommen, Odran?«
Ich schluckte. Natürlich hatte ich Gerüchte gehört. Pater Donlan hatte so wie ich seit Jahren am Terenure College gearbeitet. Ehrlich gesagt hatte ich ihn nie gemocht. Er hatte irgendwie verbittert gewirkt und sprach über die Jungen, als faszinierten sie ihn und widerten ihn zugleich an. Ja, natürlich hatte es Gerüchte gegeben.
»Ich kannte ihn nicht besonders gut«, sagte ich ausweichend.
»Du kanntest ihn nicht besonders gut«, wiederholte er und sah mich an, bis ich den Blick abwandte. »Aber wenn dir etwas zu Ohren gekommen wäre, Odran, oder wenn dir etwas Ähnliches über jemand anderen zu Ohren käme, was würdest du dann tun?«
Nichts, wäre die ehrliche Antwort gewesen. »Ich würde wohl mit dem Mann reden.«
»Du würdest mit dem Mann reden. So, so. Würdest du auch mit mir reden?«
»Wahrscheinlich schon.«
»Und würdest du die Polizei benachrichtigen und den Mann anzeigen?«
»Nein«, sagte ich schnell. »Zumindest nicht sofort.«
»Nicht sofort. Aha. Wann dann?«
Ich zuckte mit den Schultern und überlegte krampfhaft, was er hören wollte. »Um ehrlich zu sein, Jim, weiß ich nicht, was ich tun würde oder wem ich wann davon erzählen würde. Das käme ganz auf die Umstände an.«
»Ich sage dir, was du tun würdest: Du würdest mir davon erzählen und sonst niemandem«, sagte er scharf. »Die Journalisten sind hinter uns her, siehst du das nicht? Die Sache ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Wir müssen die Kontrolle wiedergewinnen. Wir müssen die Medien an die Leine legen.« Er sah zur Statue von Erzbischof McQuaid auf dem Barschränkchen hinüber. »Glaubst du etwa, er hätte sich das gefallen lassen? Er hätte den Schreiberlingen das Maul gestopft. Er hätte das Gebäude der Fernseh- und Rundfunkanstalt gekauft und RTÉ vor die Tür gesetzt.«
»Die Zeiten haben sich geändert«, murmelte ich.
»Ja, zum Schlechten. Aber was soll’s … Eigentlich wollte ich mit dir über was ganz anderes reden. Wo war ich stehen geblieben?«
»Der Priester aus Nigeria.« Ich war erleichtert, dass er das Thema wechselte.
»Ah ja, Pater Ngezo. Ein guter Mann. Nur halt schwarz wie die Nacht. Aber so ist das heute. Er ist ja beileibe nicht der Einzige. Wir haben drei Priester aus Mali, zwei Kenianer und einen aus dem Tschad, drüben in Donnybrook. Und nächsten Monat kommt ein Junge aus Burkina Faso, der in Thurles als Kaplan anfangen soll. Hast du schon mal was von Burkina Faso gehört? Ich hatte noch nie davon gehört, aber anscheinend ist das ein Land.«
»Liegt das nicht nördlich von Ghana?« Ich versuchte, mir die Landkarte von Afrika in Erinnerung zu rufen.
»Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Es könnte genauso gut auf dem Mond liegen. Heutzutage müssen wir nehmen, was wir kriegen. Jedenfalls will ich Pater Ngezo eine Chance geben. Er braucht eine Veränderung, und er ist ein großer Rugbyfan. Du hast dich doch sowieso nie groß für den Sport interessiert, nicht wahr?«
»Ich gehe zu fast allen Spielen«, sagte ich zu meiner Verteidigung.
»Tatsächlich? Ich dachte, du hättest nichts damit am Hut. Bestimmt wird er sich prima mit den Jungs verstehen, und ihnen tut es gut, mit einer fremden Kultur in Berührung zu kommen. Hättest du etwas dagegen, wenn er deinen Posten übernimmt?«
»Ich bin seit siebenundzwanzig Jahren an der Schule, Exzellenz.«
»Ich weiß.«
»Die Schule ist mein Zuhause.«
Er seufzte und lächelte leicht. »Wir Priester haben kein Zuhause. Jedenfalls kein eigenes. Das weißt du doch.«
Du hast gut reden, dachte ich und ließ den Blick über die prunkvollen Sessel und die schweren Samtgardinen schweifen.
»Ich würde die Schule sehr vermissen«, sagte ich.
»Aber es täte dir bestimmt gut, eine Auszeit vom Unterrichten zu nehmen und mal wieder in einer Gemeinde zu arbeiten. Es wäre ja nicht für immer.«
»Ich war noch nie in einer Gemeinde tätig, Exzellenz.«
»Jim, ich heiße Jim«, sagte er gelangweilt.
»Ich wüsste nicht einmal, was in einer Gemeinde von mir erwartet würde. Wo willst du mich denn hinschicken?«
Er lächelte schwach, starrte auf den Teppich und holte geräuschvoll Luft. Dann machte er ein verlegenes Gesicht. »Du kannst es dir vermutlich denken. Es wäre wirklich nur für kurze Zeit. Ich brauche jemanden, der Toms Gemeinde übernimmt.«
»Toms Gemeinde? Welchen Tom meinen Sie?«
»Was glaubst du?«
Ich riss die Augen auf. »Tom Cardle?«
»Er hat dich vorgeschlagen.«
»Das war seine Idee?«
»Es war meine Idee, Pater Yates«, sagte der Erzbischof streng. »Aber Tom war dabei, als wir alle Möglichkeiten erörtert haben.«
Ich konnte das kaum glauben. »Ich habe ihn noch am Freitag getroffen, und er hat die Sache mit keinem Wort erwähnt.«
»Wir haben uns am Samstagmorgen getroffen«, erklärte der Erzbischof. »Er war hier, und wir haben darüber gesprochen. Er sagte, du würdest dich bestimmt über eine Veränderung freuen, und ich habe ihm zugestimmt.«
Ich schwieg verwirrt. Ich begriff nicht, warum Tom damit gleich zu Jim Cordington gegangen war und nicht erst mit mir gesprochen hatte. Schließlich kannten wir uns seit unserer Jugend und waren eng befreundet.
Tom Cardle und ich waren im Jahr 1973 ins Priesterseminar eingetreten und hatten nebeneinandergesessen, als der Regens uns Neuankömmlingen erklärte, wie unser Tagesablauf in den nächsten Monaten aussehen werde. Tom kam vom Land, aus dem County Wexford, und war ein paar Monate älter als ich. Er war in der Woche zuvor siebzehn geworden. Ich spürte gleich, dass er todunglücklich war. Er wollte nicht am Clonliffe sein. Ich fühlte mich ihm auf Anhieb verbunden – nicht, weil ich seine Verzweiflung teilte, sondern weil ich die Einsamkeit fürchtete. Ich hatte mir vorgenommen, so schnell wie möglich Freunde zu finden. Ich vermisste Hannah, und ich ahnte, dass ich einen Vertrauten brauchen würde. Meine Wahl fiel auf Tom, und so wurden wir Freunde.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich, als wir in der Zelle, die wir miteinander teilen würden, unsere Sachen auspackten. Es war das erste Mal, dass ich versuchte, mich als Seelsorger zu betätigen. Man hatte uns zusammengelegt, weil wir bei der Begrüßungsrede nebeneinandergesessen hatten. Unsere Zelle war winzig und spartanisch eingerichtet: Rechts und links an den Wänden standen zwei schmale Betten, dazwischen war gerade genug Platz, dass wir beide dort stehen konnten. Außerdem gab es noch einen Kleiderschrank und einen kleinen Tisch mit einer Schüssel und einem Krug. In einer Ecke stand ein Eimer.
»Du bist ziemlich blass.«
»Mir ist ein bisschen übel«, sagte er in seinem breiten Akzent aus dem Süden, der mir gut gefiel. Ich war froh, dass ich das Zimmer nicht mit einem Jungen aus Dublin teilen musste. Als er sagte, er sei aus Wexford, zog sich mir jedoch das Herz zusammen, denn der Name dieser Gegend weckte traurige Erinnerungen.
»Von der langen Fahrt?«, fragte ich.
»Vielleicht. Die Straßen sind in einem ziemlich schlechten Zustand. Daddy hat mich mit dem Traktor hergebracht.«
Ich starrte ihn ungläubig an. »Du hast den ganzen Weg von Wexford nach Dublin in einem Traktor zurückgelegt?«
»Ja.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wie habt ihr das denn geschafft?«
»Wir sind langsam gefahren«, sagte er, »und mehrmals liegen geblieben.«
»Du Armer. Wie heißt du eigentlich?«
»Tom Cardle.«
»Odran Yates.« Ich streckte ihm die Hand hin, und er schüttelte sie. Einen Moment fürchtete ich, er würde in Tränen ausbrechen.
»Freust du dich, hier zu sein?«, fragte ich. Er schnaubte und murmelte irgendetwas Unverständliches. »Keine Angst, es wird dir bestimmt gut gefallen. Ein Junge, den ich kenne, war vor ein paar Jahren hier im Seminar und hat erzählt, dass es großen Spaß macht. Wir müssen nicht von morgens bis abends beten. Wir dürfen auch Brettspiele spielen, Sport treiben und singen. Wir werden eine tolle Zeit haben, wart’s nur ab.«
Er nickte, machte aber ein zweifelndes Gesicht. Dann klappte er den Deckel seines Koffers auf. Viel hatte er nicht dabei, ein paar Hemden und Hosen, etwas Unterwäsche und ein paar Socken. Auf den Kleidern lag eine Bibel in einem kostbaren Ledereinband. Ich nahm sie in die Hand und betrachtete sie.
»Meine Mam und mein Dad haben sie mir geschenkt«, sagte er. »Zum Abschied.«
»Muss ganz schön teuer gewesen sein«, bemerkte ich und gab ihm die Bibel zurück.
»Du kannst sie haben, wenn du willst. Ich kann nichts damit anfangen.«
Ich lachte, weil ich glaubte, er mache einen Scherz, aber seine Miene war todernst.
»Nein, nein, sie gehört doch dir.«
Er zuckte mit den Achseln und warf sie achtlos auf den kleinen Tisch. In den folgenden Jahren sollte er sie nur selten aufschlagen.
»Tom ist doch erst seit zwei Jahren in dieser Gemeinde tätig«, sagte ich zu Erzbischof Cordington. Ich wunderte mich, dass er schon wieder versetzt werden sollte. Tom hatte in den letzten fünfundzwanzig Jahren sehr oft die Gemeinde gewechselt. Ich sagte häufig im Scherz, dass er immer einen gepackten Koffer im Schrank stehen hatte.
»Seit achtzehn Monaten. Kein schlechter Schnitt.«
»Er hat sich bestimmt gerade erst eingelebt.«
»Er braucht eine Veränderung.«
»Natürlich ist das deine Entscheidung«, wagte ich mich vor, weil ich hoffte, dass er sich mit guten Argumenten umstimmen ließe, »aber ist Tom in den letzten Jahren nicht oft genug umgezogen? Wäre es nicht besser, ihn für eine Weile zur Ruhe kommen zu lassen?«
»Wie heißt es noch gleich bei Shakespeare?«, sagte der Erzbischof mit einem breiten Lächeln. »Vorwärts, wir fragen und zagen nicht? Vorwärts, wir wanken und schwanken nicht?«
»Vorwärts, sie fragen und zagen nicht / Vorwärts, sie wanken und schwanken nicht / Vorwärts, gehorchen ist einzige Pflicht«, verbesserte ich ihn. »Alfred Tennyson.«
»Nicht Shakespeare?«
»Nein, Exzellenz.«
»Ich hätte schwören können, es wäre Shakespeare.«
Ich schwieg.
»Jedenfalls weißt du, was ich meine«, sagte er kalt. »Tom Cardles einzige Pflicht ist es zu gehorchen. Und Odran Yates’ auch.« Er trank von seinem Whiskey.
»Verzeihung«, sagte ich. »Ich wollte nicht …«