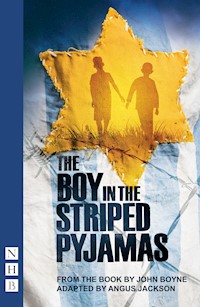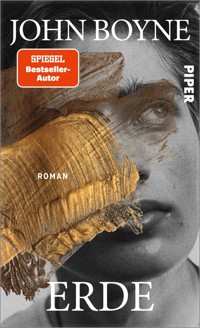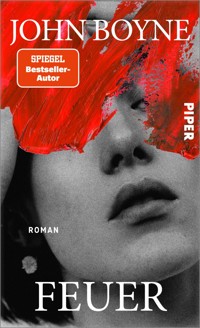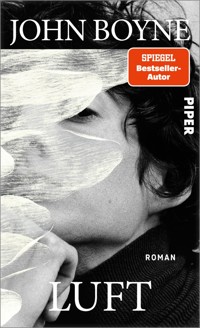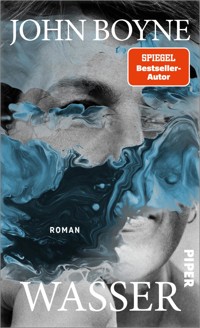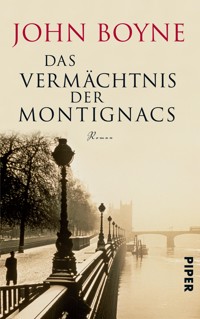8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England 1867. Die junge Eliza Caine fährt in die englische Grafschaft Norfolk, um eine Stellung als Gouvernante anzutreten. Als sie an einem nebeligen Novemberabend müde und durchgefroren die Empfangshalle von Gaudlin Hall betritt, wird sie von ihren beiden Schützlingen Isabella und Eustace freudig begrüßt. Zu ihrer Überraschung stellt sie fest, dass außer den beiden Kindern niemand in dem alten viktorianischen Anwesen lebt – bis sie erkennen muss, dass sie dennoch nicht alleine sind. Etwas verfolgt sie und trachtet ihnen nach dem Leben. Eliza muss längst begrabene, tödliche Geheimnisse enträtseln, wenn sie nicht selbst den düsteren Mauern von Gaudlin Hall zum Opfer fallen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Sinéad
Die englische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Hause is Haunted« bei Transworld.
Übersetzung aus dem Englischen von Sonja Finck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96779-2
© John Boyne, 2014
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Andy & Michelle Kerry/Trevillion Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Erstes
Kapitel
London, 1867 Ich mache Charles Dickens für den Tod meines Vaters verantwortlich.
Wenn ich an den Moment zurückdenke, an dem das Grauen in mein Leben trat und es in seinen Grundfesten erschütterte, sehe ich mich wieder im Wohnzimmer unseres kleinen Reihenhauses in der Nähe des Hyde Parks sitzen, den abgenutzten Kaminvorleger betrachten und darüber nachsinnen, ob ich ihn ausbessern sollte oder ob es nicht an der Zeit wäre, einen neuen zu kaufen. Banale, alltägliche Gedanken. Draußen ging ein zögerlicher, aber beharrlicher Nieselregen nieder, und als ich mich vom Fenster abwandte und mich im Spiegel über dem Kamin musterte, schlug mir der Anblick aufs Gemüt. Ich war nie besonders attraktiv gewesen, aber an jenem Tag wirkte meine Haut noch blasser als sonst und mein schwarzes Haar war drahtig und ungekämmt. Ich saß mit aufgestützten Ellbogen, hochgezogenen Schultern und einer Tasse Tee in der Hand am Tisch, und als ich meine gekrümmte Haltung bemerkte, straffte ich die Schultern und drückte den Rücken durch. Dann tat ich etwas überaus Törichtes: Ich lächelte mir zu, als könne ein fröhlicher Gesichtsausdruck etwas an dem Ergebnis verbessern. Plötzlich entdeckte ich zu meinem Entsetzen ein zweites Gesicht, kleiner als meines, das mir aus der unteren linken Ecke des Spiegels entgegenstarrte.
Ich schnappte nach Luft und legte mir eine Hand auf die Brust. Im nächsten Moment lachte ich über meine Dummheit, denn was ich sah, war nur das Spiegelbild des Porträts meiner verstorbenen Mutter, das an der Wand hinter meinem Stuhl hing. Im Spiegel sah man unsere beiden Gesichter nebeneinander, und der Vergleich fiel nicht gerade zu meinen Gunsten aus, denn Mutter war eine Schönheit mit großen, leuchtenden Augen, während meine schmal und blässlich waren. Ihre Wangenknochen waren weiblich, während meine zu männlicher Härte neigten, und sie hatte einen zierlichen Körper, während meiner sich immer schon klobig und albern angefühlt hatte.
Das Porträt war mir natürlich wohlvertraut. Es hing schon so lange an seinem Platz, dass ich es seit einer ganzen Weile nicht mehr wirklich wahrgenommen hatte, so wie man über gewohnte Dinge – ein Sofakissen oder Familienangehörige – leicht hinwegsieht.
Doch an jenem Morgen ließ mich ihr Gesichtsausdruck nicht los. Obwohl sie diese Welt schon vor über einem Jahrzehnt verlassen hatte, spürte ich in diesem Moment, wie traurig ich über ihren Tod war. Damals war ich noch ein halbes Kind gewesen. Jetzt dachte ich an das Jenseits und fragte mich, wo ihr Geist nach dem Tod wohl seine letzte Ruhe gefunden hatte und ob sie all die Jahre über mich gewacht, sich an meinen kleinen Erfolgen erfreut und meine zahlreichen Fehler beklagt hatte.
Draußen senkte sich der Morgennebel auf die Straße, und ein schneidender Wind fuhr in den Kamin, wehte durch den bröckeligen Schacht und stieß ins Zimmer, ohne an Kraft zu verlieren, sodass ich mein Schultertuch enger um mich ziehen musste. Ich schauderte und sehnte mich zurück in mein warmes Bett.
Ich wurde aus meinen Tagträumen gerissen, als Vater einen verzückten Schrei ausstieß. Er saß mir gegenüber, hatte seinen Teller mit den halb gegessenen Heringen und Eiern beiseitegeschoben und blätterte in der Illustrated London News. Die Zeitung lag seit dem vorigen Samstag ungelesen auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, und ich hatte sie am Morgen wegwerfen wollen, doch aus irgendeinem Grund hatte Vater plötzlich beschlossen, beim Frühstück einen Blick hineinzuwerfen. Ich sah erstaunt auf – erst dachte ich, er hätte sich verschluckt, aber dann sah ich seine in freudiger Erregung geröteten Wangen. Er reichte mir die Zeitung und tippte mehrmals mit dem Finger darauf.
»Schau mal, Liebes«, sagte er. »Ist das nicht wunderbar?«
Ich nahm die Zeitung und starrte auf die aufgeschlagene Seite. In dem Artikel ging es um einen großen Kongress, der kurz vor Weihnachten in London stattfinden und sich mit dem amerikanischen Kontinent beschäftigen würde. Ich las ein paar Absätze, verlor aber angesichts der politischen Rhetorik, die den Leser wohl gleichermaßen in Aufruhr versetzen und in den Bann ziehen sollte, rasch den Faden. Ich blickte auf und sah Vater verwirrt an. Er hatte sich nie zuvor für Amerika interessiert. Im Gegenteil, bei jeder sich bietenden Gelegenheit tat er seine Überzeugung kund, jenseits des Atlantischen Ozeans lebten nichts als primitive, streitsüchtige Halunken, die man niemals in die Unabhängigkeit hätte entlassen dürfen, denn diese sei ein Verrat an der Krone, und der Duke of Portland, der Premierminister, der schuld an dem ganzen Schlamassel sei, solle auf ewig verflucht sein.
»Was ist damit?«, fragte ich. »Du möchtest doch wohl nicht aus Protest hingehen, oder? Das Museum würde es gewiss nicht gutheißen, wenn du anfängst, dich politisch zu betätigen.«
»Was?«, fragte er verwirrt über meine Erwiderung und schüttelte dann hastig den Kopf. »Nein, nein. Ich meine nicht den Artikel über diese Schurken. Sie haben sich die Suppe eingebrockt, nun sollen sie sie auch auslöffeln. Die können mir den Buckel runterrutschen. Nein, weiter links. Die Anzeige am Rand.«
Ich nahm die Zeitung wieder zur Hand und sah sogleich, was er meinte. Charles Dickens, der weltberühmte Schriftsteller, würde am nächsten Abend, einem Freitag, aus seinen Werken lesen, und zwar in einem Saal in Knightsbridge, nicht mehr als eine halbe Stunde zu Fuß von unserem Haus entfernt. Interessenten wurden gebeten, früh zu kommen, denn es sei bekannt, dass Mr Dickens stets eine große und begeisterte Zuhörerschaft anziehe.
»Da müssen wir hingehen, Eliza!«, rief Vater mit strahlendem Gesicht und schob sich genüsslich einen Happen Hering in den Mund.
Draußen wehte der Wind eine Schindel vom Dach, und sie krachte in den Vorgarten. Ich hörte ein Knistern im Gebälk.
Ich biss mir auf die Lippen und las die Anzeige ein zweites Mal. Vater litt seit über einer Woche unter einem hartnäckigen Husten, der ihm die Brust zuschnürte, und bisher gab es kein Anzeichen von Besserung. Zwei Tage zuvor hatte er einen Arzt aufgesucht, der ihm einen klebrigen, grünen Trank verschrieben hatte. Ich musste ihm die Medizin fast mit Gewalt einflößen, aber bisher zeigte sie überhaupt keine Wirkung. Im Gegenteil, sein Zustand hatte sich eher noch verschlimmert.
»Denkst du, das wäre vernünftig?«, fragte ich. »Du hast deine Krankheit noch nicht ganz überstanden, und das Wetter ist schrecklich ungemütlich. Es wäre vernünftiger, wenn du noch ein paar Tage zu Hause am Kamin bleiben würdest, findest du nicht?«
»Unsinn, Liebes«, sagte er kopfschüttelnd und machte ein bestürztes Gesicht, weil ich ihm seinen größten Wunsch zu verweigern drohte. »Ich versichere dir, dass ich schon beinahe wieder gesund bin. Morgen werde ich ganz der Alte sein.«
Als wollte er seine eigenen Worte Lügen strafen, begann er bellend zu husten. Der Anfall nahm kein Ende: Sein Gesicht lief rot an, Tränen schossen ihm in die Augen, und er musste sich keuchend von mir abwenden. Ich rannte in die Küche, schenkte ein Glas Wasser ein und brachte es ihm. Er nahm einen tiefen Schluck und bemühte sich, mir aufmunternd zuzulächeln.
»Siehst du, der Husten löst sich. Ich versichere dir, mir geht es stündlich besser.«
Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Wäre es Frühling gewesen und die Sonne hätte durch die knospenden Äste der Bäume geschienen, hätten mich seine Worte vielleicht überzeugt. Aber es war nicht Frühling, sondern Herbst. Ich fand es unbesonnen, dass er seine Gesundheit aufs Spiel setzen wollte, nur um Mr Dickens persönlich zu erleben, wo er die Worte des Schriftstellers doch jederzeit schwarz auf weiß zwischen zwei Buchdeckeln finden konnte.
»Lass uns abwarten, wie es dir morgen geht«, sagte ich, denn schließlich hatte die Entscheidung noch Zeit.
»Nein, lass es uns jetzt gleich beschließen«, rief er, stellte das Wasserglas beiseite und griff nach seiner Pfeife. Er klopfte die Asche vom Vortag in seine Untertasse und stopfte die Pfeife mit seiner ganz speziellen Tabaksorte, die er rauchte, seit er ein junger Mann gewesen war. Der vertraute Duft nach Kastanien und Zimt erfüllte die Luft. Vaters Tabak roch stark nach diesem Gewürz, und immer wenn mir der Geruch anderswo begegnete, erinnerte er mich an zu Hause, an Wärme und Geborgenheit.
»Das Museum hat mich bis Ende der Woche beurlaubt. Ich werde das Haus heute und morgen den ganzen Tag nicht verlassen, und abends ziehen wir uns die Wintermäntel über und gehen gemeinsam zu Mr Dickens’ Lesung. Ich möchte sie um nichts in der Welt verpassen.«
Ich nickte seufzend, weil ich merkte, dass ihn nichts von seinem Vorhaben abbringen würde, auch wenn er sonst meist auf meine Ratschläge hörte.
»Großartig!«, rief er, entfachte ein Zündholz, ließ es ein paar Sekunden brennen, bis der Schwefel sich verflüchtigt hatte, und hielt es dann an den Pfeifenkopf. Er sog mit solchem Genuss an dem Mundstück, dass ich nicht umhinkam, über seinen zufriedenen Gesichtsausdruck zu schmunzeln. Im Halbdunkel des Wohnzimmers, im flackernden Kerzenlicht, im Schein des Feuers und hinter der glühenden Pfeife wirkte seine Haut jedoch gespenstig dünn, und mir gefror das Lächeln auf den Lippen, als mir auffiel, wie sehr er in letzter Zeit gealtert war. Wann hatten sich unsere Rollen so gewandelt? Erstaunlich, dass ich, die Tochter, ihm, dem Vater, die Erlaubnis für einen Ausflug geben musste.
Zweites
Kapitel
Vater war immer ein leidenschaftlicher Leser gewesen. In seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss, in das er sich zurückzog, wenn er mit seinen Gedanken und Erinnerungen allein sein wollte, stand eine reich bestückte Bibliothek. Eine Wand beherbergte mehrere Reihen mit Bänden, die seinem Studienfach, der Insektenkunde, gewidmet waren, ein Gebiet, das ihn seit der Kindheit faszinierte. Als Junge, so hatte er mir erzählt, bewahrte er zum Entsetzen seiner Eltern in einem gläsernen Kasten in einer Ecke seines Zimmers Dutzende von lebenden Insekten auf. In der gegenüberliegenden Ecke stand ein zweiter Behälter, in dem er ihre Körper post mortem präsentierte. Das Überwechseln der Insekten von einer Seite des Zimmers zur anderen bereitete ihm große Freude, auch wenn er es selbstverständlich nicht darauf anlegte, dass sie starben. Noch lieber studierte er sie lebend, und er führte gewissenhaft Buch über ihre Entwicklung, Geschlechtsreife und ihr Ableben. Natürlich protestierten die Dienstmädchen, wenn sie sein Zimmer putzen sollten – eine reichte sogar empört ihre Kündigung ein –, und seine Mutter weigerte sich standhaft, das Zimmer zu betreten. (Damals hatte seine Familie noch Geld und konnte sich Bedienstete leisten. Ein älterer Bruder, der nun schon viele Jahre tot ist, brachte das Erbe später durch, weshalb Vater und ich auf derartigen Luxus verzichten mussten.)
Neben Büchern, die vom Lebenszyklus von Termitenköniginnen, dem Darmtrakt von Bockkäfern und den Balzritualen der Fächerflügler handelten, standen mehrere Ordner, in denen er seine Korrespondenz mit Mr William Kirby aufbewahrte. Mr Kirby war sein Mentor und hatte ihm 1832, als Vater gerade volljährig geworden war, seine erste bezahlte Stellung besorgt, als Assistent des neuen Museums in Norwich. Später hatte Mr Kirby Vater dann mit nach London genommen, damit er ihm bei der Gründung der Insektenkundlichen Gesellschaft half, und dieser Weg hatte ihn geradewegs zu seiner jetzigen Beschäftigung als Kurator der Insektenkundlichen Abteilung des Britischen Museums geführt, eine Arbeit, die er sehr liebte. Ich teilte seine Leidenschaft nicht. Insekten stießen mich ab.
Mr Kirby war vor sechzehn Jahren gestorben, aber Vater las seine Briefe und Notizen immer noch mit großer Begeisterung. Auf diese Weise rief er sich die einzelnen Anschaffungen ins Gedächtnis, aus denen die beeindruckenden Sammlungen erst der Insektenkundlichen Gesellschaft und später des Museums entstanden waren.
Die »Insektenbücher«, wie ich sie scherzhaft nannte, standen in Reih und Glied in dem Regal neben seinem Schreibtisch, wobei nur Vater die Ordnung durchschaute. An der gegenüberliegenden Wand, neben dem Lesesessel am Fenster, wo es mehr Licht gab, befand sich eine kleinere Sammlung von Romanen, beherrscht von Mr Dickens, dem Autor, der nach Vaters Meinung einzigartig war.
»Wenn er einen Roman über Zikaden oder Grashüpfer statt über Waisenkinder schreiben würde«, sagte ich zu ihm, »würdest du im siebten Himmel schweben, nicht wahr?«
»Liebes, du vergisst Das Heimchen am Herde«, entgegnete Vater, der das Werk des Schriftstellers so gut kannte wie niemand sonst. »Und dann gibt es da noch die Spinnenfamilie in Große Erwartungen, die in Miss Havishams Hochzeitskuchen, den sie nicht angerührt hat, Quartier bezieht. Und Bitzers Wimpern in Harte Zeiten. Womit vergleicht Mr Dickens sie noch gleich? Mit den ›Fühlern geschäftiger Insekten‹, wenn ich mich recht entsinne. Wie du siehst, spielen Insekten in vielen von Dickens’ Werken eine herausragende Rolle. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihnen ein ganzes Buch widmet. Ich glaube, er ist ein passionierter Insektenkundler.«
Da ich die meisten dieser Romane selbst gelesen hatte, war ich mir dessen nicht ganz so sicher, aber selbst Vater las Dickens schließlich nicht um der Insekten, sondern um der Geschichten willen. Als ich nach dem Tod meiner Mutter aus dem Haus meiner Tanten in Cornwall zurückkehrte, sah ich Vater zum ersten Mal bei der Lektüre von Die Pickwicker wieder lächeln. Der Held dieses Romans hatte ihn vor Mutters Tod immer so sehr amüsiert, dass ihm Lachtränen über die Wangen gelaufen waren.
»Eliza, du musst das hier lesen«, sagte er an meinem vierzehnten Geburtstag und drückte mir eine Ausgabe von Bleakhaus in die Hand. »Dieses Werk ist sehr viel zeitgemäßer als die Groschenromane, die du so liebst.«
Ich schlug das Buch widerwillig auf, und bei dem Versuch zu verstehen, worum es bei dem Rechtsstreit Jarndyce gegen Jarndyce ging, wuchs mein Unmut, aber natürlich hatte Vater recht, denn als ich mich erst einmal durch die ersten Kapitel gekämpft hatte, begann ich die Geschichte zu durchschauen und entwickelte große Sympathien für Esther Summerson, ganz zu schweigen davon, dass mich die zarte Romanze berührte, die sich zwischen ihr und Dr. Woodcourt entspann, einem ehrenwerten Mann, der sie trotz ihres unansehnlichem Äußeren liebte. (Was das anging, fand ich in Esther eine Seelenverwandte, auch wenn sie ihre Schönheit verloren hatte, nachdem sie an Pocken erkrankt war, und ich nie eine Schönheit gewesen war.)
Bevor ihn eine Woche zuvor die Erkältung ereilt hatte, war Vater ein kräftiger Mann gewesen. Bei jedem Wetter legte er den Weg zur Arbeit zu Fuß zurück und verzichtete auf den Omnibus, der vor unserer Haustür hielt und ihn direkt zum Museum gebracht hätte. Als ein Mischlingshund namens Bull’s Eye ein paar Jahre lang bei uns gelebt hatte, ein sehr viel freundlicheres und ausgeglicheneres Geschöpf als sein Namensvetter, der in Oliver Twist von dem Schurken Bill Sikes misshandelt wird, führte er den Hund zusätzlich zweimal täglich im Hyde Park spazieren. Er warf im Kensington Garden Stöckchen für ihn oder ließ ihn am Serpentine-See von der Leine. Eines Tages, zumindest behauptete er das, begegnete er dort Prinzessin Helena, die weinend am Ufer saß. (Warum sie traurig war, weiß ich nicht. Er ging zu ihr und fragte sie nach ihrem Befinden, aber sie schickte ihn fort.) Jedenfalls ging Vater nie spät zu Bett und hatte einen tiefen Schlaf. Er aß maßvoll, trank nicht viel und war weder zu dick noch zu dünn. Es schien nichts dagegen zu sprechen, dass er ein hohes Alter erreichen würde. Und doch sollte es anders kommen.
Vielleicht hätte ich hartnäckiger versuchen sollen, ihn von dem Besuch von Mr Dickens’ Veranstaltung abzubringen, aber tief in meinem Herzen wusste ich, dass ich ihm nicht verbieten konnte, den Park zu durchqueren und sich nach Knightsbridge zu begeben, auch wenn er mich stets in dem Glauben ließ, er füge sich mir in häuslichen Dingen. Trotz seiner Leidenschaft für das Lesen hatte er noch nie das Vergnügen gehabt, den großen Schriftsteller öffentlich sprechen zu hören, und es war allseits bekannt, dass seine Lesungen den Theateraufführungen in der Drury Lane und der Shaftesbury Avenue in nichts nachstanden – wenn sie sie nicht sogar übertrafen. Und so sagte ich nichts, beugte mich seinem Willen und stimmte dem Unternehmen zu.
»Hör auf, dir Sorgen zu machen, Eliza«, sagte er, als wir am Freitagabend aus dem Haus traten und ich vorschlug, er solle sich wenigstens einen zweiten Schal umbinden, denn es war bitterkalt, und obwohl es seit ein paar Tagen nicht geregnet hatte, zogen ausgerechnet jetzt große graue Wolken auf. Vater, der sich nicht gern bemuttern ließ, ignorierte meinen Ratschlag geflissentlich.
Wir schlenderten Arm in Arm zum Lancaster Gate, ließen die Italienischen Gärten links liegen und durchquerten den Hyde Park auf dem Hauptweg. Als wir die Anlage etwa zwanzig Minuten später durch das Queen’s Gate wieder verließen, meinte ich plötzlich, im Nebel ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich kniff die Augen zusammen, um es besser erkennen zu können, und schnappte nach Luft, denn es war dasselbe Antlitz, das ich am Morgen im Spiegel gesehen hatte, das Gesicht meiner verstorbenen Mutter. Ich umklammerte Vaters Arm und blieb ungläubig mitten auf der Straße stehen. Er wandte sich mir mit überraschter Miene zu, als eine Frau aus dem Dunst trat und uns im Vorbeigehen zunickte. Natürlich war es nicht Mutter – wie auch? –, aber sie hätte ihre Schwester oder Cousine sein können. Die Ähnlichkeit von Augen- und Stirnpartie war verblüffend.
Dann begann es zu regnen, große schwere Tropfen fielen auf unsere Köpfe und Mäntel, und die Menschen rannten los, um Unterschlupf zu finden. Ein Schauer fuhr mir in die Glieder, und ich zitterte. Ein Stück vor uns stand eine dicke Eiche, unter deren Blättern wir Schutz hätten finden können, aber als ich darauf zeigte, schüttelte Vater den Kopf und tippte mit dem Zeigefinger auf seine Taschenuhr.
»Wenn wir uns beeilen, sind wir in fünf Minuten da«, sagte er und beschleunigte seine Schritte. »Wenn wir uns jetzt unterstellen, verpassen wir den Anfang.«
Ich ärgerte mich, weil ich den Regenschirm zu Hause vergessen hatte. Ich hatte ihn im Flur neben der Tür stehen lassen, als Vater und ich über den Schal diskutierten, und deshalb rannten wir jetzt schutzlos durch die Pfützen, die sich rasch auf dem Pflaster ausbreiteten. Als wir an unserem Ziel ankamen, waren wir pitschnass. Im Vestibül schälte ich mir die durchnässten Handschuhe von den Händen und wünschte mich zitternd an unser wärmendes Kaminfeuer. Neben mir bekam Vater einen Hustenanfall, der seinen ganzen Körper erschütterte, und ich verachtete die Besucher, die ihn deswegen im Vorbeigehen missbilligend musterten. Er brauchte mehrere Minuten, um wieder zu Atem zu kommen, und ich wollte gerade auf die Straße gehen und eine Droschke herbeiwinken, die uns nach Hause bringen würde, als Vater mich zurückrief und sagte, davon wolle er nichts wissen. Er marschierte schnurstracks in den Saal, und was konnte ich unter diesen Umständen schon anderes tun, als ihm zu folgen?
Drinnen waren an die tausend Menschen versammelt, die alle genauso durchnässt und durchfroren waren wie wir. Der schwere Geruch von nasser Wolle und Schweiß lag in der Luft. Ich sah mich um und hoffte, eine ruhige Ecke zu finden, doch mittlerweile waren fast alle Plätze belegt, und so mussten wir mit zwei Sitzen in der Mitte einer Reihe vorliebnehmen, wo wir von bibbernden und schniefenden Zuschauern umgeben waren. Glücklicherweise mussten wir nicht lange warten. Schon nach wenigen Minuten trat Mr Dickens auf die Bühne. Applaus brandete auf, und wir standen auf, um ihn gebührend zu empfangen. Die Begeisterung der Zuschauer erfreute ihn sichtlich, denn er breitete die Hände aus, als wollte er uns alle umarmen. Ganz offenbar hielt er den Jubel für wohlverdient.
Er machte keine Anstalten, dem Applaus ein Ende zu bereiten, und erst nach fünf Minuten trat er endlich an den Bühnenrand, bedeutete uns mit einer Geste, dass wir eine kurze Pause einlegen dürften, und erlaubte uns, wieder Platz zu nehmen. Er war recht blass und sein Haar und Bart waren zerzaust, doch sein Anzug und seine Weste waren aus solch teurem Tuch, dass ich den unwiderstehlichen Drang verspürte, den Stoff zu berühren. Ich fragte mich, was er wohl für ein Leben führte. Bewegte er sich tatsächlich ebenso ungezwungen in den Hinterhöfen des Londoner East Ends wie in den hochherrschaftlichen Fluren des Balmoral Castle? Es ging das Gerücht um, die trauernde Queen habe ihn in ihr Schloss geladen, damit er vor ihr auftrete. Gefiel er sich in der Gesellschaft von Einbrechern, Taschendieben und Prostituierten tatsächlich ebenso gut wie in der Gegenwart von Bischöfen, Ministern und Industriellen? In meiner Arglosigkeit konnte ich mir nicht vorstellen, was es hieß, solch ein Mann von Welt zu sein, ein Mann, der dies- und jenseits des Ozeans berühmt war und von allen verehrt wurde.
Jetzt blickte Mr Dickens mit dem Anflug eines Lächelns ins Publikum.
»Heute Abend sind Damen zugegen«, sagte er mit hallender Stimme. »Natürlich freut mich das sehr, aber ich bin auch etwas besorgt. Ich hoffe, keine von Ihnen leidet unter der übertriebenen Empfindsamkeit, die ihrem Geschlecht eigen ist. Liebe Leser, liebe Freunde, verehrte Liebhaber des geschriebenen Wortes, ich werde Sie heute Abend nicht mit den Scherzen eines Sam Weller zum Lachen bringen. Auch werde ich nicht für Ihre Erbauung sorgen, indem ich Ihnen von dem tapferen Jungen Master Copperfield erzähle, den ich so sehr schätze. Ich werde Sie nicht rühren, indem ich die letzten Tage der unglücklichen Nelly Trent schildere, diesem kleinen Engel, möge Gott sich ihrer Seele erbarmen.«
Er verstummte, um die Spannung zu steigern, und das Publikum starrte ihn gebannt an.
»Stattdessen«, fuhr er nach einer längeren Pause fort und sprach jetzt langsam und mit tiefer, einschmeichelnder Stimme, »möchte ich Ihnen eine Geistergeschichte vorlesen, die ich erst kürzlich verfasst habe und die in der Weihnachtsausgabe meiner Zeitschrift All the Year Round erscheinen wird. Meine Damen und Herren, es handelt sich hierbei um eine äußerst gruselige Geschichte, die Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen und Sie um den Schlaf bringen wird. Darin geht es um Übernatürliches, um Untote, um diese erbarmungswürdigen Geschöpfe, deren Seelen nach dem Tod keine Ruhe finden und zwischen den Welten umherirren. Eine der Figuren ist weder lebendig noch tot. Ich habe die Geschichte geschrieben, um Ihnen Grauen einzuflößen und Ihnen die schlimmsten Albträume zu bescheren.«
Da erhob sich ein Schrei im Saal, und als ich den Kopf wandte, sah ich eine junge Frau etwa in meinem Alter – Anfang zwanzig – aufspringen und zum Ausgang laufen. Ich seufzte und verachtete sie insgeheim. Sie war eine Blamage für unser Geschlecht.
»Sollten weitere Damen den Saal verlassen wollen«, sagte Mr Dickens, der den Zwischenfall sichtlich genoss, »möchte ich Sie bitten, das jetzt zu tun. Ich werde nun beginnen und möchte nicht mitten in der Geschichte unterbrochen werden.«
Nun betrat ein kleiner Junge von der Seite her die Bühne, ging zu dem Schriftsteller, verneigte sich tief, drückte ihm einen Stapel Blätter in die Hand und rannte davon. Mr Dickens sah auf das Papier hinab, riss die Augen weit auf, ließ seinen Blick durch den Saal schweifen und begann zu lesen.
»Hallo! Ist da unten jemand!«, brüllte er so laut und unerwartet, dass ich zusammenfuhr. Eine Dame hinter mir rief: »Grundgütiger«, und ein Herr in der Nähe des Gangs ließ seine Brille fallen. Mr Dickens, der sich offenkundig an den Reaktionen des Publikums ergötzte, legte eine Kunstpause ein, bevor er weitersprach, und bald lauschte ich völlig gebannt seiner Geschichte. Eine einzelne Gaslampe erhellte sein blasses Gesicht. Er schlüpfte in die Rolle der handelnden Figuren und vermittelte ihre Angst, Verwirrung und Verzweiflung, indem er nur leicht den Tonfall änderte. Er hatte ein hervorragendes Gespür für Dramatik, brachte uns mit einem Satz zum Lachen, jagte uns mit dem nächsten einen Schauer über den Rücken und versetzte uns mit dem dritten in Angst und Schrecken. Die zwei Hauptfiguren der Geschichte – ein Signalwärter, der vor einem Eisenbahntunnel Dienst tat, und ein zufällig vorbeischauender Besucher – stellte er so lebensnah dar, dass man den Eindruck hatte, zwei Schauspieler stünden auf der Bühne. Die Geschichte selbst war, wie Mr Dickens angekündigt hatte, sehr gruselig, denn der Signalwärter glaubte, dass ein Gespenst ihn vor bevorstehendem Unheil warnte. Als der Geist ihm zum ersten Mal erschienen war, waren gleich darauf zwei Züge im Tunnel zusammengestoßen; beim zweiten Mal war eine Dame in einem vorbeifahrenden Zug gestorben. Nun war der Geist zum dritten Mal aufgetaucht und hatte dem Signalwärter wild gestikulierend bedeutet, den Weg freizugeben. Da bisher kein weiteres Unglück geschehen war, grauste es dem Mann bei dem Gedanken, welche Tragödie ihm noch bevorstand. Ich hatte den Eindruck, dass es Mr Dickens ein teuflisches Vergnügen bereitete, mit den Gefühlen des Publikums zu spielen. Wenn er wusste, dass wir uns fürchteten, trieb er das Spiel auf die Spitze und schürte unsere Angst, indem er eine düstere, bedrohliche Stimmung schuf. Wenn wir sicher waren, dass jeden Moment etwas Furchtbares passieren würde, enttäuschte er unsere Erwartung und ließ wieder Frieden einkehren, sodass der gesamte Saal, nachdem er in Erwartung weiterer Schrecken die Luft angehalten hatte, seufzend ausatmete. Gerade wenn wir dann glaubten, alles wäre wieder gut und wir könnten uns entspannen, überraschte er uns mit einem kurzen Satz und entlockte uns spitze Schreie, jagte uns Schauer des Entsetzens über den Rücken und gestattete sich ein kleines Grinsen bei dem Gedanken, wie sehr er uns in der Hand hatte.
Während Mr Dickens las, begann ich zu fürchten, dass ich in der Nacht kein Auge zumachen würde. Mit einem Mal war ich überzeugt, dass ich von den Seelen derjenigen umgeben war, die ihr irdisches Dasein hinter sich gelassen, aber noch keinen Eingang in den Himmel gefunden hatten und die wehklagend durch die Welt zogen und verzweifelt versuchten, sich bemerkbar zu machen, die Chaos und Leid stifteten, wo immer sie hinkamen, und die nicht wussten, wann sie endlich Ruhe finden würden.
Als Mister Dickens geendet hatte, senkte er den Kopf, und die Zuschauer verharrten vielleicht zehn Sekunden lang in tiefem Schweigen, bevor tosender Applaus losbrach und wir aufsprangen und nach einer Zugabe verlangten. Ich drehte mich zu Vater um, der nicht ganz so begeistert wirkte, wie ich erwartet hatte. Er war entsetzlich blass, ein dünner Schweißfilm glänzte auf seinem Gesicht, und sein Atem ging schwer und rasselnd. Er starrte vor sich auf den Boden und rang verzweifelt nach Luft. In der rechten Faust hielt er ein blutbeflecktes Taschentuch.
Als wir aus dem Theater in die kühle, feuchte Nacht hinaustraten, schlotterten mir immer noch die Knie, und ich war überzeugt, dass überall Geister und Gespenster lauerten, aber Vater schien sich wieder ganz und gar erholt zu haben, denn er verkündete, so einen vergnüglichen Abend habe er schon lange nicht mehr verbracht.
»Er ist ein ebenso begabter Schauspieler wie Schriftsteller«, bemerkte er, während wir den Park in umgekehrter Richtung durchquerten und es abermals zu regnen begann. Im Nebel konnten wir nicht weiter als ein paar Schritte sehen.
»Ich glaube, dass er häufiger Theaterstücke aufführt«, sagte ich, »sowohl in seinem eigenen Haus als auch in dem von Freunden.«
»Ja, davon habe ich auch gelesen«, sagte Vater. »Wäre es nicht wunderbar, wenn wir einmal zu einer solchen –«
Ein weiterer Hustenanfall überkam ihn, und er beugte sich keuchend vor. So gekrümmt gab er ein armseliges Bild ab.
»Vater«, sagte ich, legte ihm einen Arm um die Schultern und versuchte, ihn aufzurichten. »Wir müssen nach Hause. Je eher du aus der nassen Kleidung herauskommst und ein heißes Bad nehmen kannst, desto besser.«
Er nickte, stützte sich auf mich und schleppte sich hustend und niesend vorwärts. Als wir die Bayswater Road entlanggingen und in die Brook Street einbogen, ließ der Regen zu meiner Erleichterung urplötzlich nach, aber bei jedem Schritt spürte ich meine durchweichten Füße in den Schuhen, und ich mochte mir gar nicht vorstellen, wie nass Vaters Füße waren. Als wir endlich zu Hause waren, stieg er schwerfällig in die eiserne Badewanne und lag eine halbe Stunde im heißen Wasser, bevor er sein Nachthemd und seinen Schlafrock anzog und sich zu mir ins Wohnzimmer gesellte.
»Ich werde den heutigen Abend nie vergessen, Eliza«, sagte er, als wir zusammen am Feuer saßen, heißen Tee tranken, Toast mit Butter aßen und der Raum sich abermals mit dem Zimtduft seiner Pfeife füllte. »Was für ein Pfundskerl!«
»Ich fand ihn ziemlich unheimlich«, entgegnete ich. »Ich mag Mr Dickens’ Romane fast so sehr wie du, aber ich wünschte, er hätte aus einem seiner dramatischen Bücher vorgelesen. Ich finde keinen großen Gefallen an Spukgeschichten.«
»Machen sie dir Angst?«
»Nein, aber sie beunruhigen mich. Jede Geschichte, die vom Jenseits handelt und von Kräften, die der menschliche Verstand nicht zu fassen vermag, versetzt ihre Leser in Aufruhr. Allerdings möchte ich meinen, dass ich weniger Angst als andere empfinde. Ich verstehe nicht, was daran so schrecklich sein soll. Ich empfinde nur Unbehagen und eine leichte Beklemmung. Zum Beispiel der Signalwärter in der Geschichte. Er hatte entsetzliche Angst vor dem Unheil, das ihm angeblich drohte. Oder die Frau im Publikum, die schreiend den Saal verließ. Wie kann man sich nur so fürchten?«
»Glaubst du denn nicht an Gespenster, Eliza?«, fragte Vater, und ich wandte mich überrascht zu ihm um. Im Wohnzimmer war es dunkel, und sein Gesicht wurde nur von den glühenden Kohlen erhellt, wodurch seine Augen dunkler als sonst wirkten. Hin und wieder flackerte eine Flamme auf und brachte seine Haut zum Schimmern.
»Ich weiß nicht«, sagte ich, und das war die reine Wahrheit. »Du etwa?«
»Ich glaube, dass die Frau nicht ganz bei Trost war«, sagte Vater. »Mr Dickens hatte noch nicht einmal mit der Geschichte begonnen, als sie schon kreischend davonlief. Sie hätte gleich zu Hause bleiben sollen, wenn sie so zartbesaitet ist.«
»Mir jedenfalls gefallen seine realistischen Geschichten besser«, sagte ich und wandte den Blick ab. »Die Romane, die von Waisenkindern handeln und davon, wie sie sich trotz aller Widrigkeiten behaupten. David Copperfield, Oliver Twist und Nicholas Nickleby waren mir schon immer lieber als Mr Scrooge und Mr Marley.«
»Marley war tot, damit wollen wir beginnen«, sagte Vater mit tiefer Stimme und imitierte Mr Dickens so gut, dass ich erschauderte. »Darüber gibt es nicht den mindesten Zweifel.«
»Nicht«, sagte ich und musste trotzdem lachen. »Bitte verschone mich.«
Gleich nachdem ich zu Bett gegangen war, schlief ich ein, aber ich hatte eine unruhige Nacht und wurde von Albträumen geplagt. Statt aufregende Abenteuer zu erleben, begegnete ich Gespenstern. Ich lief über dunkle Friedhöfe und sah schemenhafte Gestalten, statt die Alpen zu besteigen oder in Venedig in einem Boot über die Kanäle zu fahren. Trotzdem schlief ich bis zum Morgen durch, und als ich benommen und missmutig erwachte, fiel bereits Morgenlicht durch die Vorhänge. Ich sah zu meiner Wanduhr hoch. Es war fast zehn nach sieben, und ich verwünschte mich, da ich zu spät zur Arbeit kommen würde, zumal ich Vater noch das Frühstück bereiten musste. Als ich wenige Minuten später sein Zimmer betrat, um nach ihm zu sehen, bemerkte ich sofort, dass sich sein Zustand verschlechtert hatte. Er war sehr viel kränker, als ich mir hatte eingestehen wollen. Der Regen vom Vorabend hatte seinen Tribut gefordert, die Kälte saß ihm tief in den Knochen. Seine Haut war leichenblass und feuchtkalt. Ich bekam es mit der Angst zu tun, zog mich rasch an und rannte bis zum Ende der Straße, wo Dr. Connolly wohnte, unser Hausarzt und ein langjähriger Freund der Familie. Er begleitete mich zurück und tat zweifellos alles in seiner Macht Stehende, aber nachdem er Vater untersucht hatte, sagte er, wir könnten nur abwarten und hoffen, dass das Fieber sinke. Ich verbrachte den Rest des Tages an Vaters Bett und betete zu einem Gott, der mir nur selten in den Sinn kam, und am frühen Abend, als die Sonne hinter dem Horizont verschwunden und der beklemmende Londoner Nebel heraufgezogen war, spürte ich, wie Vaters Griff um meine Hand schwächer wurde, er sein Leben aushauchte und friedlich dahinschied. Er ließ mich als Waise zurück, wie eine der Romanfiguren, von denen ich am Abend zuvor gesprochen hatte. Wenn man denn eine einundzwanzigjährige Frau als Waise bezeichnen kann.
Drittes
Kapitel
Vaters Beerdigung fand am nächsten Montag in der St. James’s Church in Paddington statt, und es war mir ein großer Trost, dass ein halbes Dutzend seiner Arbeitskollegen vom Britischen Museum und drei meiner eigenen Kolleginnen gekommen waren – ich unterrichtete die erste Klasse an der St. Elizabeth’s School –, um mir ihr Beileid auszusprechen. Wir hatten keine lebenden Verwandten, und so gab es nur wenige Trauergäste, unter anderem die Witwe, die neben uns wohnte und die sonst immer geflissentlich weggeschaut hatte, wenn ich ihr auf der Straße begegnet war, ein höflicher, aber schüchterner junger Student, dem Vater bei seinen Insektenstudien mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte, Jessie, unser Dienstmädchen, das ein paar Stunden in der Woche zu uns kam, und Mr Billington, der Tabakhändler aus der Connaught Street, bei dem Vater, solange ich denken konnte, seinen Zimttabak gekauft hatte. Seine Anwesenheit rührte mich ganz besonders und erfüllte mich mit Dankbarkeit.
Mr Heston, Vaters unmittelbarer Vorgesetzter in der Insektenkundlichen Abteilung, ergriff mit beiden Händen meine rechte Hand, drückte sie leicht und sagte mir, wie sehr er Vaters klugen Verstand bewundert habe. Eine gewisse Miss Sharpton, eine gebildete Frau, deren Anstellung Vater anfangs leicht befremdet hatte, teilte mir mit, dass sie seinen Scharfsinn und Humor vermissen werde, eine Bemerkung, die mich sehr erstaunte, die ich aber trotzdem tröstend fand. (Hatte Vater mir unbekannte Seiten gehabt? War er ein Mann gewesen, der geistreiche Gespräche führte, Scherze machte und jungen Frauen imponierte? Möglich war das durchaus, aber doch auch verwunderlich.) Ich bewunderte Miss Sharpton und wünschte, ich könnte sie besser kennenlernen. Ich wusste, dass sie an der Sorbonne studiert und dort auch einen Abschluss erworben hatte, der von englischen Universitäten aber nicht anerkannt wurde. Offenbar hatte ihre Familie sie deswegen sogar verstoßen. Vater erzählte mir einmal, dass er sie gefragt habe, ob sie sich auf den Tag freue, an dem sie heiraten werde und nicht mehr arbeiten müsse. Ihre Antwort – sie würde lieber Tinte trinken – hatte ihn entsetzt und mich neugierig gemacht.
Draußen vor der Kirche verkündete Mrs Farnsworth, die Direktorin meiner Schule, die mich als Mädchen unterrichtet und mich später als Lehrerin angestellt hatte, dass ich mir den Rest der Woche freinehmen müsse, um angemessen um Vater zu trauern, dass aber harte Arbeit erstaunlich gut gegen Schwermut helfe und sie sich deshalb freue, mich am nächsten Montag wieder in der Schule zu sehen. Sie war keine hartherzige Person und hatte im Vorjahr ihren Ehemann und zwei Jahre zuvor einen Sohn verloren. Trauer war ihr ein vertrauter Zustand.
Zum Glück regnete es nicht, während wir Vater zu Grabe trugen, aber in dem dichten Nebel sah ich kaum, wie der Sarg in die Grube gesenkt wurde. Vielleicht war es ein Segen, dass ich den Moment verpasste, in dem man den Sarg zum allerletzten Mal sieht.
Erst als der Priester zu mir trat, um mir die Hand zu schütteln, ging mir auf, dass die Beerdigung vorbei war und mir nichts blieb, als nach Hause zu gehen.
Ich beschloss jedoch, nicht sofort in das leere Haus zurückzukehren, sondern schlenderte noch eine Weile über den Friedhof, spähte durch die Nebelschleier zu den Grabsteinen und las die eingravierten Namen und Daten. Einige der hier Begrabenen waren wohl eines natürlichen Todes gestorben – Männer und Frauen, die ihr sechzigstes oder sogar siebzigstes Jahr erlebt hatten. Andere hingegen waren viel zu früh aus dem Leben gerissen worden, Kinder, die kaum dem Windelalter entwachsen waren, und junge Mütter, die gemeinsam mit ihren Säuglingen bestattet worden waren. Ich kam am Grab von Arthur Covan vorbei, einem einstigen Kollegen, und als ich daran dachte, was er getan hatte, lief mir ein Schauer über den Rücken. Arthur und ich hatten uns gut verstanden, kurze Zeit hatte ich sogar gehofft, dass mehr daraus werden könnte. Die Erinnerung an meine Zuneigung zu ihm und das Wissen darum, welche Schandtat dieser gestörte junge Mann begangen hatte, wühlten mich noch mehr auf.
Mir kam der Gedanke, dass ein Friedhof in diesem Moment vielleicht nicht der beste Ort für mich war, und suchte nach dem Ausgang, musste aber feststellen, dass ich mich verlaufen hatte. Der Nebel um mich herum wurde immer dichter, und bald konnte ich die Inschriften auf den Grabsteinen nicht mehr lesen. Zu meiner Rechten – unglaublich! – hörte ich ein Paar lachen. Ich drehte mich um und wunderte mich über ein so unschickliches Verhalten an diesem Ort, konnte aber niemanden sehen. Unsicher strecke ich eine Hand aus, doch meine behandschuhten Finger griffen nur ins Leere.
»Ist da jemand?«, fragte ich, traute mich aber nicht, die Stimme zu heben, weil ich nicht sicher war, ob ich die Antwort tatsächlich hören wollte. Ohnehin blieb es totenstill. Ich erreichte eine Mauer und hoffte, auf ein Tor zu stoßen, wenn ich daran entlangging, stolperte aber nur über einen Haufen alter Grabsteine. Mein Herz begann vor Furcht schneller zu schlagen. Ich rief mich selbst zur Ordnung. Ich musste Ruhe bewahren, tief durchatmen und den Weg nach draußen finden. Doch als ich mich abermals umwandte, entfuhr mir ein Schrei, denn vor mir stand ein kleines Mädchen, nicht älter als sieben Jahre, das trotz der Kälte keinen Mantel trug.
»Mein Bruder ist ertrunken«, sagte das Mädchen, und ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. »Unsere Eltern hatten ihm verboten, zum Fluss zu gehen, aber er hat nicht auf sie gehört. Er war ungezogen. Deshalb ist er ertrunken. Mama sitzt immer noch an seinem Grab.«
»Wo ist sein Grab denn?«, fragte ich, und das Mädchen zeigte mit dem Finger auf eine Stelle hinter mir. Ich drehte mich um, konnte aber im Nebel niemanden ausmachen. Als ich mich wieder dem Mädchen zuwandte, rannte es davon und verschwand im Nebel. Panik stieg in mir auf. Sie hätte sich zu Hysterie auswachsen können, wenn ich mich nicht dazu gezwungen hätte, ruhig zu bleiben und rasch den Weg entlangzugehen. Schließlich gelangte ich zu meiner großen Erleichterung wieder auf die Straße, wo ich fast mit einem übergewichtigen Mann zusammengestoßen wäre, in dem ich den Abgeordneten unseres Wahlkreises zu erkennen meinte.
Auf dem Heimweg kam ich am Goat and Garter vorbei, einem Wirtshaus, in das ich natürlich noch nie einen Fuß gesetzt hatte. Zu meiner Verblüffung saß Miss Sharpton in dem Lokal am Fenster, ein kleines Glas Dunkelbier vor sich. Sie war in ein wissenschaftliches Buch vertieft und machte sich in einem Heft Notizen. Hinter ihr sah ich die empörten Gesichtsausdrücke der männlichen Gäste – sie hielten sie offenbar für irgendwie verrucht –, aber ich war sicher, dass sich Miss Sharpton einen feuchten Kehricht um ihr Urteil scherte. Wie sehr sehnte ich mich danach, die Gaststätte zu betreten und mich neben sie zu setzen! Sagen Sie, Miss Sharpton, was soll ich mit meinem Leben anfangen?, hätte ich sie gern gefragt. Wie kann ich meine Aussichten verbessern? Bitte helfen Sie mir, denn ich bin ganz allein auf der Welt und habe weder Freund noch Wohltäter. Sagen Sie mir, was ich tun soll.
Andere Menschen hatten Freunde. Natürlich hatten sie das, es war das Normalste von der Welt. Sie fühlten sich in der Gegenwart anderer wohl und vertrauten ihnen ihre geheimsten Gefühle an. Ich hatte nie zu diesen Menschen gehört. Ich war immer ein fleißiges, wissbegieriges Mädchen gewesen, das seine Zeit gern zu Hause bei Vater verbrachte. Außerdem war ich nicht hübsch. In der Schule hatten die anderen Mädchen Gruppen gebildet, von denen ich ausgeschlossen gewesen war. Über mich hatten sie sich das Maul zerrissen. Ich werde die Wörter, mit denen sie mich bedachten, hier nicht wiederholen. Sie machten sich über meinen plumpen Körper, meine blasse Haut und mein struppiges Haar lustig. Ich weiß nicht, warum ich so geboren worden bin. Schließlich war Vater ein stattlicher Mann und Mutter eine große Schönheit, aber aus irgendeinem Grund war ihre Tochter nicht mit einem guten Aussehen gesegnet.
In diesem Moment hätte ich alles dafür gegeben, eine Freundin zu haben, eine Freundin wie Miss Sharpton. Sie hätte mich vielleicht davon abgehalten, die überstürzte Entscheidung zu treffen, die mich fast zugrunde gerichtet hätte. Die mich immer noch zugrunde richten kann.
Ich spähte durch die Scheibe des Goat and Garter und versuchte, Miss Sharpton mit reiner Willenskraft dazu zu bringen hochzusehen. Vielleicht würde sie mir winken und darauf bestehen, dass ich mich zu ihr gesellte. Als sie sich nicht rührte, wandte ich mich schweren Herzens ab und ging nach Hause, wo ich den Rest des Nachmittags in meinem Sessel vor dem Kamin verbrachte und zum ersten Mal seit Vaters Tod weinte.
Am späten Nachmittag legte ich Kohlen nach, und da ich entschlossen war, den Anschein von Normalität aufrechtzuerhalten, ging ich zu der Metzgerei am Norfolk Place und kaufte zwei Schweinekoteletts. Ich hatte keinen großen Hunger, aber ich fürchtete, dass ich endgültig in Schwermut versinken würde, wenn ich den ganzen Tag im Haus verbrachte, ohne etwas zu essen. Obwohl ich gerade erst begonnen hatte, um Vater zu trauern, war ich nicht gewillt, mich derart gehen zu lassen. Als ich am Kramladen vorbeikam, beschloss ich sogar, mir eine Tüte Bonbons zu gönnen, und kaufte gleich noch eine Ausgabe der Morning Post. (Wenn Miss Sharpton die Sorbonne besucht hatte, konnte ich mich wenigstens darüber informieren, was in meinem eigenen Land vor sich ging.)
Als ich zu Hause meine Tasche auspackte und meinen Fehler bemerkte, wurde mir wieder schwer ums Herz. Zwei Schweinekoteletts? Und für wen war das zweite? Ich hatte es aus reiner Gewohnheit gekauft. Trotzdem briet ich beide Koteletts, aß das eine mit einer gekochten Kartoffel, und gab das zweite dem Spaniel, der im Nachbarhaus lebte. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, es jetzt gleich zu essen oder es für später aufzubewahren. (Außerdem wäre Vater, der Hunde sehr liebte, hocherfreut über meine milde Gabe gewesen.)
Als es Abend wurde, stellte ich zwei Kerzen auf den kleinen Tisch, machte es mir mit der Bonbontüte auf dem Schoß in meinem Sessel gemütlich und schlug die Zeitung auf. Ich blätterte sie rasch durch, da ich mich auf keinen Artikel so richtig konzentrieren konnte, war ich kurz davor, das Ding ins Feuer zu werfen, als ich auf die Stellenanzeigen stieß. Eine Annonce fiel mir sofort ins Auge.
Ein gewisser »H. Bennet« aus Gaudlin Hall im Landkreis Norfolk suchte nach einer Gouvernante, die sich um die Kinder des Hauses kümmern und ihnen Unterricht erteilen sollte. Die Stelle stehe einer geeigneten Bewerberin umgehend zur Verfügung, die Bezahlung sei großzügig, und bei Interesse solle man unverzüglich schreiben. Viel mehr stand da nicht. »H. Bennet«, wer auch immer das war, ging nicht darauf ein, um wie viele Kinder es ging oder wie alt sie waren. Die Zeilen wirkten rasch hingeworfen, ganz so, als ob sie in Eile verfasst und ohne Bedacht an die Redaktion gesandt worden wären. Aber aus irgendeinem Grund berührte mich die Dringlichkeit, die aus der Annonce sprach, und so las ich sie wieder und wieder vom ersten bis zum letzten Wort und fragte mich, wie Gaudlin Hall aussehen mochte und was für eine Art Mensch dieser H. Bennet wohl war.
Bis zu diesem Tag hatte ich London nur ein einziges Mal verlassen, und das war schon zwölf Jahre her, als ich neun Jahre alt gewesen war, kurz nach dem Tod meiner Mutter. In den ersten acht Jahren meiner Kindheit hatte unsere Familie in trauter Eintracht zusammengelebt. Meine Eltern hatten eine hervorstechende Eigenschaft, die sie von anderen Eltern unterschied: Sie gingen liebevoll miteinander um. Was bei uns zu Hause ganz natürlich schien – sie verabschiedeten sich jeden Morgen mit einem Kuss, saßen abends beim Lesen nebeneinander statt in getrennten Zimmern, hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, lachten viel miteinander, berührten sich häufig und sagten immer wieder, wie glücklich sie waren –, war in anderen Familien undenkbar. Das wusste ich nur zu gut. Einige wenige Male hatte ich die Häuser von Nachbarsmädchen oder Schulkameradinnen besucht, und bei diesen Gelegenheiten war mir aufgefallen, was für ein distanziertes Verhältnis ihre Eltern hatten. Sie benahmen sich nicht, als wären sie einander begegnet, hätten sich ineinander verliebt, sich einander anvertraut und wären dann vor den Altar getreten, weil sie ihr Leben miteinander verbringen wollten, sondern als wären sie Fremde, eine Art Zellengenossen, die zusammen eine Strafe absaßen, und die nicht mehr miteinander verband als die Jahrzehnte, die sie in der Gesellschaft des anderen verbringen mussten.
Bei meinen Eltern war das völlig anders. Sie machten keinen Hehl aus ihrer Zuneigung füreinander, doch ihre Liebe zu mir brachten sie noch deutlicher zum Ausdruck. Allerdings verwöhnten sie mich nicht – beide waren stramme Anglikaner und legten großen Wert auf Disziplin und Selbstbeherrschung. Sie erfreuten sich lediglich an meiner Gegenwart und gingen liebevoll mit mir um, und so waren wir eine glückliche Familie, bis die beiden mich im Alter von acht Jahren zu sich riefen und mir eröffneten, dass ich im Frühling einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bekommen würde. Natürlich freuten sie sich sehr darüber, weil sie sich lange ein zweites Kind gewünscht hatten, doch als die Jahre vergingen, waren sie zu der Überzeugung gelangt, dass es einfach nicht sein sollte. Jetzt erzählten sie mir freudestrahlend, dass unsere kleine Familie bald auf vier Mitglieder anwachsen würde.
Ich muss gestehen, dass ich mich in jenen Monaten unmöglich aufführte. Der Gedanke, einen Säugling in den Kreis der Familie aufzunehmen, begeisterte mich weit weniger als meine Eltern. Nach den vielen Jahren als Einzelkind hatte sich eine gewisse Selbstsucht in meinem Herzen eingenistet, und diese kam nun in Form von Aufsässigkeit zum Vorschein. Entgegen meines Naturells verhielt ich mich so ungezogen und widerspenstig, dass Vater mich im letzten Monat von Mutters Schwangerschaft zur Seite nahm und mir sagte, ich müsse mir keine Sorgen machen, es werde sich nichts ändern, in unserem Haus gebe es genug Liebe für mich und ein zweites Kind, und eines Tages werde ich zurückblicken und mir nicht mehr vorstellen können, wie ich ohne diesen jüngeren Bruder oder diese jüngere Schwester gelebt hätte. Er oder sie werde mir gewiss rasch ans Herz wachsen.
Leider erfüllte sich diese Vorhersage, an die ich mich allmählich gewöhnt hatte, nicht. Es war eine schwere Geburt, und schon nach wenigen Tagen mussten wir meine kleine Schwester in einen Sarg legen, in die Arme der Frau, die sie neun Monate in ihrem Leib getragen hatte. Auf dem Grabstein stand: Angeline Caine, 1813 – 1855, geliebte Ehefrau und Mutter, und Säugling Mary. Nun waren Vater und ich allein.
Aufgrund der tiefen Liebe, die Vater für Mutter empfunden hatte, litt er in den Wochen nach ihrem Tod natürlich sehr. Er schloss sich häufig in seinem Arbeitszimmer ein, war nicht imstande zu lesen, aß kaum noch etwas, verfiel zu häufig den Verlockungen des Alkohols, vernachlässigte seine Arbeit und seine Freunde und, noch viel schlimmer, mich. Wäre es so weitergegangen, wären wir gewiss im Armenhaus oder gleich im Schuldturm gelandet, aber zum Glück kamen Vaters ältere Schwestern Hermione und Rachel aus Cornwall unangekündigt zu Besuch. Sie stellten bestürzt fest, wie sehr sich ihr Bruder gehen ließ und unter welchen Umständen ihre Nichte leben musste, und nahmen die Dinge in die Hand. Trotz Vaters lautstarken Protesten putzten sie das Haus von oben bis unten. Er versuchte, sie wie Mäuse mit dem Besen aus dem Haus zu jagen, aber sie ließen sich davon nicht beeindrucken und weigerten sich standhaft abzureisen, bis sie dem Niedergang Einhalt geboten hätten. Sie sahen Mutters Habseligkeiten durch und bewahrten ein paar kostbare Stücke auf – ein wenig Schmuck, den sie besessen hatte, und ein hübsches Kleid, das mir in zehn Jahren passen würde. Den Rest gaben sie dem Gemeindepfarrer, damit er es an die Armen verteilte, worüber Vater schrecklich in Rage geriet, aber klug und besonnen wie die beiden waren, ignorierten sie den Zorn ihres Bruders und machten unbeirrt weiter.
»Wir werden nicht zulassen, dass hier der Schlendrian einzieht«, sagten meine Tanten zu mir, während sie unsere Vorratskammer ausräumten, alle verdorbenen Lebensmittel wegwarfen und frische in die Regale legten.
»Es ist nicht unsere Art, in Schwermut zu versinken, und du darfst das auch nicht, Eliza.«
Sie nahmen mich in ihre Mitte und sagten mit einer Mischung aus Verständnis und Missbilligung:
»Deine Mutter ist gestorben, und sie ist jetzt bei Gott. Das ist traurig, aber so ist es nun einmal. Für dich und deinen Vater muss das Leben weitergehen.«
Ende der Leseprobe