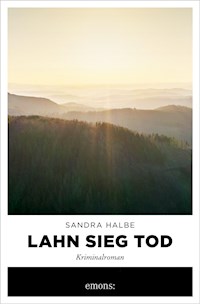Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Betti ist mit Leib und Seele Konditorin und führt erfolgreich ein kleines Café. Philip arbeitet als Koch in einem Restaurant. Bei einem Abendessen mit Freunden treffen sie aufeinander und kommen sich schnell näher. Betti hat sich geschworen, ihr Herz nie wieder für jemanden zu öffnen. Zu viel ist in ihrer Vergangenheit schon passiert. Philip würde gerne mehr über sie erfahren. Schon einmal hat er eine böse Überraschung erlebt. Wie soll er sich da auf eine Frau einlassen, die er kaum kennt? Gemeinsam engagieren beide sich für Flüchtlinge, doch das wird nicht von jedem gerne gesehen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Vater, der mir erzählt hat, wie die italienischen Gastarbeiter in Deutschland früher genannt wurden – und damit den Grundstein für diese Geschichte legte.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
EPILOG
REZEPTE
PROLOG
Viele belächeln meine Angewohnheit, nach der Arbeit noch eine Runde laufen zu gehen. »Als wärst du dort nicht schon genug auf den Beinen«, sagen sie dann und hoffen, dass ich darüber nachdenke und es dann ruhiger angehen lasse.
Bei mir löst dieser Satz eher einen »Jetzt erst recht!«-Impuls aus. Niemand schreibt mir vor, wann und wie ich meine Runde zu laufen habe. Außerdem brauche ich diesen einen Moment, Zeit, in der ich ganz für mich allein sein kann, in der einfach mal niemand etwas von mir will und kein Stimmengewirr um mich herum wahrzunehmen ist. Nein, hier kann ich einfach vor mich hinlaufen und meine Gedanken schweifen lassen, nachdem ich mich den ganzen Tag voll konzentriert habe. Noch einmal in mich gehen, bevor der Alltag mich wieder einfängt. Ganz für mich allein.
Laufen hat etwas Meditatives, gerade abends, wenn mir nicht alle paar Meter jemand entgegenkommt und der Autolärm um mich herum langsam abebbt. Wenn die Straßen sich leeren und ich mir ein wenig vorkomme wie der einzige Mensch weit und breit. Dann höre ich nur das Geräusch, wenn meine Schuhe auf dem Asphalt aufkommen, dieses monotone Trommeln. Rechts und links. Rechts und links. Hin und wieder höre ich auch ein Schmatzen, wenn ich über Pflastersteine laufe, in deren Lücken sich Erde und vielleicht ein wenig Gras gesetzt hat. Wenn der Boden zusätzlich nass ist vom letzten Regen, kommt dieses schlürfende Geräusch hinzu, das den Trommelrhythmus ein wenig stört. Manche sagen, sie tragen nur deswegen Kopfhörer und lassen sich von anderen Rhythmen davontragen, damit sie dieses Schmatzen nicht hören müssen. Bei Schnee ist es noch schlimmer, sagen sie. Dann klingt es, als würde morsches Holz unter den Füßen zerspringen. Aber ich sauge lieber alles auf, was um mich herum passiert. Vielleicht kommt noch das Prasseln einiger Regentropfen hinzu oder ein wenig Vogelgezwitscher. Dazu mein Atem, der irgendwann schneller geht, aber schön regelmäßig bleibt, genauso wie das Trommeln meiner Schuhe auf dem Boden. Nein, diese Geräusche sind Musik genug für mich. Ich brauche keine Kopfhörer.
Und Kopfhörer hätten mich auch nicht vor dem geschützt, was ich erleben sollte, als ich an diesem Abend um die Ecke lief.
KAPITEL 1
Philip
»Guten Abend!«, wurde ich freudig von meinem Besuch begrüßt, als ich die Tür öffnete.
»Hallo, Rotschopf«, lächelte ich, als Franzi hereinkam.
»Hey!« Scheinbar entrüstet knuffte sie mir in die Seite, bevor sie an mir vorbei in die Küche stürmte, um dort ganz ungeniert in die Töpfe und Pfannen zu spähen. In der Zwischenzeit begrüßte ich Jan, der genauso wie ich ungläubig im Flur zurückgeblieben war, während Franzi mit einem genüsslichen »Hmmmm« einen Löffel aus der Besteckschublade fischte, um die Soße zu probieren.
»Wer bist du und was hast du mit Franzi gemacht?«, fragte ich. Ich weiß nicht genau, ob ich damit sie selbst oder Jan meinte.
Auch er schüttelte ungläubig den Kopf, als wäre Franzi, die nun ganz freimütig den Küchentisch für uns drei eindeckte, eine Wildfremde für ihn.
»Wie geht es ihr?«, schob ich leiser hinterher.
Seit damals hatten wir uns alle angewöhnt, bei Jan nachzuhaken, ob alles in Ordnung war, wann immer Franzi sich kurz außer Hörweite befand. Damals. Als Franzi ihren langjährigen Freund Tobias erstach, nachdem dieser ihr zahlreiche Misshandlungen hinzugefügt hatte. Als sie nach dem Messer griff, um sich zu verteidigen, damit er sie nicht umbringen würde. Damals, als sie ein nervliches Wrack war und nach der Tat nicht einmal mehr sprechen konnte. Als ein Richter sie für unschuldig befand und sie nur langsam, ganz langsam ins Leben zurückfand. Als ein Frankreich-Aufenthalt und vor allem Jan ihr wieder auf die Beine halfen. Das Ganze war nun fast drei Jahre her. Und eigentlich sahen wir alle, dass es Franzi gut ging und wie glücklich sie mit Jan war.
Anfangs waren wir noch auf Zehenspitzen um sie herumgeschlichen, als könnte jedes laute Geräusch oder ein falsches Wort sie in eine neue Krise stürzen. Sobald in den Nachrichten von Mord oder häuslicher Gewalt die Rede war, hatten wir den Fernseher leiser gestellt oder ausgeschaltet. Wir hatten es vermieden, über unsere eigenen Probleme zu sprechen, um sie nicht zu sehr zu belasten.
Erst nach und nach hatten wir begriffen, dass diese übertriebene Vorsicht nicht nötig war. Im Gegenteil: Unser Verhalten hielt Franzi davon ab, wieder völlig auf die Beine zu kommen. Und so griff sie irgendwann selbst nach der Fernbedienung und stellte den Ton lauter. Oder sie merkte, wenn uns etwas beschäftigte, das wir vor ihr verstecken wollten. Dann fragte sie mit diesen für sie typisch weit aufgerissenen Augen, ob alles in Ordnung sei und ließ nicht locker, bis wir uns schließlich ein Herz fassten und erzählten, was gerade in uns vorging. Sie versuchte, uns immer wieder zu zeigen, dass die Schonfrist für sie vorbei war, bis wir es irgendwann begriffen. Diese übertriebene Vorsicht hatten wir uns also nach und nach abgewöhnt und taten jetzt in der Regel so, als sei all das nicht passiert.
Aber die Frage, wie es Franzi ging, stellten wir alle. Immer.
Wir alle, damit meine ich zum Beispiel Michi, Franzis ehemalige Mitbewohnerin. Sie war angehende Ärztin in einem der umliegenden Krankenhäuser und versorgte ihre Freundin, wenn Tobias es mal wieder übertrieben hatte mit seinen Prügeleien.
Dann gab es noch Mark, der mit Jan zusammen ein kleines Unternehmen mit Importen aus dem europäischen Ausland führte, zu dem in der Innenstadt auch ein Laden gehörte. Franzi war nach ihrem Studium im Geschäft der beiden eingestiegen. Sie und Jan hatten sich damals in einem kleinen Café kennengelernt, wo sie so manchen Nachmittag miteinander verbrachten und sich schließlich näherkamen. Die Inhaberin des Cafés, Betti, war mittlerweile zu einer guten Freundin der beiden geworden.
Und dann gab es da noch mich, Philip. Franzi und ich waren zusammen in unserem kleinen Heimatdorf aufgewachsen. Sie hatte damals Jan und mich einander vorgestellt, als ich zufällig in derselben Stadt landete und Jan ein freies Zimmer zur Verfügung hatte. Wir beide hatten uns daraufhin eine ganze Weile lang eine Wohnung geteilt. Auch jetzt, nachdem er mit Franzi zusammengezogen war, hielten wir regelmäßigen Kontakt.
So hatten wir uns heute zum gemeinsamen Abendessen in Jans alter Wohnung verabredet, die ich immer noch bewohnte.
Wenn Jan meine Nachfrage nach Franzis Zustand störte, so zeigte er es nicht. »Hin und wieder hat sie Albträume.«, sagte er leise. »Aber es geht aufwärts, immer ein Bisschen.«
Ich drückte kurz seinen Arm. Ich würde für ihn da sein, wenn er mal jemandem zum Reden brauchte.
Er nickte zum Zeichen, dass er verstanden hatte, drehte sich dann aber um und steuerte auf die Küche zu.
»Komm, Phil. Ich habe einen Bärenhunger. Und wenn du Franzi weiter hier allein lässt, ist gleich nichts mehr übrig für uns!«
»Warum wolltest du eigentlich Koch werden?«, fragte Jan mich unvermittelt, nachdem wir alle gegessen hatten.
Ich überlegte einen Moment. »Ich weiß es gar nicht so genau«, gab ich schließlich zu. »Als ich meine Ausbildung begann, liefen im Fernsehen noch gar nicht so viele Kochsendungen, die mich beeinflusst haben könnten. Kochen war lange nicht so in Mode, wie es das heute ist. Aber ich fand schon immer, dass ein schöner Abend im Kreise von Freunden oder der Familie durch nichts zu übertreffen ist. Und mit einem guten Essen wird so ein Abend erst perfekt. Tja, und dann wollte ich eben lernen, wie ich so ein gutes Essen selbst hinbekomme.«
»Und das mit Erfolg«, sagte Franzi und deutete auf die leeren Schüsseln und Teller. »Ich finde, das sollten wir öfter machen. Vielleicht laden wir noch Mark und Michi ein. So eine Art Perfektes Dinner für Freunde. Was meint ihr?«
»Aber ohne Punktevergabe, oder?«, fragte Jan.
»Und ohne durch die Wohnungen der anderen zu rennen und in jede Schublade zu glotzen!«, schob ich schnell hinterher. Bei dem Gedanken daran, gerade heute jemanden in mein Schlafzimmer zu lassen, stellten sich in meinem Nacken sämtliche Haare auf.
Sie zuckte mit den Schultern. »Es muss ja kein Wettbewerb werden. Aber wir sehen einander kaum noch. Wann haben wir denn zuletzt alle zusammen an einem Tisch gesessen? Die Arbeit vereinnahmt uns so stark, dass wir am Ende des Tages nur noch auf die Couch fallen. So ein gemütlicher Abend mit einem netten Essen wäre da doch ein tolles Gegenprogramm.«
»Und würde uns zwingen, mal wieder die Pizza vom Lieferservice nebenan liegen zu lassen«, grinste Jan. Er und ich waren begeistert. Nun mussten wir nur noch Michi und Mark mit ins Boot holen.
Wie wichtig diese Abende werden, ja, dass sie mein Leben grundlegend verändern würden, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen.
Betti
Meine Mutter Maria war eine junge Frau, als meine Großeltern damals beschlossen, nach Deutschland einzuwandern. Freunde von ihnen waren bereits im Land und hatten sich ein neues Leben aufgebaut. Viel hatte man ihnen versprochen von »Bella Germania«. Hier sollte es ihnen bessergehen als zu Hause im fernen Italien.
Doch dass man ihnen in dem kleinen Dorf, wo sie landen würden, zunächst mit Argwohn begegnen sollte, dass man sie »Spaghettifresser« nennen würde, das hatte man ihnen nicht gesagt. Die Leute warfen ihnen hinter vorgehaltener Hand vor, dass sie den Deutschen nur das Geld aus der Tasche ziehen und damit wieder in ihre Heimat verschwinden würden. Dass der Staat für sie viel mehr tue als fürs eigene Volk. Mit dem Knüpfen von Kontakten taten sie sich dementsprechend schwer, sprachen sie doch keinen Brocken deutsch. Die Einheimischen ignorierten sie weitgehend, im Dorf wurde die Familie geschnitten. Meine Großeltern ließen sich trotzdem nicht unterkriegen. Ein kleines leerstehendes Gebäude in der Nähe des Marktplatzes war schnell gefunden. Mit jeder Menge Arbeit, Schweiß und der Hilfe der wenigen anderen Italiener, die es in unsere Gegend verschlagen hatte, bauten sie es nach und nach zu einem gemütlichen Lokal um. Einen kleinen Kredit hatte mein Großvater bei der Bank herausholen können - keine Ahnung, wie er das angestellt hat. Die Renovierungskosten und die Miete für die ersten Monate konnten sie damit vorerst bezahlen, und so feierte es bald Eröffnung, ihr eigenes kleines Restaurant »da Giovanni«.
Auch wenn die Leute in unserem Dorf über die Italiener schimpften, genossen sie das Essen, das meine Nonna ihnen servierte. Schnell sprach sich herum, dass es bei Giovanni die besten hausgemachten Nudeln im Umkreis gab. Das herzliche Auftreten meiner Großeltern tat sein Übriges. Mit einem Mal war das Lokal ständig gut gefüllt und der Andrang ließ nicht nach. Abends kamen die Arbeiter auf ein schnelles Bier an der Theke herein, um den Feierabend einzuläuten. Am Wochenende war unser Restaurant ein beliebtes Ziel für Familien: Ja, meine Großeltern waren in Deutschland angekommen.
Spätestens seit die beiden in einen Steinofen für hausgemachte Pizza investiert hatten, konnten sie die Arbeit nicht mehr allein stemmen. Mein Opa hatte von Geburt an ein Herzleiden und die Tätigkeiten in der heißen Küche fielen ihm vor allem in den Sommermonaten immer schwerer. Meine Großmutter sprang zwischen Theke und Küche hin und her, um ihn zu entlasten, während meine Mutter im Gastraum kellnerte. Doch Nonna wurde nicht jünger, und so kam auch sie an die Grenze der Belastbarkeit. Schließlich wurde der junge Oliver als Küchenhilfe angestellt, um die Situation zu entschärfen. Er und Maria verbrachten von da an sehr viel Zeit miteinander. Speziell unter der Woche, an ruhigeren Tagen, zogen meine Großeltern sich gern einmal zurück und ließen Maria und Oliver allein, wenn sich der Gastraum langsam leerte. Schon nach kurzer Zeit waren die beiden jungen Leute so gut aufeinander eingespielt, dass meine Großeltern keine Bedenken hatten, ihnen an manchen Tagen das Ruder gänzlich zu überlassen. Es kam, wie es kommen musste: Irgendwann verliebten Oliver und Maria sich ineinander. Schon bald klingelten die Hochzeitsglocken. Meine Großeltern waren sehr konservativ, weißt du. Und wenn das junge Paar noch länger mit der Hochzeit gewartet hätte, wäre der Babybauch meiner Mutter nur allzu deutlich unter dem weißen Brautkleid zu sehen gewesen.
Die Hochzeitsfeier war eine kleine Veranstaltung. Auch wenn das Geschäft gut lief, musste man vorsichtig mit dem Ersparten umgehen. Der Pizzaofen war meinen Großeltern heilig. Nicht auszudenken, wenn eine Reparatur daran oder an ihrem kleinen Häuschen fällig werden würde! Für diesen Fall musste Geld da sein. Von den finanziellen Möglichkeiten abgesehen, hielten sich auch die sozialen Kontakte meiner Eltern in Grenzen. Zwar gab es die italienische Gemeinschaft und den ein oder anderen Stammgast, den sie hätten einladen können - in unserem Restaurant hatten sie bereits zusammen mit einigen Gästen auf die Trauung angestoßen. Doch viele enge Freunde hatten die beiden nicht. Und so kehrten sie nach der Zeremonie lediglich mit der Familie in ein kleines Lokal ein, aßen gemeinsam zu Mittag, und ließen die Veranstaltung nach dem Kaffee ausklingen. Meine Mutter sprach immer davon, die richtig große Feier mit den Familienmitgliedern, die in Italien zurückgeblieben waren, nachzuholen. Meine Großeltern zogen dann nur die Augenbrauen hoch, ersparten sich aber jeglichen Kommentar. Und ein paar Monate später hatten sich die Reisepläne sowieso vorerst erledigt, als ich auf die Welt kam.
Eine der ersten bewussten Erinnerungen, die ich habe, ist die, wie mein Vater von meiner Geburt berichtet. Stundenlang hatte meine Mutter in den Wehen gelegen. Einen Kaiserschnitt hatte sie abgelehnt und wollte ihre Meinung nur ändern, wenn ihr oder mein Leben in Gefahr gewesen wäre.
»So eine sture Frau«, zischte eine der Schwestern meinem Vater zu, als sie ihm auf dem Flur über den Weg lief. »Es könnte alles so einfach sein, aber die Dame will ja um jeden Preis eine natürliche Geburt!«
Mein Vater kannte meine Mutter gut genug. Deswegen wusste er, dass jeder Widerstand zwecklos war, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Also sparte er sich seinen Atem und erwiderte nichts auf die bissigen Kommentare der Schwester. Er lief weiter den Flur auf und ab und schaute aus dem Fenster, bis er endlich meine Schreie im Geburtszimmer hörte.
»Als ich dich zum ersten Mal sah«, erzählte er mir immer, »war ich, gelinde gesagt, ein wenig überrascht. Immerhin war deine Mutter eine Italienerin, so wie man sich eine Südländerin eben vorstellt: rabenschwarzes Haar, olivenfarbene Haut und rehbraune Augen. Also hatten wir beide ein Baby mit dunklen Augen und Haaren erwartet, so wie sie sie hatte. Wir dachten einfach, dass ihre Gene sich durchsetzen würden. Das Mädchen, das deine Mutter im Arm hielt, als ich das Zimmer betrat, war jedoch blond, fast weißhaarig. Und die Augen waren himmelblau, so wie meine. Weißt du, wenn es umgekehrt gewesen wäre, also deine Mutter die Deutsche und ich, dein Vater der Italiener, könnte ich mir eine wunderschöne Eifersuchtsszene vorstellen.«
Mit diesen Worten baute er sich vor mir auf, begann wie verrückt mit den Händen zu gestikulieren und nahm einen italienischen Akzent an, als er sagte: »Maria, was haste du getan, meine Kind ist eine Bastardo! Musse sein dunkel wie eine waschechte Italiano!«
Ich musste immer wahnsinnig lachen, wenn mein Vater, der eigentlich eher ruhig und zurückhaltend war, versuchte, sich aufzuführen wie ein cholerischer Italiener. Er musste nur aufpassen, dass meine Mutter ihn dabei nicht erwischte. Einmal kam sie zur Tür herein, als er gerade seine »Vorstellung« gab. »Bastardo«, sagte sie verächtlich. »Bastardo. Bastardo!«, Sie schüttelte angewidert den Kopf. »Weißt du, Oliver, Betti ist der Beweis dafür, dass die Dunkelheit nicht immer siegt, sondern auch das Helle manchmal die Oberhand hat. Manchmal bringt jemand Licht ins Dunkel. Merk dir das!«
Welche Dunkelheit meine Mutter damit meinte, sollten wir erst später erfahren.
Philip
Das nächste Abendessen fand bei Jan und Franzi statt. Mark und Michi konnten leider nicht kommen. Ich weiß nicht genau, wessen Idee es war, deswegen Betti an diesem Abend einzuladen. Natürlich waren wir einander schon einmal über den Weg gelaufen. Zwar war das Café weiterhin Jan und Franzis Stammlokal. Aber hin und wieder kam auch ich dort vorbei. Mal war ich auf dem Weg zur Arbeit und der Hunger nach einem Stück Kuchen, den wir nicht selbst auf der Speisekarte hatten, überfiel mich. Mal brauchte ich einen Ort zum Durchatmen. Wenn am Vortag auf der Arbeit die Hölle los gewesen war oder wenn das Getümmel der vielen Menschen auf der Straße mir zu viel wurde, war das Café einfach perfekt, um einen Moment lang den Stress hinter mir zu lassen. Jan hatte den Ort einmal als »Yoga-Kurs für Feinschmecker« bezeichnet. Und ich musste ihm zustimmen: Bei einem Stück hausgemachtem Kuchen auf den gemütlichen Sofas sitzend, konnte ich in der Tat alles vergessen, was mich gerade beschäftigte.
Das Café lag etwas abseits der großen Einkaufsstraßen, sodass hier nicht der gleiche Betrieb herrschte wie in den Café-Ketten der Stadt. Ich konnte mir gut vorstellen, wie Franzi oder Jan hier sogar im hinteren Teil die Ruhe fanden, sich in ein Buch zu vertiefen.
Wenn ich dort war, unterhielten Betti und ich uns miteinander. Aber ich konnte nicht behaupten, dass ich sie wirklich gut kannte. Genau genommen war eigentlich immer ich derjenige, der redete, während sie aufmerksam zuhörte. Vielleicht hatte ich deswegen sogar selbst vorgeschlagen, sie einzuladen, um endlich einmal mehr über sie zu erfahren. Wahrscheinlicher war jedoch, dass Jan oder Franzi sie an einem ihrer Lesenachmittage im Café aufgefordert hatten, abends zum Essen vorbeizuschauen.
Als es an der Tür klingelte, war Jan in der Küche beschäftigt, die Nudeln abzugießen, sodass ich schnell in den Flur lief, um zu öffnen.
»Wow!«, entfuhr es mir, als ich Betti vor mir stehen sah: Die blonden Haare, die im Café immer zusammengebunden waren, fielen ihr heute lockig über die Schultern. Das blaue Sommerkleid, das ihr bis zu den Knien reichte, hatte dieselbe Farbe wie ihre Augen.
»Selber Wow«, gab sie grinsend zurück, auch wenn ich nicht wusste, was an meiner Jeans und dem kurzärmligen Hemd, das mein Bäuchlein ein wenig kaschierte, bitte »Wow« sein sollte. Einen Moment lang standen wir unschlüssig voreinander.
»Darf ich?«, fragte sie und nickte in Richtung Flur.
»Verdammt, natürlich! Tut mir leid!« Ich wich einen Meter zurück, damit sie hereinkommen konnte, und fühlte mich wie der letzte Idiot. Wenigstens war ich so schlau, ihr die Plastikschüssel, in der sich wahrscheinlich der Nachtisch befand, abzunehmen. Ich wollte Betti allerdings nicht allein hier stehen lassen. Mit in die Küche konnte ich sie und die Schüssel aber auch nicht nehmen, ohne zu riskieren, dass es dort zu eng werden würde. Also stand ich wieder ein wenig unbeholfen vor ihr herum, mit der dummen Schüssel in der Hand. Bevor sich die Stille zwischen uns noch weiter ausbreiten konnte, kam Gott sei Dank Jan in den Flur, um Betti zu begrüßen, und erlöste mich aus meiner peinlichen Lage.
»Wie geht es ihr?«, fragte Betti mit dem Blick in Richtung Küche, wo Franzi gerade das Gulasch in eine Porzellanschüssel füllte. Ich konnte nicht anders als aufzulachen, hatte ich doch vor nicht einmal einer Stunde bei meiner Ankunft genau dieselbe Frage gestellt.
»Ihr seht es doch«, erwiderte Jan leicht genervt. »Es geht ihr gut. Also hört endlich auf damit! Ob ihr es glaubt oder nicht, sie weiß, dass ihr mich jedes Mal fragt, und sie will nicht mehr behandelt werden wie eine Schwerkranke!«
»Wir machen uns doch nur Sorgen«, sagte Betti leise.
»Ich weiß«, gab Jan etwas ruhiger zurück, als er merkte, dass seine kleine Standpauke uns naheging. »Aber es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Wir kommen damit zurecht. Trotzdem mag ich nicht unbedingt jedes Mal an das, was passiert ist, erinnert werden, wenn wir uns sehen. Also lasst es einfach gut sein. Wir melden uns, wenn wir Hilfe brauchen. Versprochen.«
Betti und ich warfen erst einander und dann Jan einen Blick zu und nickten schließlich.
»Und Michi?«, fragte ich.
»Auch sie weiß Bescheid und wird hoffentlich nicht immer wieder nachfragen, wenn es keinen wirklichen Grund dazu gibt.«
»Einen Grund wofür?«, hörten wir auf einmal Franzi hinter uns. Jans Augen wurden kreisrund.
»Dich allein in der Küche werkeln zu lassen, während wir uns hier im Flur über den Nachtisch hermachen«, erwiderte Betti lächelnd, als hätten wir nie über etwas Anderes gesprochen. Sie berührte Franzi, die mit einer Servierschale voll Gulasch vor uns stand, zur Begrüßung kurz am Arm. »Komm, ich bringe das an den Tisch. Dann kann ich mich wenigstens ein wenig nützlich machen, wenn ich mich schon bei euch durchfuttern darf. Oh, riecht das gut! Pass bloß auf, dass ich das hier nicht alles allein esse!«
Bevor Betti mit der Schüssel ins Wohnzimmer verschwand, schaute sie noch einmal über die Schulter zurück und zwinkerte uns zu.
»Dann lass uns mal sehen, dass wir für das hier einen Platz im Kühlschrank finden.« Jan deutete auf die Plastik-Schüssel, die ich immer noch in den Händen hielt. Unmerklich hatten wir beide aufgeatmet, als Betti uns so geschickt aus der Situation herausmanövriert hatte. Nun machten wir uns auf in die Küche, um den Nachtisch kalt zu stellen und den Rest des Abendessens ins Wohnzimmer zu bringen, wo schon der gedeckte Tisch auf uns wartete.
»Puh, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel gegessen habe!«, stöhnte Jan nach dem Essen und rückte mit seinem Stuhl ein Stück vom Tisch ab.
»Da bist du nicht der Einzige!«, schloss sich Franzi dem Gejammer an. Wir hatten zu viert alles weggeputzt und hielten uns die gut gefüllten Bäuche.
»Aber ich habe doch auch noch Nachtisch mitgebracht«, protestierte Betti halbherzig. »Mousse au Chocolat!«
Bei der Aussicht auf noch mehr Essen rissen wir alle panisch die Augen auf.
»Vielleicht nach einer Pause«, ergänzte sie halbherzig und lächelte gequält. Auch sie schien keinen Hunger mehr zu haben.
Während des Abendessens hatten wir über dies und das gesprochen. Wieder einmal war auch die Suche nach einem neuen Mitbewohner für mich ein Thema. Seit Jan aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, hatte ich immer mal wieder jemanden für das leerstehende Zimmer gefunden. Aber oft waren es Studenten im ersten Semester, die entweder nach ein paar Wochen das Handtuch schmissen, weil das Studium anscheinend doch nicht das war, was sie sich vorgestellt hatten. Oder aber das Studentenleben wurde dermaßen ausgiebig gefeiert, dass es für mich, der schon im Berufsleben stand, auf Dauer nicht erträglich war, weil ich nach einer anstrengenden Schicht im Restaurant meine Ruhe brauchte.
Irgendwann hatte ich Studienanfänger direkt abgelehnt, auch wenn der ein oder andere Bewerber vielleicht ein angenehmer Mitbewohner gewesen wäre. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr, es darauf ankommen zu lassen. Dafür war ich einmal zu oft über Alkoholleichen geklettert, um die Musik leiser zu machen, wenn ich nachts von der Arbeit nach Hause kam und in meiner Abwesenheit mal wieder eine Party gefeiert worden war.
»Ich werde nie die Nacht vergessen, in der ich in meinem Schlafzimmer eine wildfremde Frau vorgefunden habe. Die Gute hatte sich einfach mal zum Schlafen in mein Bett gelegt, als es ihr zu viel wurde.« Beim Gedanken an den Schock, als ich, schon im Halbschlaf, unter die Decke kroch und feststellte, dass ich nicht allein war, musste ich heute, ein paar Monate später, immer noch fassungslos den Kopf schütteln.
»Andere hätten sich vielleicht über so eine Überraschung gefreut«, gab Jan grinsend zu bedenken und verzog kurz darauf schmerzverzerrt das Gesicht, als Franzi ihn mit einem Tritt unter dem Tisch zum Schweigen brachte.
»Glaub mir, ihr markerschütternder Schrei und mein Plumps auf den Boden, als ich rückwärts aus dem Bett fiel, hätten jede noch so kleine Freude zunichtegemacht.« Gedankenverloren schwenkte ich das Glas Wein in meiner Hand hin und her. »Es muss doch auch vernünftige Mitbewohner geben. Allein kann ich auf Dauer die Wohnung nicht halten.«
Jan nickte verständnisvoll, hatte er doch aus genau diesem Grund damals mich bei sich einziehen lassen. Auch ihm war es lieber gewesen, mit einem Berufstätigen zusammen zu wohnen. Als er mit Franzi zusammengezogen war, hatte er mir die Wohnung überlassen. Ich fühlte mich dort ausgesprochen wohl. Umziehen kam für mich nicht infrage, solange ich es vermeiden konnte. Doch das leere Schlafzimmer war mir auf Dauer zu deprimierend, von der Miete, die ich nun allein zahlen musste, ganz zu schweigen.
»Hast du schon mal daran gedacht, einen Flüchtling bei dir aufzunehmen?«, fragte Betti auf einmal. Erst jetzt fiel mir auf, wie still sie den ganzen Abend über gewesen war. Sie hatte sich immer wieder an unseren Gesprächen beteiligt. Aber wie auch im Café hatte sie die meiste Zeit zugehört.
»Einen Flüchtling?"
»Naja, es gibt im Moment viele von ihnen in der Stadt, die Hilfe brauchen und unter wirklich unmenschlichen Bedingungen wohnen. Und es werden immer mehr. Die Stadt sucht händeringend nach Unterkünften und übernimmt sogar zumindest teilweise die Kosten für die Miete. Es gibt Flüchtlinge, die in Mentoren-Programmen untergebracht sind oder ein Praktikum machen und damit schon ein wenig Geld verdienen, um für ihre Verpflegung aufzukommen. Was ihnen aber noch fehlt, ist eine halbwegs angemessene Bleibe und mehr Kontakt zu den Deutschen. Deswegen sind gerade WGs oder Zimmer bei Familien gefragt, um diese Menschen besser in unserer Gesellschaft zu integrieren. Hin und wieder kommen Leute von der Stadtverwaltung in mein Café. Dann schnappe ich so was auf.«
Ich weiß nicht, ob ich Betti schon jemals so lange an einem Stück sprechen gehört habe, und auch sie schien von ihrer kleinen Rede erschöpft zu sein. Wie ein Luftballon, aus dem man die Luft gelassen hat, lehnte sie sich zurück und sah mich erwartungsvoll an. Einen Moment lang sagte ich gar nichts und ließ ihre Worte auf mich wirken. Über diese Option hatte ich noch nie nachgedacht, oder, besser gesagt, gar nicht von ihr gewusst.
»Das ist doch bestimmt mit jeder Menge Papierkram verbunden«, gab ich zu bedenken.
»Aber der lässt sich bewältigen. Auf ein paar Wochen mehr oder weniger kommt es doch nicht an, oder? Und wenn du damit einem Menschen eine Perspektive bieten kannst, ist es das doch wert. Und außerdem,« sie hob bedeutungsvoll den Finger, »weiß der bestimmt, dass er sich nicht einfach in dein Bett legen darf.«
KAPITEL 2
Betti
Anfangs schob mein Vater es auf das südländische Temperament meiner Mutter. Sie war eben Italienerin, sagte er sich. Es waren doch diese großen Emotionen, in die er sich verliebt hatte, als er bei meinen Großeltern arbeitete. Gegensätze ziehen sich eben an, redete er sich ein. Er hatte nie eine Frau gewollt, die ruhig und in sich gekehrt war. Keine Frau, die, wie er, immer erst alles gründlich abwog und angestrengt über jedes Detail nachdachte, sondern eine Frau voller Energie und Spontaneität. Eben eine Frau wie meine Mutter.
Und so störte es ihn zuerst nicht, wenn sie vor Aufregung schrie und keifte und die Türen zuknallte, als sie frisch verheiratet in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen waren. Als Maria während eines Streits Porzellan durch die Küche warf, schob er es auf die Schwangerschaftshormone und ließ sie gewähren. Stumm kehrte er die Scherben auf, nachdem sie aus der Wohnung gestürmt war, im festen Glauben, dass der Ärger sich legen würde. Und meistens behielt er recht.
Erst als ich auf der Welt war und sie während eines Streits wieder einmal aus Wut zu einem Glas griff, um es an die Wand zu schmeißen, gebot er ihr Einhalt. In ihren Augen las er den Groll und spürte, wie sie am ganzen Körper zitterte, als er auf sie zukam und ihr das Glas aus der Hand nahm. Bevor sie protestieren und ihrem Ärger weiter Luft machen konnte, schüttelte er stumm den Kopf, umfasste ihre bebenden Arme mit beiden Händen und nickte mit dem Kopf in meine Richtung. Er gab sich Mühe, diese Geste dezent zu halten, aber ich nahm sie trotzdem wahr. Ich saß auf dem mir angestammten Platz am Küchentisch beim Mittagessen.
Mama folgte seinem Blick und starrte mich an, am ganzen Körper zitternd. Sie atmete so schwer, als wäre sie gerade einen Marathon gelaufen. In ihren Augen sah ich immer noch die kochende Wut. Bei meinem Anblick weiteten diese sich jedoch, als würde ihr jetzt erst klar, dass sie nicht allein hier in der Küche waren. Wortlos wandte sie sich wieder meinem Vater zu und nickte kurz. Sie hatte verstanden.
Mit einem Mal hörte das Zittern auf und sie ließ sich auf einen der freien Stühle fallen, als hätte damit auch jegliche Kraft ihren Körper verlassen. Sie verbarg das Gesicht in ihren Händen und begann leise zu schluchzen. Dabei murmelte sie irgendetwas auf Italienisch, das ich nicht verstand. Mein Vater strich ihr mit dem Arm immer wieder beruhigend über den Rücken.
Meine Erinnerung an diese Szene ist sehr blass, also kann ich noch nicht besonders alt gewesen sein. Aber ich hatte bereits zu jener Zeit gelernt, immer leise zu sein und den Kopf einzuziehen, wenn Mama in einer derartigen Verfassung war. Alles konnte sie wütend machen. So war auch dieser Streit durch eine Kleinigkeit entstanden, so unbedeutend, dass ich dir nicht mal mehr sagen kann, um was es eigentlich ging. Aber diese Ausraster passierten mit der Zeit immer häufiger. Nur an den Abenden, wenn meine Nonna auf mich aufpasste und Mama arbeiten musste, war sie in bester Stimmung, sodass die Gäste bei Giovanni nicht bemerkten, was sich bei uns zu Hause abspielte.
Nach ihren Schichten war Mama oft so ausgelaugt, dass sie tagelang im Bett lag. Alles strengte sie an. »Ich bin so müde«, sagte sie an solchen Tagen immer, »so unendlich müde.« Dementsprechend viel schlief sie.
Wenn sie in dieser Verfassung war, umsorgten Papa und ich meine Mutter, als wäre sie das Kind in unserer Familie und nicht ich. Wir brachten ihr ein Tablett mit Essen ans Bett, das ich in den meisten Fällen unangetastet zurück in die Küche mitnahm. Manchmal legte Papa einen Schokoriegel mit dazu. Den ließ ich dann in einem unbemerkten Moment in meiner Tasche verschwinden, wenn Mama ihn mit der restlichen Mahlzeit zurückgehen ließ.
Ich weiß bis heute nicht, ob mein Vater die Schokolade für mich dort deponierte oder ob er wirklich dachte, meine Mutter würde alles außer den Süßigkeiten verschmähen. Aber ich denke eher, dass der Riegel für mich bestimmt war. Vielleicht war er als Trostpflaster oder Entschädigung gedacht. Immerhin musste Papa dafür sorgen, dass wir finanziell über die Runden kamen. Wenn meine Mutter mal wieder im Bett lag, unfähig, ihre Schichten im Restaurant zu übernehmen, musste er einspringen. Oft war dies auch kurzfristig der Fall, sodass er mich gerade an Abenden, wenn es spät werden würde, mit ihr allein zurückließ, und niemand auf mich aufpassen konnte.
»Du bist mein großes Mädchen«, sagte Papa dann immer. Und ich nickte, stolz darauf, dass er mir so vertraute.
Ich war froh, den Schokoriegel zu haben. Welches Kind isst nicht gern etwas Süßes? Und die Kau- und Schmatz-Geräusche aus meinem Mund, wenn ich ihn abends im Bett langsam aß, übertönten wenigstens für kurze Zeit das Weinen und Schluchzen meiner Mutter, das durch die Wände im Schlafzimmer zu mir durchdrang.
Philip