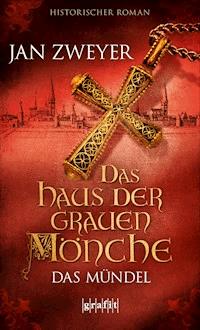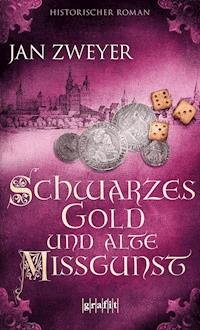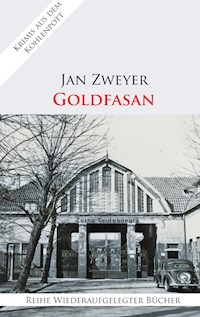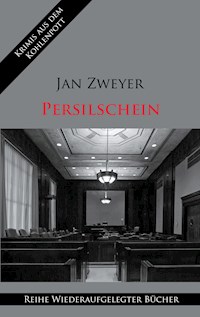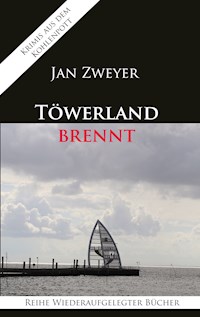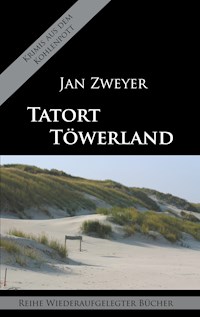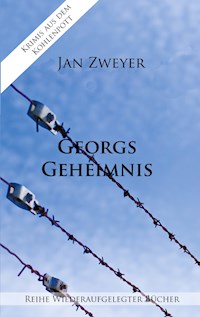5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Endlich eine lukrative Tour für Taxifahrer Rainer Esch. Der Kunde will zum Hauptbahnhof. Die letzte Fahrt von Jürgen Grohlers, denn kurz nachdem er den Wagen verlassen hat, wird er erschossen. Und Esch sieht sich fortan Bedrohungen ausgesetzt. Warum? Rainer ermittelt in eigener Sache und stößt auf dubiose Geldgeschäfte...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie Franzosenliebchen, Goldfasan und Persilschein das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die von Linden-Saga, eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet (bisher fünf Bände, zuletzt: Schwarzes Gold und Alte Missgunst, Ein Königreich von kurzer Dauer, beide Grafit-Verlag).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
1
Rainer Esch wartete in seinem Benz am Taxistand gegenüber dem Hauptbahnhof in Recklinghausen schon seit über dreißig Minuten auf zahlende Kundschaft. Es war sehr heiß an diesem Augustnachmittag. Die Luft stand flimmernd über dem Asphalt und die Innentemperatur seines Wagens näherte sich trotz offener Türen und Fenster Saunawerten. Etwas Fahrtwind könnte die gewünschte Abkühlung bringen. Leider waren Kunden bis jetzt Mangelware. Das Geschäft lief nicht besonders gut in der Haupturlaubszeit.
Esch tröstete sich mit dem Gedanken, dass auch sein Urlaub, auf der Insel Mykonos, unmittelbar bevorstand. Melancholisch überlegte er, dass dies seit fünf Jahren der erste Urlaub war, den er ohne seine Freundin Stefanie Westhoff verbringen würde. Seine Beziehung zu Stefanie war seit einiger Zeit merklich abgekühlt, was nicht zuletzt daran lag, dass er seine Neigung zur Rechthaberei und für gemütliche Kneipen nur schwer unterdrücken konnte. Stefanie hatte es kategorisch abgelehnt, mit ihm zu verreisen. Das wiederum hatte ihn veranlasst, das Ibiza der Ägäis als Ferienziel zu wählen. Wenn er schon alleine in den Urlaub fahren musste, dann wollte er wenigstens dorthin, wo der Bär los war. Und auf Mykonos war der Bär los. Behaupteten zumindest seine frisch gekauften Reiseführer.
Esch zündete die nächste Reval an und beruhigte sich mit dem festen Versprechen, demnächst mit dem Rauchen aufzuhören. Das intelligente Bonmot fiel ihm ein: Mit dem Rauchen aufzuhören ist ganz einfach, das habe ich schon hundertmal geschafft.
Das Taxi vor ihm in der Reihe setzte sich in Bewegung. Rainer startete ebenfalls den Motor und ließ seinen Wagen einige Meter nach vorne rollen. Jetzt war er der Erste in der Reihe der wartenden Droschken. Plötzlich plärrte das Funkgerät los.
»Zentrale Krawiecke an Krawiecke vier, bitte kommen.«
Esch erkannte die Stimme Renates, die in der Zentrale des Taxiunternehmens den Funkkontakt zu den einzelnen Fahrzeugen hielt. Renate, deren Nachnamen er trotz jahrelanger Dienste im Interesse der Taxiinnung nicht kannte, war eine etwas pummelige Brünette, die ihm schon häufiger die eine oder andere lukrative Fahrt zugeschanzt hatte. Auch ihr sonstiges Verhalten ließ bei ihm keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie mehr als nur ein Auge auf ihn geworfen hatte. Esch tat nichts, um sie in ihrem Anliegen zu bestärken, machte aber auch andererseits keine Anstalten, ihre Avancen unmissverständlich zurückzuweisen. So blieb ihr Verhältnis, sofern man dieses überhaupt so nennen konnte, in einem seltsamen Schwebezustand, der Esch öfter außergewöhnliche Einnahmen sicherte.
»Hier Krawiecke vier, ich höre.«
»Hallo Rainer, wie geht’s?«, erkundigte sich Renate.
»Warm.«
Sie lachte. »Glaub ich dir gern. Dann lass dir mal etwas Wind um die Nase wehen. Auf dem Parkplatz auf der A 43 in Richtung Münster vor der Abfahrt Marl-Sinsen steht einer. Der braucht deine Dienste.«
»Auf dem Parkplatz?« Esch staunte. »Wie kommt der denn da ohne Auto hin?«
»Hin ist er schon mit dem Wagen gekommen. Nur nicht mehr auf die Autobahn zurück. Seine Karre ist im Eimer und er hat’s eilig. Hat uns über Handy benachrichtigt. Weiß der Teufel, wie der an unsere Nummer gekommen ist. Also setz dich in Bewegung und fahr hin. Ende Zentrale.«
»Also gut. Ich sammle ihn ein. Ende und aus.«
Esch steuerte sein Taxi über die Halterner Straße in nördlicher Richtung auf den Autobahnzubringer, der ihn am Kreuz Recklinghausen-Nord auf die A 43 brachte. Nach fünfminütiger Fahrt auf der Bahn bog er auf den Parkplatz ab. Dort stand ein einsamer dunkelblauer BMW, neben dem ein Mann in einem grauen Anzug wartete.
Esch hielt an und stieg aus. »Tag. Haben Sie ein Taxi bestellt?«
»So ist es. Einen Moment. Ich hole nur noch meine Sachen.« Der Fahrgast öffnete den Kofferraum des BMW und nahm einen Aktenkoffer und einen hellen Sommertrench heraus, den er sich über den Arm warf. Er verschloss seinen Wagen, ging zum Taxi und setzte sich auf die Rückbank hinter den Beifahrersitz. Aktenkoffer und Mantel legte er links neben sich.
»Fahren Sie mich bitte zum nächsten Hauptbahnhof.«
»Nach Recklinghausen?«, fragte Esch.
»Wenn das der nächste ist, dann dahin. Aber schnell. Ich hab’s eilig.«
»Klar.« Esch meldete sich bei seiner Zentrale, nannte das Fahrziel, startete das Taxi, schaute in den Rückspiegel und musterte den Mann, den er auf Ende vierzig, Anfang fünfzig schätzte. Sein Fahrgast berlinerte leicht, nicht sehr viel, aber dennoch genug, dass er seine Herkunft aus der Bundeshauptstadt nicht verheimlichen konnte.
»Panne gehabt?«, versuchte Rainer ein Gespräch zu beginnen. Er unterhielt sich gern mit seinen Kunden, sofern diese noch dazu in der Lage waren und nicht durch übermäßigen Alkoholkonsum daran gehindert wurden. So hatte er schon eine Menge interessanter Leute kennen gelernt, unter anderem auch Stefanie.
»Ja«, antwortete der Mann hinter ihm.
»Was ist denn kaputt?«
»Weiß nicht.«
Nicht sehr erschöpfend diese Unterhaltung, fand Esch. Er startete einen erneuten Versuch. »Wie sind Sie denn an unsere Nummer gekommen?«
»Auskunft«, kam die knappe Antwort.
Sehr gesprächsfreudig schien dieser Fahrgast nicht zu sein. Langjährige Erfahrung sagte Esch, dass er die Klappe zu halten hatte. Vom richtigen Gespür für die Stimmungen der Leute, die er durch die Gegend fuhr, hing oftmals die Höhe des Trinkgeldes ab.
Von Zeit zu Zeit warf Esch im Rückspiegel einen Blick auf seinen Gast. Er hielt seinen geöffneten Aktenkoffer auf dem Schoß, kramte in seinen Unterlagen, rutschte auf seinem Platz hin und her und durchsuchte die Taschen seines Trenchcoats, um ihn dann umständlich wieder neben sich auf die Rückbank zu legen. Manchmal sah der Mann durch die Fondsscheibe nach hinten, als ob er etwas erwartete. Zweimal griff er zum Handy, wählte eine Nummer, brach dann aber nach einem Blick nach vorne den Wahlvorgang wieder ab. Auf Rainer machte er einen unruhigen, fast schon hektischen Eindruck.
Dann sprach ihn der Mann an: »Sagen Sie, wie heißt Ihr Taxiunternehmen?«
»Krawiecke, warum?«
»Und Sie haben Ihren Firmensitz in Recklinghausen?«
»Ja, weshalb interessiert Sie das?«
»Gewohnheit. Ich habe mal was in einem Taxi vergessen. Es ist leichter, das Verlorene zurückzubekommen, wenn man den Namen des Unternehmens kennt. Ihre Wagennummer ist vier?«
»Ach so.« Esch hatte schon vor Jahren aufgehört, sich über die Marotten seiner Fahrgäste zu wundern. »Ja, Krawiecke vier.«
»Danke.« Sein Fahrgast schwieg erneut.
An der Abfahrt Marl-Sinsen verließ Esch die Autobahn und fuhr über die Bundesstraße 225 südlich zurück in Richtung Recklinghausen. Er stoppte das Taxi direkt vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofes und stellte den Taxameter auf null.
»Zweiunddreißigachtzig, bitte.«
Der Mann gab ihm zwei Zwanzigmarkscheine. »Stimmt so.«
»Vielen Dank. Auf Wiedersehen.«
Grußlos verließ sein Fahrgast den Wagen. Esch war die Unhöflichkeit völlig egal. Bei einem solchen Trinkgeld verzieh er fast alles. Er sah den Mann im Bahnhofsgebäude verschwinden und reihte sich mit seinem Fahrzeug wieder hinten in die Schlange der wartenden Taxis ein.
»Krawiecke vier an Zentrale, bin frei am Hauptbahnhof.«
»Verstanden Krawiecke vier. Rainer, warte auf den Interregio aus Münster.«
»Renate, für dich tu ich doch fast alles.«
»Leider nur fast. Aber ich komme trotzdem darauf zurück. Ende.«
Esch lehnte sich zurück, fingerte eine Reval aus der Packung und inhalierte mit Genuss. Nach einigen Minuten sah er auf seine Armbanduhr. Kurz vor Sechs. Der Interregio musste jeden Moment einlaufen und Kundschaft ausspucken. Er schaute zum Eingang des Bahnhofes. Dann stutzte er. Sein Fahrgast von vorhin verließ gerade das Bahnhofsgebäude wieder, schaute sich suchend um und betrat eine der Telefonzellen neben dem Eingang. Esch beobachtete, wie der Mann sein Handy aus der Jackentasche nahm, wählte und dann mit dem Gerät am Ohr gestikulierend sprach. Augenscheinlich war der Mann sehr erregt.
Bevor Esch sich jedoch die Frage beantworten konnte, warum sich jemand bei dreißig Grad im Schatten mit einem Handy in eine stickige Telefonzelle quetscht, rief ihn seine Taxizentrale.
»Krawiecke vier, vergiss den Zug. Das hübsche Mädel von der Flamingo-Bar will zur Schicht. Hol sie zu Hause ab. Aber schön sauber bleiben, klar?«
Rainer grinste. Auf Renate war Verlass. Die Thekenchefin des Nachtclubs auf dem platten Land zwischen Dorsten und Wulfen war für ihre großzügigen Trinkgelder bekannt. Gelebte Solidarität der Nachtarbeiter. Die deutsche Gewerkschaftsbewegung war nichts dagegen.
»Keine Angst. Außerdem stellt sie nur den Schampus hin. Die restlichen Arbeiten erledigen ihre Kolleginnen. Krawiecke vier fährt nach Suderwich. Ende.«
»Schon sehr eigenartig, was du so alles arbeiten nennst. Zentrale Ende.«
2
Einige Minuten, nachdem Rainer Esch mit seinem Taxi den Bahnhofsvorplatz verlassen hatte, beendete der Mann in der Telefonzelle sein Gespräch, verstaute sein Handy und ging in Richtung Innenstadt. Er kreuzte den Grafenwall, bog rechts in die Kunibertistraße ein, um dann links der Kampstraße bis zum Löhrhofcenter zu folgen. Er setzte sich an einen Tisch vor der Eisdiele und bestellte nach einem Blick in die Karte einen Eiskaffee.
Nach etwa einer Stunde bezahlte er, überquerte den Löhrhof und erreichte über die Herren- und Schaumburgstraße den Markt. Dort orientierte der Mann sich wieder, ging zum östlichen Ende des Platzes, um zwischen der Boutique New Yorker und dem Tabakwarengeschäft Mühlensiepen den Kirchplatz hinter der Petruskirche zu betreten.
An der Plastik, die die ehemalige Trennung Deutschlands symbolisierte, wartete er. Auf der Wiese vor der Kirche spielte eine junge Frau mit ihrem Hund, auf den Bänken etwas weiter entfernt saßen mehrere ältere Leute und genossen die abkühlende Luft der frühen Abendstunden.
Nach einiger Zeit näherten sich aus Richtung Münsterstraße zwei gut gekleidete Männer. Der eine von ihnen war dunkelblond, etwa einsfünfundachtzig groß und schlank. Er trug einen grauen Zweireiher im Stil der zwanziger Jahre: breites Revers, großer Schlag, breiter Umschlag am Hosenbein. Dazu ein hellblaues Hemd mit einer roten Krawatte. An der linken Hand stellte er einen schweren, protzigen Siegelring zur Schau, der nicht recht zur sonst so distinguierten Erscheinung passen wollte. Sein Begleiter hatte schwarze Haare, war etwas kleiner als der andere Mann und konnte einen leichten Bauchansatz nicht verbergen. Er war mit einem traditionellen blauen Anzug, braunen Schuhen und einem weißen Hemd bekleidet. Unterhalb des rechten Auges hatte er einen etwa markstückgroßen Leberfleck. Der mit dem Leberfleck sprach den Wartenden an.
»Guten Abend. Haben Sie die Unterlagen dabei?«, fragte er.
Der Angesprochene, der die beiden nicht hatte kommen sehen, zuckte erstaunt zusammen und drehte sich um. »Was wollen Sie denn hier?«
Der Mann im blauen Anzug griff in die Seitentasche seines Sakkos, ohne auf die Gegenfrage einzugehen, und zog eine Pistole. Ein Knall, nicht lauter als das Entkorken einer Weinflasche, war zu hören.
Der Mann, den Esch zum Bahnhof gebracht hatte, blickte ungläubig auf die Waffe. Es ploppte ein zweites Mal. Der Getroffene ließ die Aktentasche fallen und stöhnte auf. Sein Trenchcoat rutschte zu Boden. Mit weit aufgerissenen Augen und einem wie vor Überraschung offen stehenden Mund sank er langsam nach hinten. Auf seiner Brust bildete sich ein roter Fleck.
Der zweite Mann hielt das Opfer fest und drückte es zurück an das Kunstwerk hinter ihm. So verhinderte er, dass der Verletzte seitlich zu Boden fiel. Der Schütze trat nah an den Sterbenden heran, hielt die Waffe in die Herzgegend und drückte ein drittes Mal ab. Der Körper zuckte kurz auf und wurde dann schlaff.
Die Täter durchsuchten rasch die Kleidung des Mannes, nahmen seine Brieftasche an sich, schnappten den Aktenkoffer und entfernten sich zügig, aber ohne Hast, zurück in Richtung Münsterstraße.
Wenig später schnupperte der Hund einer jungen Frau an der Leiche. Seine Besitzerin näherte sich, nachdem ihr Liebling auf ihr Rufen nicht reagierte, dem Denkmal.
»Pfui, Felix, pfui.« Sie wandte sich an den Toten, den sie zunächst nur von der Seite sah. »Entschuldigen Sie bitte, das macht er sonst nicht. Aber er tut nichts. Felix, hierher, Felix ...«
Die Frau beugte sich zu ihrem Hund hinunter, um ihn am Halsband zu greifen. Dabei entdeckte sie den roten Fleck, der sich auf dem Erdreich gebildete hatte. Sie verfolgte mit ihren Blicken die Blutspur über das rechte Hosenbein des Opfers nach oben bis zum blutüberströmten Brustkorb, sah den offenen Mund und dann die aufgerissenen Augen. Sie erstarrte. Und schrie hysterisch auf.
3
Hauptkommissar Rüdiger Brischinsky und sein Kollege, Kommissar Heiner Baumann, trafen gegen halb acht ein. Zwei Fotoreporter waren eifrig damit beschäftigt, die Leiche auf Zelluloid zu bannen. Zahlreiche Schaulustige drängten sich auf dem Kirchplatz. Drei Streifenwagenbesatzungen bemühten sich redlich, die nach vorne drängenden Passanten auf Distanz zu halten.
»Was ist das hier für eine Scheiße? Sind wir hier auf einem Volksfest, oder was?«, brüllte Brischinsky, als er sich dem Chaos näherte. »Wer hat hier die Einsatzleitung?«
Ein uniformierter Beamte in seiner Nähe zuckte zusammen. »Eigentlich keiner, Herr Hauptkommissar, wir haben gewartet, bis Sie ...«
»Denkt hier keiner von euch mit? Wartet ihr nur auf eure Pension? Baumann«, schrie Brischinsky, »Baumann ...«
»Du brauchst nicht so zu brüllen, Chef, bin ja hier.«
»Hast du so was schon mal gesehen? Kommen die alle frisch von der Polizeischule? War einer von euch«, er sah seine Kollegen von der Schutzpolizei provozierend an, »überhaupt da drauf?«
Bevor sich Protest regen konnte, griff Baumann ein. »Sie«, er sprach den direkt neben ihn stehenden Beamten an, »rufen noch Verstärkung. Und Sie und Sie«, er zeigte auf zwei weitere Uniformierte, »sichern den Tatort, so gut es geht. Und schaffen Sie die Reporter da weg.«
»Gut gemacht«, lobte Brischinsky seinen Kollegen. »Und du suchst nach Zeugen, die was gehört oder gesehen haben. Oder beides. Ich will zunächst die beiden von der Presse sprechen. Pronto, wenn ich bitte darf.«
Die beiden Reporter waren alles andere als begeistert, als sie von einem Polizeibeamten mit mehr oder weniger sanftem Zwang zu Brischinsky geleitet wurden.
»Abend, meine Herren. Darf ich mal Ihre Presseausweise sehen?«, begrüßte sie der Hauptkommissar.
Beide Journalisten griffen in ihre Taschen und zückten ihre Papiere.
»Aah ja. Die WAZ und die Recklinghäuser«, stellte der Kripomann fest. »Darf ich mal fragen, wie Sie so schnell hier sein konnten? Wohl den Polizeifunk abgehört? Oder sind Sie hier rein zufällig mit Ihren Kameras beim Einkaufsbummel gewesen?«
Er blockte ihren aufkeimenden Widerspruch mit einer Handbewegung ab. »Ich mache Ihnen ein Angebot. Und das nur einmal. Sie geben mir Ihre Filme. Wir entwickeln die. Und morgen haben Sie Ihre Ausbeute wieder. Wenn Sie einverstanden sind, haben Sie übermorgen Ihre Bilder im Blatt und ein hoffentlich nach wie vor ungestörtes Verhältnis zur Polizei. Wenn nicht, haben Sie zwar schon morgen exklusiv Fotos in Ihren Zeitungen. Nur ist dann zukünftig unsere doch recht gute Zusammenarbeit beeinträchtigt, empfindlich beeinträchtigt. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt?«
Er hatte. Und die Filme hatte er auch.
»Was ist mit dem Absperrband? Muss ich mich hier eigentlich um alles kümmern? Da passiert ein Mord in unserer Stadt und diejenigen, die den Schutz des Rechtsstaates übernehmen sollen, ähneln einem aufgescheuchten Hühnerhaufen. Ihr steht alle kurz vorm Innendienst.« Brischinsky dachte nach. »Nein, Quatsch, das hättet ihr wohl gern. Nachtschicht. Ab sofort.«
»Chef, nun mal halb lang.« Baumann trat wieder an seine Seite. »Wir haben den Platz schon geräumt. Absperrband kommt sofort. Ich habe die Zeugen, die eine Aussage machen können. Sie warten drüben im Gemeindehaus. Ihre Adressen sind schon aufgenommen.« Er zeigte auf ein Gebäude links am Rand der Grünanlage. »Der Pfarrer war so freundlich, uns ein paar Räume zu überlassen.«
»Was ist mit der Spurensicherung?«
»In Marsch gesetzt, muss gleich hier sein.«
»Und der Tote?«
»Der Notarzt sagt, das Opfer ist noch nicht lange tot. Die Leiche ist noch körperwarm. Kann aber auch an der Außentemperatur liegen.«
Brischinsky sah seinen Kollegen missbilligend an.
»’tschuldigung. Sollte ’n Witz sein.«
»Selten so gelacht. Hast du schon mit den Zeugen ...«
»Habe ich. Nur ...«
»Was nur?«
»Na ja, ich konnte ja nur kurz mit denen sprechen. Sehr ergiebig erscheint mir das alles nicht.«
»Wieso? Die waren doch nur wenige Meter entfernt?«
»Das schon Chef, aber leider ...«
»Was leider?«
»Komm, red selbst mit denen.«
Brischinsky folgte seinem Kollegen in das Gemeindehaus.
Der Pfarrer begrüßte ihn. »Schrecklich, Herr Hauptkommissar, schrecklich. Der arme Mann. Ich habe schon für ihn gebetet.«
»Das wird ihn freuen«, rutschte Baumann heraus. Er erntete einen bösen Blick seines Vorgesetzten.
»Vielen Dank, Herr ...« Brischinsky sah den Geistlichen fragend an.
»Holst. Weinolf Holst«, antwortete der Pastor.
»Herr Holst. Wo sind die Leute?«
»Bitte hier.« Holst öffnete eine Tür.
In einer Art Warteraum saßen eine jüngere Frau, zwei ältere Damen und drei ältere Männer. Als Brischinsky den Raum betrat, redeten alle durcheinander auf ihn ein.
»Ich habe das genau gesehen, Herr Hauptkommissar ...«
»Herr Wachtmeister, der ist nach hinten gefallen ...«
»Die Frau hat geschossen.«
»Quatsch. Das war der alte Mann.«
»Den Hund haben sie mitgenommen, Herr Inspektor ...«
»Blödsinn, das war mein Hund. Der ist jetzt bei meiner Schwester.«
»Aber die Frau ...«
»Die drei Täter waren schwarz. Ich hab das ganz deutlich ...«
»Spinnen Sie? Russen waren das. Die Russenmafia. Die haben so komisch geredet.«
»Sie verstehen doch ohne Hörgerät kein Wort. Wie wollen Sie da ...«
»Ruhe«, brüllte Brischinsky, »bitte sofort Ruhe.«
Erschreckt wandte sich die Runde dem Hauptkommissar zu.
»Meine Herrschaften. Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, uns Ihre Beobachtungen mitzuteilen. Aber ich muss Sie bitten, nicht alle durcheinanderzureden.« Er wandte sich an den Pfarrer. »Können wir hier irgendwo ungestört ...?«
»Selbstverständlich.« Der Pastor zeigte den Kriminalbeamten den Weg in ein Nebenzimmer. »Wenn Sie mit meinem Büro vorliebnehmen möchten?«
»Danke. Vielen Dank.«
»Meine Frau bringt Ihnen gleich einen Kaffee. Sie trinken doch Kaffee?«
Brischinsky lächelte. »Ja, gerne.«
Der Kirchenmann verließ den Raum. Baumann sah seinen Chef fragend an. »Du schickst mir die junge Frau rein. Dann kümmerst du dich um die Spurensicherung. Frag nach, ob die schon was sagen können. Wenn sich hier was für die Fahndung ergibt, sag ich dir sofort Bescheid.«
Baumann nickte.
»Dann los!«
Als Baumann zwei Stunden später erneut das Büro des Pfarrers betrat, stützte Brischinsky seinen Kopf in beide Hände. Resigniert sah er seinen Mitarbeiter an. »Na?«
»Der Tote wurde erschossen.«
»Ach nee. Was du nicht sagst.«
»Etwa eine halbe Stunde oder weniger vor unserem Eintreffen. Papiere haben wir noch nicht entdeckt. Die Leiche wurde schon erkennungsdienstlich behandelt.«
»Gut.«
»Wir haben zwei Patronenhülsen gefunden. Wenn der Notarzt mit seiner ersten Diagnose Recht hat, sind es drei Einschüsse. Alle aus nächster Nähe. Wir suchen nach der dritten Hülse. Aber es wird langsam dunkel.« Baumann zuckte mit den Schultern. »Der Tote ist jetzt zur Obduktion. Morgen haben wir das Ergebnis. Und bei dir?«
»Sechs Zeugen, sieben Aussagen. Nein, im Ernst. Die älteren Leutchen kannste vergessen. Da vermischt sich Wahrnehmung mit Vermutung und Erinnerung an den letzten Krimi im Fernsehen. Einer der älteren Herren hat deutlich eine Maschinengewehrsalve wie vor Stalingrad gehört, konnte mich aber nur dann verstehen, wenn ich ihn angeschrien habe. Dafür konnte er aber wunderbar erklären, warum General Paulus viel eher die Front hätte begradigen müssen.«
»Wer ist General Paulus?«, fragte Baumann.
»Mein Gott, was lernt die Jugend heute eigentlich im Geschichtsunterricht? Es dauert nicht mehr lange, da wird Hitler für den Bauingenieur gehalten, der die Autobahnen geplant hat.«
»Hat Hitler nicht die Autobahnen ...«
»Nein«, unterbrach ihn Brischinsky, »er hat nicht. Aber ich bringe dir morgen das aktuelle Angebot der Volkshochschule Recklinghausen mit. Das ist der schöne Bau an der Krim, der mit viel Efeu; da gibt’s bestimmt geeignete Kurse. Na gut. Du kannst ja nichts dafür, hoffe ich zumindest. Der nächste Zeuge war zwar fast blind, hat aber die Mörder klar als dunkelhäutig identifiziert. Zwei bis fünf Täter. Eine Mischung zwischen Süditaliener und Zulu. Der dritte Mann stritt gerade mit einer der älteren Damen darüber, ob Dodi nun hat oder nicht hat, und hat deshalb nichts mitbekommen.«
»Wer hat was?«
»Dodi.«
»Kapier ich nicht.«
»Macht nichts.«
»Was ist Dodi?«
»Vergiss es. Du dürftest der Einzige unter etwa fünf Milliarden Menschen sein, der das nicht weiß. Wirklich außergewöhnlich. Na, dafür verzeih ich dir den Paulus. Die Letzte der älteren Frauen hat zumindest zwei potentielle Täter gesehen. Leider ist sie sich bezüglich des Alters nicht sicher. Ihre Angaben schwanken zwischen zwölf und dreiundachtzig.«
»Dreiundachtzig?«
»Dreiundachtzig. So alt ist sie nämlich. Ungefähr so alt wie ich kann der eine gewesen sein, Herr Wachtmeister. Das waren ihre Worte. Einzig brauchbar ist die Junge mit dem Hund.«
»Und?«
»Na ja, die Frau hat zwei Männer gesehen, gut gekleidet, Anzug und so.«
»Und sonst? Spuck’s schon aus. Was hat die noch gesehen?«
»Nichts.«
»Das war alles?«
»Das war alles.«
»Ich hab’s befürchtet. Scheiße.«
»Das kannst du laut sagen. Da wird in der Hauptgeschäftszeit hier bei uns in Recklinghausen in direkter Nachbarschaft der Einkaufszone ein Mann umgenietet, sechs Leute sitzen in unmittelbarer Nähe, wir sind eine halbe Stunde später am Tatort, und was haben wir? Nichts haben wir. Absolut nichts. Scheiße. Wirklich totale Scheiße.«
4
Kurz vor acht Uhr traf Rainer Esch mit seinem Taxi auf dem Betriebshof des Taxiunternehmens Krawiecke in der Hochstraße 26 im Recklinghäuser Stadtteil Grullbad ein. Wie erwartet, hatte ihm die Bardame der Flamingo-Bar zum Abschied nicht nur ihr schönstes Lächeln, sondern auch dreizehn Mark Trinkgeld geschenkt. Esch war fest entschlossen, Renate bei Gelegenheit als Dank zum Essen einzuladen.
Da um acht Schichtwechsel war, parkten schon einige Wagen auf dem Hof. Esch steuerte sein Taxi auf einen freien Platz und stieg aus. Der dicke Kalle, seine abendliche Ablösung, kam gerade mit Hans Krawiecke, dem Inhaber, aus der Zentrale. Beide steuerten auf ihn zu. Krawiecke öffnete die Fahrertür, um den Tagesstand des Taxameters abzulesen.
»’n Abend, Kalle. Wagen ist in Ordnung. Musst nur bald tanken.«
»Hallo, Rainer, alles klar, danke.«
Esch wollte an den beiden vorbei gehen.
Krawiecke warf einen flüchtigen Blick ins Wageninnere.
»Halt wart mal, Rainer. Das da«, er zeigte auf ein Stück Papier hinter dem Beifahrersitz, »nennst du in Ordnung? Eine Schweinerei ist das, wie du meine Fahrzeuge übergibst.« Krawieckes Stimme wurde lauter. »Das ist der reinste Saustall hier. Den machst du jetzt erstmal sauber. Und zwar sofort.« Der Unternehmer hatte sich mit krebsrotem Gesicht vor Rainer aufgebaut. Der Taxiinhaber stand kurz vor einem seiner berühmt-berüchtigten cholerischen Anfälle.
Hans Krawiecke hatte nach Eschs unmaßgeblicher Meinung noch nicht realisiert, dass die Feudalgesellschaft durch den entwickelten Spätkapitalismus abgelöst worden war. Er behandelte seine Mitarbeiter wie Leibeigene – oder versuchte es zumindest von Zeit zu Zeit. Heute schien wieder einer dieser Momente zu sein. Rainer hätte schon längst die Initiative ergriffen, in diesem Laden einen Betriebsrat zu installieren, wenn es nur ausreichend Festangestellte für einen solchen revolutionären Akt gegeben hätte. Leider waren fast alle Kutscher so genannte geringfügig Beschäftigte und Studenten, die ihr Bafög oder den elterlichen Scheck mit Taxifahren aufbesserten. Esch machte da keine Ausnahme. Allerdings unterschied er sich in zwei nicht ganz unerheblichen Details von seinen Kolleginnen und Kollegen. Zum einen war er an der Universität nur deshalb noch eingeschrieben, um die hohen Sozialversicherungsbeiträge zu minimieren und nicht um zu studieren, zum anderen war er der dienstälteste Fahrer bei Krawiecke, was ihm eine gewisse Unangreifbarkeit verlieh. Er wusste, dass Krawiecke wusste, was er wirklich alles wusste, und Rainer hätte keine Sekunde gezögert, dieses Wissen, beispielsweise über schwarzarbeitende Arbeitslose, einzusetzen. Und da Krawiecke auch das wusste, genoss Esch besonderen Kündigungsschutz.
»Sofort habe ich gesagt, und ich meine sofort«, brüllte Krawiecke ihn an.
Esch grinste. »Reg dich nicht künstlich auf. Da liegt doch nur ein Stück Papier. Keiner hat die Karre voll gekotzt, keiner Schokoladenflecken auf die Polster geschmiert. Take it easy, Mann.«
Krawieckes Hals schwoll noch mehr. Rainer starrte sein Gegenüber bewundernd an.
»Du, du, du ..., was du da erzählst, geht bei mir hier rein und da raus.« Krawiecke zeigte erst auf sein linkes, dann rechtes Ohr. »Hier rein und da raus«, wiederholte er wütend.
»Kein Wunder«, antwortete Esch, »ist ja auch nichts dazwischen, was den Schall aufhalten kann.« Für einen Moment glaubte er, zu weit gegangen zu sein. Er erwartete jeden Moment einen körperlichen Angriff Krawieckes.
Da schaltete sich Kalle ein.
»Warte, Hans, ich mach schon.« Kalle öffnete die hintere Tür und fischte den Papierfetzen aus dem Wagen. »So, das war’s. Ich fahr dann. Bis morgen, Rainer.«
»Bis dann, Kalle.«
Esch ließ den nach Luft schnappenden Inhaber auf dem Platz stehen und machte sich auf den Weg in die Zentrale.
Kurz vor der Tür drehte er sich um und rief Krawiecke zu: »Wenn du dich abgeregt hast, kannst du dich mit deinen Daten mal her bemühen. Ich hab Feierabend und keine Lust, hier Wurzeln zu schlagen.«
Wutentbrannt folgte der Taxiunternehmer seinem Fahrer ins Innere des Gebäudes, um die Tageseinnahmen abzurechnen.
Eine halbe Stunde später saß Rainer Esch in seinem Golf, der schon erheblich bessere Tage gesehen hatte, und steuerte seine Karre Richtung Westerholter Weg im Recklinghäuser Westviertel, wo seine Wohnung lag. Er schaltete das Autoradio ein und ärgerte sich über die Musik, die Radio FiV über den Äther schickte. Mit dem Technogehämmere konnte er nichts anfangen. Er stand auf die Stones, Who, Doors und die anderen Rockgiganten aus den sechziger und frühen siebziger Jahren.
Rainer rekapitulierte die Einnahmen des heutigen Tages. Neben seinem Lohn für die zwölfstündige Hitzeschlacht hatte er über siebzig Mark Trinkgeld erhalten, so dass er um rund zweihundertfünfzig Schleifen reicher als heute Morgen war. Esch beschloss, seinen Freund Cengiz Kaya anzurufen und ihn zum Essen einzuladen.
An der nächsten roten Ampel beugte er sich vor und kramte sein Handy aus dem Handschuhfach. Er drückte die Kurzwahlnummer und wartete, bis sein Freund sich meldete.
»Kaya.«
»Hi. Rainer hier. Wie wär’s mit Essen gehen? Ich lade dich ein.«
»Hast du im Lotto gewonnen? Oder hat Look und Listen wider Erwarten Geld abgeworfen?«
Der Hinweis seines Freundes auf die Erfolglosigkeit seines zweiten Standbeins, die Detektei Look und Listen, schmerzte.
Vor gut einem Jahr hatte Esch, geblendet von der erfolgreichen Überführung der Mörder des Bruders seiner Freundin, im Recklinghäuser Süden eine Detektei gegründet. Er hatte gehofft, dass Stefanie und Cengiz sich an dem Laden beteiligen und sie gemeinsam eine rasante Ermittlerkarriere starten würden. Leider hatten seine Freunde ihn damals nicht nur ausgelacht und die Mitarbeit verweigert, sondern auch noch Recht behalten.
Look und Listen war ein absoluter Reinfall, die Pleite schlechthin. In zwölf Monaten hatte lediglich eine Kundin seine Dienste in Anspruch genommen. Und die zahlte ein Erfolgshonorar von sage und schreibe fünfzig Mark, als er ihren entflogenen Kanarienvogel aus dem Geäst des nächsten Baumes gerettet hatte. Das war’s.
Rainer hielt den Laden nur deshalb aufrecht, um seinen Freunden und vor allem aber sich selbst sein Scheitern nicht eingestehen zu müssen. Rückblickend musste er zugeben, dass sie ihren damaligen Erfolg mehr einer Kette von Zufällen zu verdanken hatten und nicht konsequenter Ermittlungsarbeit. Im Gegenteil, Cegiz und er wären ohne die Unterstützung der Recklinghäuser Polizei wohl nicht so unbeschädigt aus der Angelegenheit herausgekommen.
»Das muss ja jetzt nicht sein, oder? Also, was ist? Kommst du mit?«
»Gern. Wohin?«
»Mir egal. Ich sitz im Auto, kann auch nach Herne kommen.«
»Gut, komm nach Herne. Ins Neokyma.«
»Zum Griechen? Ein Türke zum Griechen? Hast du keine Bedenken, dass sie dir die Okkupation Zyperns heimzahlen wollen?«
»Quatsch keinen Scheiß. Außerdem, ich kenn nur ein einziges türkisches Restaurant in Herne, und das taugt nicht viel. Dann lieber griechisch essen. Die Küche hat eh türkische Wurzeln, auch wenn die Griechen das nicht wahrhaben wollen. Und im Übrigen bin ich Deutscher, wie du weißt.«
»Meinst du. Nur weil du seit sechs Wochen einen deutschen Pass hast, vergess ich doch nicht, dass du Schafhirte aus dem hintersten Winkel Anatoliens stammst.«
»Arsch, ich komm aus Istanbul«, regte sich sein Freund auf.
»Weiß ich doch, Cengiz. War Spaß. Nur die Retourkutsche für Look und Listen. Frieden?«
»Frieden.«
»Also gut, bis gleich im Neokyma.«
Das Restaurant in Herne war kein typisches griechisches Restaurant. Es gab zwar diverse Grillteller mit Bergen von Fleisch, aber auch die etwas andere griechische Küche, feiner und origineller. Die Küchencrew offerierte auf einer großen Schiefertafel darüber hinaus das, was Markt und Küche aktuell an frischen Erzeugnissen zu bieten hatten. Im Winter war das Neokyma, besonders in der Nähe des Eingangs, chronisch zugig, im Sommer häufig zu warm. Trotzdem war es besonders an den Wochenenden schwer, abends ohne vorherige Reservierung einen Tisch zu bekommen.
Esch, der den zweiten halben Liter trockenen Demestica in sich reingeschüttet hatte, fragte nach dem Essen: »Hör mal, Cengiz, fahren ist nicht mehr. Kann ich bei dir ...?«
»Ich dachte es mir fast. Ja, du kannst. Aber ich muss morgen früh auf Schicht. Ich vermute, du gehst nicht zur Uni?«
»Nein, morgen nicht.«
»Und fährst auch nicht Taxi?«
»Nee, erst Freitag wieder.«
»Aha. Hinter lass bitte nicht so ein Chaos in der Küche wie das letzte Mal, sonst war’s für dich das selbige, klar?«
»Logo. Du kennst mich doch.«
»Eben.«
»Hör mal, Cengiz, was ich dich fragen wollte ...?«
»Wenn du mich anpumpen willst, solltest du mich nicht vorher zum Essen einladen. Das passt irgendwie nicht zusammen.«
»Nee, Unsinn. Sag mal, hättest du nicht Lust, mit mir nach Mykonos zu kommen?«
Kaya sah seinen Freund verblüfft an. »Und was soll ich da? Bei dir Händchen halten, damit du den Frust mit Stefanie vergisst? Ich bin da wahrscheinlich ein schlechter Ersatz. Aber du dürftest auf Mykonos sehr schnell Anschluss finden, hab ich gehört.«
»Wieso? Sind da so viel alleinreisende Frauen?«
»Nee, Männer.«
»Spinner. Nein, im Ernst, ich hab irgendwie so recht keine Lust, allein in den Urlaub zu fahren.«
»Jetzt pass mal auf, Rainer. Du wirst dich wohl oder übel mit der Tatsache abfinden müssen, dass du bei Stefanie im Moment nur schlechte Karten hast, was ein glückliches Liebesleben angeht. Und das Beste wäre, du akzeptierst das bald. Sonst sind irgendwann alle Frauen, die nicht Stefanie heißen, vergeben und du bist so ein alter Knacker, dass du nur noch mit ’ner vollen Brieftasche bei einem hübschen und halbwegs intelligenten Mädel landen kannst. Und da du nie eine volle Brieftasche haben wirst«, Kaya grinste, »jedenfalls nie für sehr lange, würdest du als Eremit enden. Was mir ehrlich Leid täte.«
»Da lad ich dich zum Essen ein und du beleidigst mich unentwegt. Du bist vielleicht ’n Kumpel.«
»Bin ich auch. Merkt man nur nicht immer sofort. Und du sowieso nicht. Und jetzt kipp deinen Wein runter und zahl. Ich muss morgen im Gegensatz zu dir arbeiten.«
»Okay.«
Der Kellner brachte die Rechnung und Esch bezahlte. Er hob sein Glas. »Let’s drink to the hard working people.«
»Rolling Stones«, stellte Kaya lakonisch fest. »Let it bleed?«
»Nee, Beggars banquet. Salt of the earth. Aber das wird jemand, der Rock für ein weibliches Kleidungsstück gehalten hat, während ich die Stones im Gelsenkirchener Parkstadion live gesehen haben, ohnehin nie kapieren. Gehen wir.«
5
Hauptkommissar Rüdiger Brischinsky hatte seine beiden Füße auf dem Schreibtisch drapiert, einen vollen Kaffeepott neben sich und studierte aufmerksam die Berichterstattung beider Recklinghäuser Lokalzeitungen über den Mord des Vortages. Die Journalisten spekulierten über das Motiv der Täter und vor allem über die Identität des Opfers.
Die, dachte Brischinsky, würde ihn auch interessieren, sehr sogar. Er nahm einen tiefen Schluck aus der Tasse, zog an seiner Zigarette und widmete sich dann den Fotografien, die die beiden Journalisten gemacht hatten. Sie unterschieden sich nur in Nuancen von den Bildern ihrer eigenen Spurensicherung.
Der Hauptkommissar beschloss deshalb, die Bilder den Zeitungsreportern unverzüglich zurückzugeben. In diesem Moment schellte das Telefon.
»Morgen, Herr Brischinsky, Rutter hier.«
Rüdiger Brischinsky schmeckte der Kaffee nicht mehr. Rutter von der Bildzeitung war ein Reporter, der für eine gute Story über Leichen ging. Brischinsky konnte ihn nicht ausstehen. »Was wollen Sie denn?«
»Informationen, was denn sonst, Herr Hauptkommissar.«
»Den Hauptkommissar können Sie sich schenken. Wir haben unsere Ermittlungen gerade erst aufgenommen, da gibt es noch keine Informationen. Warten Sie’s ab. Möglicherweise geben wir heute noch ’ne Pressekonferenz.«
»Aber Sie wissen doch sicher ...«
»Nein«, unterbrach ihn Brischinsky grob, »ich weiß nichts. Absolut nichts. Wiederhören.« Er legte auf, ohne die Antwort seines Gesprächspartners abzuwarten.
Baumann betrat das Dienstzimmer und knallte seinem Chef einen Stapel Akten auf den Schreibtisch. »Haben alle prima gearbeitet, wirklich. Gestern Abend ist der Mord passiert, heute schon erste Ergebnisse. Hier, der vorläufige Obduktionsbericht.« Er suchte einen Aktenordner aus dem Stapel und legte ihn offen auf den Tisch vor Brischinsky und halb auf dessen ausgestreckten Beine. »Mensch, nimm doch mal deine Haxen hier weg.«
»Immer langsam mit die jungen Pferde«, antwortete sein Kollege, nahm aber die Haltung ein, die ein deutscher Steuerzahler von einem arbeitenden deutschen Beamten erwartete.
»Und das hier ist das ballistische Gutachten. Zwar auch vorläufig, aber immerhin. Haben uns die Bochumer Kollegen heute Morgen geschickt.«
Brischinsky sah seinen Assistenten mit Interesse an. Solcher Arbeitseifer am frühen Morgen war normalerweise nicht seine Art. Entweder fesselte ihn der Fall ganz besonders, oder er war scharf auf eine positive Beurteilung.
»Das Beste kommt aber noch. Diese Unterlage«, Baumann wedelte vor Brischinskys Augen mit einem Blatt herum, »ist eben gekommen. Per Fax vom Bundeskriminalamt. Wir wissen nun, wer der Tote ist. Die Fingerabdrücke waren in unserem Computer. Der so unsanft vom Leben zu Tode Gekommene ist für uns kein Unbekannter. Was sagst du nun?«
Brischinsky sagte gar nichts, sondern nahm Baumann das Fax des BKA aus der Hand und überflog es. Mit fünfundneunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit waren die Fingerabdrücke, die der Erkennungsdienst dem Toten abgenommen hatte, identisch mit denen eines Jürgen Grohlers, geboren am 16. April 1946 in Bernsdorf.
»Wo, zum Teufel, ist Bernsdorf?«, fragte der Hauptkommissar seinen Mitarbeiter. »Hast du das schon ermittelt?«
»Hab ich. In Sachsen. Nordöstlich von Dresden.«
»Aha.«