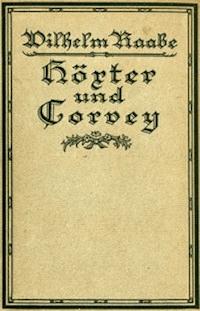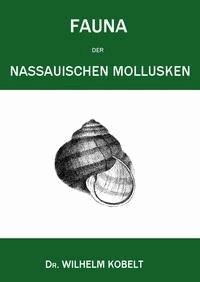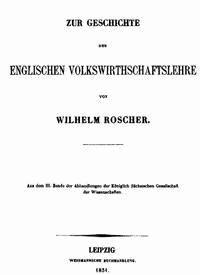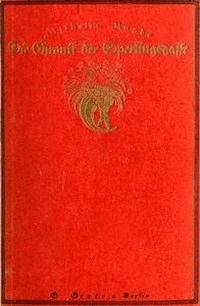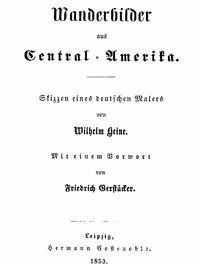0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Ähnliche
Wilhelm RaabeAlte Nester
Volksausgabe
Wilhelm Raabe
Alte Nester
Zwei Bücher Lebensgeschichten
Ein Freund von mir begleitete einmal Goethen auf einem Spaziergange. Unterwegs stießen sie auf einen armen Knaben, der am Wege saß, den Kopf in den Händen und die Arme auf die Kniee stützend. Junge, was machst du da? worauf wartest du? rief Goethes Begleiter. — Worauf sollte er warten, mein Freund? nahm Goethe das Wort. Er wartet auf menschliche Schicksale. —
O. L. B. Wolff.
Allgemeine Geschichte des Romans, von dessen Ursprung bis zur neuesten Zeit.
21.-25. Tausend der Volksausgabe
Berlin-Grunewald Verlagsanstalt Hermann Klemm A.-G.
Dieses Werk wurde gedruckt in der Offizin G. Kreysing in Leipzig. Den Einband fertigte H. Fikentscher in Leipzig.
Erstes Buch
Erstes Kapitel.
Eine Blume, die sich erschließt, macht keinen Lärm dabei; auch das, was man von der Aloe in dieser Beziehung behauptet, halte ich für eine Fabel. Auf leisen Sohlen wandeln die Schönheit, das wahre Glück und das echte Heldentum. Unbemerkt kommt alles, was Dauer haben wird in dieser wechselnden, lärmvollen Welt voll falschen Heldentums, falschen Glücks und unechter Schönheit; und es ist kein eitles, sich überhebendes Wort, was ich hier zu Anfang dieser Blätter hinsetze; denn es sind die Lebensgeschichten anderer Leute, die ich beschreiben will, nicht meine eigenen. Das Heldentum und die Schönheit der Rolle, die ich dabei abspiele, lassen sich wohl halten in der hohlen Hand. Aber eines ist auch wahr und darf gesagt werden: Glück, viel Glück habe ich wohl nicht gehabt, aber doch dann und wann mein Behagen, meine Belustigung und meine Ergötzlichkeiten; und das alles ist gleichfalls ganz natürlich und ziemlich unbemerkt gekommen und gegangen, — so daß es heute, in den gegenwärtigen stillen, nachdenklichen, überlegenden Stunden nichts Erstaunenswürdigeres für mich gibt als mein unleugbar vorhandenes Wohlgefallen nicht nur an der Welt, sondern auch immer noch an mir.
Mein erstes Aufblicken in dieser Welt fällt in die Zeit der Gründung des deutschen Zollvereins, also in den Anfang der vierziger Jahre dieses Säkulums. Wer eine Ahnung davon hatte, daß aus dieser anfangs etwas unbequemen und viel bestrittenen Institution einmal das einige Deutsche Reich aufwachsen könne, behielt dieselbe ruhig für sich, und eine kleine Ausnahme machte da vielleicht nur ein kleiner Mann im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Paris, Mr. Louis Adolphe Thiers genannt. Das deutsche Volk ließ sich murrend, wenn auch nach seiner Art gutwillig, die ersten Lebensbedürfnisse und vor allem das Salz durch den segensreichen politischen Schachzug verteuern.
Da war nun so ein Stätlein (auf die Landkarte bitte ich dabei nicht zu sehen), das diesem „preußischen Verein“ beigetreten war, aber seine Planetenstelle nicht verändern konnte, sondern liegen bleiben mußte, wo es lag: nämlich ganz und gar umgeben von einem anderen Staat, der nicht „beigetreten“ war, und das junge Reichsvolk von heute hat gottlob keine Idee davon, was das seinerzeit bedeutete, obgleich es eigentlich noch gar so lange nicht her ist. Zog der eine deutsche Bruder seinen Grenzkordon, so zog ihn der andere ebenfalls. Daß wir im ganzen das deutsche Volk und der erlauchte deutsche Bund dabei blieben, konnte den Zeitungsleser nur mäßig erquicken und ihn höchstens ganz kosmopolitisch in seiner Selbstachtung über dem Wasser erhalten.
Die Hauptsache für mich, auch heute noch, ist, daß das, was damals von zivilversorgungsberechtigten Militärpersonen vorhanden war, fest darauf rechnen durfte, „unter die Steuer gesteckt zu werden“, und daß mein braver, seliger Vater mit dem Titel Herr Kontrolleur natürlich gleichfalls hineinfiel, und meine Mutter ebenso selbstverständlich mit ihm. Meine erste deutliche Lebenserinnerung aber ist, daß ich von einem Wagen gehoben und in ein Haus getragen wurde, das mir aus einem einzigen großmächtigen, kindlich ungeheuerlichen schwarzen Scheunenflur, einer Rauchwolke unter der Decke und zwei Reihen Kuhkrippen, nebst den dazugehörigen heraäugigen, hauptschüttelnden, kettenrasselnden gekrönten Herrschaften zu bestehen schien.
Dem war jedoch nicht ganz so. Es fanden sich in dem unteren Raume dieses Hauses noch zwei oder drei Gemächer, die den zu dem Feuerherde und den Haustieren gehörigen Menschen zu allerlei Gebrauche dienten; und eine leiterartige steile Stiege führte sogar in ein oberes Stockwerk, wenigstens in der Front des Gebäudes, empor, — in unsere Wohnung, die einzige, die meinen Eltern bei ihrer Versetzung in dieses Gebirgsstädtchen offen gestanden hatte. Dicht an unsere Wohnung stieß der Heuboden, und wir hatten deshalb mit Feuer und Licht sehr vorsichtig umzugehen, was wir denn auch taten, und vorzüglich ich, dem alles unnötige Spiel damit mehrfach in schlagender Weise verleidet wurde.
Mein Vater, der reitende Steuerkontrolleur Hermann Langreuter, trug einen Säbel und eine Uniform, die mir heute in der Erinnerung den Eindruck von Grünblau und Blau und vielen gelben Metallknöpfen mit dem Landeswappen macht. Was den Anzug meiner Mutter betrifft, so halte ich es hell in dem Gedächtnis fest, daß sie stets in hellen Kleidern ging, — bis zu dem Ereignis, das sie für immer in Schwarz und Grau warf.
Die Salzschmuggler haben mir nämlich meinen Vater erschossen. Um einen Sack voll Salz mußte er damals sein Leben im Walde auf der lächerlichen Grenze lassen. Ich aber habe wahrlich später keine Verlustliste, die um des deutschen Volkes Einheit ausgegeben wurde, gelesen, ohne an den alten Griesgram auf seinem Felde der Ehre wehmütig und kopfschüttelnd zu denken. Der Donner der tausend Kanonen in den großen Siegesschlachten der Gegenwart hat die Schüsse, die seinerzeit hinüber und herüber gewechselt wurden, nicht übertönen können. Gottlob ist es heute nur höchstens ein Drittel der Nation, das sich jenes brüderliche Nachbargeplänkel zurückwünscht, was in Anbetracht des Nationalcharakters merkwürdig wenig ist, zumal wenn man noch die sehr verschiedenartigen Gründe, aus denen jener Wunsch aufwächst, in Betracht und in Rechnung zieht.
Auch aus diesem letzten politisch-historischen Exkurs wird meinem Leser einleuchtend hervorgehen, daß der schöne Sommermorgen, an dem uns die schlimme Nachricht über den Vater gebracht wurde, ziemlich weit zurückliegt. So ist es; es ist viel mehr als ein Menschenalter seit dem Tage hingegangen, und ich kann dreist die objektivsten Bemerkungen an ihn anknüpfen.
Dessenungeachtet liegt jener Tag und alle seine Stimmungen heute schier klarer vor meiner Seele als der gestrige, an dem es mir zuerst einfiel, mir selbst einmal schriftlich von mir selber und dem, was dazu gehört, Rechenschaft zu geben.
Daß der Sommermorgen schön war, sage ich, weil ich heute noch sein Licht, seine Wärme, seinen Landstraßenstaub und seinen Waldduft in mir und um mich spüre. Wir aber, meine Mutter und ich, sind um Sonnenaufgang mit der schrecklichen Nachricht geweckt worden, kurz vor dem längsten Tage.
Ich saß aufrecht in meinem kleinen Bette, und meine Mutter hielt mich und hielt sich an mir. Da erscholl das ewige, jedenfalls Jahrhunderte alte Leibstücklein des Kuhhirten in der Gasse des Ackerstädtchens. Die Sonne schien mir auf die Bettdecke, unten im Hause brüllten die Kühe. Meine Mutter war in einem Weinkrampf, und die Hausgenossenschaft und ein paar Nachbarinnen und ein alter eisgrauer Kamerad und Steuerkollege meines Vaters waren auch in der Kammer, und die Stube nebenan war voll von Menschen. Unter den Leuten in der Stube aber befand sich ein Mann in einer fremden Uniform, wie es mir schien. Das war aber die Livree derer von Everstein, die ich nachher sehr genau kennen gelernt habe.
Der Herr Graf hatte den Diener mit dem Eberkopfe auf den Rockknöpfen an meine Mutter geschickt und seinen Wagen dazu. Mein toter Vater lag auf dem Hause Werden, dem Wohnsitze des Herrn Grafen, und ich hörte, wie der alte Kamerad des Vaters zu meiner Mutter sagte:
„Frau Steuerkontrolleurin, liebe Frau, Sie müssen es ja leider Gottes, also fassen Sie sich! Sehen Sie doch mal an, gefaßt mußten Sie ja immer im Grunde auf so was sein. Wie wäre es denn nun gewesen, wenn uns der liebe Herrgott während unserer Militärdienstzeit einen guten, braven Krieg beschert hätte? Eben vielleicht nicht anders als jetzt; nur wäre es vielleicht dann noch früher eingetroffen, und das wäre dann noch viel betrübter für Sie gewesen. Nicht wahr? Sie sind doch nun gottlob eine Soldatenfrau, und Ihren Jungen haben Sie ja da auch noch, und er nimmt sich gewiß in dieser ernsthaften Stunde ein Beispiel an seinem lieben Vater, und macht es ihm in allen Dingen nach. Nicht wahr, Fritz, das versprichst du uns?“
„Ja, ja!“ heulte ich, ohne im geringsten zu wissen, was alles ich hier versprach; aber ich fühlte, wie meine Mutter mich fester faßte und heftiger mich an sich drückte, als werde sie mich nie mehr aus ihren lieben, schützenden Armen loslassen:
„Fritz, du bleibst bei mir! du gehst nie von mir!“
„Ja, Mutter, ich fahre mit, ich darf mit ausfahren zum Vater! Nicht wahr, und ich darf auf des Vaters Braunen nach Hause reiten?“
„Der Wagen hält schon seit einer Stunde vor der Tür,“ sagte der alte Kamerad. „Und es ist doch auch recht freundlich von der Herrschaft auf Schloß Werden, daß sie ihre eigene Equipage schickt. Von Amts wegen sind wir schon längst zu Pferde hinaus; da wird nicht das geringste verabsäumt werden, was Ihnen zum Trost gereichen kann, Frau. Und jetzt kommen Sie; — die Nachbarinnen ziehen Ihnen den Jungen an, und dann fahren wir langsam nach. Es geht ja alles im menschlichen Leben hin, und eins in das andere. Erinnern Sie sich nur recht genau an alles, was Sie mir so gut und brav zum Troste sagten, als ich so bei meiner seligen Frau saß, und sie dalag. Sie wissen ja also alles Beste, was Ihnen einer jetzt sagen kann, schon von selber. Fritze, du kannst mitfahren.“
Zweites Kapitel.
Was für eine Magie liegt selbst für die Erwachsenen in dem sich drehenden Rad! Fahren!… ausfahren! Fahren durch einen frischen, sonnigen Sommermorgen in die weite, weite Welt hinein. Gibt es ein glückseligeres Fieber als das, was bei diesem Worte und dieser Vorstellung das Kind ergreift und ihm in erwartungsvoller Wonne fast den Atem benimmt?
Ich war an jenem schrecklichen Morgen ungefähr fünf oder sechs Jahre alt; aber wie deutlich steht er mir noch vor der Seele! Mit allen seinen Einzelheiten! Da war das hastige Ankleiden, bei dem ein Dutzend aufgeregte Hände helfen wollten. Da war das Geflüster rundum, und dazwischen das stille Weinen und laute Schluchzen der Mutter, von Zeit zu Zeit ein neues Gesicht, das sich in die Tür schob und in einem Winkel sich „des Genaueren“ berichten ließ. Dazwischen immer wieder von neuem die braven, guten Worte des alten Kameraden und Kollegen und dann — das Peitschenknallen des Kutschers in der Gasse, das allmählich immer mehr von steigender Ungeduld zeugte.
Und dann waren wir auf der Treppe und dann in der Gasse, und die Gasse rund um die gräfliche Kutsche war auch voll Menschen, die sich verhältnismäßig still verhielten, aber desto mehr und dichter sich im Kreis herandrängten und, wie mir schien, sämtlich nur allzu gern mitgefahren wären in die Weite hinaus und nach Schloß Werden.
Und die Mutter bekümmerte sich nun gar nicht mehr um mich. Ich hielt mich an ihrem Rocke, sie aber ließ sich starr, stumm und willenlos führen, und ich fürchtete mich vor ihren Augen, mit denen sie gar nichts mehr sah, selbst mich nicht. Ich aber sah auch nur beiläufig auf sie; denn der hellblaue Kutscher sah auf mich, und er hatte zwei Braune vor seinem Wagen.
Das holperige Pflaster der einzigen Hauptstraße des Städtchens — aus dem Tor, an den Gärten hin auf die Landstraße; ich neben der Mutter im Rücksitz des Wagens, und des Vaters Kamerad und Kollege uns gegenüber! Da ist die Mühle, wo sich das Wasser aus ziemlicher Höhe auf das Rad stürzt und mir mit seinem ewigen Brausen und weißen Schäumen und eiligen Weitertosen im Bach immer einen so wonnigen Schauder einjagt. Da ist die Gänseweide, unser Hauptspielplatz; Schulkinder mit ihren Schiefertafeln und Abcbüchern stehen am Rande des Grabens und starren uns an, und sind im nächsten Augenblick zurückgeblieben, während ich weiterfahre. Auf der weißen Landstraße liegt die Sonne schon ziemlich heiß; — was wohl der Steinklopfer denkt, der uns auch nachsieht? Was er wohl denkt über unseren Kutscher in dem hellblauen Rock und mit dem Silberstreifen um den Hut? und über den anderen Mann vor uns auf dem Bocke, auch in Hellblau und Silber?! Ich sehe um die Schultern der beiden Leute von Schloß Werden auf die im Traben sich hebenden und senkenden Pferdeköpfe und die schwarzen Mähnen. Wer doch das alles immer so vor sich haben könnte und vorbeifahren immerzu an den Menschen und Bäumen, Zäunen und Hecken — immer, auch wenn die Sonne noch heißer scheinen sollte!… Ich stehe auf, um in die zurückbleibenden, weißen Staubwolken hineinzusehen. Meine Mutter zieht mich wieder auf den Sitz, und wir fahren in das Freie, Klare, Frische hinein.
„Bald sind wir glücklicherweise im Schatten,“ sagt der Kamerad. Seine Säbelscheide wird heiß; ich habe den Finger darauf gelegt, weil die Sonne auch auf ihr blitzt und blinkert; — zu verlockend, um nicht auch da von ihrem Glanze verlockt zu werden. Es ist acht Uhr am neuen Tage, — auch das bemerkt der Kamerad, seine Uhr hervorziehend.
„Nun sehen Sie einmal, liebe Frau, wie es doch immer viel später wird, als man denkt; wenn man es auch noch so eilig haben will. Da sind wir aber gottlob wenigstens endlich im Walde und im Schatten.“
Ja, wir fuhren jetzt im Walde, und es gab nichts Schöneres als ihn an diesem Morgen. Die Buchen streckten ihre Zweige zu einem grünen Dache über uns hin. Wasserläufe rieselten hervor und begleiteten uns stellenweise. Dann und wann sah man hinein in ein Tal, und dann wieder trat der rote Sandstein bis dicht an den Weg hinan, und die Grillen schrillten in dem Spalte des heißen Gesteines, und nie in ihrem glücklichen Dasein und Weitereilen gestörte Blumen — gelb und blau — sahen uns vorüberfahren.
Doch uns drohte nun in all der Pracht, Lieblichkeit und Schönheit ein Schreckliches.
Ein leises Klirren kam heran an einer Wendung der Chaussee und dazu Pferdehufschlag und eine andere Staubwolke. Zwei gefesselte Männer wurden inmitten dieser Staubwolke und zwischen den Pferden der begleitenden Landreiter geführt. Der Kamerad des toten Vaters zog seinen Säbel an sich und trat mit dem Fuß auf und sprach einen Fluch. Die Mutter aber richtete sich empor und bog sich vor und starrte auf die gebundenen zwei Männer aus ihren verweinten Augen:
„Die?“
„Da könnte man lernen, was es heißen muß, im Ernst einhauen!“ sagte leise der Kamerad, und er hatte die Hand auf den Wagenschlag gelegt und rüttelte daran. Die beiden Leute auf dem Bocke aber sahen auch zur Seite und dann auf meine Mutter und mich, und dann schlug der Kutscher plötzlich auf die Pferde, und vorüber ging das auch in Staubwolken, Sonnenlicht und Waldschatten. Im raschesten Trabe gingen die Gäule weiter, obgleich der Weg sich eben bergan zog.
Es ist ein sehr angenehmes Waldgebirge, durch welches damals die Grenze gegen den Nachbarstaat, der das deutsche Salz in anderer Weise als wir besteuerte, sich zog. Eine Grenze ist dort auch heute noch vorhanden, aber jener Staat nicht mehr; doch davon ist jetzt nicht die Rede, sondern von der Gegend — der Landschaft überhaupt. Forsten und Steinbrüche überwiegen; das Ackerland läßt manches zu wünschen übrig; doch ist es in den Händen der Bauern und Kleinbürger, und das ist immer viel wert. Nur einige große Landesdomänen bilden zusammenhängendere Komplexe, und zwei oder drei Rittergüter mit alten Geschlechtern darauf haben gleichfalls ihr größer Teil vom alten Erbe Adams festgehalten. Schloß Werden hatte in dieser Hinsicht den weitesten Besitz aufzuweisen, freilich aber auch, vom trefflichen Walde abgesehen, den steinigsten und unfruchtbarsten. Der Zweig der alten Familie, die es bewohnte, stammte von einem Bergschlosse, fünfzehn Meilen weiter nach Norden im Lande gelegen, und durch viele andere bunte Grenzpfähle von dem Absenker getrennt; dazu auch nur als Ruine, zu der es schon, wenn wir nicht irren, im Jahre der Entdeckung Amerikas mit Aufwendung aller damaligen kriegerischen Ingenieurkünste gemacht wurde.
In Wien sitzen Fürsten zu Everstein, in München Freiherren desselbigen Namens, und hier in diesem Waldgebirge, verschollen wie Amerika nach der Entdeckung durch die Chinesen oder die Norweger, oder wer es sonst zuerst aufgefunden haben soll, Herr Friedrich Graf Everstein mit einer einzigen Tochter, Komtesse Irene; und sonderbare Geschichten und Gerüchte gingen über den Herrn und seinen Haushalt im Lande herum. Je genauer man aber darauf hinhörte, desto weniger wirklich Genaues hat man darüber erfahren, außer daß, „von Anfang an wenig dort zu suchen und noch weniger zu finden“ war. Ein Verbrechen ist das gerade nicht, doch angenehm und behaglich ist’s auch nicht. So sagten wenigstens die Leute später.
Noch eine Stunde hatten wir durch den Buchenwald zu fahren, dann kamen wir an einen sumpfigen Graben voll Riedgras und Binsen. Ein altersgrauer Grenzstein stand, halb versunken, dicht an der Chaussee. Um ihn herum war das Gras niedergetreten wie von vielen Füßen. Unser grauschnauzbärtiger Begleiter schob die Schultern plötzlich hin und her und sah grimmig verlegen auf den Platz hin, und legte dann meiner Mutter die Hand auf das Knie und sah dann meine Mutter an, indem er sich mit den Knöcheln der anderen Hand die Stirn rieb.
„Ich weiß nicht, ob es recht von mir ist, Frau, aber ich — der Junge — mag sich wohl einmal daran erinnern wollen. Da!“
„Da hat man ihn gefunden!… Gemordet!… Mir und unserem armen Kinde in seinem Blute!“ schrie meine Mutter, und —
„Ja,“ sagte der alte Kamerad. „Zum Henker, Kutscher, fahr zu!“
Das kam wohl schroff und hart heraus, aber doch aus dem weichsten, teilnehmendsten Gemüte. Und es war auch in der Tat wohl sehr gut, daß der Kutscher wirklich rasch zufuhr. Es war wohl besser, die Frau sanft um den Leib zu fassen und sie zurückzuhalten, als sie blind nach dem Griff des Wagenschlages faßte, um sich hinaus und auf die schreckliche Stätte zu stürzen. Der Tau hing im Schatten noch überall an Gras, Blumen und Blättern; aber da — unterm Erlenbusch —, da, wo der Boden am meisten zerstampft war, mochte wohl noch ein anderer Tau an den Gräsern und dem niedergetretenen Gezweige hängen.
Beiläufig, es erregt ganz eigentümliche Gefühle, wenn man sich heute, nach so langen Jahren, erinnert, damals, wenn auch nicht auf der schweren Fahrt, ein Wort aufgeschnappt zu haben, dahin lautend, daß „der Alte in der Tat merkwürdig viel Blut verloren habe“!
Fünf Minuten weiter von der furchtbaren Stelle entfernt zweigte sich ein Fahrweg von der Landstraße ab, quer über Wiesen. Da bog auch unser Wagen ein. Jenseits der Wiesen, über dichte Lindenwipfel und andere parkähnliche Baum- und Buschgruppen, erhoben sich die blauschwarzen Schieferdächer und die beiden altersgrauen Ecktürme von Schloß Werden.
Ein Pfahl am Wege verbot hier das Fahren und Reiten.
„Sonst fährt hier nur die Herrschaft,“ erklärte der Kamerad und Steuerkollege; und es war freilich für uns eine bittere Ausnahmsweggelegenheit! ich hörte das Wort; aber nach dem Fahren hätte ich in diesem Augenblicke wenig gefragt, wenn ich zu allem anderen freie Verfügung über die sonnige, grüne Fläche gehabt hätte.
Die große Wiese stand in der vollsten, buntesten Pracht ihrer sommerlichen Schönheit. Es schrillte tausendstimmig über ihr; die Schmetterlinge, Käfer und Mücken flatterten und tanzten, es tanzte die heiße Luft über ihr. Wir aber, wir fuhren weiter diesmal, — die Kinderjagd nach den Farben und Tönen des Sommers sollte mir diesmal noch nicht erlaubt sein; — wir fuhren an einem Teil der hohen Hecke des Parkes entlang und dann an einer noch höheren Mauer hin, bis zu einem alten, aber immer noch festen und stattlichen Eingangstor, über dessen beiden Pfeilern zwei greifenartige Wappentiere auf Steinschilden in ihren Tatzen das Wappen mit dem Eberkopf der Morgensonne hinhielten.
Der Wagen rasselte auf einen weiten, stillen Hof an ein langgedehntes, graues Gebäude heran und dicht an eine breite Steintreppe, die hier zu einer großen, offenen Tür führte, sich aber an der ganzen Fronte dieses Hauptflügels des Schlosses Werden hinzog.
Der Diener sprang vom Bock und öffnete den Schlag, ein anderer älterer Mann in derselben Livree kam heran und nannte meine Mutter seltsamerweise „gnädige Frau“ und fügte ganz leise hinzu:
„Belieben auszusteigen.“
Auf den stummen Jammerblick und die hastige Frage der armen Frau aber hob er nur die Achseln und sagte:
„Da sind der Herr Graf schon selber … Ach ja, es geht — den Umständen nach!“
Das letztere Wort bezog sich wohl auf meinen Vater und hieß soviel als: „Noch lebt er wohl, Frau reitende Steuerkontrolleurin; aber — wie lange?!“
Es ist ein nicht mehr ganz junger Mann gewesen, der uns aus der Pforte und an der Auffahrt entgegentrat und den Namen Graf Friedrich Everstein führte. Er hat manches Auffällige in seiner Erscheinung an sich getragen, mir aber ist nichts, aus jener Stunde wenigstens, davon bewußt. Nur sprach er so leise, wie sonst niemand von allen anderen Menschen in meiner Umgebung.
Drittes Kapitel.
Leise sagte er etwas zu meiner Mutter, und dann bot er ihr den Arm. Wir wurden durch die weite, kühle, mit Hirschkronen, alten Blumen-, Frucht- und Jagdstücken gezierte Halle geführt bis zu einer dunklen Tür. Der ältere Diener öffnete diese Tür, und wir standen in dem Sterbezimmer meines Vaters. Mich hatten der plötzliche Übergang aus dem heißen Sonnentage in diese Kühle, die ganz veränderte Umgebung, die fremden Gesichter vollständig betäubt. Ich ging, den Rock meiner Mutter haltend, wie zu unserem Platze in der Kirche — es waren ganz die nämlichen Gefühle, ein Bangen, Frösteln, Unbehagen und — Behagen.
Ich erinnere mich auch hier noch der Äußerlichkeiten: der braunen Täfelung dieses Gartensaales, des Grüns, das aus dem sonnigen Garten in die beiden hohen Bogenfenster hineinsah, der offenen Glastür, die zu den Gebüschen und Blumenbeeten führte, und des Pfaus, der wie neugierig in dieser Tür stand und seinen schönen Schweif gravitätisch langsam im Kreis über den feinen Kies zog. Wir haben nachher diesen Ort zu allen Jahreszeiten als Spielplatz gern gehabt, und es hat mich wenig gekümmert, daß man einst meinen sterbenden Vater dahin als in das nächst und bequemst gelegene Gemach bettete.
An jenem Morgen waren viele Leute darin, und wahrscheinlich darunter auch ein Arzt. Meine Mutter warf sich jammernd über das Lager, und ich stand einen Augenblick wie allein unter den vielen Fremden.
Es war der Herr Graf, der mich an der Hand nahm und mich gleichfalls zu dem Bette hinführte. Die Mutter lag da bewußtlos, und der Vater war tot.
Das letztere Wort wurde im Kreise umhergeflüstert; ich aber weiß nunmehr von jenem Tage nur noch, daß ich in ein anderes Zimmer geführt wurde und daselbst mit Irene, Komtesse Everstein, Milch trank und Weißbrot aß. Alles andere ist dämmerig, unbestimmt, dunkel — ist nichts. Es war mein Recht, durstig, hungrig und schläfrig zu sein von der Fahrt durch den heißen Sommermorgen; nachher sehe ich mich wieder um in meiner Umgebung und — sie ist eine andere geworden, als sie war. Und hier ist die Stelle, ein weniges mehr von meiner Mutter zu reden, und wie sie in eine hohe Verwandtschaft gehörte und das Recht dazu von Gottes Gnaden besaß und aufweisen konnte.
Den gottlob kaum erwähnenswerten Ansatz von Buckel, den mir das Schicksal zwischen die Schultern und, wie einige wissen wollen, in bedeutend höherem Grade auch auf die Seele gelegt hat, habe ich gewißlich nicht von ihr. Schlank, zart, scheu-mutig steht sie mir vor der Erinnerung, und ein Licht geht von ihr aus, das von keiner Dunkelheit und noch viel weniger von einem anderen Licht in der Welt überwältigt werden kann. Sie trägt ihre Freuden wie ihre bittersten, schwersten Schmerzen still und so, dem Schein nach, leicht. Ihr wurde alles zu einem Kranze, und woher sie ihre Bildung hatte, das bleibt ein Rätsel, und sie selber wußte vielleicht am allerwenigsten Rechenschaft darüber abzulegen. In der „Mädchenschule“ einer kleinen Provinzialstadt hatte sie im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts Lesen, Schreiben, Rechnen und — Singen gelernt, das war alles; aber wenn wo die ersten neun Worte, mit denen ich diesen meinen Lebensbericht eröffnet habe, zur Geltung kommen, so ist das bei ihr der Fall. Sie ist dagewesen wie das große Kunstwerk von Gottes Gnaden; sie ist vorübergegangen. Sie sind alle bei ihr wie bei ihresgleichen gewesen; sie haben keine Ahnung davon gehabt, daß dem nicht so war; ihr ist es nie in den Sinn gekommen, sie zu enttäuschen; denn sie hatte ja eigentlich auch keine Ahnung davon.
Ich bin fest überzeugt, sie hat einen argen Schrecken bekommen, als der Herr Graf sagte:
„Meine verehrte Frau, Sie sind die Dame, die mir für die Erziehung meines armen Kindes in seiner jetzigen Lebensepoche gefehlt hat, und die ich seit langem vergeblich gesucht habe. Bleiben Sie bei uns. Betrachten Sie sich als zu diesem Hause gehörig. Sie erziehen meine Tochter, und ich nehme die Erziehung Ihres Sohnes nach besten Kräften über mich. Wir haben einen recht gelehrten Pfarrer im Dorfe, der wird das Seinige dazu geben. Ist der Junge für das Gymnasium herangewachsen, so wird sich ja wohl auch das Weitere finden. Lassen Sie uns einander gegenseitig aushelfen, da uns das Schicksal in dieser Weise zusammengeführt hat. Sie wissen nicht, wie hülflos ich in hundert Beziehungen bin.“
Nun war auch meine Mutter, wie sich das ja eigentlich von selber verstand, fast nach allen Richtungen und in allen Beziehungen hülflos. Außerdem aber, wie es sich baldigst herausstellte, für ihren und meinen Unterhalt nach dem Tode des Vaters auf eine Pension von sechzig Talern angewiesen, sonst aber auf ihrer Hände Arbeit.
„Was soll ich Ihrem Kinde geben können?“ fragte sie in heftiger Aufregung; aber der Herr Graf hat gelächelt, wenn auch sehr melancholisch. Er hat es sehr genau gewußt, was die arme Frau aus ihrem Reichtum zu geben hatte.
Wir, das heißt meine Mutter und ich, siedelten im Laufe desselben Sommers nach Schloß Werden über. Der Herr Graf hatte sich aber nicht geirrt: wenn die Leute, die man in der Ferne aufsucht, sich stets in die Leute verwandeln, die man rundum in der nächsten Nachbarschaft wohnen hat, so ist das für seine Tochter und für ihn selber in Hinsicht auf die Witwe des reitenden Steuerkontrolleurs Langreuter nicht der Fall gewesen. Und ich — ich, wenn ich in die Sonne sehen will, so hebe ich nicht das Auge zu dem öden brennenden Stern auf, sondern denke mich in jene Tage und Jahre zurück, die da folgten.
Viertes Kapitel.
Ich bin im Verlaufe der Tage in des Lebens Ernüchterungen wie andere tief genug hineingeraten, aber meine in Blau, Silber, Grün, Gold und Purpur schimmernden Märchenjahre habe ich auch gehabt. Hier beginnen sie und verwandeln mir auch den heutigen Tag in sein vollständiges Gegenteil. Daß ich ein poetisch Gemüt sei, das hat nachher wohl niemand von mir behauptet (ich habe wenigstens alles dahin Einschlägige vorsichtig und fest für mich selber behalten), aber damals war doch manches Gedicht — echte Naturdichtung — in mir und um mich, und alles Heimweh — die Quelle aller Poesie —, das ich in leereren Tagen gefühlt habe, stammt aus dieser Zeit und geht dahin.
Wir grübeln viel, wir gebildeten, klug, d. h. dumm gewordenen Menschen, über den Schein in dieser Welt, der sich den Anschein des Wesens gibt; ach, wenn er nur schön war, dieser Schein, wer möchte ihn missen wollen aus seinen Tagen? wer möchte nicht dumm, d. h. klug gewesen sein, wenn auch nur in den Tagen, da er noch jung war?!…
Ich bin natürlich zuerst nur mit in den Kauf genommen worden auf Schloß Werden. Ich kam als ein Appendix meiner Mutter dahin; und es war mir ganz recht so, und es war gut so; es war alles ganz vortrefflich. Die Welt am siebenten Schöpfungstage konnte unserem Herrgott nicht um das Mindeste besser gefallen; das Behagen des einen wäre hier freilich ohne die Seligkeit des anderen gar nicht möglich gewesen!
„Gib mir deine Hand, Junge; ich will dir alles zeigen, was ich habe,“ sagte Komtesse Irene Everstein. „Du kommst aus der weiten Welt, und ich bin hier immer bei Papa gewesen. Mach dich aber nicht mausig; Ewald wird dich sonst durchprügeln, wenn Eva nicht dabei ist.“
Ich habe es erst später, als wir „in das Griechische kamen“, erfahren, daß der Name Irene eigentlich Friede oder die Friedliche bedeutet; aber Namen und Sachen, Worte und Begriffe passen nicht zu jeder Zeit aufeinander. Es ginge so sonst ja wohl auch ein wenig zu glatt ab in dieser doch einmal auf das Rauhe gestellten Welt.
„Weißt du, Junge,“ sagte das Kind, „ich bin die Prinzessin aus dem Bilderbuche, ich bin die Fee, ich zaubere. Wenn du nicht artig bist, so verwandle ich dich in einen schnurrenden, buckligen Kater. Wenn du aber Ewald was davon sagst, so prügele ich selber dich, denn ich will nicht, daß Ewald über mich lacht. Mein Vater lacht niemals über mich, o, und ich will genau aufpassen, was deine Mutter tut, wenn sie aufgehört hat zu weinen. Aber deine Mutter ist gut, und so kannst du auch gut sein. Du kannst ja auch mit Eva gehen, wenn Ewald und ich dir nicht gefallen.“
Der trübe Tag vermag nichts dagegen; die Namen, die hier zum ersten Mal auftauchen, liegen doch im ewigen Sonnenschein, und andere werden dazu kommen; wartet es nur ab, daß die Nebel sinken: man sieht auch von der besten Aussichtsstelle nicht an jedwedem Tage, den Gott gibt, die Höhen über den Tälern leuchten vom Großglockner bis zum Monte Rosa.
Es sind die beiden Kinder des Försters Sixtus im Dorfe Werden, von denen die Rede ist. Von dem Papst Sixtus dem Fünften stammte der alte Herr in Grün nicht ab; aber der Zufall hatte ein altes Buch in seinen Besitz gebracht: Leben des berühmten Papstes Sixti V., geschrieben durch Gregorio Leti. Aus dem Italienischen übersetzt. Frankfurt, bei Thomas Fritschen, 1720; und darauf hat oft seine brave schwere Hand, zur Faust geballt, gelegen, und heute klingt mir noch der Brummseufzer in den Ohren:
„Das war ein Kerl, Fritze! Alle Hagel, der ist ja gerade so mit seiner Satansbande umgesprungen, wie der Doktor Luther hier bei uns mit uns, mit seiner, und wie ich mit euch umgehen werde, ihr Raubzeug und Teufelskinder, wenn ihr es mir zu bunt macht. Fritze, da sieht man’s wieder, daß der Herrgott mehr von einer Sorte im Sacke hat und nur hereinzugreifen braucht, um einen ’rauszulangen und hinzustellen, wo er zu brauchen ist. Aus dem Buch hat mir mein Junge vorlesen müssen und nachher mein Mädchen, und bei Gelegenheit kannst du auch an die Reihe kommen, aber die Hauptstellen lese ich doch lieber für mich allein, die passen für euch naseweises Geziefer jetzt noch nicht. So ’nen Papst lass’ ich mir gefallen, und es ist mir eine Ehre, daß er meinen Familiennamen sich angenommen hat.“
Ich habe später über manchem anderen, in der Menschen Kunde abschmeckend gewordenen Tröster mit beiden Armen aufgestützt gelegen, aber nie wieder über einem so wie über diesem. Das langweilige Buch in dem edlen Deutsch von Siebenzehnhundertzwanzig ist gottlob in meinen Besitz übergegangen und nimmt einen griffgerechten Ehrenplatz in meiner Bibliothek hier in Berlin ein. Ich brauche es nur wie ein richtiges Zauberbuch aufzuschlagen, um über seine vergilbten Blätter hinweg alles vor mir lebendig zu haben, was damals mein Leben nicht bloß bedeutete, sondern war. Treffe ich auf eine Daumenspur des Alten am Rande der Blattseite, so ist es noch besser und gibt die wärmere Farbe. Freilich eine wärmere Farbe! Ich ergreife hier mit beiden Händen die Gelegenheit, zu versichern, daß hier nichts, gar nichts allzu reinlich, zierlich und frisch lackiert aus dem Putz- und Schmuckkästchen der Romantik entnommen ist. Wir rochen um uns her alle Gerüche und sahen alle Dinge, wie sie die Menschen und die Natur im ewigen Hervorbringen vergänglich hinstellen. Alles war seit lange im Gebrauch gewesen und wurde weiter abgenutzt; und wenn ich vorhin von den Livreen des Schlosses Werden gesprochen habe, so stelle der Leser sich dieselben ja nicht zu farbenfrisch und tressenglitzernd, sondern ganz im Gegenteil vor. Wir trugen sämtlich unsere Kleider so lange als möglich und schämten uns eines Flickens an der rechten Stelle wenig. Wir trugen den Frühjahrsregenschmutz, jegliche Gewitterspur und alles, was Herbst und Winter da geben, überall hin, wo eine Tür offen war. Wir hatten alle Wünsche, die nur durch mehr irdische Güter, als wir besaßen, befriedigt werden konnten, und der Herr Graf war da durchaus nicht ausgenommen, sondern auch im Gegenteil. Das Schloß war kein pomphaft Epos und die Försterei keine geleckte Idylle. Sie trugen inwendig und auswendig gleichfalls ihr Flickwerk und ihre Erdgerüche an sich und um sich, und was die letzteren anbetraf, so hatten der Wald mit seinen Buchen- und Tannendüften und die Wiesen mit ihrem Heugeruch recht häufig das Beste dazu zu tun, um die Atmosphäre für fremde heikle Nasen zu verbessern.
Da ist so eine Daumenspur — hier auf S. 595:
„Wer unter dem itzigen Papste dem galgen entgehen will, der muß kein bedenken tragen, sich in ein kloster einzusperren, sollte es auch das allerunglückseligste seyn.“
und ein süßer Duft weht über die Stelle, aber ein ganz eigentümlicher. Es war ein braver Tabak, den der Alte bei seiner absonderlichen Lektüre verqualmte, und ich erkenne die Sorte heute noch mit innigstem Behagen wieder auf Spaziergängen und im Eisenbahnwagen dritter Klasse. Rauchte ich selber, so würde ich nur diese rauchen! Und nun, um es kurz zu machen und es mit dem treffendsten Idiotismus zu nennen: wir waren allesamt und auf Meilen in die Runde ein schmuddeliges Volk, ausgenommen vielleicht der Herr Graf, meine Mutter und Evchen Sixtus; Komtesse Irene Everstein dagegen nicht ausgenommen. — Wir waren ein ganz unromantisches Völklein; aber zu seinem Recht soll das hübsche Wort „romantisch“ doch auch hier gelangen, und wir hängen es wie gewöhnlich an ein Haar. Ach, es gibt sich leider nichts leichter, als in irgendein Handwerk hineinzupfuschen!
Irene war eine Goldblondine, die die Leute ansahen und für sanft hielten; Eva war dunkel und sanft, und Ewald hielt allen seinen Schulmeistern einen braunen Lockenkopf zum Dreingreifen und Zerzausen hin. Von dem, was der Herrgott auf meinem Schädel wachsen ließ, rede ich lieber nicht; aber stimmungsvoll war’s! es stimmte merkwürdig gut zu allem übrigen, und die gütige Vorsehung erhalte es mir solange als möglich, wenn nicht der Schönheit, so doch der Nützlichkeit wegen.
Es kam aber keinem von uns darauf an, wie er eigentlich aussah. Auch was die Mädchen angeht, so macht es mir heute den Eindruck in der Erinnerung, als ob sie sich wenig darum gekümmert hätten; wenn ich dieses auch nicht als feste Behauptung hinstellen darf.
Die Sonne lag uns auf den Köpfen bei jeglicher Witterung, und so trieben wir uns um in den Wäldern, auf den Wiesen und Feldern, in der Schulstube und in den Gängen und Sälen von Schloß Werden. Was jenseits der Berge war, davon wußten wir gar nichts; und wie das so häufig geht, haben wir alle später viel davon erfahren — mehr jedenfalls, als zu unserem Glücke nötig war. Andere freilich haben das vielleicht dann und wann unser Glück genannt; da ist eben mit der „anderen“ Anschauungen und Einbildungen nicht zu rechnen.
Das rechte Licht! War es das rechte Licht, das damals über unsere Köpfe und Tage fiel?
Darüber ließe sich viel sagen; und am Ende ist es gar nicht der einzelne Mensch mit seinen zwei Augen, der etwas darüber zu sagen hat. Nur die auserwähltesten Geister sind es, die hier und da in höchst seltenen Fällen ihre Meinung ausdrücken dürfen. Sie können dann wie der Maler der heiligen Nacht den Schein vom neugeborenen Erlöser in der Krippe ausgehen lassen; oder wie auf der Rubensschen Heuernte, die der alte Goethe seinem Eckermann entzückt vorweist, die Sonne von den Dingen zwei Schatten geradeweg einander entgegenwerfen lassen.
Auch die allerniedrigsten oder einfachsten Geister reden da oft das Richtige. Aber alle zwischen der Höhe und der Tiefe liegende Verständigkeit der Erde hält einfach am besten den Mund und läßt sich bescheinen, — schwitzt und ärgert sich, wenn es ihr zu heiß wird, und kriecht in die Sonne und lobt sie im Vorfrühling und Spätherbst oder im Winter, wenn die Knochen dürr werden, die Zähne wackeln oder ganz mangeln, und die romantischen Locken verwehen „gleich den Blättern der Bäume“, wie Vater Homer davon sang, nicht in einem seiner schläfrigen Augenblicke, sondern an einem der hellsten ionischen Sonnentage, wo er nicht schlief.
Bin ich von der Daumenspur in dem kurieusen Geschichtsschreiber Gregorius Leti zu weit abgekommen? Ich glaube nicht.
Da sitzt der Alte noch vor mir in seiner Amtswohnung am Ende des Dorfes. Alle Türen und Fenster des Hauses stehen offen, und alle Lichter, Töne und Düfte haben freiesten Zutritt; Vieh und Mensch, und also auch der Herr Graf. Da kommt er ein wenig schwerfällig auf seinen Stock sich stützend und seinen Weg mit den Fußspitzen vorsichtig vorausfühlend. Ein gewisser Lehnstuhl wird ihm hingerückt, und da sitzt er, und eines von beiden wird sofort geschlossen, entweder die Tür oder das Fenster, meistens aber beide.
„Wie steht das Befinden, alter Freund?“
„Danke, Herr. Ohne die verflixten Holzwrogen könnte man es vielleicht wohl zu einem hübschen Alter bringen; aber nun sehen Sie mal diese Schandliste von Frevlern! Und alle aus dem Dorf! und jeder Halunke mit einem Handbeil unter der Weste, und jedwedes Subjektum vom schönen Geschlecht mit einer Säge unterm Unterrock. Und die letzten sind die schlimmsten, denn sie ruinieren den Forst von unten auf. Kein junger Trieb ist da vor der ältesten Wackelliese sicher, und von den jungen Spitzbübinnen will ich gar nicht reden. Da möchte man doch lieber Papst in Rom sein; und meinen Namensahnherrn wünsche ich mir nur auf vier Wochen hierher an meine Stelle.“
Der Herr Graf lächelt matt und seufzt:
„Wäre es mein Wald, so würde ich sagen, sehen Sie durch die Finger, Sixtus. Jetzt sehen Sie allein zu, wie Sie Ihr gutes Herz und die Feuerungsbedürfnisse unserer braven Nachbarn mit Ihrer Amtspflicht in Harmonie bringen. Das Kind ist auch wieder den ganzen Morgen durch aus unserem Gesichtskreise verschwunden und hilft wahrscheinlich ebenfalls beim Holzstehlen. Frau Langreuter ist in Verzweiflung und kündigt mir sicherlich demnächst ihr Gouvernantentum. Was haben Sie von Ihren Sorgen zu Hause?“
„Nichts! Sie haben gesagt, sie seien in den Sommerferien, und sind auf und davon. Mein Evchen wollte eigentlich nicht; aber es mußte. Der Junge muß mir zu Michaelis sicher auf die Schule; der Pastor kommt nicht mehr mit ihm zu Rande. Das Fritzchen da hab’ ich nur allein noch am Hoftor erwischt und gesagt: hier; halt mal! und ihn mit an meine Rechnungen gesetzt. Da sitzt er, Herr Graf, und nun fragen Sie ihn selber einmal, wo die anderen stecken!“
Das „Fritzchen“, das war ich, — der Weltweisheit Doktor Friedrich Langreuter, und der Herr Graf dreht seine silberne Dose zwischen den Fingern, nimmt bedächtig eine Prise und wendet sich in der Tat an mich und fragt:
„Wo ist Irene, mein Sohn?“
Und bei dieser Frage öffnet es sich vor mir breit, weit, sonnig, grün, Berghügel und Berghügel, Tal und Tal, und dann einmal zwischen zwei Bergen das Glitzern einer Flußwindung, und dann auf der Ferne rundum ein blauer, lichter, magischer Dunstschleier, den man — wie Ewald behauptet — sich am besten zwischen seinen ausgespreizten Beinen durch besieht; da ist Eva Sixtus und ihr Bruder Ewald, und Irene Everstein und — ich auch, Friedrich Langreuter, der Weltweisheit Beflissener! Den unsterblichen Göttern sei Dank, daß dem so war! daß wir einmal so da waren! — — —
Wir wissen noch nichts von den Vermögens- und Familienverhältnissen des Herrn Grafen und von unseren eigenen noch weniger. Wir leben in den Tag hinein, und wie kann man besser oder vielmehr angenehmer leben? — Wenn die Frage: Wo ist Irene? wo sind Ewald und Eva? wo sind die anderen? von neuem gestellt werden wird, dann hat sich alles geändert und nicht zum Besseren. Wir leben dann nicht mehr in den Tag, in das Licht hinein: wir wissen dann leider ganz genau, mit welcher Regelmäßigkeit die Dämmerung und die Nacht kommen und wie es am hellsten Mittage dunkel werden kann über dem Menschen und seinem Zubehör.
Fünftes Kapitel.
Von dem gelehrten Herrn Pastor, den der Herr Graf gleich zu Anfang unserer Bekanntschaft meiner Mutter rühmte, habe ich wenig zu sagen. Der Herr Graf verstand es wohl nicht besser, aber die Gelehrtheit des guten Mannes war nicht weit her und sein Einfluß auf uns unbedeutend.
Hierüber aber erhält Ewald am besten das Wort. Er nahm mich seinerzeit beiseite, das heißt, indem er mich am Kragen faßte und, mich auf offener Dorfgasse abschüttelnd, bemerkte:
„Tust du dumme Stadtpflanze noch ein einzig Mal da (dieses war von einer Schulterbewegung dem Pfarrhause zu begleitet), als wüßtest du mehr als ich von all den Dummheiten, so paß auf! Wie die Engel im Himmel singen, das weißt du wohl noch nicht? Hör mal, so!“
Nun ist es durchaus nicht angenehm, seiner Wissenschaften wegen an den Ohren auf- und von den Füßen gehoben zu werden.
„Hörst du sie?! Nicht wahr, sie singen wirklich wie die Engel? Und nun tu’s nicht wieder und heb den Finger in die Höhe, wenn ich feststecke. Frag nur Irene, ob die alten Ritter das getan haben. In der Dorfschule beim Kantor tun sie es alle, und da tue ich es auch, und du kannst es auch tun; aber bei dem dummen Lateinischen und dem Herrn Pastor da probiere es mir nur noch ein einziges Mal und du sollst sehen, was du erlebst, und wenn du mir auch hundertmal deinen Robinson und deine Campes Eroberung von Mexiko geliehen hast.“
„Was soll ich aber denn tun, wenn ich was weiß?“ heulte ich, während Irene lachte und Eva ihren Bruder am Hosenbund nach rückwärts zog.
„Die dumme Schnauze halten! Der Alte sagt es schon ganz von selber her. Ich gehe doch schon lange genug bei ihm in die Privatstunde und muß es wissen, was er alles weiß! O, der weiß für uns beide noch lange genug!“
So war es; aber leider war das, was der gute geistliche Herr wußte, auch wenig genug, und was das Schlimmste war, seine Begabung zum Lehrer stand noch tief unter der Wasserhöhe seiner Wissenschaft. In der Hinsicht war es jedenfalls für uns sehr von Nutzen, daß die Jahre hingingen und wir ihm entwuchsen. Und der Herr Graf, der meiner Mutter wegen in der Tat allen Grund hatte, Wort zu halten, hielt es auch. Ich wurde mit Ewald auf das Gymnasium der größeren Provinzialstadt des anderen Staates jenseits des Flusses „getan“; und wir kamen von da an nur in den Ferien nach Hause, das heißt zurück nach Schloß Werden, in das Försterhaus, das Dorf und den Wald und zu den beiden Mädchen.
Die beiden Mädchen! Als wir zum ersten Mal abzogen, sagte Irene:
„Ihr habt es gut.“
Worauf Ewald mit einem bedenklichen Griff nach seinem Rücken erwiderte:
„Weißt du das? Erst probieren und nachher weise Redensarten. Na, was mich angeht, so ist die Hauptsache, daß ich endlich einmal aus dem dummen Dachsbau herauskomme. So’n langweiliges Volk als euch findet man ja immer, und nachher geht der Weg ja auch weiter, und deshalb haben wir zwei es sicher besser als ihr beiden dummen Frauenzimmer.“
„Und ich verbitte mir endlich diese ewigen dummen Dummheiten,“ rief Irene. „Das wird auch auf die Länge dumm und langweilig, du — dummer Junge. Laß sie stehen, Eva, und komm in die französische Stunde; so wie auf morgen, wo wir endlich mal Ruhe vor ihnen haben, habe ich mich noch auf keinen anderen Tag gefreut. Schafskopf!… Herr Gott, Fritz, da ist deine Mama! Ach, nun hat sie auch das wieder gehört! Komm rasch, Evchen! Adieu, messieurs, mademoiselle Martin nous attend. Ach Gott, ach Gott, ach Gott!“
Es war freilich meine Mutter, die um das Gartengebüsch trat und in der Tat das Wort „Schafskopf“ noch vernommen hatte. Und obgleich sie die richtige Adresse sicherlich ganz genau kannte, wendete sie sich dessenungeachtet an die falsche, nämlich an mich, und sagte nichts weiter als:
„Aber Fritz?!“
„Ich war es, mit dem sie sich gezankt haben,“ murmelte Ewald kleinlaut, aber ehrlich.
„Von deiner Schwester ist gar nicht die Rede, Kind,“ sagte meine Mutter, und ging weiter den sonnigen Kiesweg entlang, um als Frau Aja mit dem Strickstrumpf in einer Fensternische der französischen Stunde beizuwohnen und die Vokabeln leise mit nachzusprechen. Mademoiselle Martin aus Nanzig in Lothringen, die alte „Kammerfrau“ der verstorbenen Frau Gräfin, befleißigte sich der besten Aussprache des Idioms.
„Es ist zwar schauderhaft,“ seufzte der Herr Graf, „aber ich habe das meinige doch auch nur in Wien gelernt, und sie hat es wenigstens aus Büchern und ist mit der Grammatik in ihrem Geburtsort in die Schule gegangen. In Nizza hat meine selige Frau sie gefunden, und sie hat treu bei uns ausgehalten durch Gut und durch Böse. Durch das letztere meistens mehr als durch das erstere. Ihre Eltern hatten sie zur soeur ignorantine bestimmt; aber sie fand in sich keinen Beruf dazu, und mir ist es lieb, daß wir sie gefunden haben. Sie hat sehr treu bei mir ausgehalten, Madam Langreuter, und, wie gesagt, durch gute und durch böse Zeiten, und durch die letzteren mehr als durch die ersteren.“
Auch mein Französisch stammt in seinen Elementen aus der Schule der Mamsell Martin, und es ist danach geblieben. Irene und Ewald hatten Gelegenheit, das ihrige sehr zu verbessern, und Ewald spricht und schreibt es heute fast ebenso gut wie das Englische, das er mit einer spaßhaften Neigung ins Irische zu seiner zweiten Muttersprache gemacht hat.
Wir gingen ab nach dem Gymnasium und kamen von da nur in den Ferien nach Schloß Werden zurück. Wenn ich anfangen wollte, davon zu reden und zu schildern, so würde wohl nicht an ein Aufhören zu denken sein. So ist es aber hundert und aber hundert Autobiographen und Biographen ergangen, und sie sollen für mich mit gesprochen und geschrieben haben. Es wiederholt sich und bleibt sich vieles gleich in der Welt, was an und für sich den Eindruck der individuellsten Originalität macht.
Aber die großen italienischen Nußbüsche an der letzten Hecke des äußersten Gemüsegartens derer von Everstein und den Vetter Just hat nicht jedermann erlebt, und so machen wir die beiden zu unserer Spezialität, und den letzteren durch alle Blätter dieser Aufzeichnungen hindurch.
Sie haben eigentlich nichts miteinander zu schaffen; der Vetter hat nie in ihnen gesessen, in den Nußbüschen nämlich; aber doch kann ich nie an den einen ohne die anderen denken. Sie gehören in der grünsten, lichtesten, lachendsten und doch zugleich ernsthaftesten Weise zusammen in meiner Seele. Wie hundertmal in der Wirklichkeit besuche ich heute in der Erinnerung den einen von dem anderen aus, den Vetter Just auf seinem Hofe jenseits des Flusses von dem Gezweige unseres alten Wunderbaums herunter.
Es war eigentlich gar kein einzelner Baum, sondern ein Bündel dick- und hochstämmigen Gebüsches, das der liebe Gott aus einem halben Dutzend Kernen zu unserem Vergnügen auf einer Bodenerhöhung an der Hecke zu außergewöhnlicher Höhe und Pracht hatte aufschießen und sich ineinander weitästig verwirren lassen. In weit entlegene, uns ganz und gar vorgeschichtliche Zeit war das Aufsprießen gefallen, aber der Gipfel der Verwirrung nur allein für uns, wie wir glaubten, in die unserige, und das war das Schöne. Die Vorsehung hatte es auch in diesem Falle gewußt, was alles in dem Keime lag, den sie hier in seiner Hülse auf den Boden fallen ließ, den sie erst mit gelben Blättern, dann mit trefflicher Gartenerde bedeckte und ungestört Wurzeln nach unten in die Dunkelheit und zwei zarte grüne Blättchen nach oben in das Licht, in die Sonne treiben ließ! Der Mensch denkt nie daran, wenn er im großen Walde geht, was alles in zwei solchen grünen Keimblättchen zu seinen Füßen für ihn und seine Art auseinander klappt. Wo bliebe aber auch das Spazierengehen, wenn dem so wäre? Es würden manche dafür danken und unter diesen ich zuerst. Zu Hause, innerhalb seiner vier Wände, unter alle dem, was man sich selber allgemach zusammengetragen hat, würde es bei weitem behaglicher sein als draußen im Freien.
Es war natürlich Ewald Sixtus gewesen, der zuerst herausgefunden hatte, wozu dieses Baumgebüsch gut sei. Er hatte die Leiterstufen gezimmert, die an dem knorrigen Hauptstamm in die Höhe führten bis zu der ersten Gabelung, von wo dann Irenes Ruhe, Evas Höhe, Friedrichs Lust und Ewalds Heim mit mehr oder weniger Beschwerlichkeit und Gefahr des Hals-, Arm- und Beinbrechens zu erreichen waren. Die „Ruhe“ und das „Heim“ hingen selbstverständlich im schwanksten und luftigsten Gezweig; Evas Höhe saß ebenso selbstverständlich am tiefsten und sichersten, und ich — ich wäre mit und zu meiner Lust am liebsten unten am Baum auf festem Erdboden geblieben; aber hinauf mußte ich wie die anderen, und wenn ich einmal oben saß, so gab es freilich auch für mich keinen besseren Platz im Himmel und auf Erden als diesen zwischen Himmel und Erde.
Da waren es einzig und allein die Vögel, die es noch besser hatten als wir, und die wir dann und wann immer noch beneiden durften.
„Wer es wie die könnte!“ seufzte Irene, im äußersten Gezweig, schon jenseits der Hecke des Schloß-Küchengartens in ihrer gefahrvollen Ruhe, zwanzig Fuß hoch über der Wiese hängend. Und das war wieder einmal an einem Sommermorgen, gerade als die Sonne aufging, und alle Frische und aller Tau und alle Erwartungen vom Tage und sämtliche Pläne für die angenehmste Verwendung desselben noch vorhanden waren.
Es ist kaum zu glauben, aber es war doch so: wir, Ewald und ich, wir schmauchten frech hinein in die heilige Frühe und noch dazu Zigarren, von denen der Herr Pastor nie begreifen konnte (während unserer Ferien), wie sie ihm so rasch zu Ende gingen.
Der Herr Graf rauchte leider nicht; er würde sich sonst gewiß an eine bessere Sorte gehalten haben. Den Knaster, den Vater Sixtus aus seiner kurzen Jägerpfeife verdampfte, hatten sich die beiden Herrinnen von Evenshöhe und Irenensruhe in „ihrem Baum und so früh in der Natur“ ganz ernsthaft verbeten. Ich habe es schon gesagt, ich rauche heute auch nicht mehr; aber ich weiß das Blatt aus jener Zeit her noch zu würdigen und zöge es jetzt jedem anderen vor. Ewald hatte gewöhnlich alle Taschen voll davon und meinte: „Das nenne ich gar nicht einem was ausführen, sondern nur gerechte Sühne! Es ist einfach scheußlich, wie billig der Alte den himmlischen Äther (nicht wahr, so heißt’s, Fritz?) verstänkert. Es ist aber ganz sicher ganz dasselbe Kraut, was sich sein lieber Papst Sixtus der Fünfte hier im Walde verstattet haben würde; nicht wahr, Fritzchen? Du mußt es wissen.“
Weshalb mußte ich das wissen?… Weil ich den „Schlingel aus dem Försterhause“ um drei Eselsohrenlängen in der Gymnasialbildung hinter mir zurückgelassen hatte? Es hat sich nachher ausgewiesen, daß das ziemlich wenig zu bedeuten hatte.
Da sitzt Eva im Zweig und sagt vorwurfsvoll: „Aber Ewald, sprich doch nicht so vom Vater!“
„Wozu hat man denn sein Taschengeld von ihm?“ klingt es zurück; und — es ist immer noch der Sommer und der Sommermorgen, die Jugend und die Frage: was fangen wir heute mit dem unendlichen Tage bis Sonnenuntergang an? auf der Tagesordnung!
„Heute gehen wir ihnen einmal recht ordentlich durch. Nachher kriegen wir dann alles auf einmal über die Köpfe und sind für ein Vierteljahr hübsch reuig durch. Übermorgen geht ihr ja doch wieder ab, und wir haben Zeit für alle guten Ermahnungen und Weisheit und Tugend, nicht wahr, Evchen?“ ruft die Gräfin von Everstein von ihrem Aste und greift nach dem nächsten über ihr und steht aufrecht, in tollster Lust sich wiegend. Das ganze jetzt von der vollsten klarsten Morgensonne durchleuchtete grüne Haus schwankt bis in seine Grundfesten, das heißt bis in die äußersten Wurzelfasern.
„Nicht schütteln! O Irene!“ ruft Eva ängstlich; aber wohl rüttelt und schüttelt sich alles rundum, der Nußbaum und die weite wonnige Welt. Die blitzenden Tautropfen sprühen im buntesten Glanze um uns hernieder, und jenseits der Hecke von seinem Zweige hängt Ewald bereits wie ein Affe auf die freie, weite Wiese herunter, mit den Füßen in freier Luft, nach dem nächsten Aste unter ihm tastend. Daß er das Experiment nicht mit dem Kopfe nach unten hängend ausführt, ist ein schöner Zug seiner Nachgiebigkeit und Herzensgüte; versucht hat er’s selbstverständlich, aber Eva hat es sich für „unseren Baum“ verbeten, wie Irene eben dafür den Knaster aus der Schweinsblase seines Vaters.
Er kommt richtig auch diesmal wieder mit ungebrochenen Gliedmaßen im hohen Grase und unter den Sternblumen und Kuckucksblumen der Wiese an und schlägt zur Erholung von der Anstrengung noch ein Dutzend Mal Rad im Kreise. Schon kriecht die Komtesse durch die Hainbuchenhecke, und mehr als daß sie springt, fliegt sie über die hohen Kletten- und Brennesselbüsche im Graben. Aus dem Wunderbaum erschallt noch ein flehend klägliches Stimmchen:
„Ach Gott, Fritz?!“
Ich reiche beide Arme an der Leiter empor, um das ängstliche Vöglein aus dem Baum im Notfall im Fall auffangen zu können.
„Da rennen sie schon über die Wiese nach dem Walde! Mach rasch, Evchen!“
„Ach Gott, ja! Sie hören ja nun wieder nicht! Und ich ginge doch so gern erst hin und sagte es zu Hause, wo wir geblieben sind.“
„Wir sind ja zu Vier, Evchen! Und einer wird doch wohl übrig bleiben und Nachricht bringen, wenn drei von uns zu Schaden kommen.“
„Ja, und ihr wollt dann, daß ich das bin! Mein Vater ängstigt sich wohl nicht; der kommt vielleicht auch erst zum Abendessen heim. Aber deine Mutter!… Und Irenens Vater?!“