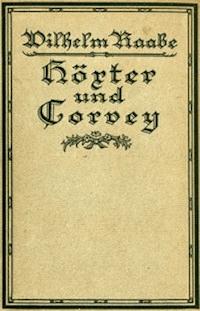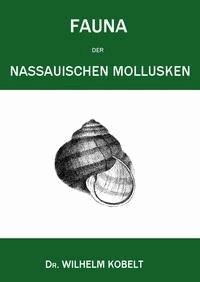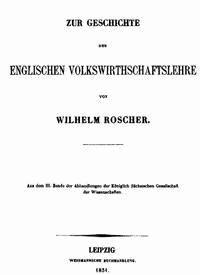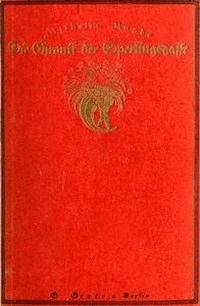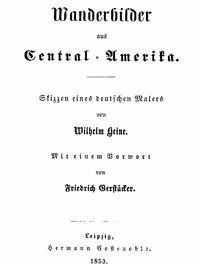0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text so gekennzeichnet. Der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.
Gradiva
Gradiva
Ein pompejanisches PhantasiestückvonWilhelm Jensen
Dresden und LeipzigVerlag von Carl Reissner 1903.
Beim Besuche einer der grossen Antikensammlungen Roms hatte Norbert Hanold ein Reliefbild entdeckt, das ihn ausnehmend angezogen, so dass er sehr erfreut gewesen war, nach Deutschland zurückgekehrt, einen vortrefflichen Gipsabguss davon erhalten zu können. Der hing nun schon seit einigen Jahren an einem bevorzugten Wandplatz seines sonst zumeist von Bücherständern umgebenen Arbeitszimmers, sowohl im richtigen Lichtauffall, als an der, wenngleich nur kurz, von der Abendsonne besuchten Seite. Ungefähr in Drittel-Lebensgrösse stellte das Bildniss eine vollständige, im Schreiten begriffene weibliche Gestalt dar, noch jung, doch nicht mehr im Kindesalter, andrerseits indess augenscheinlich keine Frau, sondern eine römische Virgo, die etwa in den Anfang der Zwanziger-Jahre eingetreten. Sie erinnerte in nichts an die vielfach erhaltenen Reliefbilder einer Venus, Diana oder sonstigen Olympierin, ebensowenig an eine Psyche oder Nymphe. In ihr gelangte etwas im nicht niedrigen Sinn Menschlich-Alltägliches, gewissermassen ›Heutiges‹ zur körperhaften Wiedergabe, als ob der Künstler, statt wie in unsern Tagen mit dem Stift eine Skizze auf ein Blatt hinzuwerfen, sie auf der Strasse im Vorübergehen rasch nach dem Leben im Thonmodell festgehalten habe. Eine hochwüchsige und schlanke Gestalt, deren leichtgewelltes Haar ein faltiges Kopftuch beinahe völlig umschlungen hielt; von dem ziemlich schmalen Gesicht ging nicht das Geringste einer blendenden Wirkung aus. Doch lag ihm unverkennbar auch fremd ab, eine solche üben zu wollen; in den feingebildeten Zügen drückte sich eine gleichmütige Achtlosigkeit auf das umher Vorgehende aus, das ruhig vor sich hinschauende Auge sprach von voll unbeeinträchtigter leiblicher Sehkraft und still in sich zurückgezogenen Gedanken. So fesselte das junge Weib keineswegs durch plastische Formenschönheit, besass aber etwas bei den antiken Steingebilden Seltenes, eine naturwahre, einfache, mädchenhafte Anmut, die den Eindruck regte, ihm Leben einzuflössen. Hauptsächlich geschah dies wohl durch die Bewegung, in der sie dargestellt war. Nur ganz leicht vorgeneigten Kopfes, hielt sie mit der linken Hand ihr ausserordentlich reichfaltiges, vom Nacken bis zu den Knöcheln niederfliessendes Gewand ein wenig aufgerafft, so dass die Füsse in den Sandalen sichtbar wurden. Der linke hatte sich vorgesetzt, und der rechte, im Begriff, nachzufolgen, berührte nur lose mit den Zehenspitzen den Boden, während die Sohle und Ferse sich fast senkrecht emporhoben. Diese Bewegung rief ein Doppelgefühl überaus leichter Behendigkeit der Ausschreitenden wach und zugleich eines sicheren Ruhens auf sich. Das verlieh ihr, ein flugartiges Schweben mit festem Auftreten verbindend, die eigenartige Anmut.
Wo war sie so gegangen und wohin ging sie? Doctor Norbert Hanold, Docent der Archäologie, fand eigentlich für seine Wissenschaft an dem Relief nichts sonderlich Beachtenswerthes. Es war kein plastisches Erzeugniss alter grosser Kunst, sondern im Grunde ein römisches Genrebild, und er wusste sich nicht klarzustellen, was daran seine Aufmerksamkeit erregt habe, nur dass er von etwas angezogen worden und diese Wirkung des ersten Anblicks sich seitdem unverändert forterhalten habe. Um dem Bildwerk einen Namen beizulegen, hatte er es für sich ›Gradiva‹ benannt, ›die Vorschreitende‹; das war zwar ein von den alten Dichtern lediglich dem Mars Gradivus, dem zum Kampf ausziehenden Kriegsgott, verliehenes Beiwort, doch Norbert erschien es für die Haltung und Bewegung des jungen Mädchens am besten bezeichnend. Oder, nach dem Ausdruck unserer Zeit, der jungen Dame, denn unverkennbar gehörte sie nicht unterem Stande an, war die Tochter eines Nobilis, jedenfalls eines honesto loco ortus. Vielleicht – ihre Erscheinung erweckte ihm unwillkürlich die Vorstellung – konnte sie vom Hause eines patrizischen Aedilis sein, der sein Amt im Namen der Ceres ausübte, und befand sich zu irgend einer Verrichtung auf dem Weg nach dem Tempel der Göttin.
Doch einem Gefühl des jungen Archäologen stand's entgegen, sie sich in den Rahmen der grossen, lärmvollen Stadtwelt Roms einzufügen. Ihr Wesen, ihre ruhige stille Art gehörte ihm nicht in dies tausendfältige Getriebe, drin niemand auf den andern achtete, sondern in eine kleinere Ortschaft, wo jeder sie kannte, stillstehend und ihr nachblickend zu einem Begleiter sagte: »Das ist Gradiva« – ihren wirklichen Namen vermochte Norbert nicht an die Stelle zu setzen – »die Tochter des ... sie geht am schönsten von allen Jungfrauen in unserer Stadt.«
Als ob er's mit eigenem Ohr so vernommen, hatte sich das ihm im Kopfe festgesetzt und drin eine andere Annahme fast zur Ueberzeugung ausgebildet. Auf seiner italienischen Reise war er mehrere Wochen hindurch zum Studium der alten Trümmerreste in Pompeji verblieben und in Deutschland ihm eines Tages plötzlich aufgegangen, die von dem Bild Dargestellte schreite dort irgendwo auf den wieder ausgegrabenen eigenthümlichen Trittsteinen, die bei regnerischem Wetter einen trockenen Uebergang von einer Seite der Strasse zur anderen ermöglicht und doch auch Durchlass für Wagenräder gestattet hatten. So sah er sie, wie ihr einer Fuss sich über die Lücke zwischen zwei Steinen hinübergesetzt, während der andere im Begriff stand, nachzufolgen, und bei der Betrachtung der Ausschreitenden baute sich das sie näher und weiter Umgebende wie leibhaftig vor seiner Vorstellungskraft auf. Sie erschuf ihm, unter Beihülfe seiner Alterthumskenntniss, den Anblick der lang hingedehnten Strasse, zwischen deren beide Häuserreihen mannigfach Tempelgebäude und Säulenhallen sich einmischten. Auch Handel und Gewerbe traten ringsum zur Schau, tabernae, officinae, cauponae, Verkaufsläden, Werkstätten, Schankbuden; Bäcker hielten ihre Brode ausgelegt, Thonkrüge, in marmorne Ladentische eingelassen, boten alles für den Haushalt und die Küche Erforderliche dar; an der Strassenkreuzungsecke sass eine Frau, in Körben Gemüse und Früchte feilbietend; von einem halben Dutzend der grossen Wallnüsse hatte sie die Hälfte der Schale weggethan, um zur Reizung der Kauflust den Kerninhalt als frisch und tadellos zu zeigen. Wohin das Gesicht sich wendete, stiess es auf lebhafte Farben, bunt bemalte Mauerflächen, Säulen mit rothen und gelben Kapitälen; alles funkelte und strahlte in mittägiger Sonne Blendung zurück. Weiter abwärts ragte auf hohem Sockel eine weissblitzende Statue empor, darüberher sah aus der Weite, doch von zitterndem Spiel der heissen Luft halb verschleiert, der Mons Vesuvius, noch nicht in seiner heutigen Kegelgestalt und braunen Oede, sondern bis gegen den zerfurchten Schroffengipfel hinan mit grünflimmerndem Pflanzenwuchs bedeckt. In der Strasse bewegten sich nur wenig Leute, nach Möglichkeit einen Schattenwurf aufsuchend, hin und her, die Glut der sommerlichen Mittagsstunde lähmte das sonst geschäftige Treiben. Dazwischen schritt die Gradiva über die Trittsteine dahin, scheuchte eine goldgrünschillernde Lacerte von ihnen fort.
So stand's lebendig vor Norbert Hanold's Augen, allein aus der täglichen Anschauung ihres Kopfes hatte sich ihm allmählich noch eine neue Mutmassung herausgebildet. Der Schnitt ihrer Gesichtszüge bedünkte ihn mehr und mehr nicht von römischer oder latinischer, sondern von griechischer Art, so dass sich ihm nach und nach ihre hellenische Abstammung zur Gewissheit erhob. Ausreichende Begründung dafür lieferte die alte Besiedelung des ganzen südlichen Italiens von Griechenland her, und weitere, den darauf Fussenden angenehm berührende Vorstellungen entsprangen daraus. Dann hatte die junge ›domina‹ vielleicht in ihrem Elternhause Griechisch gesprochen und war, mit griechischer Bildung genährt, aufgewachsen. Bei eingehender Betrachtung fand dies auch in dem Ausdruck des Antlitzes Bestätigung, es lag entschieden unter seiner Anspruchslosigkeit Kluges und etwas fein Durchgeistigtes verborgen.
Diese Conjekturen oder Ausfindungen konnten indess ein wirkliches archäologisches Interesse an dem kleinen Bildwerk nicht begründen, und Norbert war sich auch bewusst, etwas Anderes, und zwar in seine Wissenschaft Fallendes sei's, was ihn zu so häufiger Beschäftigung damit zurückkehren lasse. Es handelte sich für ihn um eine kritische Urtheilsabgabe, ob der Künstler den Vorgang des Ausschreitens bei der Gradiva dem Leben entsprechend wiedergegeben habe. Darüber vermochte er nicht ins Klare zu gelangen, und seine reichhaltige Sammlung von Abbildungen antiker plastischer Werke verhalf ihm ebenfalls nicht dazu. Ihn bedünkte nämlich die fast senkrechte Aufstellung des rechten Fusses als übertrieben; bei allen Versuchen, die er selbst unternahm, liess die nachziehende Bewegung seinen Fuss stets in einer weit minder steilen Haltung; mathematisch formulirt, stand der seinige während des flüchtigen Verharrungsmomentes nur in der Hälfte des rechten Winkels gegen den Boden, und so erschien's ihm auch für die Mechanik des Gehens, weil am zweckdienlichsten, als naturgemäss. Er benützte einmal die Anwesenheit eines ihm befreundeten jungen Anatomen, diesem die Frage vorzulegen, doch auch der war zur Abgabe eines sicheren Entscheides ausser stande, da er nie Beobachtungen in dieser Richtung angestellt hatte. Die von dem Freunde an sich selbst gewonnene Erfahrung bestätigte er wohl als mit seiner eigenen übereinstimmend, wusste indess nicht zu sagen, ob vielleicht die weibliche Gangweise sich von der männlichen unterscheide, und die Frage gelangte nicht zu einer Lösung.
Trotzdem war ihre Besprechung nicht ertraglos gewesen, denn sie hatte Norbert Hanold auf etwas ihm bisher nicht Eingefallenes gebracht, zur Aufhellung der Sache selbst Beobachtungen nach dem Leben anzustellen. Das nöthigte ihn allerdings zu einem ihm durchaus fremdartigen Thun; das weibliche Geschlecht war bisher für ihn nur ein Begriff aus Marmor oder Erzguss gewesen, und er hatte seinen zeitgenössischen Vertreterinnen desselben niemals die geringste Beachtung geschenkt. Aber sein Erkenntnissdrang versetzte ihn in einen wissenschaftlichen Eifer, mit dem er sich der von ihm als nothwendig erkannten eigenthümlichen Ausforschung hingab. Diese zeigte sich in dem Menschengedränge der Grossstadt durch viele Schwierigkeiten behindert, liess ein Ergebniss nur vom Aufsuchen minder belebter Strassen erhoffen. Doch auch hier machten zumeist lange Kleider die Gangart völlig unerkennbar, hauptsächlich trugen nur die Dienstmägde kurze Röcke, konnten jedoch mit Ausnahme einer geringen Minderzahl schon wegen ihres groben Schuhwerks für die Lösung der Frage nicht wohl in Betracht fallen. Trotzdem fuhr er beharrlich in seiner Auskundung fort, bei trockener, wie bei nasser Witterung; er nahm gewahr, dass die letztere noch am ehesten Erfolg verheisse, da sie die Damen zum Aufraffen ihrer Kleidsäume veranlasse. Unvermeidlich musste mancher von ihnen sein prüfend nach ihren Füssen gerichteter Blick auffallen; nicht selten gab ein unmutiger Gesichtszug der Betrachteten kund, sie sehe sein Behaben als eine Keckheit oder Ungezogenheit an; hin und wieder, da er ein junger Mann von sehr einnehmendem Aeussern war, drückte sich in ein paar Augen das Gegentheil, etwas Ermutigendes aus, doch kam ihm das eine so wenig zum Verständniss wie das andere. Nach und nach dagegen gelang seiner Ausdauer dennoch die Einsammlung einer ziemlichen Anzahl von Beobachtungen, die seinem Blick mannigfache Verschiedenheiten vorüberführten. Diese gingen langsam, jene hurtig, die einen schwerfällig, die andern leichter beweglich. Manche liessen die Sohle nur eben über den Boden hingleiten, nicht viele hoben sie zu zierlicherer Haltung schräger auf. Unter allen aber bot nicht eine einzige die Gangweise der Gradiva zur Schau; das erfüllte ihn mit der Genugthuung, er habe sich in seinem archäologischen Urtheil über das Relief nicht geirrt. Andrerseits indess bereiteten seine Wahrnehmungen ihm einen Verdruss, denn er fand die senkrechte Aufstellung des anhaltenden Fusses schön und bedauerte, dass sie, nur von der Phantasie oder Willkür des Bildhauers geschaffen, der Lebenswirklichkeit nicht entsprach.
Bald nachdem seine pedestrischen Prüfungen ihm diese Erkenntniss eingetragen, hatte er eines nachts einen schreckvoll beängstigenden Traum. Darin befand er sich im alten Pompeji, und zwar grade an dem 24. Augusttage des Jahres 79, der den furchtbaren Ausbruch des Vesuvs mit sich brachte. Der Himmel hielt die zur Vernichtung ausersehene Stadt in einen schwarzen Qualmmantel eingeschlagen, nur da und dort liessen durch eine Lücke die aus dem Krater auflodernden Flammenmassen etwas von blutrothem Licht Uebergossenes erkennen; alle Bewohner suchten, einzeln oder wirr zusammengeballt, von dem unbekannten Entsetzen kopfverloren-betäubt, Rettung in der Flucht. Auch auf Norbert stürzten die Lapilli und der Aschenregen nieder, doch, wie's in Träumen wunderbar geschieht, verletzten sie ihn nicht, und ebenso roch er den tödlichen Schwefeldunst in der Luft, ohne davon am Athmen behindert zu werden. Wie er so am Rande des Forums neben dem Jupitertempel stand, sah er plötzlich in geringer Entfernung die Gradiva vor sich; bis dahin hatte ihn kein Gedanke an ihr Hiersein angerührt, jetzt aber ging ihm auf einmal und als natürlich auf, da sie ja eine Pompejanerin sei, lebe sie in ihrer Vaterstadt und, ohne dass er's geahnt habe, gleichzeitig mit ihm. Auf den ersten Blick erkannte er sie, ihr steinernes Abbild war bis in jede Einzelheit vortrefflich gerathen und gleicherweise ihre schreitende Bewegung; unwillkürlich bezeichnete er sich diese als ›lente festinans‹. Und so ging sie ruhig-behend über die Fliesenplatten des Forums dem Apollotempel zu, mit der ihr eigenen gleichmütigen Achtlosigkeit für ihre Umgebung. Sie schien von dem auf die Stadt niederbrechenden Geschick nichts zu bemerken, nur ihren Gedanken nachzuhängen; darüber vergass auch er den furchtbaren Vorgang, wenigstens ein paar Augenblicke lang, suchte in einem Gefühl, ihre lebende Wirklichkeit werde ihm rasch wieder verschwinden, sich diese aufs genaueste einzuprägen. Dann indess, ihn jählings überfallend, kam ihm zum Bewusstwerden, wenn sie sich nicht eilig rette, müsse sie dem allgemeinen Untergang mit verfallen, und heftiger Schreck entriss seinem Mund einen Warnruf. Den hörte sie auch, denn ihr Kopf wendete sich ihm entgegen, so dass ihr Antlitz ihm jetzt flüchtig die Vollansicht bot, doch mit einem völlig verständnisslosen Ausdruck und ohne weiter achtzugeben, setzte sie ihre Richtung in der vorherigen Weise fort. Dabei aber entfärbte ihr Gesicht sich blasser, wie wenn es sich zu weissem Marmor umwandle; sie schritt noch bis zum Porticus des Tempels hinan, doch dort zwischen den Säulen setzte sie sich auf eine Treppenstufe und legte langsam den Kopf auf diese nieder. Nun fielen die Lapilli so massenhaft, dass sie sich zu einem völlig undurchsichtigen Vorhang verdichteten; ihr hastig nacheilend, fand er indess den Weg zu der Stelle, an der sie seinem Blick verschwunden war, und da lag sie, von dem vorspringenden Dach geschützt, auf der breiten Stufe wie zum Schlaf hingestreckt, doch nicht mehr athmend, offenbar von den Schwefeldünsten erstickt. Vom Vesuv her überflackerte der rothe Schein ihr Antlitz, das mit geschlossenen Lidern vollständig dem eines schönen Steinbildes glich; nichts von einer Angst und Verzerrung gab sich in den Zügen kund, ein wundersamer, sich ruhig in das Unabänderliche fügender Gleichmut sah aus ihnen. Doch wurden sie rasch undeutlicher, da der Wind jetzt den Aschenregen hierhertrieb, der sich erst wie ein grauer Florschleier über sie breitete, dann den letzten Schimmer ihres Gesichtes auslöschte und bald auch wie ein nordisch-winterliches Flockengestöber die ganze Gestalt unter einer gleichmässigen Decke begrub. Drauss ragten die Säulen des Apollotempels auf, indes auch nur zur Hälfte mehr, denn eilig häufte sich an ihnen ebenfalls der graue Aschenfall empor.
Als Norbert Hanold aufwachte, lag ihm noch das verworrene Geschrei der nach Rettung suchenden Bewohner Pompejis und der dumpf dröhnende Brandungsanschlag der wilderregten See im Ohr. Dann kam er zur Besinnung; die Sonne warf ein goldenes Glanzband über sein Bett, ein Aprilmorgen war's, und von draussen scholl das vielfältige Gelärm der Grossstadt, Ausrufe von Verkäufern und Wagengeroll bis zu seinem Stockwerk herauf. Doch stand das Traumbild noch mit jeder Einzelheit ihm aufs deutlichste vor den geöffneten Augen, und es bedurfte einiger Zeit, eh' er sich aus einem Halbzustand der Sinnbefangenheit losmachen konnte, dass er nicht wirklich in der Nacht vor bald zwei Jahrtausenden dem Untergang an der Bucht von Neapel beigewohnt habe. Erst beim Ankleiden ward er allmählich davon frei, dagegen gelang's ihm nicht, sich durch Anwendung kritischen Denkens seiner Vorstellung zu entwinden, dass die Gradiva in Pompeji gelebt und dort im Jahre 79 mit verschüttet worden sei. Vielmehr hatte die erstere Annahme sich ihm zur Gewissheit befestigt, und ebenso schloss sich jetzt auch die zweite daran. Mit einer wehmütigen Empfindung betrachtete er in seinem Wohnzimmer das alte Relief, das für ihn eine neue Bedeutung angenommen. Es war gewissermassen ein Gruftdenkmal, mit dem der Künstler das Bild der so früh aus dem Leben Geschiedenen für die Nachwelt forterhalten hatte. Doch wenn man sie mit aufgegangenem Verständnisse ansah, liess der Ausdruck ihres ganzen Wesens nicht zweifelhaft, dass sie sich in der verhängnisvollen Nacht wirklich mit solcher Ruhe zum Sterben hingelegt habe, wie's der Traum ihm gezeigt. Ein altes Wort sagte, die Lieblinge der Götter seien's, die sie in blühender Jugend von der Erde fortnähmen.
Norbert legte sich, ohne seinen Hals noch in einen Kragen eingeengt zu haben, in leichter häuslicher Morgenkleidung, mit Hausschuhen an den Füssen, ins geöffnete Fenster und blickte hinaus. Der endlich auch zum Norden vorgeschrittene Frühling lag draussen, gab sich in der grossen Steingrube der Stadt zwar nur durch das Himmelsblau und die linde Luft kund, doch ein Ahnen berührte aus ihr die Sinne, weckte Verlangen in die sonnige Weite nach Blättergrün, Duft und Vogelgesang; ein Anhauch davon kam doch auch bis hierher, die Marktweiber auf der Strasse hatten ihre Körbe mit ein paar bunten Wiesenblumen besteckt, und an einem offenstehenden Fenster schmetterte ein Kanarienvogel im Käfig sein Lied. Der arme Bursche that Norbert leid, er hörte unter dem hellem Klang trotz seinem Jubeltone die Sehnsucht nach der Freiheit, der Ferne hinaus.