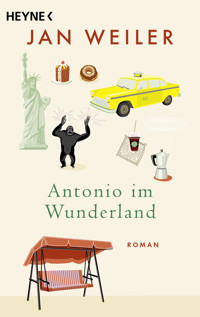13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus der Älternzeit gibt es keine Rückkehr
Wenn Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen nicht mehr erforderlich sind, bricht für die Ältern ein neues Zeitalter an. Nun fordern die Spätpubertiere aus dem Urlaub in Kroatien größere Geldbeträge an. Sie konfrontieren die Ältern mit deren unfreshen Weltsichten und verbieten ihnen den Gebrauch von Alufolie, längere Autofahrten sowie das Tragen von schicken Hemden. Sie rufen niemals auf dem Festnetz an und schalten die blauen Häkchen bei WhatsApp aus. So beginnt sie – die Älternzeit. Man muss es mit Humor nehmen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Wenn Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen nicht mehr erforderlich sind, bricht für die Ältern ein neues Zeitalter an. Nun fordern die Spätpubertiere aus dem Urlaub in Kroatien größere Geldbeträge an. Sie konfrontieren die Ältern mit deren unfreshen Weltsichten und verbieten ihnen den Gebrauch von Alufolie, längere Autofahrten sowie das Tragen von schicken Hemden. Sie rufen rufen niemals auf dem Festnetz an und schalten die blauen Häkchen bei WhatsApp aus. So beginnt sie – die Älternzeit. Man muss es mit Humor nehmen!
Der Autor
Jan Weiler, 1967 in Düsseldorf geboren, ist Journalist und Schriftsteller. Er war viele Jahre Chefredakteur des SZ Magazins. Sein erstes Buch »Maria, ihm schmeckt’s nicht!« gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte. Es folgten unter anderem »Antonio im Wunderland«, »Mein Leben als Mensch«, »Das Pubertier«, »Die Ältern« und die Kriminalromane um den überforderten Kommissar Martin Kühn. Neben seinen Romanen verfasst Jan Weiler zudem Kolumnen, Drehbücher, Hörspiele und Hörbücher, die er auch selbst spricht. Er lebt in München und Umbrien.
JAN WEILER
ÄLTERNZEIT
Illustriert von Till Hafenbrak
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 by Jan Weiler
copyright © by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Einband- und Innenillustrationen: © Till Hafenbrak
Umschlaggestaltung: Teresa Mutzenbach unter Verwendung einer Illustration von © Till Hafenbrak
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28592-0V001
www.heyne.de
Für Katharina
INHALT
Vertragsende in Sicht
Keine Nummer unter diesem Anschluss
Aurelian und Marle lernen was
Deutsch: mega oder madig?
Carla, die Witzpolizei
Übersinnliche Ausschweifung
In der WG der Racheengel
Zugphilosophie
Fußball mit Aktivisten
Mit Mett und Maus
Wasserhahn zu?
Eingetuppert und eingedost
Zlatanisierte Zitronensterne
Die Rehkapitulation
Ein Binder für den Hänger
Neues von der Artenvielfalt
Mauer des Schweigens
Verrückte Verbraucherphobien
Der Kauf des Jahres
Stapeln oder Schlachten
Der Zikaderich hat’s schwer
Schuhlos, aber glücklich
Pustekuchen
Ich bin keine Hilfe mehr
Wanderfalke versus Waldschnepfe
Der Gutschein-Coup
Das Personal protestiert
Mein Rücktritt unter Tränen
Schlussgedanken
ÄLTERNZEIT
VERTRAGSENDE IN SICHT
Wenn von wechselbereiten Fußballprofis die Rede ist, sprechen die Manager des abgabeunwilligen Vereins oft davon, der Spieler habe noch Vertrag. Diese grammatikalisch eigentümliche Wendung hat sich ziemlich eingebürgert. Der Soundso hat noch Vertrag bis 2026. Dasselbe habe ich auch immer für mich in Anspruch genommen, sogar unbefristet.
Das war natürlich naiv, denn jeder Vertrag endet irgendwann. Auch meiner als Familienvater. Meine Kinder wurden immer älter, dann volljährig, und nun haben sie quasi sämtliche Versorgungs-, Erziehungs- und Anschiss-Verträge einseitig gekündigt. Mein Karriereende naht, auch wenn ich mich topfit auf meiner Position fühle.
Ich bin auch noch im Spiel, ich wurde bisher nicht ausgewechselt und ich hocke auch nicht meinen Vertrag auf der Bank ab. Ich bin noch Stammspieler, aber das ist eine Frage der Zeit. Als Sara und ich beschlossen, nicht mehr zusammenzuwohnen, zog unsere Tochter Carla mit zu ihr und unser Sohn Nick eröffnete mit mir eine Jungs-WG. Carla ist inzwischen bei Sara ausgezogen und Nick droht andauernd, dasselbe bei mir zu tun.
Nach dem Abi sei er weg, hat er schon vor Jahren verkündet. Das zieht sich nun etwas, woraufhin Sara im vergangenen Jahr behauptete, ich hätte Nicks Anstrengungen torpediert, damit er noch ein bisschen bei mir bleibt. Ich hätte ihn dazu gezwungen, am städtischen Nachtleben teilzunehmen. Ich sei verantwortlich dafür, dass er lieber Snowboard gefahren sei als für die Prüfungen zu lernen. Ohne mein Zutun hätte er weniger gechillt und könnte längst in eine fremde Stadt gezogen sein.
Auch wenn es mich bei dieser Vorstellung graust, sind Saras Behauptungen blanker Unsinn. Gut. Ich habe nicht kettenhundmäßig jede Hausaufgabe kontrolliert. Und ich habe ihm auch nicht verboten, zwei Tage vor der Matheprüfung zu diesem Rave nach Österreich zu fahren. Aber was sollte ich tun, der Junge ist volljährig. Am Ende hieß es, er wolle es im nächsten Schuljahr noch einmal versuchen, diesmal ganz ernsthaft, und danach sei er eben weg. Und ich versprach, strenger zu sein.
Also rechne ich damit, dass ich demnächst eine Anschlussverwendung benötige. Sara ist in diesem Punkt weiter. Sie verbringt viel Zeit mit Freunden und sogenannten Hobbys, sie hat wieder gelernt auszuschlafen, sie telefoniert manchmal über Tage nicht mit ihren Kindern. Ich hingegen hüpfe immer noch durch sämtliche Stahlbäder, die der Alltag so aufstellt. Die übliche To-do-Liste des Lebens mit einem zwanzigjährigen Altpubertier absolviere ich gerne, wenn auch mit matter Routine.
Ich habe schon unbeschreibliche Dinge unter dem Bett meines Sohnes hervorgeholt. Ich habe auf seinen Wunsch eine Pekingente hergestellt, wegen der beinahe der ganze Stadtteil evakuiert wurde. Das Besondere an dieser Ente war, dass sie nach der Zubereitung noch fabelhaft fliegen konnte. Und zwar in den Mülleimer. Ich habe getröstet und auch pointenlos vor mich hin gebrüllt, Millionen Partien Minigolf gespielt und Nick Klamotten gekauft, die ich selber nie für Kleidungsstücke gehalten hätte. Ich habe in bedingungsloser Liebe Tätowierungen und neue Freundinnen über mich ergehen lassen und ich habe mit ihm The Mandalorian angesehen.
Seit einiger Zeit wecke ich Nick wieder. Wir haben es zuvor zwei Jahre lang ohne Morgenpatrouille probiert, weil er irgendwann verkündete, er sei alt genug, sich selbst zu organisieren. Dies führte allerdings nicht dazu, dass er morgens aufstand. Er stellte sich zwar zwei Wecker, die er jedoch ignorierte. Irgendwann riss er sich dann von selbst hoch und verließ meistens viel zu spät und in Panik das Haus. Immerhin war er wach, machte aber häufig einen vernachlässigten Eindruck.
Um sicherzustellen, dass er seine Schule jemals beendet, schiebe ich jetzt wieder Morgendienst. Immerhin weiß er den Service zu schätzen, der mit zarter Weckung beginnt und durch einen perfekten Cappuccino abgerundet wird. Den nimmt er in der Regel stehend in der Küche ein. Häufig wird Nick dabei wieder müde. Bevor er einschläft, schiebe ich ihn auf eine Sackkarre und fahre ihn vors Haus an die Bushaltestelle, wo ich ihn vorsichtig ablade. Wenn ich wieder in der Wohnung bin und aus dem Fenster sehe, ist er meistens weg. Ich kümmere mich wirklich sehr darum, dass er pünktlich und satt in der Schule ankommt.
Dennoch habe ich Zweifel am pädagogischen Wert meiner Strategie. Vorgestern stopfte er sein Pausenbrot in den Rucksack und sagte: »So geil! Ich stelle mir gerade vor, dass du das noch machst, wenn ich dreißig bin und zur Arbeit gehe. Ich glaube, ich ziehe nie aus.« Ich fürchte, ich habe für immer Vertrag.
KEINE NUMMER UNTER DIESEM ANSCHLUSS
Vor ein paar Tagen fragte mich jemand nach meiner Telefonnummer. Es ging um eine Bestellung und ich nannte dem Herrn meine Handynummer. Festnetz sei ihm lieber, sagte der Mann. Also begann ich mit der Vorwahl von München und stockte dann. Exakt so muss sich der Moment anfühlen, wenn eine schrullige, aber liebenswerte Unkonzentriertheit die Schwelle zur Demenz überschreitet. Ich wusste meine Festnetznummer nicht. Sie fiel mir nicht ein. Nicht eine einzige Ziffer.
Ist das nicht überaus seltsam? Ich weiß die Nummer meiner Eltern und jene meines Grundschulkumpels Matthias. Ich kenne noch die Nummer meiner ersten Freundin von vor 38 Jahren und die von meiner ersten Arbeitsstelle. Aber ich kann nicht sagen, unter welcher Rufnummer ich derzeit zu Hause zu erreichen bin. Eigentlich sind das sogar zwei Leitungen mit zwei Nummern. Die zweite hört mit acht auf. Glaube ich. Oder mit sechs.
Ich schwindelte, dass ich eigentlich gar keine Festnetzleitung habe und er sich mit der Mobilfunknummer begnügen müsse, was der Mann dann auch tat. Dann ging ich nach Hause und dachte, dass ich mal wieder ein Telefonat führen müsse. Mit meinem Festnetztelefon. Ich erinnere mich an schöne Plapperstunden, aber die habe ich seit Jahren nicht mehr mit einem richtigen normalen Telefon in der Hand verbracht. Das liegt aber nicht an mir.
Mein Festnetzdings nervt einfach seit seiner Anschaffung vor zwei Jahren. Das Ding ist wie ein Kochtopf, der zusätzlich Kartoffeln schälen und zu Püree stampfen kann, wodurch man sich genötigt sieht, Kartoffelbrei zu essen, nur um dem Topf einen Gefallen zu tun. Das Telefon drängt sich jedenfalls mit lauter überflüssigen Anwendungen auf. Ich brauche weder den Kalender noch das Adressbuch, ich nutze keinerlei Rufumleitungen oder Sprachboxen und ich möchte auch nicht über Börsenkurse oder Horoskope informiert werden. Wenn überhaupt würde ich damit telefonieren wollen. Aber nur, wenn ich mein Handy nicht fände. Aus lauter Trotz stellte ich nicht einmal Uhr und Datum ein. Monatelang war auf dem Display das Jahr 1976 zu lesen. Dann programmierte Nick das Ding und richtete einen Anrufbeantworter sowie 6 000 weitere Funktionen ein. Das Telefon stand dann in meinem Büro, und als es zum ersten Mal klingelte, kapierte ich erst gar nicht, dass es sich um einen Anruf handelte, weil ich den Klingelton noch nie gehört hatte.
Eineinhalb Jahre lang blinkte ein rotes Briefumschlag-Symbol am Telefon. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, die Bedienungsanleitung dieses Kommunikationsmonstrums aus dem Internet runterzuladen und nachzusehen. In den einzigen Anrufen, die ich regelmäßig erhielt, wurde mir mit stockender Stimme mitgeteilt, dass ich. Vier. Neue. Nachrichten. Habe. Zum Abhören solle ich die »eins« drücken. Machte ich nie. Wahrscheinlich bestanden die aufgenommenen Nachrichten darin, dass die Mailbox mitteilte, dass ich noch drei Sprachnachrichten in der Mailbox hätte. Das Festnetz hatte ich nur, weil man das irgendwie so hat. Vermutlich gehöre ich der letzten Generation an, die noch so denkt.
Ich kam also jedenfalls in Gedanken an ein Festnetztelefonat nach Hause, und dann stand das Telefon nicht in seiner Halterung. Es war weg. Ich rief es an, aber es klingelte nicht. Also suchte ich es überall in der Wohnung und fand es schließlich unter der Couch. Ich glaube, es lag seit Wochen oder Monaten dort, denn es war verstaubt und hatte sich abgeschaltet. Wahrscheinlich wollte es sich aus dem Fenster stürzen, kam aber nur bis unters Sofa. Ich stellte es wieder in die Halterung, und es lud sich auf.
Und dann blinkte es wieder. Ich drückte auf den leuchtenden Knopf, und das Telefon spielte eine Nachricht ab. Von meiner Tochter. Man hört ein paar Töne auf der Ukulele, dann kommt ihre Stimme: »Hallo! Ich dachte, ich rufe auf dem Festnetz an, das macht man ja bei älteren Menschen. Hör mal, hier ist ein Lied für dich.« Und dann singt sie ein selbst komponiertes Lied für ihren Vater. Und ich Vollidiot höre das erst eineinhalb Jahre später ab.
AURELIAN UND MARLE LERNEN WAS
Im Großen und Ganzen bin ich sehr froh, dass meine Kinder schon volljährig sind. Man erspart sich dadurch allerhand. Rolf Zuckowski zum Beispiel. Man tritt auch nicht mehr mit nackten Füßen auf Legosteine, wenn man nachts ins Bad geht. Man hat keine angesabberten Reiswaffeln mehr im Auto. Man muss nicht zu Elternsprechtagen und Elternabenden. Und man begegnet nur noch ganz selten grauenhaften kleinen Monstern.
Das letzte Mal traf mich dieses Schicksal im vergangenen Sommer. Sara, Carla, Nick und Freunde und ich machten Ferien in Italien. Im selben Haus wie immer. Ich bin sehr gespannt, wie oft ich meine Kinder noch dazu überreden kann. Im Moment bringe ich die Familie zusammen, weil sich Carla und Nick keinen anderen Urlaub leisten können. Sie sind quasi abhängig von mir. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich genieße das. Und die Witzqualität meines Sohnes ist inzwischen derart hervorragend, dass ich auch in den Ferien nicht darauf verzichten möchte.
Da stehe ich zum Beispiel neben Nick in der Küche und er fragt vollkommen beiläufig: »Sag mal, was macht man eigentlich mit diesem weißen Gummiball, der noch in der Tüte ist, wenn man den Mozzarella getrunken hat?« Ich brauche in solchen Situationen einen Moment, bis ich den Scherz kapiere und dass ich gerade darauf geprüft werde, ob ich ernsthaft antworte.
Noch bestehe ich den Test. Und ich reagiere richtig, wenn Nick den Rest seines Bieres mehrfach als »Uwe« bezeichnet. Er wartet ungeduldig darauf, dass ich frage, was damit bitte schön gemeint sei, und wenn ich frage, antwortet er fröhlich, »Uwe« stehe für »Unten wird’s eklig«. Da hat er recht. Ich habe einige Jahrzehnte benötigt, um zu dieser Einsicht zu gelangen, und meistens vergesse ich sie, besonders, wenn es abends lustig ist.
Ich brauche zwar länger, um einfache Sachverhalte zu verstehen, aber wenn ich mal etwas weiß, dann weiß ich es für immer. Dies führt zu Konflikten mit Nick, der ein schrecklicher digitaler Klugscheißer ist. Was immer man äußert, es wird einem sofortigen Online-Faktencheck unterzogen. Gestern Abend behauptet er, dass das Kiffen in den USA erlaubt sei. Ich erwidere, das sei in ein paar Staaten der Fall, aber nicht in allen. Also sieht er nach. Ergebnis: In 18 Staaten ist das Kiffen legal. Er behauptet, das sei ja praktisch überall. Ich sage, es sei ein gutes Drittel aller US-Staaten. Er sieht nach. Und so geht das immer weiter.
Aber ich will mich nicht beschweren, immerhin bleibt die Konversation friedlich. Ich bin dafür sehr dankbar, besonders seit der Abreise von Friedrich.
Friedrich wurde mir vor dem Besuch seiner Familie letzten Sommer als geistreicher und charmanter Zehnjähriger angekündigt, wirkte auf mich jedoch wie eine Mischung aus Erich Mielke und einem gusseisernen Schirmständer. Kaum im Ferienhaus angekommen, beschwerte sich der kleine Griesgram über das langsame Internet. Seine Handyspiele liefen nur in einer Ecke des Wohnzimmers, sodass er dort neben einer Gardine stehend Stellung bezog und die nächsten sechs Stunden nicht weiter auffiel.
Abends gingen wir in ein Restaurant und es wurde Fanta für Friedrich bestellt, weil er nichts anderes trinken könne. Allerdings müsse die Fanta ohne Kohlensäure sein. Zu Hause schüttele man die lebensgefährlichen Blasen aus dem Getränk. Friedrichs Vater bestellte nun allen Ernstes »Fanta senza Frizzante«, was den Kellner erst verwirrte, dann sichtlich erheiterte und im Ergebnis völlig folgenlos blieb. Jedenfalls enthielt die Fanta dann Sprudel, was Friedrich dazu veranlasste, mit düsterer Miene zu verkünden, er werde nun gar nichts trinken.