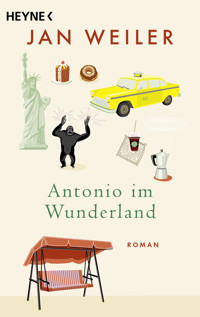10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Postbote. Busfahrer. Rentner. Sachbearbeiterin. Architekt.
Fünf Menschen, in deren Leben irgendwann mal was richtig schiefgegangen ist. Fünf ganz normale Verrückte und ihr ehrgeiziger Arzt. Dem die Behandlung langsam aus dem Ruder läuft. Bis die fünf eines Tages ausbrechen und sich an der Gesellschaft rächen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Autor
Jan Weiler, 1967 in Düsseldorf geboren, ist Journalist und Schriftsteller. Er war viele Jahre Chefredakteur des SZ Magazins. Sein erstes Buch »Maria, ihm schmeckt›s nicht!« gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte. Es folgten unter anderem »Antonio im Wunderland«, »Mein Leben als Mensch«, »Das Pubertier«, »Die Ältern« und die Kriminalromane um den überforderten Kommissar Martin Kühn. Auch sein jüngster Roman »Der Markisenmann« stand monatelang auf der Bestsellerliste. Neben seinen Romanen verfasst Jan Weiler zudem Kolumnen, Drehbücher, Hörspiele und Hörbücher, die er auch selbst spricht. Er lebt in München und Umbrien.«Eine beklemmend realistische – und hoffentlich nicht prophetische – Vorstellung.» (FAZ)
«Irre komisch – bis man realisiert, dass diese Gesellschaft gar nicht komisch ist.» (Hamburger Morgenpost)
«Eine herrliche Groteske.» (Hessische Allgemeine)
«Eine sezierende Parodie auf die deutsche Medienwelt.» (SZ)
« Ein tolles Buch! » (NDR)
«Witzig und skurril.» (Hamburger Abendblatt)
Jan Weiler
Drachensaat
Roman
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2008 by Jan Weiler
Copyright © 2023 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
DRACHENSAAT erschien erstmals 2008 im Rowohlt Verlag, Hamburg
Covergestaltung: t.mutzenbach design, München, nach einer Vorlage und Motiven von: any.way, Barbara Hanke / Cordula Schmidt (Foto: Arnold Odermatt: Dallenwil, 1977. © Urs Odermatt, Windisch / VG Bild-Kunst, Bonn 2023)
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31357-9V001
www.heyne.de
Teil 1HausUnruh
1. Mein triumphaler Einzug ins Haus Unruh
Die meisten Menschen würden sagen, man hört es nicht. Sie glauben, es ginge einfach zu schnell. Man setzt die Mündung an seine Schläfe, drückt ab, und dann dauert es nicht einmal eine tausendstel Sekunde, bis das Projektil im Schädel ankommt. Der Schall dringt langsamer ins Ohr als die Kugel in den Kopf. Und danach ist ja sowieso Ruhe. Mag sein, dass das Trommelfell platzt, aber gleichzeitig fliegt das Hirn durchs Zimmer. Du wirst ganz sicher nicht mehr zum Ohrenarzt gehen. Jedenfalls sind die meisten Leute der Ansicht, man könne den Knall nicht hören. Das stimmt aber nicht. Ich habe ihn gehört.
Nun können Sie natürlich mit einigem Recht behaupten, dass ich, wenn ich den Schuss gehört habe und sogar noch davon erzählen kann, auch nicht tot bin. Das ist richtig. Zwar drang die Kugel in meinen Kopf ein, aber eben nicht so, wie sie hätte eindringen sollen. Sie flog haarscharf am Hirn vorbei. Eigentlich hat sie bloß das Stirnbein gestreift und den Knochen zertrümmert. Bleibende Schäden sind nicht entstanden, wenn man einmal davon absieht, dass ich wegen eines von dem Schuss verursachten Knalltraumas auf dem rechten Ohr nichts mehr höre außer einem Tinnitus. In meinem Kopf rauscht es, ich bin so eine Art Mensch gewordener Niagarafall. Die Ärzte waren der Meinung, dass mein Gemüt gelitten habe, doch die kannten mich vorher nicht, die können das nicht beurteilen. Aber sagen Sie so etwas mal einem Arzt. Er wird gleich beleidigt sein, und Ihre Beurteilung fällt schlechter aus. Solange man bloß in der Sprechstunde eines Urologen sitzt, ist das nicht so schlimm, aber wenn Sie darum kämpfen, aus einer Landesklinik entlassen zu werden, würde ich Ihnen empfehlen, nicht zu widersprechen, wenn Ihr Therapeut Vermutungen über Sie anstellt.
Ich hätte mir die Geschichte, die nach dem Knall passiert ist, erspart, wäre ich beim Abdrücken aufmerksamer gewesen. Im Grunde genommen hätte ich mir schon diesen blamablen Kopfschuss ersparen können, wenn ich vorher mein Leben nicht versaut hätte. Dann wäre es gar nicht zu dieser peinlichen Vorstellung gekommen, und ich würde vielleicht wie Sie gemütlich auf der Couch sitzen und ein Buch lesen.
Nichts hat auf eine derart vermurkste Biographie hingedeutet, als ich zwanzig Jahre alt war. Ich stand damals, vor über dreißig Jahren, noch ziemlich am Anfang eines soliden Lebenslaufes. Stellen Sie sich einen unauffälligen Zwanzigjährigen vor, der gerade seinen Wehrdienst beendet hat. Ich trug Ende der siebziger Jahre die Haare nicht mehr lang und auch keine Parkas oder Latzhosen, sondern eine pflegeleichte Kurzhaarfrisur, Cordhosen und in der Regel ein gebügeltes Hemd. Das betone ich bloß deswegen, weil ich nicht will, dass Sie mich für einen Ausgeflippten oder so etwas halten. Das kam alles erst viel später.
1979 war das Bemerkenswerteste an mir ein Schnurrbartversuch, den ich mangels Fülle nach drei Monaten abbrach, sowie die Tatsache, dass ich noch Jungfrau war. Mir machte das nichts aus, ich war auch nicht schüchtern oder hässlich. Es hatte sich bloß bis dahin nichts ergeben. Ich dachte damals nicht darüber nach und erwähne es jetzt auch nur, weil Doktor Zens mich danach fragte. Für Psychologen sind das wichtige Fragen – oder sie sind einfach nur genauso neugierig wie jeder andere Mensch. Ich war jedenfalls nicht gerade ein Don Juan. Wenn ich heute noch Fotos von damals hätte – ich habe keine, es ist alles weg –, würde ich mich wohl über den jungen Bernhard amüsieren. Kleiner, dürrer Bernhard Schade mit Schnurrbärtchen und Pullunder.
Immerhin: Mein Leben lang bekam ich Komplimente für meine langen schmalen Finger. Damals wusste ich nicht, wohin damit. Außer wenn ich zeichnete. Schon als kleiner Junge malte ich vor allem Häuser, das beruhigte mich. Häuser ließen mich an sich heran, meine Zeichnungen von ihnen sahen immer genau so aus, wie ich sie mir vorstellte. Menschen oder Tiere konnte ich nicht. Da geht es mir wie allen Untalentierten. Wir zeichnen Tiere gerne in Seitenansicht, weil wir uns einbilden, dass man sie dann besser erkennt. Doch ein Pferd sieht bei uns nicht viel anders aus als eine Katze oder ein Hund. Wir sehen vor unserem geistigen Auge eine wundervolle Blume, doch wenn wir sie malen, kommt niemals das Bild dabei heraus, das wir im Kopf haben. So tief unsere Empfindung für die Blume auch sein mag, wir bekommen sie nicht aufs Papier. Als Kind brachte mich das zur Verzweiflung.
Ich zerriss Dutzende von misslungenen Rosen, bis ich einmal, gelangweilt von meinen Wutausbrüchen, begann, kleine Fenster in einen Stängel zu zeichnen, dann aus den Blättern ein Dach machte und auf die Blüte einen Schornstein und eine Antenne setzte. Ganz unten fügte ich eine Haustür hinzu und einen Briefkasten. Auf den schrieb ich: «Bernhard Schade». Mein erstes Haus. Ich bewahrte diese Zeichnung sehr lange auf, zuletzt hing sie gerahmt in meinem Büro. Meine Frau hat das Bild zerstört.
Für mich stand jedenfalls früh fest, dass ich mein Leben lang Häuser zeichnen würde. Also wurde ich Architekt. Mit zwanzig Jahren begann ich zu studieren, mit dreißig hatte ich ein eigenes Büro, fünf Jahre später 18 Mitarbeiter. Ich hatte großen Erfolg, den ich aber nicht meinem kreativen Talent oder einer Ader zur Geschäftstüchtigkeit verdankte, sondern allein meinem Sohn, denn der kam mit einer Behinderung zur Welt. Ohne Udos Handicap wäre ich nicht zu einem von Deutschlands führenden Architekten in meinem Bereich geworden.
Bis hierhin klingt das womöglich ganz alltäglich, und im Rückblick habe ich eher positive Erinnerungen an die erste Hälfte meines Lebens, aber genau dort fing im Grunde genommen das ganze Elend an. Mit 22 Jahren lernte ich Ariane kennen. Sie studierte ebenfalls Architektur und war die erste Frau, mit der ich schlief. Das habe ich vor ihr nie zugegeben, weil es mir peinlich war. Jedenfalls war sie meine einzige echte Liebe und nach unserer ersten Nacht prompt schwanger. Wir heirateten drei Monate später.
Udo kam im Dezember 1981 auf die Welt, am 12., einem Samstag. Er und ich hatten von Anfang an eine nicht ganz unproblematische Beziehung. Man könnte es auch anders ausdrücken: Ich war nicht der Vater, den er verdient gehabt hätte, und er war nicht der Sohn, den ich mir gewünscht habe.
Es war gar nicht so, dass ich meinen Sohn nicht mochte, ich konnte nur überhaupt nichts mit ihm anfangen. Das lag daran, dass Udo mit Trisomie 21, dem Downsyndrom, geboren wurde. Ich ahne, dass Sie beim Lesen nun einen schlechten Eindruck von mir bekommen, das ist bedauerlich, und ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Aber ich habe nun einmal vor, ganz ehrlich zu sein, gerade weil es das erste Mal in meinem Leben sein könnte. Ich nehme diese Gelegenheit zur Ehrlichkeit auch deshalb wahr, weil ich damit etliche Falschmeldungen korrigieren kann. Es hat so viel Blödsinn über mich in der Zeitung gestanden.
Ich belog Ariane jedenfalls nicht nur in puncto meiner erotischen Erfahrung, sondern auch, was mein Verhältnis zu Udo anging. Natürlich wollte ich unseren Sohn vorbehaltlos und genau so lieben, wie er war, aber das konnte ich nicht. Vielleicht war ich einfach von mir selber enttäuscht. Mein Samen hatte nur ein einziges Kind gezeugt, und das war behindert. Ich hatte und habe nichts gegen Behinderte. Aber vor die Wahl gestellt, hätte ich lieber einen gesunden Jungen gehabt, so einfach ist das. Alle Träume, die ich in das Ungeborene projiziert hatte, erschienen angesichts dieses Jungen als hoffnungslose Spinnereien. Meine Wünsche und Sehnsüchte kamen mir so vermessen vor und das Ergebnis meiner ersten Liebesnacht wie eine Strafe. Entschuldigung, ich finde mich ja selber zum Kotzen. Aber ich war damals noch jung.
Bald nach Udos Geburt begann ich Ariane zu betrügen. Vielleicht musste ich etwas nachholen, möglich, dass ich mich an ihr rächen wollte oder dachte, irgendwas an der Menschheit wiedergutmachen zu müssen. Kann auch sein, dass ich einfach nicht zu Hause sein wollte bei ihr und unserem Sohn. Es wird von allem etwas gewesen sein.
Der Therapeut im Haus Unruh hat an solchen Stellen immer genickt. Ich habe ihn gefragt, was er mit dem Nicken meinte, denn es ist ja interpretierbar, so ein Nicken. Er hat dann gesagt: «Das Nicken dient der positiven Verstärkung. Damit möchte ich Sie ermuntern weiterzuerzählen, weil es gut für Sie ist.» Er hat gelogen. Heute denke ich, er nickte, weil er genau wusste, was ich meine. Es gibt diesen postnatalen Verpisserdrang bei vielen Männern. Auch wenn man nicht von sich auf andere schließen sollte, so glaube ich doch, dass der Doktor das verstanden hat.
Die Jahre von Udos Kindheit verliefen einigermaßen normal, wenn man davon absieht, dass wir ständig bedauert oder gemieden wurden. Oder beides gleichzeitig. So ist das nun einmal mit einem behinderten Kind, da braucht man sich nichts vorzumachen. Natürlich fragen die Nachbarn teilnahmsvoll. Aber sie glotzen auch. Und sie laden einen nicht ein, weil sie fürchten, man könnte sein Kind mitbringen.
Immerhin genoss einer von uns sein Leben, und das war Udo. Ich war sicher kein Mustervater, aber manchmal unternahmen wir was. Es ging dann auf den Spielplatz oder in den Park, auf jeden Fall blieben wir an der frischen Luft, weil es in Kinos oder Restaurants jedes Mal zu Zwischenfällen kam. Udo konnte nicht stillsitzen und flippte in Zeichentrickfilmen vor Freude derart aus, dass wir einmal bereits nach einer Viertelstunde gebeten wurden, den Saal zu verlassen. Das ist ungerecht und gemein, aber ich hatte Verständnis dafür. Ich habe mich oft geschämt, wenn ich die anderen Leute besser verstand als meinen Sohn, und war eigentlich nie loyal ihm gegenüber. Manchmal habe ich ihn sogar verleugnet. Das ist erbärmlich, ich weiß, aber ich wollte nun einmal nicht den ganzen Abend über ihn sprechen, wenn ich eine Frau in einer Hotelbar aufgerissen hatte. Können Sie das verstehen? Nein? Könnte ich an Ihrer Stelle vielleicht auch nicht.
Aber er hat mich auch nicht der Vater sein lassen, der ich gerne gewesen wäre. Nie habe ich am Rand eines Sportplatzes gestanden und ihn beim Fußball angefeuert. Nie habe ich ein Konzert von ihm besucht, nie ein Gedicht von ihm gelesen. Er hat nämlich keinen Sport getrieben, spielte kein Instrument und konnte kaum schreiben. Auch die wundervollen Vatergespräche über Politik oder das Erwachsenwerden haben wir nicht geführt. Er hat mich darum betrogen. Oder ich mich selber, ich weiß es nicht.
Was wir hatten, waren gemeinsame Fahrten zur Töpfergruppe oder zur Gymnastik. Und natürlich haben wir uns unterhalten. Über Erbsen und Möhrchen aus der Dose zum Beispiel. Oder über die Schlümpfe. Oder über den plötzlichen Tod meiner Mutter. Sie fiel Weihnachten 1992 beim Schmücken des Christbaums von der Leiter und brach sich das Genick. Im Sturz warf sie den Korb mit Lametta in die Luft, und das Zeug rieselte auf sie herab. Ausgerechnet Udo fand den glitzernden Leichnam im Wohnzimmer. Er kam in mein Büro gelaufen und rief: «Die Oma hat sich als Weihnachtsbaum verkleidet. Die ist lustig, die Oma.» Ich habe es nie vermocht, ihm klarzumachen, dass seine Großmutter das nicht mit Absicht gemacht hat.
Meine Karriere verdanke ich, wie gesagt, Udo. Als ich mein Studium abschloss, war er fünf Jahre alt, und wir verbrachten viel Zeit in therapeutischen Einrichtungen. Die meisten waren nicht für Behinderte gebaut worden. Ich fand es nur naheliegend, dass ich in meiner Diplomarbeit ein behindertengerechtes Theater entwarf. Eigentlich ist das keine große Kunst. Es gibt Normen für Türen, für Treppen, für Lichtschalter und für Fenster und festgelegte Neigungswinkel für Rollstuhlrampen. Aber ich fragte Udo, wie er sich ein Theater vorstellte, und er erklärte mir ganz genau, was er von so einem Haus erwartete, zum Beispiel bunte Türklinken. Behindertengerecht war kein Terminus, den er verwendet hätte. Er sprach immer nur von einem Theater für sich und seine Freunde.
Ich habe später bei jedem Projekt lange Gespräche mit ihm und den anderen Kindern aus seiner Therapiegruppe geführt und danach meine Gebäude konzipiert. Ich habe ihn Bauherr sein lassen. Auf diese Weise galt ich innerhalb weniger Jahre als absolute Koryphäe für behindertengerechtes Bauen. Und das alles nur, weil Udo mir verriet, wie er ein Handtuch von der Stange nimmt und wo im Haus das Mineralwasser stehen sollte.
Ich hätte ihm dankbar sein können. Aber ich war es nicht, denn in Wirklichkeit hätte ich lieber andere Häuser gebaut. Schicke Villen, Büropaläste. Doch ich habe dafür nie eine einzige Ausschreibung gewonnen. Meine Arbeit roch nie nach Chanel Nummer fünf, sondern nur nach Kantinen-essen und Sagrotan. Ich wurde der Mann für die Spezialkliniken, die Behandlungszentren, die integrativen Einrichtungen. Menschenwürdiges Bauen hieß das Motto, mit dem ich bald in immer größere Büros umzog. Gewollt habe ich das nicht. Es hat sich so ergeben. Wegen Udo.
Ich hatte viel zu tun. Meine Ehe hat mich dann nicht mehr sehr interessiert. Wir blieben zusammen; Ariane war eine gute Mutter und ich ein schlechter Ehemann und Vater. In der Regel verbrachte sie den Tag damit, sich die Schläfen zu massieren und im Garten Unkraut zu zupfen. Alle zwei Monate schliefen wir miteinander, und an Weihnachten schenkten wir uns Sachen, an die wir uns schon am ersten Weihnachtsfeiertag nicht mehr erinnern konnten. Wir führten also das, was man gemeinhin als eine glückliche Ehe bezeichnet. Bis zu Udos 18. Geburtstag. Das war ein Sonntag.
Ich fragte ihn, ob er zur Feier des Tages auf den Weihnachtsmarkt wolle, und er schrie: «Natüüüürlich.» Also fuhren wir los. Auf einem Weihnachtsmarkt geht es laut und hektisch zu, es wird nicht viel Wert auf Etikette gelegt. Ich ging deshalb am liebsten mit Udo auf Rummelplätze und Weihnachtsmärkte.
Bereits seit ein paar Wochen beobachtete ich, dass mein Sohn ständig die Finger an seinem Geschlechtsteil hatte. Er knetete sein Ding, wenn wir im Auto saßen, er langte sich unverhohlen und mit sichtlicher Freude an den Sack, während wir fernsahen, und nun hielt Udo in der linken Hand eine Bratwurst, um sich mit der rechten im Schritt herumzufummeln. Sosehr ich ihm diese Vergnügungen auch gönnte, so unangenehm waren sie mir in der Öffentlichkeit, zumal sich Udo nicht die Mühe machte, diskret mit der Hand in der Hosentasche herumzufingern, sondern sich ungeniert und mit einem abwesenden Gesichtsausdruck von außen an die Hose griff. Auch wenn ich ihn um diesen natürlichen Umgang mit seinem Körper beneidete, nervte mich die Unverfrorenheit, mit der Udo in aller Öffentlichkeit seine Hose rieb.
«He, lass das», sagte ich, während ich dem Mann an der Imbissbude Geld für die Bratwürste gab.
«Was ’n?»
«Lass deinen Schwanz doch mal für eine Minute los. Das ist ja nicht zu fassen.»
«Schuuans.»
«Wo hast du denn das gelernt? Könntest du dich für ein paar Minuten verhalten wie ein erwachsener Mann?»
«–»
«Mann Gottes, das muss doch nicht sein. Seit einer Stunde sind wir unterwegs, und seitdem fummelst du an dir herum.»
«Schuuuans.»
Udo nahm die Hände aus dem Schritt und schaute mich verwundert an. Ganz offensichtlich verstand er kein einziges Wort. Wie auch, niemand hatte ihn je aufgeklärt, und für ihn hatte sein Pimmel genau zwei angenehme Eigenschaften, auf die er nicht verzichten wollte. Was sollte daran schlecht sein?
«Warum?», fragte er also.
«Weil’s saublöd aussieht, darum», sagte ich und tunkte meine Wurst in billigen Senf. «Es sieht wirklich doof aus. Du solltest dich mal sehen, wenn du da herumfummelst.» Mir war schon klar, dass es meinem Sohn ziemlich egal war, wie er dabei aussah. Aber Udo schien darüber nachzudenken. Um seine Gedanken auf Trab zu bringen, fuhr er sich an den Schwanz und rieb ihn ein bisschen.
«Verdammt, du tust es ja schon wieder. Habe ich dich nicht vor einer Minute gebeten, damit aufzuhören?»
«Ja.»
«Und warum machst du dann trotzdem weiter?»
«Weiß nicht.»
«Was weißt du eigentlich?»
Das war gemein. Manchmal sagte ich solche Sachen zu ihm. Ich konnte weder mit Udos Angewohnheit umgehen, wildfremde Leute nach ihren Namen zu fragen, noch mit seiner Marotte, Essen umgehend auszuspucken, wenn es ihm nicht schmeckte. Das machte mich wütend. Dann wünschte ich, es gäbe keinen Udo in meinem Leben. Und keine Spezialkliniken und keine Badewannen mit Hebekran. Ich empfand nicht mich selbst, sondern die Welt als ungerecht.
Natürlich war ich mir der Schlechtigkeit dieser Gedanken bewusst, ich fühlte mich auch ständig schuldig an meinem einzigen Kind, doch dies machte es mir nur noch schwerer, Udo zu lieben. Seine bloße Existenz empfand ich als Anklage. Und jetzt war ich kurz davor, ihm eine zu scheuern. Ich tat es natürlich nicht, stand nur da, wischte mir den Senf vom Mund und betrachtete meinen Sohn. Er sah mir überhaupt nicht ähnlich, höchstens die dünnen Haare erinnerten an mich.
«Schuuuans.»
Es begann zu regnen, und ich wollte nach Hause. Ich hätte ihm sagen können, dass ich noch arbeiten musste. Ich hätte ihm vorschwindeln können, eine Erkältung zu bekommen, ich hätte ihm die dreisteste Lüge auftischen können, um meine Ruhe zu haben. Udo hätte mir alles geglaubt. Aber ich traute mich nicht, so schnell wieder zu Hause aufzutauchen. Ich wollte mich ganz einfach nicht Arianes anklagenden und wissenden Blicken aussetzen.
Während wir über den funkelnden Weihnachtsmarkt spazierten, den Glühweinduft einatmeten und Erzgebirgsschnitzereien passierten, steigerte Udo die Körpertemperatur in seiner Hose mittels mechanischer Reibung. Neben ihm ging ich, der unglückliche Clown mit der roten Nase. Ich kam mir an diesem Nachmittag lächerlich und schlecht vor. Und im Augenblick des größten Schmerzes über mich und meinen fröhlichen Sohn kam mir diese im Rückblick vollkommen bescheuerte Idee. Ich würde alles darum geben, hätte ich damals einfach die Klappe gehalten. Doch ich blieb stehen, hielt Udo an beiden Schultern fest und sagte:
«Weißt du, was man mit dem Ding zwischen deinen Beinen anfängt?»
«Pinkeln und so», antwortete Udo mit einem todernsten und ehrlichen Ausdruck in seinem runden Gesicht.
«Ja, ja, und was noch?»
«–»
«Man macht Frauen damit glücklich», sagte ich, der es eigentlich besser hätte wissen müssen.
«Frauen glücklich», wiederholte Udo tonlos.
«Möchtest du glücklich sein?», fragte ich.
«Mhhm, ja», antwortete Udo, dessen Glück vor allem darin bestand, heiße Apfeltaschen zu essen. «Ich will eine Apfeltasche», sagte er deshalb.
«Nein, ich meine nicht Apfeltaschen, ich meine etwas wirklich Heißes. Willst du mit einer Frau zusammen sein?»
«Nö.»
«Weißt du, was das bedeutet?»
«Nö.»
«Willst du es kennenlernen?»
«Dauert das lang?»
«Das hängt ganz von dir ab», witzelte ich. Ich fand Gefallen an meiner Idee.
«Vorher will ich eine Apfeltasche.»
Wenige Minuten später saßen wir im Auto und fuhren durch die Stadt. Es roch nach klebrig-süßer Apfeltasche. Ich war fest entschlossen, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Vielleicht war es eine Art unbewusste Rache an Udo, der mich, ohne es jemals zu wollen, seit 18 Jahren demütigte, der mir den letzten Nerv raubte und mir die Chance genommen hatte, ein ganz normaler Vater zu sein. Vielleicht wollte ich mich für die entgangenen Vatergefühle rächen. Vielleicht wollte ich bloß einmal sein, was ich ihm nie war: ein Berater in allen Lebenslagen, der große Zauberer, der seinen Sohn in die Kunst der körperlichen Liebe einweihte. Oder es war eine Art Forschergeist, der mich antrieb. Letzteres wäre am schlimmsten, das weiß ich. Es wäre widerwärtig.
Würde ich ihn demütigen? Oder ihm ein Stück Männlichkeit vermitteln? Würde Udo am Ende erschöpft und dankbar vor mir liegen und sagen: «Danke, Vater»? Diese Fragen geisterten mir durch den Kopf, als ich in Richtung des Industriegebietes fuhr, wo die Bordelle in einer langen bunten Reihe dicht an der Straße standen und mit Neonherzen den Autos entgegenleuchteten.
Eine erfahrene Prostituierte sollte Udo zeigen, wie das Wohlgefühl, das er beim Onanieren hatte, noch gesteigert werden konnte; was es tatsächlich bedeutete, ein Mann zu sein. Ich selbst würde im Hintergrund, aber dabei sein. So weit mein Plan.
«Schuuans, Schuuuaans», sang Udo und klopfte sich vor Vergnügen auf die Schenkel, als ich das Auto auf den Parkplatz eines besonders großen Puffs lenkte. Hier sollte Udo seine Unschuld verlieren – und ich meine Schuld. Hier würde ich zum ersten Mal wirklich Vater sein.
Das Bordell sah von außen aus wie ein Baumarkt mit zugeklebten Fenstern. Im Inneren war es so dunkel, dass ich einige Zeit brauchte, um mich zu orientieren. Ich kannte den Laden, war vor einigen Jahren schon einmal mit Bauherren hier gewesen, Richtfest feiern. In der Mitte des Raumes stand ein Springbrunnen, über dem ein marmornes Pärchen Wasser abgab. Die männliche Figur pinkelte der weiblichen in den Mund, die entließ einen plätschernden Wasserstrahl aus ihrer Scham in ein kleines Becken mit Goldfischen. Noch ehe ich mich an die Bar gesetzt hatte, begann Udo nach den Fischen zu angeln.
«Hallo, mein Freund, was darf ich dir bringen?», gurrte eine mittelalte Frau hinter dem Tresen.
«Ein Bier bitte und für meinen Sohn eine Cola. Udo, komm her, Cola trinken.»
«Cola», wiederholte Udo und trottete an die Bar, wo er sich umständlich und plump auf einen Hocker setzte.
«Ich darf keine Cola. Nur Fanta, hat Mama gesagt.»
«Wen haben wir denn da?», kam es aus dem Halbdunkel.
Ich erkannte mühsam die Konturen einer Frau, die kaum einen Meter neben Udo saß. Einen Hocker weiter machte ich eine weitere Dame aus, nicht unhübsch.
«Ich bin der Gerd», log ich. Ab diesem Augenblick bereute ich, hergefahren zu sein.
«Der Gerd. Ich bin die Sonja. Hast du ein bisschen Lust mitgebracht, Gerd?»
«Ich habe meinen Sohn mitgebracht, der hat heute seinen 18. Geburtstag», sagte ich. «Udo, sag mal guten Tag.»
«Guten Tag.»
«Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Na, Udo, möchtest du mich ein bisschen kennenlernen?», gurrte die Frau.
«Nö.»
Mir wurde heiß. Was für eine schwachsinnige Idee, mit Udo in einen Puff zu fahren, wie blödsinnig! Die Kollegin hinter der Bar stellte ein Pils und eine Limonade auf den Tresen und beugte sich vor, um Udo besser sehen zu können.
«Was ist ’n das für ’n Vogel?», fragte sie und sah mich an, wie man ein frisches Melanom ansieht. Ich fühle mich sonst in der Gegenwart von Frauen nicht schlecht, aber diese Damen machten mir Angst.
Ich sagte: «Das ist mein Sohn Udo.»
«Was will ’n der hier? Das is’ ’n Mongo, oder?»
«Er hat das Downsyndrom», gab ich in schärferem Ton zurück.
Die Frau neben Udo verlor schlagartig das Interesse und drehte uns den Rücken zu.
«Wissen Sie, es ist ganz schön schwer für meinen Sohn, eine nette Freundin zu finden. Und ich finde, er hat ein Recht darauf. Jedenfalls ist er gerade achtzehn geworden, und ich wollte, ich würde, ich meine …»
«… am besten, du trinkst aus und nimmst ihn wieder mit. Das läuft nicht.»
Na klar. Ich hatte mir die Sache anders vorgestellt, natürlich. Etwas wie mutloser Stolz erwachte in mir. Ganz sicher hatte ich nicht vor, meinen Sohn diesen Frauen wie Sauerbier anzupreisen. Mir war elend. Schweigend trank ich mein Bier, Udo saugte die Fanta zügig durch den Strohhalm, rülpste und ging zurück an den Springbrunnen. Als ich ihm zusah, wie er nach den Goldfischen angelte, riss etwas in mir. Ich kann es schwer beschreiben, ich fühlte mich wie der einsamste und dümmste Mensch der Welt. Dann begann ich zu weinen. Es war mir egal, dass die Frauen das sahen. Ich bin sicher, die haben viele Männer weinen sehen. Udo verstand das ganze Ausmaß dieser Demütigung nicht einmal. Er angelte nach Goldfischen.
«Okay.»
Ich drehte mich um.
«Okay, von mir aus, aber mit Extrazulage.»
«Was meinen Sie?»
«Ich bin halt ’n Familienmensch. Aber nich’ bumsen. Ich bums nich’ mit ’nem Behinderten, da komm ich nich’ gut drauf. Aber Blasen wäre in Ordnung.»
«Das würden Sie tun?» Mir war klar, dass ich nach meiner Heulerei keinen Rückzieher mehr machen konnte, auch wenn es eindeutig das Beste gewesen wäre.
«Und was ist mit dir, was können wir für dich tun?»
«Ich weiß nicht, vielleicht dasselbe?», sagte ich. Was hätte ich auch sonst sagen sollen?
«Möchtest du mit Tammy gehen?», fragte Sonja und deutete auf ihre Nachbarin. «Vater und Sohn und Tammy und Sonja, wie wäre das?»
«Ja, aber in einem Zimmer, bitte. Ich möchte ihn nicht mit Ihnen alleine lassen. Das wäre nicht gut, er kennt Sie ja gar nicht.»
Sonja sah zu Tammy hinüber, die kurz nickte.
«Okay. Wollt ihr vorher noch etwas trinken? Wollen wir nicht zur Feier des Tages einen kleinen Champagner ploppen lassen?»
«Nein, lieber nicht. Udo trinkt ja sowieso keinen Alkohol. Können wir gleich?»
Die Bardame räumte die Gläser ab. Mit uns war kein Geschäft zu machen. Wie kleinmütig, wie geizig von mir. Ich spürte einen heftigen Selbstekel. Sonja und Tammy taten der Barfrau wahrscheinlich jetzt schon leid.
«Na dann mal los, Gerd.»
Tammy und Sonja standen auf und gingen in Richtung einer Treppe. Wir liefen hinterher, dabei sah ich Sonja auf ihren gewaltigen Arsch. Ich hatte mit der brünetten Tammy eindeutig das bessere Los gezogen, aber so richtig freuen konnte ich mich darüber nicht, dafür war ich auch viel zu aufgeregt. Himmels willen, was für eine dämliche Idee.
«Ich find’s hier blöd», schnarrte Udo aus dem Hintergrund. «Blöde, blöde, blöhöde.»
«Reiß dich ein bisschen zusammen, okay?», zischte ich. «Es wird dir schon gefallen, glaub mir. Sonja ist eine nette Frau.»
«Mama ist nett.»
«Sonja ist genauso nett.»
Dann betraten wir ein Zimmer mit einem Bett, einer runden Badewanne und matter Beleuchtung. Neben dem Bett stand eine Packung Kleenex, in einer Ecke hing ein Waschbecken. An den Wänden hing grauenvolle erotische Kunst in Wechselrahmen. Leise Schlagermusik drang aus einem kleinen CD-Player.
Ich setzte mich auf das riesige Bett und zog Udo am Ärmel. «Setz dich hin, Udo.»
Udo setzte sich und sah Sonja an, die ihm freundlich entgegenlächelte. «Na, Casanova, alles klar mit dir?»
Udo nickte und quetschte sein Ding zwischen Daumen und Zeigefinger.
«Du kannst es wohl gar nicht abwarten, was?»
«Das macht er immer», sagte ich.
«Na, dann wollen wir unseren Udo doch nicht mehr länger auf die Folter spannen.»
Als Sonja Udo an der Schulter berührte, um ihn auf den Rücken zu kippen, griff Udo ihren Arm und hielt ihn fest. Er wollte nicht von dieser Frau berührt werden, er hatte Angst, er verstand nicht, was sich hier abspielte. Und er wollte zurück zu den Fischen.
«Udo, lass die Sonja ruhig machen. Sie ist eine gute Freundin, sie wird dir nicht wehtun. Es ist alles in Ordnung, ehrlich», versicherte ich und lächelte blöde. Normalerweise sagte ich solche Sätze, wenn wir mit Udo beim Arzt waren. Auf eine skurrile Art und Weise war Sonja auch so etwas wie eine Ärztin. Oder wenigstens Krankenschwester.
«Am besten wird sein, wir fangen mit dir an, dann kommt dein Sohn schon in Stimmung.»
«Gute Idee», log ich und legte mich auf den Rücken. Tammy strich sich die Haare aus dem Gesicht und öffnete meine Hose. Udo sah sich das Ganze mit größtem Interesse an. Zum Vorschein kam allerdings nichts besonders Aufregendes. Ich war verspannt, das wird sicher jeder verstehen. Die Situation war meiner Libido nicht förderlich. Ich lag hier mit zwei Huren und meinem behinderten Sohn auf einem Doppelbett im Gewerbegebiet; kein Wunder, dass ich keinen hochbekam. Tammy war im Grunde sehr nett und unter normalen Umständen hätte ich mit ihr kein Problem gehabt, aber heute, hier und jetzt in diesem Raum: Da lief nichts.
«Macht nichts, macht nichts», flüsterte Tammy, «ein bisschen Ladehemmung, das bekomm ich schon hin.»
Sonja machte sich inzwischen an Udo zu schaffen. Er legte sich widerspruchslos neben mich. Kopf neben Kopf lagen wir auf dem roten runden Bett, über uns zwei fremde Frauen und ein Fickspiegel an der Decke, in dem ich in mein dämliches Gesicht sah. Sonja öffnete Udos Hose.
Es kam mir vor, als würde ich immer kleiner. Ich schrumpfte neben meinem Sohn und das kleine Etwas, das Tammy immer noch in der Hand hielt, schrumpfte ebenfalls. Es war der schlimmste Tag in meinem Leben. Und er war noch lange nicht vorbei. Als Sonja versuchte, Udos Ding in ihren Mund zu bugsieren, kam er bereits und ergoss sich auf seine Hose.
Tammy putzte Udo ab. Ich zahlte Sonja wortlos zweihundert Mark.
Auf der Heimfahrt schwiegen wir. Udo wiegte den Kopf zum Geräusch des fahrenden Wagens. Ich versuchte Klarheit in meine Gedanken zu bekommen. Wer war am Ende gedemütigt worden? Ich oder er? Wer hatte wem gezeigt, was es bedeutet zu leben? Und vor allem: War ich jetzt ein besserer Vater mit einem besseren Sohn als vorher? Oder war ich ein Scheißtyp? Wahrscheinlich Letzteres. Diese Fragen waren nichts im Vergleich zu denen, die Ariane unweigerlich stellen würde. Wieso ist Udo völlig verdreckt? Ist das etwa Sperma? Was hast du mit Udo gemacht, du Dreckskerl?
Da kam mir die nächste dumme Idee. Ich muss schon sagen, dass eine die nächste nach sich zog.
«Udo, hör mir mal zu», sagte ich. «Wir sagen, das ist Zitroneneis. Wir haben mit Zitroneneis gekleckert. Wir haben eine Zitroneneisschlacht gemacht. Okay?»
«Ich will Zitroneneis.»
«Hast du kapiert? Das Zeug auf deinen Sachen ist Zitroneneis.»
«Kaufst du Zitroneneis?»
«Wo soll ich denn jetzt Zitroneneis hernehmen, Himmelherrgott? Wir fahren jetzt zur Mama und sagen, du hast gekleckert.»
«–»
«Also gut. Du kriegst dein Eis, du kriegst dein verdammtes Eis.»
Ich fuhr zu einer Tankstelle und kaufte zweimal Zitroneneis. Eins gab ich Udo, das andere erwärmte ich im Luftstrahl der Autoheizung.
«Was machst du?»
«Schadensbegrenzung.»
Als hätte ich mich nicht schon lächerlich genug gemacht, riss ich das Eispapier auf und schmierte das aufgeweichte Eis auf Udos Hose.
«Uuuii, du kleckerst», lachte Udo.
Im Grunde wusste ich, dass das Eis die ganze Sache nur noch schlimmer machen würde. Ariane würde niemals auf den Quatsch hereinfallen. Meine einzige Hoffnung bestand darin, dass sie vergessen hatte, was Sperma war.
Als ich den Wagen parkte, fühlte ich mich, als würde ich zum Galgen geführt. Das war also der traurige Höhepunkt meiner armseligen Vaterschaft. Verklebt mit Zitroneneis und Sperma, gab ich meinen Sohn zurück in die Obhut der besten und verständnisvollsten Frau, der ich jemals begegnet bin.
Ariane saß in der Küche, sah uns an und fragte: «Was ist denn mit euch los? Udo, was ist das für eine Sauerei auf deiner Hose?»
«Ich habe gekleckert. Mi’m Eisschuans.»
«Womit?»
«Tammy hat’s rausgeholt und Papa hat mir Eis gekauft.»
«Wer ist Tammy?»
«Die Freundin von Sonja.»
«Ach ja. Und wer ist Sonja?»
«Papa hat gesagt, Sonja ist genauso gut wie du.»
Ariane sah mich an und fragte mich, wer Sonja sei. Nachdem ich ihr geantwortet hatte, stellte sie drei oder vier weitere Fragen, auf die ich mit Lügen antwortete. Sie fragte weiter, sie fragte Udo und dann wieder mich. Ich kann mich an diese Konversation nicht mehr richtig erinnern, ich habe sie wie einen schlechten Traum in Erinnerung, surreal und quälend. Aber ich weiß noch, dass Ariane in mein Büro ging, alles verwüstete und mich in einer Tour anschrie. Ich trank eine halbe Flasche Cognac, Udo spielte mit der Katze. Dann war unsere Ehe nach 18 Jahren beendet. Ich bin am nächsten Morgen ausgezogen.
Ariane leistete ganze Arbeit. Sie zog die Scheidung ebenso sauber und kühl durch wie meinen Ruin. Als Erstes sagte mir ein katholisches Therapiezentrum ab. Man habe einen Formfehler bei der Ausschreibung gemacht. Dann platzte der Auftrag für eine Badeanstalt, und danach kamen keine Ausschreibungen mehr. Ich entließ immer mehr Mitarbeiter, und nach einem Jahr beantragte ich die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Ein paar Monate später war ich mein Zuhause, meine Firma, mein Büro und mein Einkommen los. Dass Ariane hinter alldem steckte, war mir klar. Sie machte gar keinen Hehl daraus und brachte sich damit um den Unterhalt, den ich nicht mehr aufbringen konnte, aber das war ihr egal. Ihre Rache an mir war so absolut wie die Liebe zu ihrem Sohn. Ich denke, sie hat mich nicht einmal mehr gehasst, sondern einfach wie eine Kellerassel zertreten.
Freunde und Kollegen wandten sich von mir ab. Niemand wollte mehr Kontakt mit mir. Also zog ich mich in eine Einzimmerwohnung zurück, beantragte Sozialhilfe und glotzte aus dem Fenster. Manchmal trug ich Prospekte aus oder schob die Einkaufswagen eines Supermarktes zusammen, meistens ging ich spazieren, saß auf einer Bank und trank.
Sieben Jahre vergingen auf diese ereignislose Weise, und ich kann über diese Zeit nichts berichten, weil ich mich nicht daran erinnere. Es kommt mir manchmal rückblickend so vor, als habe mein Leben nach Udos 18. Geburtstag nur Minuten gedauert. Dann wieder fühlt es sich an wie ein ganzes Erdzeitalter, in dem ich verlernt habe, ein Mensch zu sein. Ich sah nicht mehr in den Spiegel, putzte meine Zähne, wenn überhaupt, mit geschlossenen Augen, rasierte mich, ohne hinzusehen. Ich trank ohne Leidenschaft für den Rausch, nicht einmal ein guter Alkoholiker war ich. Ob ich tatsächlich acht Jahre gelebt oder bloß geatmet habe, kann ich nicht beantworten. Ich hätte in dieser Zeit nicht einmal den Unterschied gewusst.
Es verging mehr als ein halbes Jahrzehnt meines Lebens, ohne dass ich daran teilnahm. Ich hätte mich auch wehren, Prozesse führen, umschulen können, das ist wahr. Aber ich erstarrte regelrecht. Die Katastrophe meines Abstiegs führte zu etwas, was Ärzte vielleicht Katatonie nennen würden. Ich habe nie mit einem Arzt darüber gesprochen, ich habe überhaupt mit niemandem gesprochen, außer mit Udo.
Udo wäre jetzt 29 Jahre alt und ganz sicher noch am Leben, wenn ich ihm nicht den Quatsch mit den Engeln und den Wolken erzählt hätte.
Bei unserer letzten Begegnung fragte er mich nach dem Himmel. Wir saßen auf meiner Bank und aßen Profiterols, sein Leibgericht. Da fragte er: «Papa, warum fallen die Engel nicht runter?»
«Was meinst du damit?», fragte ich zurück.
«Die wohn’ doch in’n Wolken, oder?»
«Ja, natürlich. Die Engel wohnen streng genommen sogar auf den Wolken. Von dort aus schauen sie zu uns hinunter.»
«Könn’ die da runterfallen?»
Das war eine ganz typische Udo-Frage. Ich gab mir Mühe, sie richtig zu beantworten.
«Nein, sie haben Flügel. Wenn sie überhaupt fallen, dann fangen sie sich mit einem Flügelschlag. Sie können zwar nicht besonders gut fliegen, aber sie fallen auf jeden Fall nicht hinunter.»
Das hätte ja gereicht, aber ich hatte Lust zu fabulieren und fügte hinzu: «Und selbst wenn sie keine Flügel hätten, könnten sie nicht auf die Erde fallen, denn die Wolken sind wie Trampoline. Man kann auf ihnen herumhopsen, und das machen die Engel auch den ganzen Tag. Wenn einer von ihnen dabei von der Wolke kippt, ist darunter immer eine weitere Wolke, die ihn auffängt. Es macht ihnen gar nichts aus.»
«Aha.»
«Ja. Die Erde ist umgeben von einer Wolkenschicht, und da können die Engel nicht durch. Sie sind also ganz sicher da oben auf den Wolken.»
«Ach so.»
Das Thema schien ihn zu beschäftigen, denn er blieb sehr schweigsam. Drei Wochen später war er tot. Er sprang vom Dach eines 80 Meter hohen Bürohauses. Ariane überbrachte mir die Nachricht von Udos Tod. Es war das erste Mal, dass sie seit unserer Trennung mit mir sprach. Sie sagte, er sei aus seiner Gruppe abgehauen und dann mit der U-Bahn gefahren. Wie er auf das Dach des Hauses gekommen sei, wisse niemand, aber er habe sich von dort hinuntergestürzt. Sie weinte.
«Er hat sich nicht hinuntergestürzt», sagte ich.
«Doch, hat er», sagte Ariane. «Unser Kind ist tot.»
«Ja, aber er ist nicht runtergesprungen, sondern rauf.»
«Was meinst du damit?»
«Er wollte nicht auf die Erde fallen, sondern auf eine Wolke springen. Er hatte einen Plan.»
Ariane sah mich aus ihren kajalverschmierten Augen an. Dann schlug sie mir ins Gesicht und ging.
Es heißt, jede glückliche Familie sei auf dieselbe Art glücklich, jede unglückliche auf eine ganz eigene. Das stimmt. Meiner Familie lag der Selbstmord im Blut. Wobei ich bis heute der festen Überzeugung bin, dass Udo sich nicht hat umbringen wollen. Ganz im Gegensatz zu meinem Großvater. Er hat sich im Mai 1945 in seinem Büro mit seiner Dienstwaffe, einer Walther PPK, Kaliber 7,65 Millimeter, erschossen. Er war wohl enttäuscht über den verlorenen Krieg und hatte Angst vor den Amerikanern, denn er war Brigadeführer in der Waffen-SS. Die noch blutverschmierte Pistole gaben sie meinem Vater, der damals 15 Jahre alt und beim Volkssturm war. Er hat immer erzählt, er habe damit noch aus Rache auf einen amerikanischen Panzer geschossen. Danach lag das Ding jahrzehntelang in einem Karton in der Schublade seines Schreibtisches. Als ich nach dem Tod meines Vaters – er starb kurz nach meiner Mutter an Krebs – seine Wohnung auflöste, entdeckte ich die Pistole. Fast alle Gegenstände aus dem Besitz meiner Eltern habe ich verkauft, aber die Waffe behielt ich. Komisch. Als ob ich gewusst hätte, dass ich sie einmal brauchen würde.
Die Entscheidung fiel mit Udos Tod. Ich will jetzt nicht selbstmitleidig klingen, aber schließlich war ich schuld daran. An dem Mittwoch vor Udos Beisetzung erhielt ich einen Brief. Darin befand sich eine Karte für Bayreuth. Wagner-Festspiele. Vierzehn Jahre habe ich auf eine Karte gewartet. Und als ich sie endlich in Händen hielt, war mir klar, dass ich bei Wagner sterben wollte. Nennen Sie es ruhig pathetisch, vielleicht sogar lächerlich oder theatralisch, aber nach den elenden Jahren, die ich ausschließlich mit mir und meiner Schuld verbracht hatte, wollte ich beim Sterben unter Menschen sein. Anders kann ich mir diese Entscheidung nicht erklären. Einer der vom Gericht als Gutachter bestellten Psychologen bescheinigte mir eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Histrioniker sind Leute, die krankhaft im Mittelpunkt stehen wollen. Sie unternehmen die verrücktesten Sachen, um von ihrer Umgebung wahrgenommen zu werden. Auf mich trifft das nicht zu. Ich habe acht Jahre wie eine Kakerlake gelebt. Und diese Tiere sind sicher einiges, aber nicht histrionisch. Ich verspürte keineswegs den Wunsch, durch meinen Tod etwas mitzuteilen, ich wollte bloß, dass man zur Kenntnis nahm, dass es mich überhaupt gegeben hatte. Von mir aus nennen Sie es eine pathologische Form der Hysterie, mir egal.
Vorher übte ich schießen. Es war noch Munition da, aber woher sollte ich wissen, dass sie nach der langen Zeit in Vaters Schublade zündete? Ich konnte mir kaum etwas Dämlicheres vorstellen, als mit der SS-Brigadeführerwaffe am Kopf im Festspielhaus von Bayreuth zu stehen, abzudrücken und mich dann vor den ganzen Veteranen im Publikum zu blamieren. Also fuhr ich mit dem Bus zu einem Wald, lief stundenlang darin herum und schoss erfolglos auf ein Eichhörnchen und dann mit mehr Fortune auf eine Rotbuche. Ich hätte gleich dort Schluss machen sollen, aber ich konnte es nicht. Mitten im Konzert, so dachte ich, vor Hunderten von Menschen, würde der Erwartungsdruck so groß, dass ich nicht würde kneifen können.
Am Tag meines geplanten Todes kochte ich mir morgens einen Kaffee und setzte dann meinen Abschiedsbrief auf. Ich wusste aber gar nicht, was ich schreiben sollte, denn ich hatte niemandem etwas mitzuteilen. Ich stellte mir vor, der Hausmeister würde, nachdem er von meinem Tod erfahren hatte, die Tür aufbrechen und den Brief auf dem Küchentisch finden. Also schrieb ich: «Lieber Herr Jakulczek, alles, was Sie in dieser Wohnung finden, gehört Ihnen. Alles Gute B. S.» Das war nicht viel, und ich nehme nicht an, dass er sein Erbe angetreten hat, denn ich bin ja nicht gestorben. Aber ich weiß es nicht, denn ich habe seit jenem Tag meine Wohnung nicht mehr betreten.
Für die Oper machte ich mich so schick wie möglich, denn erstens gehört sich das so, und zweitens wollte ich auf keinen Fall auffallen und riskieren, dass man mich an der Tür abwies. Natürlich rasierte ich mich und zog meinen alten Smoking an. Stand mir gut, das Ding. Die Nachbarn staunten nicht schlecht, als sie mich in diesem Aufzug das Haus verlassen sahen. Meinen Wohnungsschlüssel warf ich in den Müllcontainer vor dem Haus. Ich fuhr mit dem Zug nach Bayreuth und lief vom Bahnhof zum Festspielhaus.
Der zweite August war ein heißer Tag. Man trank Mineralwasser auf dem Hügel und fächelte sich mit dem Programm eine kühlende Brise ins Gesicht. Ich widerstand alldem. In meiner Tasche die geladene Pistole, betrat ich das Festspielhaus. Ich habe es immer schon geliebt, schon als Architekturstudent.
Richard Wagner hat das Haus selber geplant und legte Wert darauf, dass man weder Details der Bühnentechnik noch die Musiker vom Zuschauerraum aus sehen kann. Das Theater sollte ein großes wunderbares Geheimnis sein.
Meinen Platz fand ich in der neunten Reihe. Ein wenig links von der Bühne. Ich setzte mich zwischen zwei Damen in Abendkleidern, die mich desinteressiert zur Kenntnis nahmen, und dann begann die Götterdämmerung.
Als Hagen seinen Speer in Siegfrieds Rücken bohrte, zog ich die Walther aus der Tasche und befühlte sie. Ich streckte mich und hielt die Waffe an meine rechte Schläfe, spürte die kreisrunde Mündung kühl auf meiner Haut. Das tat gut. Ich weiß noch, dass ich den Wunsch hatte, die kalte Waffe an meine Wange zu legen. Hinter mir schnauzte ein alter Knacker: «He, runter mit dem Arm.» Ich verdeckte ihm wohl die Sicht. Natürlich hätte ich sofort schießen sollen, aber ich konnte nicht, ich musste noch einatmen und ausatmen, die Augen schließen. Ich brauchte Zeit für meine Tat. Aber der Bursche hinter mir ließ mich nicht in Ruhe. Die Musik spielte. Der Alte raunzte: «Sie da vorne, Unverschämtheit.» Ich störte ihn, er störte mich.
Im Affekt stand ich auf und drehte mich schnell zu ihm um, die Pistole in der Hand.
«Sofort hinsetzen, Sie Flegel», keifte der Kerl. Ich hob die Walther, was niemand sah, denn im Festspielhaus ist es ziemlich dunkel während der Vorstellung. Das wollte Wagner so, man soll sich vollkommen auf die Bühne konzentrieren. Die Musik spielte weiter, um mich herum Hunderte von Menschen in Abendgarderobe, dennoch war ich mit dem alten Mann allein. Ich setzte mir die Pistole an die Schläfe und schrie: «Halt endlich dein Maul!» Weder auf der Bühne noch im Orchester bemerkte mich irgendjemand. Die Akustik ist sozusagen einseitig gerichtet. Wenn ich mich auf der Bühne erschossen hätte, wäre mir höchste Aufmerksamkeit zuteilgeworden. So aber musste ich mich mit dem zeternden Idioten in der Reihe hinter mir abmühen, der mich nun anschrie, ich solle endlich wieder Platz nehmen. Erst dann sah er die Waffe und schrie: «Hilfe! Attentat!» Ich setzte mir die Pistole an die Schläfe, legte den Zeigefinger in den Abzug, schloss die Augen, atmete tief ein. Und dann verlor ich das Gleichgewicht. Ich hatte mich auf das Abendkleid der Frau zu meiner Rechten gestellt, und die zog nun daran, worauf ich das Gleichgewicht verlor.
Als sich der Schuss löste, war ich gerade im Begriff, der Frau zu meiner Linken in den Schoß zu fallen. Die Kugel fuhr in meinen Kopf hinein, am Hirn vorbei gleich wieder raus und sauste in das Dach des Zuschauerraumes, was mir im Nachhinein viel Scherereien brachte, da ich für den Schaden immer noch aufkommen muss. Ich fiel auf die Frau, hörte noch ihr Kreischen, und dann ging endlich die verdammte Musik aus.
Ich kann mich danach an nicht sehr viel erinnern. Das meiste weiß ich aus meiner Krankenakte und aus den Protokollen der Staatsanwaltschaft. Sicher ist, dass ich eine ganze Weile im Krankenhaus lag und dass sie allerhand neurologische Tests mit mir veranstalteten. Schließlich wurde ich an eine Landesklinik überstellt, in der ich mehrere Monate mit komplett Irren verbrachte. Ich sah aus wie einer von ihnen, denn jeder trug die Kleidung, die er am Tag seiner Einlieferung anhatte. Ich lief also viereinhalb Monate mit meinem Smoking durch die geschlossene Abteilung, futterte meine Pillen und schwieg ansonsten, weil ich das für die beste Strategie hielt. Gesprächs- und Therapieangebote lehnte ich ab. Auch kümmerte mich nicht, was in den Zeitungen stand. Von einem Selbstmordattentäter war die Rede, denn der Blödmann in der Reihe hinter mir entpuppte sich als hochrangiger Politiker und bezog in seiner Selbstgefälligkeit die ganze Aktion im dritten Akt der Götterdämmerung natürlich auf sich. Ich beherrschte die Schlagzeilen für knapp drei Tage, in denen meine halbe Lebensgeschichte der hungrigen Republik zum Fraß vorgeworfen wurde.
Anschließend wurde ich von der Staatsanwaltschaft, vom Bundeskriminalamt, von der Kriminalpolizei und von Psychologen und anderen Besserwissern vernommen. Mal nannte man mich einen Zyniker wegen des Abschiedsbriefes, mal einen Kriminellen und dann wieder einen Psychopathen. Nur am Anfang machte ich Versuche, denen zu erklären, dass ich nur ein Verzweifelter war am Ende seines Weges, aber es hat mir eigentlich nie jemand zugehört. Alle Terroristen seien am Ende Verzweifelte am Ende eines Weges, hat der Staatsanwalt mir geantwortet. Daraufhin habe ich die Gespräche mit Abgesandten irgendwelcher Institutionen und staatlichen Stellen schweigend absolviert. Wer weiß, vielleicht war das besser so. Ich nehme es fast an.
Eines Tages, das war an einem Sonntag, wurde ich wieder einmal in einen Gesprächsraum gebeten. Der Oberarzt bot mir an, mich in eine andere Anstalt verlegen zu lassen, und sprach von dem Sonderprojekt eines Kollegen. Dort könne meinem Fall gründlicher und ausdauernder auf den Grund gegangen werden. Ich könne die Verlegung natürlich ablehnen und auf der Station bleiben, allerdings sei unklar, wie es mit mir weiterginge. Es sei auch die Eröffnung eines Strafverfahrens denkbar und somit Gefängnis. Ich sei ein Fall mit vier losen Enden. Ich nickte.
Ich fragte ihn, was das für eine Anstalt sei, und er antwortete, es handele sich um eine Villa, mitten im Schwarzwald gelegen, sehr idyllisch und mit ausgezeichnetem Klima. Klang wie ein Kurhotel. Es würde außer mir nur vier weitere Patienten geben, mit vergleichbaren Befunden. Eine optimale Betreuung sei gewährleistet. Ich nickte wieder. Ob er das als zustimmende Geste verstehen könne, fragte er. Ich nickte.
Ein Pfleger half mir, meine Habseligkeiten in eine Einkaufstüte zu packen. Es war nicht viel: Personalausweis, leeres Portemonnaie, Zahnbürste, Shampoo, Rasierer, Rasierschaum, Smokingfliege, eine entwertete Eintrittskarte für die Götterdämmerung. Mehr besaß ich nicht mehr.
Ich setzte mich auf den Rücksitz des Wagens, von dem ich abgeholt wurde. Man machte sich die Mühe, mich zu fesseln. Wir fuhren Stunde um Stunde und erreichten das Haus Unruh am 7. Januar gegen 18 Uhr. Es war bereits dunkel, als wir eintrafen. Man öffnete die Tür des Wagenfonds und half mir beim Aussteigen. Der Kummerbund meines Smokings war ein wenig nach oben gerutscht. Ich dachte, das sieht jetzt wahrscheinlich blöd aus.
«Sehr elegant, der Herr», rief ein kahlköpfig aussehendes Männlein, das im beleuchteten Hauseingang stand. Es trug einen schmal geschnittenen grauen Anzug und ein weißes Hemd mit Krawatte.
«Sie aber auch», sagte ich.
«Mein Name ist Heiner Zens. Ich bin der Institutsleiter. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen.»
«Ganz meinerseits. Leider kann ich Ihnen nicht die Hand geben.»
Wir gingen hinein, und hinter mir schloss sich die Tür des Hauses Unruh ganz automatisch.
2. Das Reich des Wassertrinkers
Die erste Zeit im Haus Unruh empfand ich als sehr angenehm, als reinste Erholung. Ich erhielt ein Einzelzimmer, verfügte über viel mehr Freiheiten als zuvor, aber vor allem waren dort praktisch keine Bekloppten unterwegs. Genau genommen gab es für eine ganze Weile nur mich und die Pfleger. Nachdem mich der Doktor begrüßt und mir erklärt hatte, dass er sich für die nächsten zehn Tage in der Schweiz bei einem Kongress aufzuhalten gedenke und noch am Abend abreisen müsse, eigentlich nur gewartet habe, um mich persönlich in Empfang zu nehmen, bat er mich ins Kaminzimmer, wo er sich in einen massiven Ledersessel fallen ließ. Ich setzte mich ihm gegenüber. Sein Anzug und mein Smoking passten gut hierher, die Szene strahlte eine gewisse Eleganz aus. Holzscheite verbrannten knackend und warfen ein flackerndes Licht auf den Arzt, der mich freundlich anlächelte, wie um mich zu beruhigen. Dabei war ich nicht aufgeregt, nur neugierig.
Heiner Zens besaß ein altersloses Gesicht. Er konnte ebenso gut Ende dreißig sein wie Anfang fünfzig. Er war nicht groß und nicht schwer und der Typ Mann, den man sich nicht in kurzen Hosen vorstellen konnte. Er wirkte, als sei er in diesem tadellos sitzenden grauen Anzug auf die Welt gekommen. Die sehr modische Brille auf seiner Nase nahm er immer wieder ab, um sie in seine Brusttasche zu stecken und nach ein paar Minuten wieder hervorzuholen, was ich als Indiz dafür wertete, dass er eher älter als jünger war, denn das Brillengefummel deutete auf Weitsichtigkeit hin. Kurzsichtige Menschen behalten ihre Brille in der Regel auf. Der Haarkranz auf seinem Kopf war kurz rasiert und von unbestimmbarer Farbe. Wegen seiner hellen Augenbrauen nahm ich an, er sei blond. Seine Haut war beinahe weiß – er schien mir ein sonnenempfindlicher Typ zu sein – und wies nicht eine einzige Unebenheit auf, keine Unreinheit, kein Muttermal, keine Sommersprossen, keinen Bartwuchs. Dies machte ihn wiederum jünger, als sein Brillentick es hätte vermuten lassen. Seine Stimme ließ ebenfalls keine Rückschlüsse auf sein Alter zu. Sie war ruhig und angenehm, klang nach Bildung, auch nach Überlegenheit. Alles in allem war Heiner Zens eine ebenso interessante wie undurchsichtige Erscheinung.
Er musterte mich mit der gleichen freundlichen Neugier, mit der ich ihn ansah. Dann sagte er: «Sie waren Architekt, richtig?»
«Richtig, ja.»
«Ein interessanter Beruf. Sie müssen mir beizeiten mal davon erzählen.»
Ich fasste das als Versuch auf, mein Vertrauen zu gewinnen. Dann plauderte er über das Haus, in dem wir uns befanden. Ich erfuhr, dass es nach seinem ersten Besitzer, einem Industriellen aus Wiesbaden, benannt worden war, der es 1918 hatte bauen lassen. Wilhelm Unruh sei Apotheker und Tablettenhersteller gewesen. Er habe alle möglichen Medikamente zusammengemischt und als Versuchsperson seiner Rezepturen eine ordentliche Drogenkarriere hingelegt, bevor er reich und glücklich in den fünfziger Jahren kinderlos starb. Das Haus habe zunächst lange leer gestanden und dann als Schulungszentrum des pharmazeutischen Konzerns, der Unruhs Firma aufgekauft hatte, gedient. Vor einem guten halben Jahr habe Doktor Zens es erworben, renoviert und für seine Zwecke hergerichtet.
«Wollen Sie Ihr neues Zuhause sehen?», fragte er und erhob sich. Dann zeigte er mir sichtlich stolz die Villa. Im Erdgeschoss lagen außer dem Kaminzimmer eine Bibliothek, ein großzügiger Wohnraum mit einem an einer Kette baumelnden Boxsack. Daneben befand sich das Speisezimmer. Ich zählte sechs Plätze an der Tafel. Es stand auch ein Getränkeautomat in dem Raum, welcher in allen acht Schächten Wasser enthielt. Wasser mit und ohne und mit wenig Kohlensäure, natriumarm, warm und kalt und mittelkalt und mit einem Hauch von Zitronenaroma. Man müsse für jede Flasche ein Markstück einwerfen, erläuterte Zens. Ich habe während meines Aufenthaltes Hunderte von Flaschen aus diesem Automaten geholt. Nie war ein Schacht leer. Das Haus Unruh verfügte über eine große Küche, in der ein Koch ständig arbeitete. Man hörte dauernd Geräusche, doch gesehen habe ich nie jemanden.
Innerhalb des Hauses durften ich und meine späteren Mitpatienten uns weitgehend frei bewegen. Fenster und Türen indes waren stets abgeschlossen, die Fenster zusätzlich vergittert. Natürlich gingen wir mal in den Park, doch dieser besaß eine unüberwindbare Mauer. Außerdem durften wir das Gebäude nur in Begleitung eines Pflegers verlassen. Die Türen unserer Zimmer blieben immer offen. Nur zur Nachtruhe schlossen sie automatisch und ließen sich dann nicht mehr von innen öffnen.
Auf der rechten Seite entlang eines mit Teppich ausgelegten Flures in der ersten Etage lagen die Patientenzimmer. Zens nannte sie «Gasträume». Gegenüber befanden sich ein großes Besprechungszimmer sowie zwei durch Türen miteinander verbundene Behandlungsräume. Im Flur stand ein Wasserautomat wie im Esszimmer.
Alles in allem machte das Haus Unruh einen sehr sauberen Eindruck. Obwohl es sich um eine Jugendstilvilla handelte, wirkte das Gebäude sehr modern und klinisch. Ganz offensichtlich war es gerade erst renoviert und eingerichtet worden. Es roch nach Farbe, unter einem der Sessel sah ich Transportfolie. Sie haben sie nicht vollständig abgerissen, als sie den Sessel im Kaminzimmer abgestellt haben. Ich habe so viele Gebäude abgenommen, ich kann frische Bohrlöcher förmlich riechen. Für mich stand fest, dass ich der erste Patient dieser Einrichtung war. Ich kann nicht behaupten, dass mir der Gedanke gefiel.
Nach der Hausführung verabschiedete sich Doktor Zens. Er sagte: «Ich finde, Sie passen ausgezeichnet hierher. Wir werden bald Gelegenheit haben, uns besser kennenzulernen.»
«Was mache ich eigentlich hier?»
«Gute Frage. Die stelle ich mir manchmal auch. Oft denke ich, dass ich selber Patient bin. Der Unterschied ist nur: Die Patienten gehen eines Tages wieder, aber ich bleibe lebenslänglich.» Zens lachte.
«Sie haben meine Frage nicht beantwortet.»
«Das geht auch nicht zwischen Tür und Angel. Wir werden uns darüber unterhalten, wenn ich wieder zurück bin. Richten Sie sich ein, akklimatisieren Sie sich. Lesen Sie ein Buch. Und Sie bekommen natürlich etwas zum Anziehen. Möchten Sie Ihre Medikamente nehmen oder nicht?»
«Habe ich denn eine Wahl?»
«Ja, natürlich. Sie müssen die Tabletten nicht nehmen, wenn Sie nicht wollen. Ich betrachte Sie nicht als krank. Und ich brauche Sie bei wachem Verstand. Mir wäre lieber, Sie würden nichts nehmen, es sei denn, es ist Ihnen danach.»
«Ich habe Kopfschmerzen.»
«Ja, sicher. Entscheiden Sie selber.»
Er gab mir die Hand und ging.
Ein Pfleger brachte mich in die erste Etage in ein komfortables Zimmer mit einem kleinen Bad. Zwar ließ sich das Fenster nicht öffnen, und die Sicht war auch hier durch Gitterstäbe eingeschränkt, aber der Raum passabel eingerichtet. Es hätten nur noch ein Fernseher und eine Minibar gefehlt, und man hätte sich in einem Viersternehotel geglaubt.
Natürlich entdeckte ich sofort die Überwachungskamera. Sie hatten sich auch überhaupt nicht die Mühe gemacht, sie zu verstecken. In der Schublade neben dem Bett fand ich sechsundzwanzig Markstücke. Für die Wasserautomaten. Ich stellte meine Zahnbürste ins Glas, zog mich bis auf die Unterhose aus, legte mich aufs Bett und wartete. Nichts geschah, irgendwann schloss sich die Tür meines Zimmers automatisch, und ich schlief ein.
Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass sich die Tür nicht öffnen ließ. Ich klopfte, aber niemand kam. Also stellte ich mich vor die Überwachungskamera und sagte: «Guten Morgen, die Herrschaften. Könnten Sie mich rauslassen, bitte? Hallo?» Aber es kam niemand. Ich zog den Bademantel an, den ich im Schrank gefunden hatte, und setzte mich aufs Bett. Ich wartete nicht lange, dann klickte es hörbar im Schloss.
Unten im Esszimmer war für eine Person eingedeckt. Ich setzte mich. Wenige Sekunden später erschien ein Pfleger und servierte das Frühstück. Wurst. Schinken. Eine Käseauswahl, dazu Marmelade, Honig, Brot und Brötchen, ein Croissant. «Guten Morgen», sagte ich. Der Mann nickte wortlos und stellte eine Karaffe mit Wasser auf den Tisch.
«Bekomme ich einen Kaffee?», fragte ich. Darauf legte er den Kopf schief wie ein kleiner Vogel, sah mich mit bekümmerter Miene an und sagte: «Nein, leider. Kein Kaffee.»
«Aha. Tee vielleicht?»
«Kein Tee. Kein Kaffee. Keine Milch, leider.»
«Ach so. Und was ist mit einem Orangensaft?»
«Kein Orangensaft. Überhaupt kein Saft.»
«Gut, dann nehme ich ein Bier.»
Er antwortete mit demselben stumpfen Ernst wie zuvor: «Kein Bier. Kein Alkohol. Eine Anweisung von Doktor Zens.»
«Was soll ich denn auf Anweisung von Doktor Zens trinken?»
Darauf schnippte er mit dem Zeigefinger gegen die Karaffe und sagte: «Wasser. Das können Sie trinken.»
Er entfernte sich und ließ mich allein. Ich fingerte eine Tablette aus der Tasche meines Bademantels und nahm sie mit einem Glas Wasser ein. Mein Kopf schmerzte. Pochender Schmerz. Pochen ist anders als Klopfen. Manchmal klopft es auch. Der Unterschied besteht in der Ausbreitung des Schmerzes. Klopfen ist, wenn nur ein Fingerknöchel penetrant rhythmisch auf eine kleine Stelle drückt. Beim Pochen ist die ganze Faust am Werk. Trotzdem ist Pochen nicht unbedingt schlimmer als Klopfen, denn das Klopfen spüre ich tiefer, Pochen ist etwas oberflächlicher. An diesem Morgen pochte es ganz gewaltig.
Ich aß mein Frühstück, danach erkundete ich das Erdgeschoss, setzte mich in alle Sessel des Kaminzimmers, hieb gegen den Boxsack, der sich kaum in Bewegung setzte, und zog Bücher aus dem Regal in der Bibliothek. Moby Dick. Ansonsten fast ausschließlich Fachliteratur. Keine Zeitungen, keine Magazine. Ich sah aus dem Fenster in den Park und bekam Lust, mit nackten Füßen über das Gras zu laufen. Nasses Gras an den Füßen, wie lange hatte ich das nicht mehr gespürt? Sicher dreißig Jahre, wahrscheinlich länger. Aber ich konnte mich gut an das Gefühl erinnern. Die Terrassentür war verschlossen. Ich rief: «Hallo? Kann mal einer die Tür hier aufmachen?», und wenige Augenblicke später stand der Pfleger im Zimmer. Ich zeigte auf die Tür und sagte: «Ich möchte nach draußen. Zens hat gestern gesagt, ich könnte nach draußen gehen.»
«Ja. Aber Sie haben nichts anzuziehen.»
«Mir egal.»
«Ihre Kleidung kommt heute.»
Zurück in meinem Zimmer, setzte ich mich auf das Bett. Ich hätte aus Langeweile onanieren können, aber die Tür stand offen, also zog ich es vor, das Bild an der gegenüberliegenden Wand zu betrachten, eine gerahmte Fotografie. Sie zeigte eine Schwarzwald-Landschaft mit Bäumen, Bäumen und Bäumen. Ich kann nicht sagen, wie lange ich das Bild anstarrte, aber ich habe große Übung im apathischen Glotzen. In meiner kleinen Wohnung habe ich jahrelang nichts anderes gemacht. Wenn Udo nicht gestorben wäre, würde ich dort heute noch aus dem Fenster gucken.
Als ich Hunger bekam, ging ich ins Esszimmer und setzte mich. Der Pfleger servierte mir mein Essen: Putengeschnetzeltes mit Reis, Kopfsalat, Pudding. Wasser.
«Passiert heute noch etwas?», fragte ich. Nicht, dass ich es eilig gehabt hätte, es war mir eigentlich egal, ob sich etwas tat. In der Anstalt, aus der ich kam, hätte jetzt die zweite Anwendung begonnen. Bewegungstherapie. Meistens saß ich dabei auf einem großen Gummiball und warf mir mit einem zahnlosen Glaser Schaumstoffkugeln zu.
«Ihre Anziehsachen sind da.»
«Na, das ist ja toll», sagte ich.