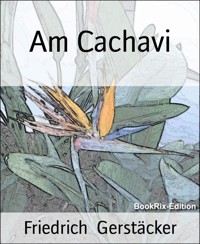
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Handlung spielt in den Wäldern Ecuadors, im Städtchen Concepcion. José, ein junger Negersklave, besucht nach jahrelanger Trennung unerlaubt seine Geliebte Eva und wird deshalb ins Gefängnis geworfen. Eva will ihn mit ihrem Ersparten freikaufen. Doch damit ist Josés Herr, ein gewissenloser Mörder und Schurke, ganz und gar nicht einverstanden! Ein Kampf auf Leben und Tot zwischen den beiden Parteien entbrennt.
In neuer deutscher Rechtschreibung und Korrektur gelesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Am Cachavi
Kurzroman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch
Die Handlung spielt in den Wäldern Ecuadors, im Städtchen Concepcion. José, ein junger Negersklave, besucht nach jahrelanger Trennung unerlaubt seine Geliebte Eva und wird deshalb ins Gefängnis geworfen. Eva will ihn mit ihrem Ersparten freikaufen. Doch damit ist Josés Herr, ein gewissenloser Mörder und Schurke, ganz und gar nicht einverstanden! Ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt zwischen den beiden Parteien.
In neuer deutscher Rechtschreibung und Korrektur gelesen.
1. Kapitel – In Concepcion
An dem Santiago-Flusse in Ecuador, tief im Walde drinnen, von Palmen- und Bananenhainen umgeben, liegt das kleine Binnenstädtchen Concepcion so malerisch und freundlich, wie sich nur etwas denken lässt.
Dicht unter demselben mündet der kurz vorher den Cachavi aufnehmende Bogota in den breiteren und tieferen Santiago und vermittelt, wenn auch nur durch Kanoes, die Verbindung mit der reichsten Provinz des Inneren, mit Imbaburru und deren Hauptstadt Ibarra, während der Santiago durch die Tola-Mündung mit dem Meer in direkter Verbindung steht und nach Norden hinauf sogar, durch die Taja-Lagune, einen breiten und bequemen Wasserweg nach dem Pailon und der dort neu angelegten englischen Kolonie und deren Hafen bildet.
Den meisten und lebendigsten Verkehr unterhielt es aber doch mit dem fast nur von Negern bewohnten Cachavi und den dortigen Golddistrikten; und wenn auch der Handel mit dem Inneren nur durch Lastträger betrieben werden konnte, da nicht einmal ein Maultierpfad durch den Wald führte, war der Umsatz doch nicht unbedeutend und die Leute befanden sich wohl und in guten Umständen.
Der Santiago wie auch der Bogota stießen aber auch durch ein reiches, unendlich fruchtbares Land, und breite, ausgedehnte Baumwollen- und Zuckerrohrfelder mit weiten Kakao- und Bananenanpflanzungen (sogenannten Platanaren) geben Zeugnis, welch reichen Ertrags der Boden dort fähig ist und wie er die geringste Arbeit tausendfältig lohnt.
Sie sind auch ziemlich dicht bewohnt, wenn auch nicht von den Ureinwohnern des Landes, die sich in den feuchten und heißen Niederungen dieser Gegend nicht so wohl zu fühlen scheinen wie weiter oben in den kühleren Bergen und an den rasch quellenden Gebirgswässern. Möglich aber auch, dass sie von den Negern, mit denen sie überhaupt nicht gern Gemeinschaft halten, zurückgedrängt wurden.
Als nämlich mit der Abschüttelung des spanischen Joches die Leibeigenen der spanischen Provinzen freigegeben und für ewige Zeiten frei erklärt wurden, da zerstreuten sie sich – besonders in Ecuador und Kolumbia – vorzugsweise über dies Terrain und wurden Herren des dortigen Bodens, dessen Sklaven sie bis jetzt gewesen waren. Überall am Santiago und Bogota legten sie Estancien an, rodeten den Wald aus und pflanzten Bananen, Kakao, Kaffee und Zuckerrohr; und wenn sie jetzt auch nach ihrer Bequemlichkeit arbeiteten und nicht mehr vom Tagesanbruch bis in die späte Nacht Hacke und Schaufel führen mussten, so dankte ihnen der Boden doch mit verschwenderischer Hand für die geringe Mühe, die sie auf seine Pflege verwandten, und wo sie nicht eben reich wurden, hatten sie doch vollauf zu leben.
Welche Bedürfnisse kannten sie denn auch, die sie nicht hier mit Leichtigkeit beschaffen mochten! Ihre Wohnungen waren um weniges besser als die, in denen sie früher von ihren Herren einquartiert worden, ihre Kleidung – eine baumwollene Hose und ein ebensolches Hemd mit einem selbstgeflochtenen Strohhut – blieb dieselbe, und was sie an Nahrung brauchten und wünschten, lieferte das Land.
So bildeten sie bald, in diesen Distrikten wenigstens, die große Majorität des Staates, und es gab Dörfer, wo sie sich sogar ihren Alkalden aus eigener schwarzer Mitte wählten.
Nur die Stellen der Gobernadores und Friedensrichter besetzte die Regierung mit den Hijos del pais – das heißt, nicht etwa den eigentlichen „Söhnen des Landes“, den Indianern, sondern mit den Abkömmlingen der spanischen Rasse, die auch solche Plätze viel besser verwerten und auszubeuten verstanden.
Ecuador war allerdings eine Republik, aber es wäre deshalb der obersten Staatsbehörde doch nicht im Traum eingefallen, dem Volk in seinen eigenen Richtern eine Majorität zu gestatten.
Auch Concepcion war zu einem sehr großen Teil von Negern bewohnt. Nichtsdestoweniger blieben aber in dieser größeren Stadt die Weißen in die Majorität, wo sie schon durch ihre Farbe den Stand der Honoratioren vertraten.
Überhaupt hat der Neger nur in sehr seltenen Fällen – so geschickt er oft in mechanischen Arbeiten sein mag – Talent zum Handel. Es fehlt ihm der Spekulationsgeist, und die verschiedenen Läden befanden sich deshalb sämtlich in der Hand von Weißen. Ebenso waren – wie sich das von selbst versteht – der Geistliche, der Alkalde und der Schullehrer Abkömmlinge der spanischen Rasse, und selbst ein italienischer Schneider hatte sich dort etabliert und sich – wie das gewöhnlich diese Art von Professionisten tun – zu einer der ersten politischen Größen und zu einer entschiedenen Opposition der bestehenden Regierung aufgeschwungen.
Señor Rigoli, wie der kleine, sehr lebendige Mann hieß, hing nämlich mit Leib und Seele an der quitenischen Regierung, während der Alkalde und Geistliche besonders – beide von dem gegenwärtigen Usurpator des Südens, dem Mulattengeneral Franco, eingesetzt – für diesen nach allen Kräfte zu wirken suchten.
Rigolis Feinde behaupteten allerdings, nur der Geist des Widerspruchs hätte den kleinen Italiener in diese politische Richtung geworfen, denn ohne Widerspruch konnte er nicht existieren; aber er leugnete dies vollkommen und würde dadurch jedenfalls seine beste Kundschaft in den Honoratioren der Stadt verloren haben, wenn sie nicht eben gezwungen gewesen wären, bei ihm arbeiten zu lassen. Er hatte nämlich keinen Konkurrenten im Ort als einen Neger, der alles verdarb, was er unter die Schere bekam, dafür aber auch zu den leidenschaftlichen Anhängern Francos gehörte und alle Augenblicke neue Gerüchte über die gewonnenen Siege des Mulattengenerals verbreitete.
Übrigens war diese politische Meinungsverschiedenheit bis jetzt sehr harmlos verlaufen, denn teil an den großen Kämpfen ihres Vaterlandes konnten die Bewohner von Concepcion nicht nehmen, dafür lagen sie von dem Hauptplatz der Aktion zu weit entfernt und völlig abgeschieden und aus dem Weg in ihrem reizenden Tal. Aber es würzte doch die Unterhaltung, und wenn Rigoli abends in der Posada eine Flasche Tschitscha getrunken und eine zweite vor sich hatte, hielt er so lange politische Reden, bis er seine Gegner – wenn auch nicht überzeugte – doch wenigstens zu Paaren trieb und zuletzt gewöhnlich das Schlachtfeld allein behauptete.
So lebhaft aber derartige Debatten fast jeden Abend geführt wurden – und in der letzten Zeit lebhafter als je, da sich ein Francoscher Offizier hier aufhielt, was aber nicht vermochte, den kleinen, mutigen Mann der Nadel einzuschüchtern – so still lag Concepcion während der heißen Stunden des Tages, wenn die Häuser keinen Schatten mehr warfen und die breiten Bananenwipfel ihre sonst vom leichten Luftzug bewegten Fächerblätter still und regungslos hielten. Dann ließ sich auch kein lebendes Wesen mehr auf der Straße blicken, und in den luftigen, auf Pfählen gebauten Häusern schaukelten die Bewohner derselben in ihren Hängematten oder lagen ausgestreckt auf dem Boden unter ihren Moskitonetzen.
***
Nicht weit von der Plaza, freundlich genug gelegen und von bunt blühenden und duftigen Akazien halb versteckt, wie von einer einzelnen Kokospalme überragt, stand ein kleines, niederes und düsteres Gebäude aus festen, eisenharten Stämmen ausgeführt und die Fenstereinschnitte – welches andere Haus hatte hier überhaupt Fenster, wo alle Wände offen lagen – mit dicken, eisernen Gittern verwahrt.
Es war die „colabozo“ das Gefängnis Concepcions und in der Tat gewöhnlich leer und offen stehend, aus dem Grunde vielleicht, damit ein jeder hineingehen und sich den unheimlichen dumpfigen Raum betrachten könne.
Heute aber schien sie verschlossen und fest verriegelt und draußen an der schweren Tür auch noch mit einem riesigen Vorlegeschloss gesichert, denn der „Schließer“ konnte doch nicht immer davor sitzen, eines einzigen lumpigen Gefangenen wegen.
In dem Gefängnis aber, die Stirn gegen das Gitter gepresst, lehnte ein junger, bis zum Gürtel nackter Neger und hielt mit dem einen durch die Stäbe hinausgestreckten Arm die Hand eines bildhübschen Negermädchens, das vor seiner Zelle stand und in der Linken ein bunt gewürfeltes Tuch mit Gaben hielt, die sie dem Gefangenen wahrscheinlich mitgebracht.
„Armer José“, klagte dabei das Mädchen, indem ihm die großen hellen Tränen in die Augen traten, „dass es dahin mit dir kommen musste! O, was hast du nur verbrochen, dass sie dich in den schrecklichen Kerker werfen konnten!“
„Verbrochen, mi corazon – nichts“, seufzte der junge Bursche. „Nichts auf der Welt weiter, als dass ich dich nach jahrelanger Abwesenheit wieder einmal sehen wollte. Nur deshalb nahm ich an der Tola-Mündung das Kanoe, und weil ich Einzelner nicht so stark rudern konnte wie die vier starken Cajapasindiander, holten sie mich hier ein, und ich muss jetzt büßen.“
„Aber die Sklaverei ist ja doch bei uns aufgehoben!“, rief das junge Mädchen heftig. „Mutter und Vater waren schon freie Menschen, und die Gesetze verbieten den Weißen, Sklaven zu halten.“
„Die Gesetze“, zischte der junge Bursche trotzig zwischen den Zähnen durch, „wer hat die Gesetze gegeben als nur die Weißen, und sie machen damit, was sie wollen. Was bin ich anderes als ein Sklave jenes Guayaquilenen? Er hatte mir Geld geborgt, und ich muss es jetzt abverdienen.“
„O José“, sagte das Mädchen mit leisem, wie schüchternem Vorwurf im Ton, aber einem gar so lieben und herzlichen Blick, „weshalb hast du von ihm geborgt? Konntest du denn das böse, hässliche Trinken nicht lassen, womit du uns beide jetzt unglücklich gemacht?“
Der junge Bursche senkte beschämt den Blick.
„Du hast recht, querida“, sagte er leise, „ich war schlecht und leichtsinnig, aber schon seit langen Monden trinke ich nicht mehr und arbeite fleißig – doch was hilft es mir? Wir ziehen ununterbrochen von Ort zu Ort, und die Arbeitstage, die er mir dem Gesetz nach gestatten muss, nützen mir nichts, denn für wen soll ich arbeiten auf der Reise?“
„Und wie viel bist du ihm schuldig?“, fragte das Mädchen ängstlich.
„Ich weiß es nicht“, seufzte der junge Bursche, „er schreibt sich alles auf, was er mir gibt; und so viel hat mir der Alkalde gesagt, dass ich für vierzig Dollars ein ganzes Jahr für ihn arbeiten muss.“
„Und ist es so viel?“
„Ich glaube es nicht – was hat er mir denn gegeben? Die dürftigste Kleidung, ein paar Stangen Tabak und schon seit Monden kein aguardiente mehr. Ich trinke – nie mehr – ich habe es dir versprochen, Eva.“
„Dann lass mich dafür sorgen, dass du frei wirst, José“, sagte das junge Mädchen, und frohe Zuversicht leuchtete aus seinen Augen. „Ich habe das letzte Jahr viel, recht viel gearbeitet. Ich habe den Leuten Lebensmittel in die Minen gefahren und selber ein wenig Gold gegraben und bei unserem Alkalden in Cachavi geschafft, Tag und Nacht, wie seine Frau krank war und sich selber nicht helfen konnte. Das Geld liegt in Cachavi – ich hole es. – Was brauchen wir es auch? Wir sind beide kräftig und gesund und können uns schon auch ohne das eine Heimat gründen.“
„Aber wie willst du nach Cachavi hinaufkommen, Herz?“, fragte der junge Bursche. „Der Fluss ist reißend, und allein wärst du nie imstande, ein Kanoe über die Stromschnellen zu bringen.“
„Mein Bruder ist hier“, sagte das Mädchen, „er lernt ein Handwerk bei einem Weißen. Der ist gut – der wird ihm erlauben, dass er mit helfen darf, und wenn wir heute Abend fortfahren, können wir morgen schon oben sein.“
„Dein Bruder ist schwächlich –“





























