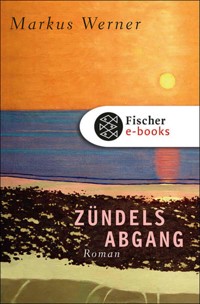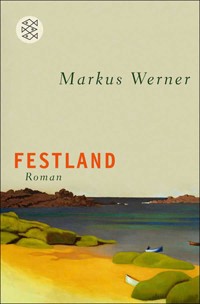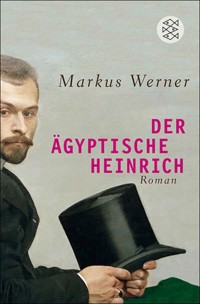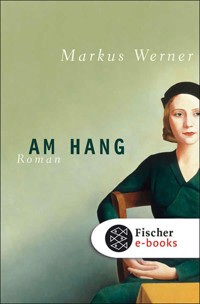
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Markus Werner ist einer der ganz Großen ... Die Romane dieses Schriftstellers ... sind Gipfelpunkte der Literatur." Helmut Böttiger, Frankfurter Rundschau Der junge Scheidungsanwalt Clarin freut sich auf ein ungestörtes Pfingstwochenende in seinem Tessiner Ferienhaus, wo er einen Aufsatz für eine Fachzeitschrift schreiben möchte. Am ersten Abend lernt er auf der Terrasse des Hotels Bellavista einen älteren Mann kennen, einen scheinbar Verwirrten, einen Verrückten vielleicht. Sie reden und debattieren bis tief in die Nacht, und allmählich erzählen sie sich auch ihre Geschichten und Liebesgeschichten. Was als stockendes Gespräch zwischen Zufallsbekannten begonnen hat, entwickelt eine fiebrige, beklemmende Dynamik, der sich weder Clarin noch der Leser entziehen kann. Es sind zweifelhafte Umstände, unter denen Loos seine geliebte, fast vergötterte Frau verloren hat, und dieser Verlust scheint ihm die Welt schwer und verhasst zu machen. Clarin hingegen lebt leicht und gern. – Ferner könnten zwei Menschen einander nicht sein. Wie nah sie sich sind, stellt sich erst spät heraus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Markus Werner
Am Hang
Roman
Über dieses Buch
Der junge Scheidungsanwalt Clarin freut sich auf ein ungestörtes Pfingstwochenende in seinem Tessiner Ferienhaus, wo er einen Aufsatz für eine Fachzeitschrift schreiben möchte. Am ersten Abend lernt er auf der Terrasse des Hotels Bellavista einen älteren Mann kennen, einen scheinbar Verwirrten, einen Verrückten vielleicht. Sie reden und debattieren bis tief in die Nacht, und allmählich erzählen sie sich auch ihre Geschichten und Liebesgeschichten. Was als stockendes Gespräch zwischen Zufallsbekannten begonnen hat, entwickelt eine fiebrige, beklemmende Dynamik, der sich weder Clarin noch der Leser entziehen kann. Es sind zweifelhafte Umstände, unter denen Loos seine geliebte, fast vergötterte Frau verloren hat, und dieser Verlust scheint ihm die Welt schwer und verhasst zu machen. Clarin hingegen lebt leicht und gern. Ferner könnten zwei Menschen einander nicht sein. Wie nah sie sich sind, stellt sich erst spät heraus.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Markus Werner wurde 1944 in der Schweiz, in Eschlikon im Kanton Thurgau, geboren und starb 2016 in Schaffhausen. Er studierte in Zürich Germanistik, arbeitete bis 1990 als Lehrer und dann als freier Schriftsteller. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane »Zündels Abgang«, »Froschnacht«, »Die kalte Schulter«, »Bis bald«, »Festland«, »Der ägyptische Heinrich« und »Am Hang«. Zu seinem Werk erschien der von Martin Ebel herausgegebene Band »›Allein das Zögern ist human‹«.
Inhalt
I
II
III
Nachwort von Oliver Vogel
I
Alles dreht sich. Und alles dreht sich um ihn. Verrückterweise bin ich sogar versucht mir einzubilden, er schleiche in diesem Augenblick ums Haus – mit oder ohne Dolch. Dabei ist er ja abgereist, heißt es, und ich höre nur Grillen und aus der Ferne nächtliches Hundegebell.
Da fährt man über Pfingsten ins Tessin, um sich in Ruhe zu vertiefen in die Geschichte des Scheidungsrechts, und dann kommt einem dieser Unbekannte in die Quere, dieser Loos, und bringt es fertig, mich so aufzuwühlen, daß alle Sammlung hin ist. Den Rest hat mir Eva gegeben, drüben in Cademario, heute, ich bin in ziemlicher Verwirrung hierher zurückgefahren und habe die Juristen-Zeitung angerufen beziehungsweise, da ja Pfingstsonntag ist, den Redaktor privat, um mitzuteilen, daß ich mich außerstande sähe, den Beitrag termingerecht abzuliefern. Eine akute, von Fieber begleitete Stirnhöhlenentzündung lege mich lahm, habe ich gesagt und mir während des kurzen Gesprächs mit Daumen und Zeigefinger die Nase zugehalten. Man höre förmlich, hat der Redaktor gesagt, wie bös es um mich stehe.
Ja, eher bös. Zwar sind die Höhlen intakt, auch bin ich fieberfrei, und doch könnte ich das, was mir zusetzt, als eine Art Stirnfieber bezeichnen. Die Schläfen jedenfalls, auf die ich meine Finger presse, um den Tumult dahinter zu dämpfen, sind heiß, so als erzeugten die hektisch ums immer Gleiche kreisenden Gedanken Reibungswärme.
Schlafen wär schön jetzt, Loos abschütteln, Loos’ Sätze, die wie Fusseln haften, aus dem Gehirn ausbürsten. Er selber hat zu mir gesagt: Vergessen Sie das Vergessen nicht, sonst werden Sie verrückt. – Er muß es wissen. Er sagte aber auch, freilich in einem anderen Zusammenhang, von allen Seuchen der Jetztzeit sei die Vergeßlichkeit die schleichendste und also schlimmste.
Nun gut und so oder so, ich werde diesen Mann nicht los, indem ich mir befehle, nicht mehr an ihn zu denken. So würde er sich nur noch breiter machen und mein Bewußtsein noch irritierender verengen. Ich kenne das Phänomen, seit mich Andrea, es ist fünfzehn Jahre her und ich war zwanzig, wie einen Schirm hat stehenlassen. Inzwischen weiß ich eigentlich, wie man den Mechanismus unterläuft und wie mit einem Durcheinander von verfilzten Fäden methodisch zu verfahren wäre. Den Anfang suchen. Den Knäuel sorgsam entknoten, entwirren. Das Garn abwickeln, ohne Hast, und zugleich ordentlich und straff aufwickeln auf eine Spule.
Leicht gesagt, nicht wahr, mein lieber Loos? Dir jedenfalls ist das gründlich mißlungen, falls du es überhaupt versucht hast. Hast du? Oder bist du mit deinem Knäuel, deinem Garn schon immer so – wie soll ich sagen – so wunderlich umgegangen wie auf der Bellevue-Terrasse?
Am Freitag vor Pfingsten hat sich der Stau am Gotthard in Grenzen gehalten, ich bin schon gegen sechs hier angekommen, habe wie üblich zuerst den Wasserhaupthahn aufgedreht, die Sicherungsschalter gekippt, Boiler und Kühlschrank angestellt und mich dann kalt geduscht. Wie üblich habe ich die leeren Flaschen, die mein Anwaltskollege und Miteigentümer des Hauses an Ostern hier zurückgelassen hat, entsorgt. Ein Feuer im Kamin zu machen hat sich nicht aufgedrängt, der Juniabend war lau. So lau, daß ich um acht nochmals ins Auto stieg, von Agra hinunter nach Montagnola fuhr und vor dem Hotel Bellevue oder Bellavista parkte. Enttäuscht habe ich feststellen müssen, daß es auf der Terrasse keinen freien Tisch mehr gab, und da ich mich nicht in den verglasten Vorbau habe setzen wollen, blieb ich unschlüssig stehen, Ausschau haltend nach stühlerückenden Gästen. Da habe ich ihn entdeckt. Er saß als einziger allein, und zwar an einem Vierertisch in der linken Terrassenecke, ich habe mich aufgerafft, bin zu ihm hingegangen – er studierte die Speisekarte – und habe ihn auf italienisch gefragt, ob er gestatte. Er hat kurz aufgeschaut und nichts gesagt. Ich habe die Frage auf deutsch wiederholt und nach seinem abwesenden Nicken ihm gegenüber Platz genommen.
Es ist mir aufgefallen, daß er, während ich auf die Speisekarte wartete, von der seinigen von Zeit zu Zeit aufblickte, den Kopf etwas drehte und seine Augen ruhen ließ auf den Hügeln und Hängen jenseits des Tals. Sein Kopf war ein Schädel, groß und starkknochig, unbehaart bis auf einen dichten, aber geschorenen Halbkranz von Schläfe zu Schläfe und einen ebenso dichten und graumelierten Dreitagebart. Schwer schien der Kopf, schwer und massig der ganze Mann, aber die Masse wirkte nicht so, als schwappe sie über die Körpergrenze, sie wirkte kompakt. Ich schätzte ihn auf gut fünfzig. Als mir der Kellner die Karte brachte, bestellte der Fremde mit tiefer, leicht näselnder Stimme sein Essen. Eine Karaffe mit Weißwein stand bereits vor ihm, er griff jetzt nach seinem Glas und trank es, den Blick wieder auf die Hügel gerichtet, langsam aus. Von mir nahm er keine Notiz. Ich blätterte in der Karte, mein Zeigefinger blieb auf dem Filetto di coniglio stehn, und ich erschrak ein wenig. Bis zu diesem Moment hatte ich nicht eine Sekunde an Valerie gedacht und daran, daß wir beide hier vor längerer Zeit Kaninchenfilet gegessen hatten, Valerie noch munter, ich eher würgend und wortarm, da innerlich damit beschäftigt, mir schonende Sätze zurechtzulegen, ich wollte mich trennen von ihr.
Die Sonne sank, und während der See unter uns schon an Farbe verlor, funkelte der Wein in der Karaffe des Fremden. Welch ein Goldgelb, hörte ich mich sagen, darf ich fragen, was Sie trinken? – Er wandte sich mir zu, verzögert, und schaute mich so an, als nähme er mich jetzt erst wahr. Nicht abweisend, nicht unfreundlich, nur überrascht sah er mich an mit hellgrauen Augen, unter denen, es ist mir sofort aufgefallen, Schatten lagen. Es waren keine Übermüdungsringe und keine Tränensäcke, es war die dunkle, wie hingehauchte Tönung der Haut, die ich bisher fast nur an indischen Menschen beobachtet hatte. Entschuldigung, sagte der Fremde, was haben Sie gefragt? – Ich will Sie nicht stören, sagte ich, ich habe nach dem Wein, den Sie trinken, gefragt. – Es ist ein Weißwein, sagte er. Obwohl ich nicht unbedingt annahm, daß er mich auf den Arm nehmen wollte, wehrte ich mich und sagte: Das sehe ich irgendwie. – Wie bitte? fragte er. Ich biß mir auf die Lippen und fragte, ob er mir seinen Wein empfehlen könne. Er überlegte eine Weile und sagte dann: Wir haben ihn immer als stimmig empfunden.
Ich bestellte Saltimbocca mit Reis, so wie mein Gegenüber, und einen halben Weißen. Mein Gegenüber rauchte abgewandt. Ich schloß nicht aus, daß wir uns beide nur halb verstanden hatten, von Stille konnte nämlich keine Rede sein an diesem Ort. Nicht nur umgab uns Geklapper und Stimmengewirr, es landete und startete unten in Agno von Zeit zu Zeit auch ein Flugzeug mit üblichem Gedröhn, und selbst der ferne Autolärm im Tal, vom See verstärkt und reflektiert, war hier oben noch als Rauschen vernehmbar. Als mein Wein kam, nutzte ich die Gelegenheit, um mich dem Fremden erneut zu nähern – ich bin ein kontaktfreudiger Mensch und finde es unnatürlich, zu zweit an einem Tisch zu sitzen und zu schweigen –, ich hob mein Glas und sagte: Zum Wohl, mein Name ist Clarin. – Er zuckte zusammen, so daß die Zigarettenasche, die abzustreifen er vergessen hatte, auf seine Serviette fiel. Er griff mit der linken Hand nach seinem Glas und sagte: Freut mich. – Aber darauf, sich seinerseits vorzustellen, schien er verzichten zu wollen. Ich sah, daß er am Ringfinger zwei Ringe trug, schlichte Eheringe, und folgerte daraus, daß er wahrscheinlich Witwer war. Ein Anhaltspunkt immerhin, sagte ich mir, wenn er sich sonst schon nicht erschließen läßt wie andere Menschen, die man nach einer Viertelstunde, auch ohne mit ihnen zu reden, ein wenig einordnen kann, zumindest in die Rubrik sympathisch oder unsympathisch. Doch selbst in dieser Hinsicht kam ich zu keinem Urteil. Ich wußte nur: er interessiert mich. Ich mußte wieder an Valerie denken, an ihre Undurchsichtigkeit, die mich am Anfang fasziniert und gegen Ende abgestoßen hatte. Da fragte mich mein Gegenüber: Wie finden Sie ihn? – Nun zuckte ich zusammen. Den Wein? fragte ich. Nein, sagte er, den Blick, den Ausblick. – Ich sagte, ich fände ihn schön, gerade auch jetzt, wo die Sonne untergegangen sei und das Panorama gegenüber nur noch aus dunklen Blautönen bestehe, im übrigen sei mir die Landschaft seit Jahren vertraut. Er nickte befriedigt, er sagte: Seit Jahren vertraut – das ist eine einnehmende Wendung, und was die Blautöne angeht: Sie sind nicht etwa Maler? – Nein, sagte ich, ich bin Jurist, Anwalt, und Sie? – So, sagte er mit einer leichten und, wie mir schien, fast verächtlichen Dehnung, auf die Gegenfrage ging er nicht ein, er hatte sie wohl überhört, weil eben das Essen gebracht wurde.
Bevor er zu Messer und Gabel griff, senkte er den Kopf und schloß ganz kurz die Augen. Natürlich, dachte ich, er ist ein Pfarrer, schwarze Hose, schwarze Jacke, ich hätte früher darauf kommen können. – Er aß langsam und in sich gekehrt, ich sprach ihn trotzdem wieder an. Heute, als ich im Stau am Gotthard stand, sagte ich, ist mir plötzlich eingefallen, daß ich vergessen habe, was Pfingsten bedeutet, ich meine, was an Pfingsten gefeiert wird, ist das nicht peinlich? – Er hörte auf zu kauen, schluckte dann und sagte: Über Staumeldungen freue ich mich stets besonders herzlich, an Pfingsten aber züngeln Flammen. – Er aß weiter, während ich, im Wissen, daß man auf Spinner eingehen muß, nach einer Pause fragte: Wo züngeln sie denn, die Flammen? – Er ließ sich Zeit, schenkte sich Wein nach, trank. Sie züngeln, sagte er dann, über den Häuptern der zwölf Apostel, und sie symbolisieren den Heiligen Geist, der fünfzig Tage nach Ostern über und in sie kommt, um sie im Wortsinn zu begeistern für ihr Wirken. – Alle Achtung, sagte ich, man könnte meinen, Sie seien Theologe. – So, sagte er, und jetzt revidieren Sie die Meinung und halten mich für keinen Spinner? – Ich erschrak. Ich fragte, wie er darauf komme. Die Augen, Herr Clarin, verraten vieles, sagte er, und manchmal kann ich einem Satz anhören, wie der Redende denkt, das geht recht mühelos, solange Blick und Ohr nicht abgerichtet sind aufs Nichtverweilen. – Ich wunderte mich, daß er sich meinen Namen hatte merken können, ihn sogar richtig, das heißt auf der zweiten Silbe betonte. Den seinigen auch endlich zu erfahren, hielt ich für angebracht. Er tat, als ich ihn danach fragte, als müsse er sich besinnen, dann sagte er: Loos, Loos mit zwei o, wir sitzen auf dem trockenen, ich bestelle noch einen, sind Sie dabei?
Der Tisch wurde abgeräumt, der Merlot bianco gebracht, man hörte aus der Ferne ein Alphorn. Loos lauschte eher gequält. Ob es ihn nerve, fragte ich. Grundsätzlich, sagte er, habe er gegen das Alphorn als solches nichts, das Alphorn sei ja sozusagen das ideale Instrument für Zwerge, und zweitens liege es ihm fern, linkische Inbrunst zu tadeln, ihn störe lediglich die Einschleppung des Alphorns ins Tessin. – Auch mir genügten, sagte ich, die hiesigen und wunderbaren Glockenspiele. – Sie lieben sie auch, das freut mich, sagte er, sie sind ein Grund, warum ich hergekommen bin, wehmütigere Klänge sind nirgends sonst zu haben. – Ich fragte, ob er hier im Bellevue wohne. Ja, sagte Loos und schaute die Fassade hoch, dort oben, zuoberst links, dort ist mein Wachtturm, von dort kann ich hinübersehn, über die Bäume hinweg und über das Tal hinweg – und Sie, logieren Sie auch hier? – In Agra, sagte ich, ich habe in Agra ein kleines Ferienhaus. – Und da erholen Sie sich über Pfingsten von Ihren Strapazen als Anwalt? – Nicht eigentlich, sagte ich, es ist ein Arbeitsaufenthalt, ich will hier ungestört schreiben. – Ein nettes Hobby, sagte Loos, wird’s ein Roman? – Sie verstehen mich falsch, sagte ich, es geht um berufliche Arbeit, um einen rechtshistorischen Aufsatz für eine Juristen-Zeitung zum Thema Eherecht, vor allem Scheidungsrecht, ich habe viel damit zu tun in meiner Anwaltspraxis, und so ergab sich nebenbei auch ein geschichtliches Interesse an der Materie.
Jetzt gehn die Lichter an dort drüben, sagte Loos. Ich schwieg und putzte verstimmt meine Brille. Rückschau ist immer gut, sagte er, wirklich, Rückschau ist wichtig, wenn auch nicht zeitgemäß, ich öffne den Mund ja kaum mehr, um Sätze zur Jetztzeit zu sagen, weil mir die Jetztzeit ja ständig das Wort abschneidet. Und wenn ich auch nur zu ihr sage: du hast eine Herkunft, und ich messe dich erstens an dieser und zweitens an jenen paar Träumchen, die ich mir nie habe austreiben lassen – dann ist sie schon beleidigt und fährt mir über den Mund. – Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe, sagte ich, wollen Sie sagen, daß Menschen, die sich ganz dem Heute widmen, die, wie man sagt, mit der Zeit gehen, gereizt auf Kritik reagieren? – So ungefähr, sagte Loos, aber es ist noch zu früh. – Zu früh wofür? – Zu früh, um über den Zeitgeist zu reden und über das Gezücht der Anschmiegsamen, ich brauche vorher noch einige Gläser, und Sie können den Grad meiner Einschüchterung sowohl daran ermessen als auch daran, daß ich auf dieser schönen Terrasse, seit wir hier sitzen, kein einziges Mal die Stirn gerunzelt habe, obwohl doch während dieser Zeit, ich habe es gezählt, nicht weniger als vierzehnmal ein Handy piepste oder zirpte und so weiter, kurzum, es muß ernüchternd sein, nicht wahr, sich ständig konfrontiert zu sehn mit Scheidungssachen, bringt Sie das nicht in Versuchung, die Ehe für undurchführbar zu halten? – Versuchung, sagte ich, sei nicht das richtige Wort, das richtige sei Gewißheit. Fast zwingend sei ich in Anbetracht von pausenloser Zweierpein genötigt, die Ehe als Irrweg zu sehn beziehungsweise als glatte Überforderung der menschlichen Natur, die einfach zu schweifend scheine, als daß sie sich auf Dauer zähmen lasse und auch nur die paar Regeln akzeptieren könne, die, würden sie befolgt, die Ehe vielleicht möglich machten. Es spotte jeder Beschreibung, sagte ich, was sich Paare in Scheidung antäten, sei es in Fortsetzung dessen, was sie sich während der Ehe schon angetan hätten, sei es in der Entwertung einstigen Glücks. Das Verrückteste aber sei, daß sich die Leute, obwohl bereits jede zweite Ehe geschieden werde, von der Heiraterei nicht abhalten ließen, und als noch verrückter müsse der Umstand gelten, daß es sich bei über zwanzig Prozent der Eheschließungen um Wiederverheiratungen handle.
Loos, der mir mit so großer Aufmerksamkeit zugehört hatte, daß ich meine Darlegungen gern noch vertieft und fortgesetzt hätte, unterbrach mich und sagte: Sie sind also Junggeselle. – Ein überzeugter, wie Sie gemerkt haben dürften. – Dann ist ja Ihre menschliche Natur nicht überfordert, das freut mich, sagte er, und während ich noch überlegte, wie er das meinen könnte, mokant oder ernst, sagte er leise: Mir ist sie Heimat gewesen. – Ich suchte seinen Blick, Loos aber schaute übers Tal. Wer? fragte ich. Die Ehe, sagte er. Gewesen? – Er nickte. Sind Sie – verwitwet? – Er trank. Wissen Sie, sagte er dann, Ihre Statistiken sind mir nicht unbekannt, ich weiß sogar, daß in jedem Ehebett zwei Millionen Staubmilben toben, und einer noch verstörenderen Untersuchung habe ich entnommen, daß deutsche Paare nach sechs Ehejahren im Schnitt noch neun Minuten täglich miteinander reden und amerikanische vier Komma zwei. – Eben, eben, sagte ich nur. – Und nun frage ich Sie, fuhr er fort, ob dieser Befund Rückschlüsse auf die menschliche Natur zuläßt oder vielleicht doch eher und unter anderem aufs abendliche Fernsehritual. – Vermutlich auf beides, sagte ich, denn einmal angenommen, das wachsende Schweigen der Paare liege am wachsenden Fernsehkonsum, so stellt sich immer noch die Frage, warum der Bildschirm einer Plauderstunde vorgezogen wird. Es ist nicht so – ich höre es oft als Anwalt –, daß man nicht redet, weil man fernsieht, nein, man sieht fern, weil es nichts mehr zu reden gibt, weil man sich nichts mehr zu sagen hat, schon gar nichts Neues oder Spannendes, es hat sich totgelaufen: das ist die Wendung, die ich am häufigsten höre, und daraus schließe ich, daß sich die menschliche Natur nach Abwechslung und Farbe sehnt und sich nicht an Gewohnheit gewöhnt. – Um recht zu haben, sagte Loos, haben Sie allzu recht, und wie gesagt, ich habe es anders erlebt, zum Wohl.
Zum Wohl, Herr Loos, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, ich weiß natürlich, daß es auch glückliche Ehen gibt. – Das interessiert mich nicht, sagte er. – Verzeihung, ich dachte, das sei unser Thema. – Es ist schon kurios, sagte er, je herrischer der Zeitgeist in unsere Seelen sickert und unser Verhalten bestimmt, um so bornierter beruft man sich auf die Natur des Menschen. Man könnte meinen, es handle sich dabei um Heimweh, weil unsere Natur ja längst verkümmert ist, und nicht um einen Trick, der dazu dient, uns zu entlasten: alles genetisch bedingt, alles entschuldigt, schaut euch doch die Schimpansen an, sie schließen keine Ehen, sie schweifen und bleiben mobil.
Daß sich, während er sprach, zwei Fliegen auf seiner Kopfhaut paarten, schien Loos nicht zu merken. Er ist, schloß ich auch daraus, seltsam erregt, ich muß besänftigen. Er glaube doch wohl nicht, daß ich Jurist geworden wäre, wenn ich Zurechnungsfähigkeit und also Schuld in Frage stellen würde, sagte ich. Nur sei es einfach so, daß ich mich wissenschaftlicher Erkenntnis nicht verschließen könne, und diese zeige einwandfrei, wie wenig Freiraum uns die Gene ließen. Loos trank und schüttelte den Kopf und sagte, vor fünfundzwanzig Jahren habe die Wissenschaft noch einwandfrei bewiesen, daß sogar Schwachsinn lernbar sei und daß das Individuum bis in sein Mark hinein geformt, genormt und in der Regel verunstaltet werde durch Einwirkungen von außen. Ich sagte, die Wissenschaft pflege nicht stehenzubleiben, ich räumte aber ein, daß die Wahrheit vielleicht in der Mitte liege. Er bat mich, ihn mit der Mitte zu verschonen, er sei zu alt für sie. Ihm schwebe jedenfalls nicht vor, bis an sein Ende höflich auf jede Seite zu nicken, und jetzt falle ihm eben eine Ergänzung ein zum vorher flüchtig Besprochenen. Wie es komme, daß die Menschen glückselig vor dem Fernseher säßen, Abend für Abend, süchtig nach dem Immergleichen, nach ihren Serien zum Beispiel, nach ihren Quizsendungen und so fort, deren Beliebtheit offenbar darin bestehe, daß sie das Immergleiche unablässig repetierten. Wie es komme, daß Hunderttausende auf den Schnauzbart eines Moderators oder Talkmasters fixiert seien und ein Aufheulen durchs Land gehe, wenn der Moderator oder Talkmaster urplötzlich ohne Schnauzbart auftrete. Wie sich erklären lasse, daß sich der Wunsch nach ödester Gleichförmigkeit nur vor dem Bildschirm rege, nicht aber im restlichen Ehealltag. Kaum nämlich habe man sich aus dem Fernsehsessel erhoben, denke man schon an Scheidung, nur weil der Partner sich die Zähne so wie gestern putze und anschließend gurgle wie immer. Wonach, Herr Clarin, steht unserer Natur nun eigentlich der Sinn?
Die Frage schien mir nicht einfach. Ich sagte, im Augenblick sei mir ein wenig kühl, ich wolle schnell die Jacke aus meinem Wagen holen, ob er mich kurz entschuldige. Nicht hungern, nicht dürsten, nicht frieren, sagte Loos, soweit sind wir uns einig, vielleicht fällt Ihnen noch weiteres ein. – Er sah mich erwartungsvoll an, als ich zurückkam, und fragte: Und? – Ich sah mich als Gymnasiast vor der Wandtafel stehn, den Blicken der Klasse ausgesetzt, auf das erwartungsvolle Und des Lehrers mit einem Blackout reagierend. Ob mir nicht gut sei, fragte Loos. Doch, sagte ich, ich sei mir nur Sekunden lang so vorgekommen wie früher, als ich vom Lehrer geprüft worden sei. Um Gottes willen, rief Loos, das tut mir leid, nichts liegt mir ferner, als den Lehrer zu spielen, ich habe aus ehrlicher Neugier gefragt, Sie sind ein junger Mann mit einem anderen Horizont, mit einem anderen Wissen, ich aber bin ein älterer Herr und nicht frei von Verhärtungstendenzen, weshalb ich mich höllisch bemühen muß, ein bißchen belehrbar zu bleiben. – Er schwieg. Ich überlegte mir eine Antwort. Im Tiefsten aber, sagte er gedämpft, bin ich nicht aufgeschlossen, das ist der Fluch der Treue. – Er gebe mir damit das Stichwort, sagte ich, es sei womöglich so, daß unsere Natur nach beidem verlange, nach Festem und nach Flüssigem, nach Wiederholung und nach Abwechslung, nach Halt und Haltlosigkeit. Loos sagte, er würde meine Diagnose unterschreiben, wenn sie nicht gar so überzeugend klänge. Es sei mir bewußt, sagte ich, daß alles komplexer sei. Auch das leuchte ein, meinte er.
Der Kellner wechselte die Aschenbecher. Man hörte fernes Donnern, ich hob den Kopf und sah nur Sterne. Loos’ ausgedrückte Zigarette glühte weiter, ein Rauchfähnchen stieg von ihr auf, und wieder dachte ich an Valerie, der es nie gelungen war, eine Zigarette im ersten Anlauf auszulöschen. Er könne sich täuschen, sagte Loos jetzt, aber an der Art, wie ich meine Brille geputzt hätte, glaube er gesehen zu haben, wie selbstverständlich ich im Leben stünde, ob seine Vermutung stimme. Er spinnt wohl doch ein wenig, dachte ich und fragte zurück, ob er die Art und Weise meines Brilleputzens noch etwas präzisieren könne. Eben selbstverständlich, sagte er, halt wie nebenbei und ohne alle Angst, daß eins der Gläser springen könnte, daß Ihnen Ihre Brille aus den Händen fallen und in die Brüche gehen könnte. – Von dieser Angst sei ich tatsächlich frei, sagte ich, und wäre ich es nicht, so stiege die Wahrscheinlichkeit, daß das Befürchtete einträte. Das sei wie mit dem Stolpern. Wer sich in ständiger Angst zu stolpern fortbewege, der stolpere garantiert, kurzum, es sei mir völlig fremd, die Dinge des Lebens schwerer als nötig zu nehmen, insofern habe er sich nicht getäuscht. – Das klinge zwar plausibel, sagte Loos, und trotzdem sei er überzeugt, daß man weit häufiger aus mangelnder Achtsamkeit stolpere als aus Angst vor dem Stolpern. – Er möge mich nicht auf das Stolpern festlegen, bat ich ihn, ich hätte einfach sagen wollen, daß man Unglück gleichsam herbeifürchten könne, was überhaupt nicht heiße, daß es nicht auch das andere Unglück gebe, das uns als Blitz aus blauem Himmel treffe.
Loos kramte in seiner Jackentasche und holte ein kleines, schwarzes Spiralheft hervor und einen kleinen, schwarzen Bleistift. Er blätterte und suchte offenbar nach einer leeren Seite. Obwohl er sich bemühte, sein Heftchen mit der linken Hand ein wenig abzuschirmen, sah ich, daß es voll von Notizen und winzigen Skizzen war. Er notierte sich etwas, es konnte nicht mehr als ein Wort sein, und steckte das Heft wieder ein. Dann sagte er mehr zu sich selbst als zu mir: Es ist was dran, immer habe ich Angst gehabt, meine Frau zu verlieren, und eines Tages habe ich sie verloren, und trotzdem war’s ein Blitz aus blauem Himmel. – Das tut mir leid, sagte ich. Er nickte und trank. Nach einer Weile fragte ich, wann sie gestorben sei. Im Augenblick könne er darüber nicht sprechen, später vielleicht, sagte er, ich solle ein wenig von mir erzählen, zum Beispiel davon, ob mir mein Junggesellentum behage. Ich sagte, daß ich, wie schon erwähnt, kein Junggeselle wider Willen sei, mein Status sei gewollt und mir gemäß. Auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu verzichten, sei undenkbar für mich und um so weniger nötig, als man als Ungebundener die Freuden, die das Leben biete, viel unbekümmerter genießen könne. Den Vorwurf, ich scheute mich davor, Verantwortung zu übernehmen, müsse ich von mir weisen, schon darum, weil ihn stets jene erhöben, die unter ihr ächzten. – Sie stehen hier nicht vor Gericht, sagte Loos, aber erzählen Sie weiter. – Natürlich komme es manchmal zu Tränen, sagte ich, wenn ich einer Frau gegenüber, die mehr von mir erwarte, als ich investieren könne, ehrlich sei und ihr die Trennung nahelege, doch solche Tränen seien Petitessen verglichen mit jeder Art Ehe-Elend. Meistens sei ja die Sache auch bald verschmerzt, ich hätte mich zum Beispiel heute, auf dieser Terrasse, an eine Freundin erinnert, mit der ich hier vor längerem zum letzten Mal zusammengewesen sei, und auch für sie sei keine Welt eingestürzt. So sei es meistens: Die lockere Beziehung verhindere Tragödien und biete zudem Schutz vor einem traurigen und herkömmliche Paare selten verschonenden Schicksal. – Hier pausierte ich kurz, um einen Schluck zu trinken, und Loos, ganz bei der Sache, fragte: Nämlich? – Ich habe es schon angedeutet, sagte ich, ich rede von der ehelichen Stufenleiter, die vom Begehren über das Mögen über die liebe Gewohnheit über die Lustlosigkeit hinabführt bis zur Abneigung, womöglich bis zum Haß, und dann kommt die Stunde der diplomierten oder undiplomierten Berater, und vielleicht sorgt ein durchsichtiges Negligé oder ein verzweifelter Tanga für ein paar letzte Funken, und dann kommt die Stunde des Anwalts.
Warum so hitzig? fragte Loos, es behauptet ja niemand das Gegenteil. Die Ehe entspricht nur wenigen und überfordert die meisten, ich möchte Sie einzig bitten, das Wort investieren nicht zu verwenden, wenn Sie von Beziehungen reden, denn schauen Sie – hier zog Loos den Ärmel seiner Jacke ein wenig hoch und zeigte mir seinen Unterarm, auf dem ich ein paar rote Tüpfchen sah –, schauen Sie, ich bin allergisch. – Ich lachte, ich glaubte an einen Scherz, er aber blieb ernst und sagte, er lese oft und gern Kontaktanzeigen, weil er auf der Höhe der Zeit bleiben wolle, deren Beschaffenheit sich unter anderem ja auch in den Kontaktanzeigen widerspiegle. Da sei er neulich auf die Annonce eines Dreißigjährigen gestoßen, der sich selbst als weltkompatibel beschrieben habe und anschließend, unter dem Stichwort Anforderungsprofil, die benötigten Eigenschaften seiner Wunschpartnerin aufgezählt habe, worauf er, Loos, auf seinen linken Unterarm aufmerksam geworden sei, weil sich darauf innerhalb kürzester Zeit rote Punkte gebildet hätten. – Ich sagte, halb lachend, halb verstimmt, ich wolle mich bemühen, Rücksicht auf seine Allergie zu nehmen, auch wenn es mir ein wenig widerstrebe, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. – Nicht jedes, jedes nicht, sagte Loos, und eigentlich beneide ich Sie ja darum, daß Sie, was Ihre Gefühle betrifft, ein zaudernder Investor und Anleger sind, so bleiben Verluste verkraftbar. Andrerseits ist freilich zu bedenken, daß sich, je kleiner das Risiko ist, auch die Gewinnaussichten minimieren, denn was wirft ein Sparheft schon ab? Gerade so viel, daß es für ein paar Reisen von Zürich nach Oerlikon reicht, während sich doch, wenn man sein Kapital waghalsiger angelegt hätte, im Glücksfall so viel gewinnen ließe, daß man die Welt umsegeln könnte, oder nicht? – Sie dürfen mich getrost hochnehmen, sagte ich, ich bin nicht sehr empfindlich, im übrigen habe ich verstanden, was Sie meinen, nur hat Ihr Gleichnis einen Haken und nimmt mich zu streng beim Wort. Über Gefühle haben wir keine Verfügungsgewalt, das weiß ich auch, es ist nicht fair, mir einen Strick daraus zu drehen, daß ich die sogenannte große Liebe noch nicht erfahren habe. Muß ich, nur weil einstweilen keine Weltumsegelung zu winken scheint, auch auf Landpartien verzichten? – Ja sehen Sie, sagte Loos, vorher hat eben alles sehr vorsätzlich geklungen, so als hätten Sie alles im Griff, jetzt klingt es menschlicher, aber es steht mir so oder so nicht zu, Ihre Lebensgestaltung zu werten, ich will Sie auch nicht fragen, ob es bei den paar Tränen bleiben würde, wenn Sie an eine Frau gerieten, die