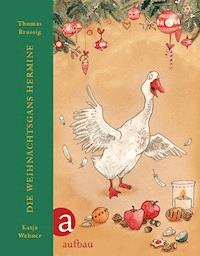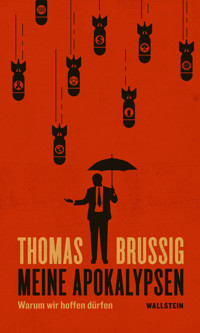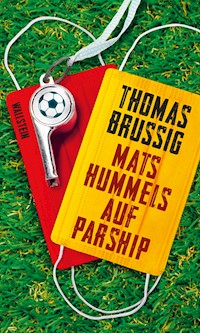9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Brussig erzählt vom Aufwachsen in einer Diktatur - mit einem Nachwort von Jonathan Franzen
Am kürzeren Ende der Sonnenallee, gleich neben der Berliner Mauer, wohnt Micha Kuppisch. Wenn er aus der Haustür tritt, hört er die Rufe westlicher Schulklassen vom Aussichtspodest: "Guck mal, 'n echter Zoni!" Micha aber hat eine andere Sorge: Miriam. Sie ist das schönste Mädchen weit und breit, doch leider schon vergeben. Pointenreich erzählt Thomas Brussig, wie im Schatten der Mauer auch die Sonne schien. Miriam, Micha und seine Freunde lieben und lachen, tricksen und träumen. Sie hören Jimi Hendrix, angeln Liebesbriefe aus dem Todesstreifen und erschaffen sich erfindungsreich ihre eigene Welt. Und erst später wird ihnen klar, dass sie unheimlich komisch waren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Am kürzeren Ende der Sonnenallee, gleich neben der Berliner Mauer, wohnt Micha Kuppisch. Wenn er aus der Haustür tritt, hört er die Rufe westlicher Schulklassen vom Aussichtspodest:
»Guck mal, ’n echter Zoni!« Micha aber hat eine andere Sorge: Miriam. Sie ist das schönste Mädchen weit und breit, doch leider schon vergeben. Und so grübelt Micha tagein und tagaus, wie er es anstellen könnte, in Miriams Nähe zu sein.
Pointenreich erzählt Thomas Brussig, wie im Schatten der Mauer auch die Sonne schien. Miriam, Micha und seine Freunde lieben und lachen, tricksen und träumen. Sie schmieden Pläne, wie man einen Liebesbrief hervorangelt, den der Wind in den Todesstreifen geweht hat. Sie hören Jimi Hendrix und lesen Sartre, sie schaffen sich erfindungsreich eine eigne Welt. Manche allerdings sind zu blöd, ein Radio einzuschalten, wie der Grenzer, der heimkehrenden Tagesbesuchern vertraulich zuzwinkert:
»Keine Angst, wir holen euch da raus.«
Onkel Heinz aus Westberlin, der sich dreißig Pfund abhungert, um unterm Anzug einen zweiten Anzug über die Grenze zu schmuggeln, Wuschel, dem ein Stones-Album das Leben rettet, oder die Existentialistin, die im Trabi ihr Baby bekommt – sie alle vom kürzeren Ende der Sonnenallee »haben die Luft bewegt«: »Mein Gott, waren wir komisch, und wir haben es nicht einmal gemerkt …«
THOMAS BRUSSIG, 1964 in Berlin geboren, hatte 1995 seinen Durchbruch mit »Helden wie wir«. Es folgten u. a. »Am kürzeren Ende der Sonnenallee« (1999), »Wie es leuchtet« (2004) und »Das gibt’s in keinem Russenfilm« (2015). Seine Werke wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Thomas Brussig ist der einzige lebende deutsche Schriftsteller, der mit einem seiner literarischen Werke wie auch mit einem Kinofilm und einem Bühnenwerk ein Millionenpublikum erreichte.
Thomas Brussig
Am kürzeren Ende der Sonnenallee
Mit einem Nachwort
von Jonathan Franzen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Text wurde der Originalausgabe entsprechend inalter Rechtschreibung gesetzt.
Copyright © 1999 Thomas Brussig
Genehmigte Ausgabe April 2023
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright des Nachwortes © 2023 Jonathan Franzen
Copyright der deutschsprachigen Übersetzung
des Nachwortes © Axel Springer SE
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
Covergestaltung: buxdesign, München
Covermotiv: © Sammlung DDR Museum, Berlin
cb · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-31007-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für meine Eltern,Sigune und Siegfried Brussig
Churchills kalter Stumpen
Es gibt im Leben zahllose Gelegenheiten, die eigene Adresse preiszugeben, und Michael Kuppisch, der in Berlin in der Sonnenallee wohnte, erlebte immer wieder, daß die Sonnenallee friedfertige, ja sogar sentimentale Regungen auszulösen vermochte. Nach Michael Kuppischs Erfahrung wirkt Sonnenallee gerade in unsicheren Momenten und sogar in gespannten Situationen. Selbst feindselige Sachsen wurden fast immer freundlich, wenn sie erfuhren, daß sie es hier mit einem Berliner zu tun hatten, der in der Sonnenallee wohnt. Michael Kuppisch konnte sich gut vorstellen, daß auch auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945, als Josef Stalin, Harry S. Truman und Winston Churchill die ehemalige Reichshauptstadt in Sektoren aufteilten, die Erwähnung der Sonnenallee etwas bewirkte. Vor allem bei Stalin; Diktatoren und Despoten sind bekanntlich prädestiniert dafür, poetischem Raunen anheimzufallen. Die Straße mit dem so schönen Namen Sonnenallee wollte Stalin nicht den Amerikanern überlassen, zumindest nicht ganz. So hat er bei Harry S. Truman einen Anspruch auf die Sonnenallee erhoben – den der natürlich abwies. Doch Stalin ließ nicht locker, und schnell drohte es handgreiflich zu werden. Als sich Stalins und Trumans Nasenspitzen fast berührten, drängte sich der britische Premier zwischen die beiden, brachte sie auseinander und trat selbst vor die Berlin-Karte. Er sah auf den ersten Blick, daß die Sonnenallee über vier Kilometer lang ist. Churchill stand traditionell auf seiten der Amerikaner, und jeder im Raum hielt es für ausgeschlossen, daß er Stalin die Sonnenallee zusprechen würde. Und wie man Churchill kannte, würde er an seiner Zigarre ziehen, einen Moment nachdenken, dann den Rauch ausblasen, den Kopf schütteln und zum nächsten Verhandlungspunkt übergehen. Doch als Churchill an seinem Stumpen zog, bemerkte er zu seinem Mißvergnügen, daß der schon wieder kalt war. Stalin war so zuvorkommend, ihm Feuer zu geben, und während Churchill seinen ersten Zug auskostete und sich über die Berlin-Karte beugte, überlegte er, wie sich Stalins Geste adäquat erwidern ließe. Als Churchill den Rauch wieder ausblies, gab er Stalin einen Zipfel von sechzig Metern Sonnenallee und wechselte das Thema.
So muß es gewesen sein, dachte Michael Kuppisch. Wie sonst konnte eine so lange Straße so kurz vor dem Ende noch geteilt worden sein? Und manchmal dachte er auch: Wenn der blöde Churchill auf seine Zigarre aufgepaßt hätte, würden wir heute im Westen leben.
Michael Kuppisch suchte immer nach Erklärungen, denn viel zu oft sah er sich mit Dingen konfrontiert, die ihm nicht normal vorkamen. Daß er in einer Straße wohnte, deren niedrigste Hausnummer die 379 war – darüber konnte er sich immer wieder wundern. Genauso wenig gewöhnte er sich an die tägliche Demütigung, die darin bestand, mit Hohnlachen vom Aussichtsturm auf der Westseite begrüßt zu werden, wenn er aus seinem Haus trat – ganze Schulklassen johlten, pfiffen und riefen »Guckt mal, ’n echter Zoni!« oder »Zoni, mach mal winke, winke, wir wolln dich knipsen!«. Aber all diese Absonderlichkeiten waren nichts gegen die schier unglaubliche Erfahrung, daß sein erster Liebesbrief vom Wind in den Todesstreifen getragen wurde und dort liegenblieb – bevor er ihn gelesen hatte.
Michael Kuppisch, den alle Micha nannten (außer seine Mutter, die ihn von einem Tag auf den anderen Mischa nannte) und der nicht nur eine Theorie darüber hatte, wieso es ein kürzeres Ende der Sonnenallee gab, hatte auch eine Theorie darüber, warum seine Jahre die interessanteste Zeit wären, die es je am kürzeren Ende der Sonnenallee gab oder geben würde: Die einzigen Häuser, die am kürzeren Ende der Sonnenallee standen, waren die legendären Q3a-Bauten mit ihren winzigen engen Wohnungen. Die einzigen Leute, die bereit waren, dort einzuziehen, waren Jungvermählte, von dem Wunsch beseelt, endlich gemeinsam unter einem Dach zu leben. Doch die Jungvermählten kriegten bald Kinder – und so wurde es in den engen Wohnungen noch enger. An eine größere Wohnung war nicht zu denken; die Behörden zählten nur die Zimmer und erklärten die Familien für »versorgt«. Zum Glück passierte das in fast allen Haushalten, und als Micha begann, sein Leben auf die Straße auszudehnen, weil er es in der engen Wohnung nicht mehr aushielt, traf er genügend andere, denen es im Grunde so ging wie ihm. Und weil fast überall am kürzeren Ende der Sonnenallee fast dasselbe passierte, fühlte sich Micha als Teil eines Potentials. Wenn seine Freunde meinten »Wir sind eine Clique«, sagte Micha »Wir sind ein Potential«. Was er damit meinte, wußte er selbst nicht genau, aber er fühlte, daß es was zu bedeuten hatte, wenn alle aus der gleichen Q3a-Enge kamen, sich jeden Tag trafen, in den gleichen Klamotten zeigten, dieselbe Musik hörten, dieselbe Sehnsucht spürten und sich mit jedem Tag deutlicher erstarken fühlten – um, wenn sie endlich erwachsen sind, alles, alles anders zu machen. Micha hielt es sogar für ein hoffnungsvolles Zeichen, daß alle dasselbe Mädchen liebten.
Die Verdonnerten
Sie trafen sich immer auf einem verwaisten Spielplatz – die Kinder, die auf diesem Spielplatz spielen sollten, waren sie selbst gewesen, aber nach ihnen kamen keine Kinder mehr. Weil kein Fünfzehnjähriger der Welt sagen kann, daß er auf den Spielplatz geht, nannten sie es »am Platz rumhängen«, was viel subversiver klang. Dann hörten sie Musik, am liebsten das, was verboten war. Meistens war es Micha, der neue Songs mitbrachte – kaum hatte er sie im SFBeat aufgenommen, spielte er sie am Platz. Allerdings waren sie da noch zu neu, um schon verboten zu sein. Ein Song wurde ungeheuer aufgewertet, wenn es hieß, daß er verboten war. Hiroshima war verboten, ebenso wie Je t’aime oder die Rolling Stones, die von vorne bis hinten verboten waren. Am verbotensten von allem war Moscow, Moscow von »Wonderland«. Keiner wußte, wer die Songs verbietet, und erst recht nicht, aus welchem Grund.
Moscow, Moscow wurde immer in einer Art autistischer Blues-Ekstase gehört – also in wiegenden Bewegungen und mit zusammengekniffenen Augen die Zähne in die Unterlippe gekrallt. Es ging darum, das ultimative Bluesfeeling zu ergründen und auch nicht zu verbergen, wie weit man es darin schon gebracht hat. Außer der Musik und den eigenen Bewegungen gab es nichts, und so bemerkten die vom Platz es erst viel zu spät, daß der ABV plötzlich neben ihnen stand, und zwar in dem Moment, als Michas Freund Mario inbrünstig ausrief »O Mann, ist das verboten! Total verboten!« und der ABV den Recorder ausschaltete, um triumphierend zu fragen: »Was ist verboten?«
Mario tat ganz unschuldig. »Verboten? Wieso verboten? Hat hier jemand verboten gesagt?« Er merkte schnell, daß er damit nicht durchkommen würde.
»Ach, verboten meinen Sie«, sagte Micha erleichtert. »Das ist doch Jugendsprache.«
»Der Ausdruck verboten findet in der Jugendsprache Anwendung, wenn die noch nicht volljährigen Sprecher ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen wollen«, sagte Brille, der schon so viel gelesen hatte, daß er sich nicht nur die Augen verdorben hatte, sondern auch mühelos arrogant lange Sätze sprechen konnte. »Verboten ist demnach ein Wort, das Zustimmung ausdrückt.«
»So wie dufte oder prima«, meinte Wuschel, der so genannt wurde, weil er aussah wie Jimi Hendrix.
»Sehr beliebt in der Jugendsprache sind auch die Ausdrücke urst oder fetzig«, sagte Brille.
»Die aber auch nur dasselbe meinen wie stark, geil, irre oder eben – verboten«, erklärte der Dicke. Alle nickten eifrig und warteten ab, was der ABV dazu sagen würde.
»Jungs, ihr wollt mich wohl für dumm verkaufen«, sagte der. »Ich glaube eher, daß ihr euch darüber unterhalten habt, daß es total verboten ist, einen Reisepaß, den eine Bürgerin der BRD verloren hat, nicht abzugeben, wenn man ihn findet.«
»Nein«, sagte Micha. »Das heißt ja – also wir wissen natürlich, daß es total verboten ist, einen Reisepaß, den man findet, nicht abzugeben. Aber darüber haben wir uns nicht unterhalten, Herr Wachtmeister.«
»Obermeister!« belehrte der ABV streng. »Ich bin kein Wachtmeister, sondern Obermeister. Das ist ein Unterführerdienstgrad. Erst ist man Oberwachtmeister, dann Hauptwachtmeister, Meister und Obermeister. Aber nächste Woche werde ich Unterleutnant. Das ist ein Offiziersdienstgrad.«
»Das ist ja interessant. Herzlichen Glückwunsch!« sagte Micha, der erleichtert war, daß der ABV vergessen hatte, weshalb er eigentlich auf dem Platz war. Anstatt dem Verbotenen nachzugehen, deklamierte er Dienstgrade herunter.
»Nach Unterleutnant kommt Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann, Major, Oberst – alles Offiziersdienstgräder.« Micha haute Brille in die Seite, der ausgerechnet jetzt, als sich die Laune des ABV besserte, Luft holte, um dessen Pluralbildung zu korrigieren.
»Dann die Generalsdienstgräder: Generalmajor, Generaloberst, Generalleutnant, Armeegeneral – fällt euch was auf?«
»Es gibt ’ne ganze Menge Dienstgräder«, sagte Wuschel, der sich so wenig wie die anderen für Dienstgrade interessierte. »Aber Ihrer scheint noch ziemlich weit unten zu sein.«
»Sie haben in Ihrer Karriere das Schönste noch vor sich«, vermutete der Dicke, der Wuschels Gedanken aufgriff und freundlicher formulierte.
»Nee, Jungs! Wenn ihr besser aufgepaßt hättet, dann hättet ihr selbst bemerkt, daß bei den Offizieren der Leutnant weit unterm Major ist, obwohl dann, bei den Generälen, der Generalleutnant überm Generalmajor steht.«
»Wie ist denn das möglich?« fragte Mario ungläubig.
»Die Letzten werden die Ersten sein«, sagte Brille. »Das steht …« Er sprach nicht weiter, weil ihn Micha wieder in die Seite haute.
»Nächste Woche werde ich Unterleutnant, und dann wird hier durchgegriffen«, sagte der ABV entschlossen. »Wenn einer von euch einen Reisepaß einer BRD-Bürgerin findet, ist der bei mir abzugeben. Verstanden?«
»Wie heißt sie denn, die BRD-Bürgerin?« fragte Brille, der es wieder ganz genau wissen wollte.
»Ihr habt natürlich jeden Reisepaß, den ihr findet, bei mir abzugeben. Aber der Paß, der verloren wurde, gehört einer Helene Rumpel. – Wie heißt die BRD-Bürgerin?«
»Helene Rumpel«, antwortete Mario. Mario hatte die längsten Haare und galt deshalb als der Aufsässigste. Wenn Mario dem ABV brave Antworten gab, dann konnte der ABV das Gefühl haben, daß er sich auf dem Platz durchgesetzt hatte.
»Genau, Rumpel, Helene«, wiederholte der ABV, und die Jungs nickten. Dann wollte der ABV gehen, aber nach drei Schritten fiel ihm noch was ein, und er kam zurück.
»Und was war das vorhin für ein Lied?« fragte er lauernd, suchte die Start-Taste des Recorders und Moscow, Moscow begann von neuem. Micha rutschte das Herz in die Hose. Der verbotenste der verbotenen Songs! Der ABV hörte zu und nickte schließlich mit Kennermiene.
»Wessen Tonträger?« fragte der ABV. »Na? Wem seine Kassette ist das?«
»Eigentlich ist das meine«, sagte Micha.
»Aha! Die nehm ich mal mit. Ich leg nämlich selbst auch ganz gerne auf, im Kreise der Kollegen.« Micha schloß vor Entsetzen die Augen, als er sich das vorstellte. Er hörte nur noch, wie der ABV im Gehen munter rief: »Na, Jungs, so ein Hobby hättet ihr mir bestimmt nicht zugetraut, oder?«
Nach einer Woche war der ABV nicht vom Obermeister zum Unterleutnant befördert, sondern zum Meister degradiert worden. Und er begann, Micha zu schikanieren, indem er sich von ihm immer den Personalausweis zeigen ließ. Wann immer Micha ihm über den Weg lief, hieß es: »Guten Tag, Meister Horkefeld, Fahndungskontrolle. Ihren Personalausweis bitte.«
Die ersten Male nahm Micha das Wort Fahndungskontrolle sehr ernst und vermutete, daß Moscow, Moscow-Hörer früher oder später auf die Fahndungslisten kommen. Später reimte er sich zusammen, daß der ABV tatsächlich Moscow, Moscow im Kreise der Kollegen gespielt hatte, vermutlich sogar auf dem großen Polizeiball anläßlich der Beförderungen. Und da Moscow, Moscow so unbeschreiblich verboten war, mußte es im Festsaal einen Riesenskandal gegeben haben. Micha konnte sich die Szene gut vorstellen: Der Polizeipräsident persönlich wird nach vorn gestürmt sein, um mit einem Gummiknüppel auf die Lautsprecherboxen einzuschlagen, während der Innenminister seine Dienstwaffe gezogen haben wird, um mitten im Lied den Kassettenrecorder zu zerschießen. Dann werden beide gleichzeitig dem ABV die beiden nagelneuen Unterleutnant-Schulterstücken wieder heruntergerissen haben. Daß es sich so, wenn nicht noch schlimmer, abgespielt hatte, mußte Micha vermuten, nachdem er viele Male erlebte, wie grimmig ihn der ABV bei den Ausweiskontrollen behandelte.
Wenn der ABV die Kassette mit Moscow, Moscow nicht an sich genommen hätte, dann wäre Michas erster Liebesbrief auch nicht in den Todesstreifen geflattert. Die Angelegenheit war kompliziert und ist demnach nicht leicht zu erklären, aber mit Moscow, Moscow hatte es im weitesten Sinne zu tun. Micha konnte sich nicht mal sicher sein, ob dieser Brief überhaupt an ihn war, und er konnte sich auch nicht sicher sein, ob dieser Brief von dem Mädchen war, von dem er für sein Leben gern einen Liebesbrief bekommen hätte.
Dieses Mädchen hieß Miriam, ging in die Parallelklasse und war ganz offensichtlich die Schulschönste. (Für Micha war sie natürlich auch die Weltschönste.) Sie war das Ereignis der Sonnenallee. Wenn sie auf die Straße trat, setzte ein ganz anderer Rhythmus ein. Die Straßenbauer ließen ihre Preßlufthämmer fallen, die Westautos, die aus dem Grenzübergang gefahren kamen, stoppten und ließen Miriam vor sich über die Straße gehen, auf dem Wachtturm im Todesstreifen rissen die Grenzsoldaten ihre Ferngläser herum, und das Lachen der westdeutschen Abiturklassen vom Aussichtsturm erstarb und wurde durch ein ehrfürchtiges Raunen abgelöst.
Miriam war noch nicht lange an der Schule, in die auch Micha, Mario und die anderen gingen. Niemand wußte etwas Genaues über sie. Miriam war für alle die fremde, schöne, rätselhafte Frau. Strenggenommen war Miriam ein uneheliches Kind, aber auch das wußte keiner. Sie war ein uneheliches Kind, weil ihr Vater mit dem Auto einmal zu früh abgebogen war. Er war auf dem Weg zum Standesamt, wo er Miriams Mutter treffen wollte, die im achten Monat schwanger war. Die Hochzeit sollte in Berlin stattfinden, und in Berlin kannte sich Miriams Vater kaum aus. Er kam aus Dessau und bog falsch vom Adlergestell ab, fuhr die Baumschulenstraße hinunter und stand plötzlich mit seinem Trabi im Grenzübergang in der Sonnenallee. Er verstand überhaupt nicht, daß er an einem Grenzübergang war, deshalb schimpfte er herum, stieg aus und lief aufgeregt umher. »Ich will da aber durch!« rief er immer wieder. Es kam öfter vor, daß sich Autos in so einen Grenzübergang verirrten, und meist wurden sie ohne viel Aufhebens zurückgeschickt. Aber Miriams cholerischer Vater hatte ein solches Faß aufgemacht, daß sich die Grenzer gründlicher mit ihm beschäftigten. Er wurde so lange verhört, daß er den Termin auf dem Standesamt nicht mehr schaffte, und ehe es zu einem neuen Termin kam, wurde Miriam geboren. So war Miriam ein uneheliches Kind.
Als Miriams kleiner Bruder geboren wurde, war Miriam bereits klar, daß sich ihre Eltern trennen würden. Ihr Vater war nicht ganz dicht – wenn er mal ausgesperrt wurde, trat er die Wohnungstür ein oder er veranstaltete auf der Straße ein Riesengeschrei, was Miriam und ihrer Mutter wegen der Nachbarn unglaublich peinlich war. Als sich Miriams Eltern endlich trennten, wollte sich Miriams Mutter vor den belästigenden Nachstellungen von Miriams verrücktem Vater sicher fühlen – und so zog sie ans kürzere Ende der Sonnenallee. Sie vermutete ganz richtig, daß Miriams Vater diese Gegend sorgfältig meiden wird.
Miriams Verhältnis zu Jungs und zu Männern war völlig undurchsichtig. Brille sagte, Miriam verhalte sich wie jedes normal deformierte Scheidungskind – diskret, ziellos, pessimistisch. Sie wurde öfter gesehen, wie sie auf ein Motorrad stieg, das just in dem Moment vorfuhr, als sie aus dem Haus kam. Die Maschine war eine AWO, also das Renommier-Motorrad. Die AWO war das einzige Viertakter-Motorrad im gesamten Ostblock, und sie gewann obendrein durch ihren Seltenheitswert, denn sie wurde seit den frühen sechziger Jahren nicht mehr gebaut. Daß Miriam auf eine AWO stieg, machte denen vom Platz klar, daß sie sich schon in einer ganz anderen Welt bewegte. Weder Micha noch Mario, Brille oder der Dicke hatten ein Motorrad oder wenigstens ein Moped; nur Wuschel hatte ein Klapprad. Und wenn einer von ihnen ein Moped oder gar ein Motorrad gehabt hätte, dann nur einen dieser aufdringlich knatternden Zweitakter. Selbst eine 350er Jawa, die immerhin zwei Zylinder hatte, kam längst nicht an den tiefen und ruhigen Sound der AWO heran. Der AWO-Sound mußte etwas Unwiderstehliches haben.
Wenn Miriam die Maschine vor ihrem Haus grummeln hörte, lief sie hinaus, begrüßte den Fahrer mit einem raschen Kuß – und weg war sie. Den AWO-Fahrer bekamen die vom Platz niemals zu Gesicht, denn er trug immer eine Motorradbrille.
»Vielleicht ist er gar nicht ihr Freund«, sagte Micha einmal. »Vielleicht ist es nur …« Ihm fiel niemand ein, der täglich das schönste Mädchen abholt, sich von ihr mit einem Kuß begrüßen läßt und nicht ihr Freund ist.
»Vielleicht ist es nur ihr Onkel«, sagte Mario spöttisch. Mario war auch in Miriam verknallt, aber im Gegensatz zu Micha romantisierte er sie nicht. »Willst du mit ihr gehen, oder willst du sie anbeten?« fragte er Micha einmal, und Micha antwortete wahrheitsgemäß: »Also erst mal will ich sie nur anbeten.« – »Aha, erst mal. Und dann, wenn erst mal vorbei ist?« fragte Mario. »Dann … Dann will ich für sie sterben«, erwiderte Micha. Er dachte betrübt daran, daß er noch längst nicht so weit war, mit einem Mädchen etwas anzufangen, wenn er sie nur anbeten und hernach nobel für sie sterben will.
Über Wochen und Monate brachte er es nie fertig, Miriam anzusprechen, und wenn sich die Gelegenheit hätte ergeben können, zum Beispiel bei der Schulspeisung, wenn sie plötzlich vor ihm in der Schlange stand, dann verkrümelte er sich wieder.
Allerdings versuchte Micha über Miriams kleinen Bruder immer wieder, alle möglichen Informationen herauszukriegen. Alle, die in Miriam verknallt waren – und das waren alle Jungs der oberen Klassen –, versuchten Miriams kleinen Bruder über Miriam auszufragen. Miriams kleiner Bruder war erst zehn, aber er wußte genau, was seine Informationen wert waren. Er ließ sich dafür sogar bezahlen, und zwar mit Matchbox-Autos. Wenn jemand von ihm etwas über Miriam wissen wollte, fragte er als erstes: »Haste ’n Metschi?« Das sprach sich schnell rum, und so wurden die Schüler der oberen Klassen zu Matchbox-Experten. Nur ihre Westverwandten wunderten sich darüber, daß Fünfzehn-, Sechzehnjährige zu Weihnachten den Lamborghini Countach oder den Road Dragster wünschten. Denn Mirimas kleiner Bruder nahm nicht jedes Auto. Als ihm Brille mal einen langweiligen froschgrünen Kennel Truck andrehen wollte, verweigerte er die Auskunft. Es sollte schon ein Maserati oder Monteverdi Hai sein, und sie mußten auch einwandfrei federn.
Miriams kleiner Bruder war in einer weiteren Beziehung privilegiert: Keiner wagte es, ihn anzufassen. Wenn ihm von den Gleichaltrigen Prügel drohte, konnte er sich auf Beistand der Älteren verlassen, und auch die taten ihm nichts, egal, wie unverschämt er wurde. Miriams Bruder war so unantastbar wie Miriam selbst.
Einmal, in einer echten Zwangslage, hat Micha dann doch versucht, Miriams Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: