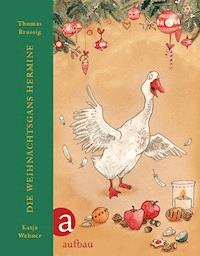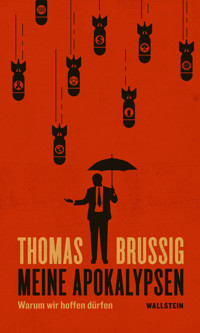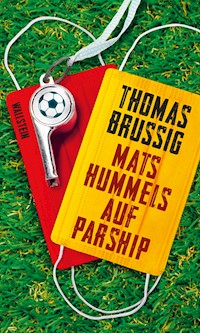Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wirklich wahre Wahrheit über den Mauerfall: der große Wenderoman von Thomas Brussig
Die deutsche Geschichte muss umgeschrieben werden: Klaus Uhltzscht war es, der die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat! Dabei ist Klaus eigentlich ein Versager par excellence. Als Sohn eines Stasi-Spitzels und einer Hygieneinspektorin wächst er zwischen Jogginghosen und Dr. Schnabels Aufklärungsbuch auf, bleibt im Sportunterricht auf ewig ein Flachschwimmer. Auch sein großer Traum, als Topagent bei der Stasi zu arbeiten, erfüllt sich leider nicht. Dafür aber wird er, der inzwischen eine Perversionskartei erfunden hat, zum persönlichen Blutspender Erich Honeckers. Jetzt, da auch noch die Mauer durch – man höre und staune – seinen Penis fiel, packt Klaus aus und erzählt von seinem ruhmreichen Leben. Keiner hat bislang frecher und unverkrampfter den kleinbürgerlichen Mief des Ostens gelüftet als Brussig. Ein Lesevergnügen allererster Ordnung!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:4 Std. 8 min
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die deutsche Geschichte muss umgeschrieben werden: Klaus Uhltzscht war es, der die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat! Dabei ist Klaus, der Sachenverlierer und Multi-Perverse, eigentlich ein Versager par excellence. Als Sohn eines Stasi-Spitzels und einer Hygieneinspektorin wächst er zwischen Jogginghosen und Dr. Schnabels Aufklärungsbuch auf, bleibt im Sportunterricht auf ewig ein Flachschwimmer und hofft vergeblich, in der Arbeitsgemeinschaft Junge Naturforscher berühmt zu werden. Auch sein großer Traum, als Topagent bei der Stasi zu arbeiten, erfüllt sich leider nicht. Dafür aber wird er, der inzwischen eine Perversionskartei erfunden hat, zum persönlichen Blutspender Erich Honeckers. Jetzt, da auch noch die Mauer durch – man höre und staune – seinen Penis fiel, packt Klaus aus und erzählt von seinem ruhmreichen Leben. Keiner hat bislang frecher und unverkrampfter den kleinbürgerlichen Mief des Ostens gelüftet als Thomas Brussig. Mit beißender Ironie und nicht mehr zu überbietender Komik durchleuchtet er die DDR in ihrer ganzen Spießigkeit. Ein Lesevergnügen allererster Ordnung!
THOMAS BRUSSIG, 1964 in Berlin geboren, hatte 1995 seinen Durchbruch mit »Helden wie wir«. Es folgten u.a. »Am kürzeren Ende der Sonnenallee« (1999), »Wie es leuchtet« (2004) und »Das gibts in keinem Russenfilm« (2015). Seine Werke wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Thomas Brussig ist der einzige lebende deutsche Schriftsteller, der mit einem seiner literarischen Werke wie auch mit einem Kinofilm und einem Bühnenwerk ein Millionenpublikum erreichte.
Thomas Brussig
Helden wie wir
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
E-Book-Ausgabe Oktober 2023
btb Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 1995 Thomas Brussig
Covergestaltung: buxdesign I Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © mauritius images / Berlin, East-Side-Gallery an der ehemaligen Berliner Mauer, Karsten Wenzel: »Die Beständigkeit der Ignoranz«, Erich Honecker im Hermelin / Catharina Lux
cb · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-31006-6V001
www.btb-verlag.de
Inhalt
Das 1. Band: Kitzelstein
Das 2. Band: Der letzte Flachschwimmer
Das 3. Band: Blutbild am Rande des Nierenversagens
Das 4. Band: Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll
Das 5. Band: wbl. Pers. Str. hns. trat 8:34
Das 6. Band: Trompeter, Trompeter
Das 7. Band: Der geheilte Pimmel
Das 1. Band: Kitzelstein
Ich darf von mir behaupten, durch ein ganzes Panzerregiment Geburtshilfe genossen zu haben, ein Panzerregiment, das am Abend des 20. August 1968 in Richtung Tschechoslowakei rollte und auch an einem kleinen Hotel im Dörfchen Brunn vorbeikam, in dem meine Mutter, mit mir im neunten Monat schwanger, während ihres Urlaubs wohnte. Motoren dröhnten, und Panzerketten klirrten aufs Pflaster. In Panik durchstieß ich die Fruchtblase, trieb durch den Geburtskanal und landete auf einem Wohnzimmertisch. Es war Nacht, es war Hölle, Panzer rollten, und ich war da: Die Luft stank und zitterte böse, und die Welt, auf die ich kam, war eine politische Welt.
Mr. Kitzelstein, wie Sie sehen, habe ich, meiner historischen Verantwortung voll bewußt, bereits damit begonnen, die Geschichte meines Lebens aufzuschreiben, auch wenn ich gestehen muß, daß ich in zwei Jahren nicht über den ersten Absatz hinausgekommen bin. Mir schwebte eine Autobiographie vor, in der ich mir voller Ehrfurcht begegne und die auch sonst so à la europäischer Zeitzeuge angelegt ist – und die mich sowohl für den Literatur- als auch den Friedensnobelpreis ins Gespräch bringt (um Sie gleich mit einer meiner hervorstechenden Eigenschaften, meinem Größenwahn, vertraut zu machen). Wer weiß, wie lange ich noch an meiner Autobiographie gesessen hätte, wenn Sie nicht angerufen und mich für Ihre New York Times um ein Interview gebeten hätten. Wie ich das mit der Berliner Mauer hingekriegt habe. Das ist eine lange Geschichte. Lassen Sie mich zuerst ein paar Mißverständnisse klären.
Ich habe gehofft, mein Anteil an den Geschehnissen jener Nacht bliebe noch eine Weile unerkannt – aber da habe ich die Beharrlichkeit des amerikanischen investigativen Journalismus einfach unterschätzt. Als die Mauer plötzlich nicht mehr stand, rieb sich Volk die Augen und mußte schließlich glauben, es hätte selbst die Mauer abgerissen. Mir war schon klar, daß diese Das-Volk-sprengt-die-Mauer-Legende nicht mehr lange halten wird. Irgendwo muß es ja abgeblieben sein, das Volk, das Mauern sprengen konnte – aber wo? Die illusionsloseren Betrachter kommen nun zu dem Schluß, daß es kein mauersprengendes Volk gegeben hat. Aber wer war’s dann? An dieser Stelle erinnert man sich an Schabowski und seine Pressekonferenz, und das Märchen, er habe die Maueröffnung verkündet, kam mir sehr gelegen, denn es verhinderte Nachforschungen in meine Richtung, so daß ich, die mir zustehenden Nobelpreise fest im Auge, ungestört an meiner Biographie arbeiten konnte. Außerdem wußte ich immer, daß ich, wenn ich mich outen würde, mit dieser Pressekonferenz-Legende relativ einfach fertig werden könnte. Man muß sich nämlich nur genau anhören, was Schabowski damals sagte: Er hat, als er sich den Journalistenfragen stellte und auf die Fluchtwelle angesprochen wurde, den Flüchtlingen ab sofort die direkte Ausreise in die Bundesrepublik zugesichert, wahrscheinlich, weil er es leid war, daß sich die Welt an Fernsehbildern von kilometerlangen Autoschlangen an der tschechisch-westdeutschen Grenze ergötzen konnte. Um mehr als eine unspektakulärere Fluchtwelle ging es ihm nicht. Zugegeben, eine Stunde später unterbrachen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ihre Debatte zum Vereinsförderungsgesetz, standen auf und sangen das Deutschlandlied. An der Mauer jedoch war bis dahin noch nichts passiert, und es passierte auch weiterhin nichts, außer daß sich viele Begierige versammelten und abwarteten. Und dann kam ich. Sie sagten am Telefon, daß Sie durch die Analyse von Videomaterial auf mich gestoßen wären. Was soll ich da noch leugnen.
Ja, es ist wahr. Ich war’s. Ich habe die Berliner Mauer umgeschmissen. Aber wenn es nur das wäre – die Rezensionen der Historiker und Publizisten jedenfalls lesen sich so: »Ende der deutschen Teilung«, »Ende der europäischen Nachkriegsordnung«, »Ende des kurzen 20. Jahrhunderts«, »Ende der Moderne«, »Ende des Kalten Krieges«, »Ende der Ideologien« und »Das Ende der Geschichte«. Wie das tapfere Schneiderlein: Sieben auf einen Streich. Ich werde Ihnen erzählen, wie es dazu kam. Die Welt hat ein Recht auf meine Geschichte, zumal sie einen Sinn ergibt.
Die Geschichte des Mauerfalls ist die Geschichte meines Pinsels, aber wie läßt sich dieser Ansatz in einem Buch unterbringen, das als eine nobelpreiswürdige Kreuzung von David Copperfield und Ein Zeitalter wird besichtigt konzipiert ist? Ich habe zwei Jahre ohne Ergebnis an einer Lösung getüftelt – und jetzt spüren Sie mich auf. Sie verstehen, daß Sie mir nicht ganz ungelegen kommen? Wenn ich über meinen Schwanz schon nicht schreiben kann, werde ich eben darüber reden. Und das sind keine Pennälerprotzereien, sondern Mosaiksteine der historischen Wahrheit, und wenn Sie nicht wollen, daß noch Fragen offenbleiben, müssen Sie schon akzeptieren, daß meine Schilderungen ziemlich schwanzlastig geraten.
Daß ich ausgerechnet Ihnen die Geschichte meines Schwanzes erzähle, hat nicht nur mit Ihrer Spürnase zu tun, sondern vor allem mit Ihrer Visitenkarte. Wann bekommt man schon die Chance, sich einem Korrespondenten der New York Times anzuvertrauen! Zumal ich mich frage, wo Sie jemanden mit meinem Steckbrief – »Ende der Moderne«, »Ende der Geschichte« und so weiter –, wo Sie so jemanden präsentieren? Doch nur auf der Titelseite! Woanders geht’s gar nicht! Was für eine Aussicht: Ich, Beendiger der Geschichte, auf der Titelseite der New York Times, dem Sprachrohr des liberalen Weltgewissens. (Um solche Formulierungen bin ich nie verlegen.) Womit mir meine zweite Titelseitenpräsenz bevorsteht, denn bereits als Neunjähriger kam ich auf die Titelseite der NBI, Neue Berliner Illustrierte, der auflagenstärksten Wochenillustrierten. Das war in der dritten Klasse, als wir einen neuen Schuldirektor bekamen. Sinnvolle Freizeitgestaltung war nach seinem Verständnis nur innerhalb von Arbeitsgemeinschaften denkbar, und weil die Beteiligung in Arbeitsgemeinschaften auch in die Statistik einging, peilte unser Direktor als Kampfziel an, daß hundert Prozent seiner Schüler in Arbeitsgemeinschaften mitmachen. Rein gefühlsmäßig neigte ich der AGSegeln zu, aber meine Mutter wollte nicht, daß ich irgendwo bin, wo man sich die Finger einklemmen kann oder – »Ich weiß doch, welche Zustände auf Segelbooten herrschen!« – Splitter einreißt. Daß Holzsplitterverletzungen zu Blutvergiftung, Amputation und Tod führen, war mir durchaus bewußt; immer das Schlimmste zu erwarten und sich gegenseitig auch tiefbesorgt darin einzuweihen war bei uns gang und gäbe. Wenn sie mir etwas Gutes tun wollte, dann war sie tiefbesorgt. Mein Vater, autoritär und rechtschaffen, interessierte sich nicht für Nebensächlichkeiten; er sprach fast nie mit mir, und wenn, nur das Nötigste. »Steck dein Hemd rein!« oder »Sei still!« oder »Komm jetzt!«. Ansonsten war er der Mann, der abends in Trainingshosen vor dem Fernseher saß, die Füße in einer Schüssel Kaltwasser.
»Mach, was du willst, aber zum Segeln gehst du nicht!« Also kein Segeln, dafür AG Junge Naturforscher. Es war Sitte, diese lästigen Arbeitsgemeinschaften immer an die jüngsten Fachlehrer abzuwälzen, und so wurde unsere Arbeitsgemeinschaft durch einen Physiklehrer betreut – der Mann hieß Küfer und hatte mit seinen siebenundzwanzig Jahren »vom vielen Denken«, wie er sagte, eine beträchtliche Glatze. Ich hatte keine Ahnung, was Physik ist. Ich dachte, junge Naturforscher werden Schildkröten füttern oder so was. Herr Küfer konnte mit uns nicht viel anfangen und ließ Unterrichtsfilme über die Weltwirtschaftskrise und den Spanischen Bürgerkrieg rückwärts durch den Projektor laufen. Es waren unvergeßliche Bilder, zum Beispiel, als ein Schutthaufen plötzlich zu stauben begann und sich in ein Haus verzauberte oder als Flugzeuge wie mit einem Magneten Bomben einsammelten, die ihnen von unten entgegentrudelten ... (Als Küfer ein paar Jahre später geschaßt wurde, hieß es unter anderem, er hätte durch rückwärtslaufende Kriegsfilme pazifistische Illusionen geweckt.) Dann sah ich im Fernsehen eine Sendung, in der es um meterhohe Betonmauern ging, die an lärmbelasteten Straßen als Schallbrecher dienten. Da in jener Sendung zweimal das Wort »physikalisch« fiel, fragte ich Herrn Küfer, wie so ein Schallbrecher funktioniert. Herr Küfer griff meine Anregung dankbar auf und vertiefte sich in die Theorie der Akustik. Nach ein paar Wochen hatte die AG Junge Naturforscher einen »Experimentierbaukasten Akustik« entwickelt, den wir zur Eröffnung der »Messe der Meister von morgen« präsentierten. Dabei blieb es nicht – wir wurden zur Kreismesse delegiert und dort für die Bezirksmesse nominiert. Und ich sollte als Standbetreuer eingesetzt werden! Ein Schüler der 3. Klasse als Experte für akustische Experimente! Was würde mein Vater dazu sagen? Ein Vater, der so wenig an mich glaubte, daß er sich nicht mal der Anstrengung unterzog, einen vernichtenden Satz wie »Ach, aus dem Jungen wird doch nichts!« zu Ende zu bringen; er winkte nach den Worten »Ach, aus dem Jungen ...« immer nur resignierend ab. Er sagte nicht mal meinen Namen! Niemals habe ich aus seinem Munde meinen Namen gehört! Ich habe zwar einen Vornamen, der jenseits der Grenze des Zumutbaren liegt – ich heiße Klaus (putzig, nicht wahr? reimt sich auf Maus und Haus), aber daß er meinen Namen völlig ignorierte, kränkt mich irgendwie. Nun wollte ich ihn in seinem Büro besuchen, damit er mich geläutert seinen Kollegen vorstellen kann, mit Worten wie: »Das ist mein Sohn, und er ist gekommen, um mir zu berichten, daß er als Messestandbetreuer eingesetzt wird, in einer wissenschaftlichen Angelegenheit, von der ich leider, leider nichts verstehe ...«
Ich war nie bei meinem Vater im Büro gewesen – er arbeitete im Ministerium für Außenhandel –, aber der Stadtplan sagte mir, wo das Ministerium lag; ich mußte zwanzig Minuten mit der U-Bahn fahren. Ich kam bis zum Pförtner, der in mehreren Verzeichnissen nach der Zimmernummer meines Vaters suchte. Mein Vorname ist sicher ein Ärgernis, aber eine wahre Katastrophe spielt sich im Nachnamen ab: Immer buchstabierbedürftig und garantiert unaussprechlich, zumindest auf Anhieb; ich habe damit schon Wetten gewonnen. Uhltzscht. Vom Pförtner des Außenhandelsministeriums blieb mir die feuchte Aussprache in Erinnerung; jedesmal, wenn er Uhltzscht sagte, wurde die Trennscheibe besprenkelt. »Einen Uhltzscht haben wir hier nicht.« Damit begann er, und dabei blieb er. Er hatte den Namen nie gehört und konnte ihn nirgendwo finden. Ich fuhr ratlos nach Hause, und als ich meinen Vater zum Feierabend fragte, wo er denn arbeitet, murmelte er was von Außenstelle. Ich ging betroffen, um nicht zu sagen geschockt, in mein Zimmer. Natürlich! Außenstelle! Endlich ein handfester Anhaltspunkt zur ewigschlechten Laune meines Vaters: Abgeschoben auf einen Außenposten, blieb ihm die große, strahlende Karriere versagt! Mein Vater, ein Außenseiter einer Außenstelle beim Außenhandel, im Inneren seines Herzens einsam wie ein Leuchtturmwärter, zerfressen von Enttäuschung ob der Schlechtigkeit der Menschen, die ihn eiskalt auf einen Außenposten verbannten. Natürlich, mein Vater ist der größte Kotzbrocken, dem ich je begegnet bin, aber das ist noch lange kein Grund, schlecht über ihn zu denken! – »So, und wer hat hier den Vorhang wieder mal nicht zugezogen?« Derjenige kann nur ich gewesen sein, aber was für einen Vorhang meinte er? Ich kam aus meinem Zimmer. Da stand er mit seinem ultimativen Gesichtsausdruck und zeigte pathetisch aufs Schuhregal, dessen Vorhang nicht zugezogen war. Nun gut, er kam von der Außenstelle nach Hause, jetzt, wo ich es wußte, sah ich ihn mit ganz anderen Augen. Ich zog den Vorhang zu, er stieg aus seinen Schuhen, zog den Vorhang wieder auf, stellte die Schuhe ins Regal, zog den Vorhang zu und sah mich höhnisch an: So einfach ist das! Und als ich ihm jetzt endlich sagte, daß die Versuchsanordnung der AG Junge Naturforscher zur Bezirksmesse delegiert wurde, als ich ihm endlich stolz erzählte, daß ich als Standbetreuer eingesetzt werde, ich, ein Neunjähriger, wissen Sie, was er dazu sagte? Er schnippte mit dem Finger an die Knopfleiste meines Hemdes und sagte: »Bis dahin wirst du hoffentlich gelernt haben, wie man sich ordentlich anzieht.«
Vergessen Sie’s. Die Messe sollte mit einem Rundgang »wichtiger Repräsentanten« eröffnet werden. Laut Protokoll würde es auch eine Visite an meinem Stand geben. Mein Schuldirektor und ein paar Leute, die ich nicht kannte, präparierten mich für diese Augenblicke und redeten pausenlos von Ehre und Bedeutung. Sie können sicher sein, daß mein Hemd richtig geknöpft war. Vom eigentlichen Ereignis weiß ich nur noch, daß ein paar dicke schwitzende Männer an meinen Stand kamen – was mich sehr verwirrte, weil mir RepräsenTanten angekündigt wurden und ich daher mit Frauen rechnete. Meine auswendig gelernte Präsentation wäre mißtrauischer ausgefallen als geplant, aber einer der Männer, vermutlich der wichtigste, ließ mich nicht zum Zuge kommen und machte einen Witz – den ich nicht verstand und nur als Witz erkennen konnte, weil die anderen Männer im Troß um das anbiederndste Lachen konkurrierten. Zwei Fotografen gingen in Stellung, der Witzchenerzähler klopfte mir auf die Schulter und resümierte: »Dann man weiter so.« Der ganze Auftritt dauerte höchstens zwei Minuten, und als sie gegangen waren, grübelte ich, wieso diese Männer RepräsenTanten genannt werden.
Am nächsten Tag war ich in der Berliner Zeitung. Meine Mutter kaufte gleich dreißig Exemplare und schickte mich nach weiteren zehn. Wenige Tage später war ich sogar auf der Titelseite der NBI: Ich, als Neunjähriger, auf der Titelseite der auflagenstärksten Illustrierten, neben einem der mächtigsten Männer des Landes! Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln: Und der Klaus, Ja, der Klaus, Sag mal, der Klaus, Also, der Klaus, Ist das wahr, der Klaus ... Mein eifriger Direktor setzte einen Auszeichnungsappell an. Man sah mir hinterher. Man raunte sich zu: »Das ist er.« Solange ich an diese Schule ging, hing die NBI-Titelseite gerahmt im Foyer. Als die Pionierzeitung »Trommel« nachzog und einen ganzseitigen Artikel über mich brachte, war meine Mutter schon so abgestumpft, daß sie nur noch acht »Trommel« kaufte.
Ich könnte Scheiße heulen, aber es war so: Mein heißester Wunsch ging in Erfüllung. Ich war kein Versager – das Titelbild war der Beweis! Als Junger Naturforscher und Meister von morgen auf der Titelseite der auflagenstärksten Illustrierten. Die werden doch wissen, warum sie ausgerechnet mich auf die Titelseite bringen. Bin ich der verheißungsvollste Meister von morgen, bin ich ein Nobelpreisträger auf der Warteliste? Auf dieser Wolke schwebte ich durch den Alltag. Der zukünftige Nobelpreisträger ist artig, der zukünftige Nobelpreisträger zieht gelassen den Vorhang vom Schuhregal zu, der zukünftige Nobelpreisträger hört, wenn man ihm was sagt. Was soll mir schon passieren? Früher oder später würden sie Straßen nach mir benennen. Ich begann Tagebücher zu führen. Obwohl ich mich in meinen Tagebüchern eher an die Nachwelt wandte, hatte ich im Alltag auch immer ein paar Worte für meine Mitmenschen übrig, was ich mir hoch anrechnete.
Und meine Mutter! Endlich konnte ich ihr in die Augen sehen! Nein, es war nicht umsonst, daß sie acht Jahre ihrer beruflichen Entwicklung meiner Erziehung geopfert hatte. Sie hatte nicht nur einen gewöhnlichen artigen, fleißigen, sauberen, klugen und somit ganz vorzeigbaren Jungen – sie hatte einen zukünftigen Nobelpreisträger herangezogen. Das Ergebnis von acht anstrengenden Jahren, in denen ich beharrlich dazu angehalten wurde, immer »im ganzen Satz« zu antworten – andernfalls wurde ignoriert, was ich sagte –, acht Jahre, in denen sie mit mir nur didaktisch wertvolle Spiele wie Merk fix! und Mühle und master mind und nur ausnahmsweise Mikado spielte – dafür aber niemals Mensch ärgere dich nicht,Schwarzer Peter oder – Gipfel des Stumpfsinns – Krieg und Frieden.
Dank der Titelseite wurde ich auch mein eigener Schlagzeilenerfinder. Meistens suchte ich nach der passenden Schlagzeile für meine augenblickliche Verrichtung. Wenn ich mit meinem Kumpel Bertram einen netten Nachmittag verbrachte, erwartete ich am nächsten Tag auf Seite 2 im Neuen Deutschland »Freundschaftliche Begegnung zwischen Klaus und Bertram«. Wenn ich fingerschnippend darauf wartete, vom Lehrer rangenommen zu werden: »Wissenschaftlicher Nachwuchs meldet sich zu Wort«.
Es ging jahrelang so weiter – bis ich mit einem Originalexemplar der BILD-Zeitung konfrontiert wurde. Ganz unvorbereitet traf es mich nicht; hin und wieder hatte ich schon Faksimiles der BILD-Titelseite gesehen, und eine Lehrerin benutzte des öfteren den Ausdruck westliche Gazetten. Aus dem Zusammenhang erschloß ich, daß es sich bei Gazetten um so eine Art Zeitung handeln muß. Ich durfte also etwas Besonderes erwarten, etwas, das wie eine Zeitung aussieht, aber eine heimtückische Gazette ist. Und dann die Schlagzeile, aber ehe ich die unvergeßliche Schlagzeile verrate, möchte ich die Präsentation würdigen: So dicke Lettern! Buchstaben, wie aus einem Felsblock gehauen! Der Begriff Blockbuchstaben bekam plötzlich so etwas Bildhaftes! Wenn der Titel doch nur WELTUNTERGANG! gewesen wäre, aber er lautete – was noch schlimmer war – SEX-SKANDAL BEI DER POLIZEI! Schrecklich! Daß die Polizei, die Hüterin des Gesetzes, Beschützerin der unbescholtenen Bürger, die Tag und Nacht für Ruhe und Ordnung sorgt, so an den Pranger gestellt wird! Haben denn die westlichen Gazetten überhaupt keine Hemmungen? Wieso hetzen die gegen die Polizei? Die Polizei bekämpft die Verbrecher! Wer die Polizei beleidigt, steht auf der Seite der Verbrecher! Oder sehen Sie das anders? Und wieso müssen die der Polizei ausgerechnet einen Sex-Skandal Vorhalten – schrecken die westlichen Gazetten denn vor gar nichts zurück? Und was mich mit meinen dreizehn Jahren am meisten verunsicherte, war die Vorstellung, meinen Nobelpreis ausgerechnet in einem Moment überreicht zu bekommen, wenn ich von einem Ständer heimgesucht werde. Was dann? Werde ich als SEX-SKANDAL BEI NOBELPREISVERLEIHUNG! enden?
Davon abgesehen, wollte ich meinen Namen, so unerfreulich er war, gedruckt sehen – und zwar so oft wie möglich. Ich beteiligte mich an Leserdiskussionen. Und an Preisausschreiben. Auf meinem Schreibtisch – ich hatte seit der ersten Klasse einen eigenen Schreibtisch – lag immer ein Stapel Postkarten. Ich durchforstete alle Zeitungen meiner unmittelbaren Reichweite nach Preisausschreiben, und mit Fragen der Sorte Wieviel Rillen hat eine Langspielplatte? kann mich seitdem keiner mehr reinlegen. Die zweite Strategie, mit der ich meinem Namen eine regelmäßige Medienpräsenz sicherte, bestand in der Teilnahme an Leserdiskussionen der Trommel, der Frösi – im Grunde schrieb ich an fast jede Zeitung, die Leserbriefe veröffentlichte. Zu jedem Thema hatte ich eine Meinung, die ich in druckreifen Formulierungen ausdrücken konnte. Ich führte Buch über meine Medienpräsenz und witterte Schiebung, wenn ich sechs, acht, ja einmal sogar vierzehn Wochen nicht gedruckt wurde. Ich, ein scheißkluger Klugscheißer, ich bildete mir sonstwas ein auf meine Leserbriefe, die ich alle meiner Mutter vorlas – natürlich erst, wenn sie gedruckt waren. Das hielt ich für das Wahre! Wie sollte ich daran zweifeln können? Kindheit ist die Zeit ohne Zweifel. Igitt, mir ist ein Aforismus rausgerutscht! Ich verabscheue Aforismen! Besonders die eigenen. Aber auch sonst: Sie haben das gewisse Etwas für fettarschige, behäbige Zuhörer, aha, aha, interessant, so habe ich es noch gar nicht gesehen ... Seit meinen Leserbriefen habe ich Übung in Aforismen, sie unterlaufen mir ständig, sie fließen aus mir raus wie Dünnpfiff. Wo war ich? Kindheit, Zweifel, ja, ein Kind muß glauben, wo es nicht versteht, aber wenn es zweifelt, hört es auf, Kind zu sein. Aforistisch, nicht wahr? Hätte garantiert die Qualifikation zum Abdruck in der Abschlußdiskussion »Zu jung zum Erwachsensein? Zu alt für ein Kind?« gereicht. Jugend ist die Zeit der Zweifel, und wo Zweifel enden, endet Jugend. Wenn das nicht Dünnpfiff-Denken ist, ohne Konsistenz, ohne Schwere – aber mein Kopf ist voll von diesem aforistischen SchubiDubi. Ich komme gar nicht zum Erzählen, weil andauernd diese Aforismen rufen: »He! Sprich mich aus! Erfinde mich! Formulier mich geistvoll! Du willst doch geistvoll sein! Du willst doch berühmt sein! Alle berühmten Menschen sind geistvoll! Also sei geistvoll, und sprich mich aus!« Ich möchte einmal den Mund auftun können, ohne das Gefühl zu haben, in ein hingehaltenes Mikrofon zu sprechen. Und jetzt sitzen Sie mit ihrem Diktiergerät vor mir, dem Beendiger der Geschichte, und ich habe die Chance, auf die Titelseite der New York Times zu kommen. Sie ahnen, was Sie mir antun. Ich könnte reden, wie ich es schon immer wollte, ich könnte reden, als täte ich Presseerklärungen kund oder persönliche Stellungnahmen. Ich könnte resümieren, verlautbaren, einschätzen – aber die Plauderei am Rande kann zum Verhängnis werden. Sie waren noch mit der Aussteuerung des Aufnahmepegels beschäftigt, ich habe mit meinem Titelseiten-Syndrom kokettiert – und was habe ich ausgebuddelt? Kränkung und Verunsicherung. Kein Wunder, daß ich nach zwei Jahren Nachdenken gerade einen Absatz Lebensbeschreibung fertigbrachte. Was bleibt uns also anderes übrig, als weiterzumachen wie bisher? Sie lassen mir die Vorstellung, daß wir noch bei der Sprechprobe sind – und bitte, tun Sie hin und wieder wenigstens so, als drehten Sie an den Knöpfen –, und ich rede weiter bis zum Schluß. Es wird die berühmteste Sprechprobe der Menschheitsgeschichte! Das will was heißen, denn zum Thema »Berühmte Sprechproben« fällt mir immerhin Ronald Reagan ein und sein von Herzen kommendes »Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, daß ich soeben ein Gesetz zur Bombardierung Rußlands unterzeichnet habe«. Genauso machen wir es auch: Ich darf alles sagen, was mir in den Sinn kommt, ohne daß ich dafür festgenagelt werden kann – ist ja nur eine Sprechprobe. (Nach all den »Wortmeldungen«, »Zwischenrufen«, »Protokollen« und »Befragungen« droht uns eine Verbreitung des Materials unter dem Titel »Sprechprobe«. Vermutlich gibt es ohnehin schon ein halbes Dutzend Entwicklungsromane, die so heißen.) Aber, bitte, glauben Sie mir: Ich wäre nicht so ausführlich, wenn ich es nicht müßte. Ich plaudere nicht wahllos, sondern ich beantworte mit aller Konzentration Ihre Frage. Ich habe das Ende stets im Auge, und was auf Sie zunächst konfus wirkt, das bekommt noch seinen Sinn. Denn in jener Nacht liefen alle Fäden zusammen. Ich war’s – aber wer war ich? Nun, um es kurz und prägnant zu sagen und Sie mit den zentralen Kategorien meiner Ausführungen vertraut zu machen: Ich war auf der Flucht vor meinem Schwanz, und als mir zufällig die Mauer in die Quere kam ...
Also was ist – wechseln Sie gleich die Kassette?
Das 2. Band: Der letzte Flachschwimmer
Ich kam tatsächlich als Sturzgeburt auf einem Wohnzimmertisch in Brunn bei Auerbach im Vogtland zur Welt, »in Abwesenheit geschulten Personals« (diese Formulierung stammt von meinem pedantischen Vater, er meint »ohne Hebamme«). Meine Eltern wohnten aber in Berlin, in der Lichtenberger Pfarrstraße, in einem Altbau, aus dem wir, als ich vier Jahre alt war, in einen Achtzehngeschosser am U-Bahnhof Magdalenenstraße zogen, genau gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit. Die Gegend heißt »Frankfurter Allee Süd«, abgekürzt FAS. Erwarten Sie nicht von mir, daß ich bereits beim Einzug eine nennenswerte Meinung zu dieser Wohnlage hatte – ich weiß lediglich, daß ich unseren Fahrstuhl aufregend fand. Ich mußte nicht in den Kindergarten, sondern saß glücklich zu Hause, hantierte mit meinen Buntstiften und malte Bilder, über die meine Mutter immer wieder in Verzückung geriet – sie strahlte, sie lachte, sie lobte, und wenn mein Vater zum Feierabend nach Hause kam, präsentierte sie ihm überschwenglich meine »Malbilder«. Er allerdings interessierte sich nicht für meine »Malbilder«, und ich hatte immer das Gefühl, daß es nicht das ist, was er von mir erwartet. Daß er immer so mürrisch war, mußte mit seiner Arbeit zusammenhängen; er war Außenhändler, also etwas, wovon ich sehr konkrete Vorstellungen hatte – wer außen Händler ist, muß Händler an der frischen Luft sein, also eine Art Straßenhändler. Was mir als der erbarmungsloseste aller Berufe vorkam, seitdem ich auf dem Weihnachtsmarkt einen Zuckerwatteverkäufer gesehen hatte, der sich frierend an seinen Becher Tee klammerte. Ein Bild des Jammers. Mir leuchtete ein, daß man von diesen Außenhändlern keine gute Laune erwarten sollte, ihr Dasein war hart und voller Entbehrungen. Während ich mit meinen Malbildern beschäftigt bin, muß mein Vater zähneklappernd auf der Straße stehen oder sich vom Regen durchweichen lassen – und dann wundere ich mich, warum er nie in Familienvaterlaune die Wohnungstür aufschließt: »Hallo, hallo, was hat denn unser kleiner Indianer heute gemalt?« Als eifriger Hörer meiner Märchenplatten hatte ich auch stets das Schicksal von Hänsel und Gretel vor Augen, die in den Wald geschickt werden mußten, obwohl deren Vater, ähnlich meinem, einer anstrengenden Arbeit nachging, um seine Familie ernähren zu können. Als ich meine Mutter am Telefon sagen hörte Ich will Klaus eigentlich nicht in den Kindergarten schicken, war ich auf das entsetzlichste bestürzt, da ich den Kindergarten für einen Garten hielt, in den die Hänsel und Gretel von heute geschickt werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein prägendes Kindheitserlebnis hatte; mein eindrucksvollstes Kindheitserlebnis weiß ich auf Anhieb: Als sich mein Vater prügelte. Und um die volle Wahrheit zu sagen: Als er sich für mich prügelte. Das muß man sich mal vorstellen: Mein Vater, ein Muster an Rechtschaffenheit, prügelt sich, obwohl doch jedes Kind weiß, daß man sich nicht prügeln soll. Was war geschehen? Mein Vater war mit mir zum Eröffnungsnachmittag eines neuen Spielplatzes gegangen, und mir lief ein kleines Mädchen in die Schaukel; ich konnte nichts dafür, ich sauste mit der Schaukel herunter und traf sie. Ein fremder Mann, vermutlich ihr Vater, war in zwei Sätzen bei mir und schüttelte mich wütend durch, aber dann kam mein Vater und entriß mich dem Mann. Daraus entwickelte sich eine Rangelei. Die Männer packten sich an den Jackenaufschlägen und sahen sich drohend an. Mir kam es so vor, daß sehr viel rohe Kraft im Spiel war. Und daß es ernst war. Sie schoben und stießen sich durch den Buddelkasten, und ihre Gesichter waren so wütend, so verzerrt – so hatte ich meinen Vater noch nie gesehen. Ich hatte Angst um ihn. Schließlich stellte der andere Vater meinem Vater ein Bein. Mein Vater flog in den Sand. Der andere Vater warf mit der Schuhspitze eine Ladung Sand über meinen Vater. Mein Vater rappelte sich auf und sagte zu mir: »Komm.« Auf dem Heimweg sprachen wir kein Wort miteinander. Oh, das hatte ich nicht gewollt! Er, der es als Straßenhändler schon schwer genug hat, wird meinetwegen sogar zu Boden gestoßen! Und mit Sand beworfen! Werde ich jetzt in den Kindergarten geschickt?
Leider habe ich auch meine Mutter in eine Situation manövriert, in der sie mir unter Mißachtung aller Benimmregeln beistehen mußte; die Geschichte habe ich so oft gehört, daß ich heute kaum noch Erzählung und eigene Erinnerung auseinanderhalten kann. – Ich bin fünf und habe mich an Erdbeeren überfressen, was ich allein der Tatsache verdanke, daß meine Mutter beim Sonntagsausflug die Gelegenheit ergriff und am Straßenrand drei Spankörbe mit Erdbeeren kaufte, die sie in den Kofferraum des Wartburg legte, wo sie – Hinfahrt, Rückfahrt, Sommerhitze, Katzenköppe – zu einer unvergeßlichen Pampe wurden (noch heute meine Assoziation zum Wort Biomasse). Um daraus Marmelade zu machen, fehlte der Zucker – richtig, es war kein Sonntagsausflug, es war ein Samstag, sie hätte auch am nächsten Tag keinen Zucker bekommen, und so blieb uns nichts übrig als die Erdbeeren »ganz spontan« zu essen. (Sind wir nicht herrlich spontan? Wir machen samstags Sonntagsausflüge, und wenn uns nichts anderes übrigbleibt, essen wir so viele Erdbeeren, wie wir können.) Als ich nachts vor Jucken nicht mehr schlafen konnte und meine Mutter mich und mein Bettchen vergeblich nach Ungeziefer abgesucht hatte, diagnostizierte sie Nesselfieber, eine Allergie gegen Nachtschattengewächse, zu denen auch Erdbeeren gehören, und rief in der Notaufnahme des Krankenhauses an, ob das entsprechende Serum verfügbar ist. Mein Vater hatte am Abend etwas Wein getrunken, was es ihm – ich erwähnte schon seine Rechtschaffenheit? – juristisch unmöglich machte, uns ins Krankenhaus zu fahren. Meine Mutter nahm ein Taxi und tat das, was sie immer tat – sie ermahnte mich: Klaus, du darfst nicht kratzen, du mußt jetzt tapfer sein, wenn man kratzt, wird es immer nur noch schlimmer, Kratzen hilft nicht, hat noch nie geholfen, du kratzt dir bloß die Haut auf, und dann dringen Keime ein, und alles entzündet sich, also beiß die Zähne zusammen, und denk an was Schönes, und außerdem ist es ja bald vorbei ... Ich heulte und war völlig verzweifelt, und der Fahrer brummelte Nu lassen Se ihn doch kratzen, worauf sie meinte, daß sie schon wisse, was zu tun sei, schließlich sei sie hier die Ärztin. Der Taxifahrer fuhr rechts ran und sagte Und ich bin hier der Fahrer. Worauf ihn meine Mutter aus Leibeskräften anschrie: »Fahren Sie meinen Jungen aufs Rettungsamt!«
Mein Schlüsselerlebnis mütterlicherseits: Mama schrie nur, wenn ihr Junge – ich! – aufs Rettungsamt mußte. Jawohl! Ich bin Zeuge! Wenn ihr Junge aufs Rettungsamt mußte, verlor sie ihre Manieren, ihre Beherrschung, ihre Contenance – mit einem Wort: alles! Dieser eine Satz ist so intensiv, daß er mich heute noch schaudern läßt: Fahren Sie meinen Jungen aufs Rettungsamt! Der Schrei einer verzweifelten Mutter, wo gibt’s den noch? In Süditalien? Im Kino der entfesselten Leidenschaften? Und auf ihre Selbstlosigkeit (um nicht zu sagen, ihren Opfermut) war Verlaß: Noch als ich neunzehn war und meine beiden Arme für sechs Wochen in Gips lagen, übernahm sie das Arschwischen. Teufel, ja! Mir ging es wie einem Zweijährigen – aber was hätte ich ohne sie getan? Hätte ich jedesmal gebadet und auf meiner eigens mit einem Lappen behängten Ferse unruhig Platz genommen? Eine Spezialvorrichtung gebaut? Was tun, wenn beide Arme in Gips liegen? Eine blöde Situation, aber meine Mutter bewies erneut Einfühlungsvermögen: »Da ist doch nichts dabei!« sagte sie, oder »Es muß doch gemacht werden!« oder »Ich bin doch deine Mutter«. Und wie sie sich aufopferte! Ich sollte jedesmal eine Rückwärtsrolle machen, eine Rückwärtsrolle mit heruntergelassenen Hosen im Korridor, wo Platz für uns beide war. Da lag ich dann, streckte ihr mein Arschloch entgegen, und sie putzte es ab – so gründlich, als ob es ihr eigenes wäre.
Oh, Mr. Kitzelstein, kann ich denn nie auf meine Mutter zu sprechen kommen, ohne eine zerknirschte Dankbarkeit zu fühlen? Daß ich der Verursacher ihres Karriereknicks bin, ist nicht von der Hand zu weisen: Als ich kam, mußte sie ihre Facharztausbildung unterbrechen. Sie hat es selbstverständlich nie erwähnt oder auch nur durchblicken lassen, solche Opfer erbrachte sie stumm. (Auch wenn ihr der Versprecher mit dem »Klautz am Bein« noch heute passiert.) Ich mußte zehn Jahre alt werden, um zu der Erkenntnis vorzudringen, daß ich ihren Doktortitel verhindert habe. Sie hatte Freude an ihrer Arbeit, sie war Lichtenbergs Hygieneinspektorin, sie ging darin auf, sie hatte ihr Fachgebiet, sie hatte einen Kittel, ein Büro, ein Telefon, ein halbes Dutzend Assistentinnen und viele, viele Termine ... Hygieneinspektorin ist nur die halbe Wahrheit. Sie war eine Hygienegöttin. Sie inspizierte Bahnhofstoiletten und Großküchen, Imbißbuden, Kühlhäuser und Schwimmhallen, Lebensmittelabteilungen und Duschräume. Sie war bekannter als der Lichtenberger Stadtbezirksbürgermeister, und charakterlich war sie mit einem Eigenschaftsbündel gesegnet, das sonst nur bei Hauptfiguren dreizehnteiliger Fernsehserien vorkommt: Ihre Zuverlässigkeit! Ihre Kompetenz! Ihr Engagement! Ihre Unbestechlichkeit! Ihre spektakulärste Maßnahme war die vierzehnmonatige Sperrung des Alfred-Brehm-Hauses, der Tropenhalle des Berliner Tierparks. Meine Mutter setzte durch, daß die Besucher gegen herabfallende Vogelscheiße zu schützen sind. Übrigens habe auch ich meine Mutter einmal in Aktion erlebt, und was soll ich Ihnen sagen: Sie war perfekt! Generationen von Hygieneinspektoren werden sich an dieser Frau messen lassen müssen!
Oh, Mr. Kitzelstein! So kommen wir nicht weiter! Gibt es keine Möglichkeit, über sie zu sprechen, ohne sofort ein Loblied anzustimmen? Kann ich meiner Mutter noch unterhalb einer Laudatio gerecht werden? – Meine Ironie ist unüberhörbar? Ich bin beruhigt.
Wenn schon mein Vater ein Stinkstiefel war und meine Mutter das Gegenteil, dann, so sagt meine Logik und mein Gefühl, müßte sie doch gut sein! Verstehen Sie: GUT! Ich ahne, daß ich jetzt den Tatsachen ins Auge sehen muß und eine Geschichte zu erzählen habe, die davon handelt, wie ich das kleinere Übel vergötterte. Was blieb mir denn übrig, als meine Mutter zum ganzen Gegenteil meines Vaters aufzubauen? Ach, ist das alles hoffnungslos ... Es kann doch nicht alles schlecht gewesen sein, um mal einen Ausspruch zu bemühen, den Helden wie wir blankziehen, wenn wir nicht mehr weiterwissen. Aber es muß sich doch auch etwas unverwechselbar Nettes über meine Mutter sagen lassen. Wenn ich ihr schon keine Chance gebe, will ich wenigstens so tun, als gäbe ich ihr eine. Mal sehen, ob ich drei ohne-Wenn-und-Aber-positive Eigenschaften oder Erinnerungen mit meiner Mutter verbinden kann. Abgemacht? Drei! Lassen Sie mich jetzt mal so richtig ins Schwärmen geraten, damit ich danach mit einem reinen schlechten Gewissen über sie herziehen kann. Die Welt soll ruhig wissen, daß hier ein undankbarer Sohn spricht, der sich sonstwie toll vorkommt, wenn er seine Eltern in den Schmutz zieht! – Nun, ich erwähnte schon, daß ich sie einmal als leibhaftige Hygieneinspektorin erlebte, da war ich in der zweiten Klasse, und mitten im Unterricht ging die Tür auf, und zwei Frauen, weiß wie Engel, standen in der Tür. Und die eine der beiden war meine Mutter! Sie stellte sich wie die liebe Märchentante vor die Klasse und erzählte uns, daß es kleine Tiere gibt, Läuse, die schädlich sind und jucken und auch stechen und die sich bei manchen Kindern in den Haaren verstecken oder dort ihre Eier ablegen, die ganz, ganz klein sind. Aber wir können uns darüber freuen, daß sie heute gekommen ist, um sich unsere Köpfe anzuschauen und die Läuse zu finden. Niemand muß Angst davor haben, daß es weh tut; sie sei zwar Ärztin, aber keine, die mit einer Spritze kommt, und wie eine Geschichtenerzählerin – und welches Kind liebt nicht Geschichtenerzähler? – erklärte sie, daß kein Kind etwas dafür kann, wenn es Läuse hat; es könnte jedem von uns passieren, und wir wollen deshalb auch niemanden auslachen, und wer das tut, zeigt dadurch nur, daß es ein sehr dummes Kind ist. Wir wollen wie bisher miteinander spielen und brauchen uns von keinem Kind wegzusetzen, denn ein befallenes Kind wird schon heute nachmittag behandelt – auch völlig schmerzfrei, »einmal Haare waschen mit unserem Geheimrezept«. Oh, nach dieser Ansprache waren wir geradezu versessen darauf, befallen zu sein. Geheimrezepte gehören bekanntlich neben Schatztruhen und Landkarten zu den wahren Dingen im Leben eines Achtjährigen. Wir mußten bloß Läuse haben! Wer von uns Läuse hätte, der wäre am nächsten Tag ein Held, ein Wissender für alle Tage, ein geheimrezepterfahrener Haudegen. Wir sprangen von unseren Stühlen auf, stürmten nach vorn und streckten meiner Mutter und ihrer Assistentin erwartungsfreudig unsere Köpfe entgegen: »Hab ich?« – »Und ich?« – »Ich vielleicht?« – Mit einem warmen Lachen erwehrte sich meine Mutter des Ansturms, schickte uns auf die Plätze zurück und begann mit der Untersuchung, bei der sie übrigens auch unsere Lehrerin untersuchte. Niemand schaffte die Qualifikation fürs Geheimrezept, leider, doch jedes Kind erfreute sich während des Inspizierens einer netten, persönlichen Bemerkung. »Du hast aber eine schöne Haarspange« oder »Wo hast du dir denn diese dicke Beule geholt?« oder, nach einem Blick ins Aufgabenheft, ins Ohr geflüstert: »Glaubst du wirklich, daß fünfzehn minus sechs gleich acht ist?«
Alle beneideten mich um meine gütige, freundliche, kluge und bedeutende Mutter, die Herrin der Geheimrezepte und schmerzloseste Ärztin weit und breit. Ich beneidete mich ja selbst um meine Mutter! Dieser Auftritt war unüberbietbar, und mir ist bis heute der Gedanke fremd geblieben, daß Läusebefall anrüchig sei. – Eine weitere wirklich zu würdigende Eigenschaft meiner Mutter war ihre Kunst des Betretens von Räumen. Ohne Übertreibung: Darin war sie königlich. Es begann, indem sie sanft die Klinke herniederdrückte und die Tür weich in den Rahmen zog. Dann öffnete sie die Tür einen Spaltweit und steckte den Kopf hindurch, neugierig und selig, als trete sie vor den Gabentisch. Sie nahm sich für einen Rundumblick zwei Sekunden Zeit, und dann lächelte sie und öffnete die Tür so weit, daß sie ganz eintreten konnte. Wunderbar! Auf die Art betrat sie jeden Morgen mein Zimmer, um mich zu wecken. Auf die Art betrat sie die Klasse zur Läuseinspektion. Auf die Art betrat sie jeden Raum. Sie hätte Räumebetreterin werden können, so toll machte sie das. Sie könnte in Stadtillus annoncieren: Betrete Ihre Räume, Pr. n. Vereinb. Mein Vater dagegen öffnete jede Tür so, als wollte er Geiseln befreien. Es kracht – und dann steht er da. Wenn er zum Feierabend nach Hause kam, konnte ich nie sicher sein, ob er die Wohnungstür aufgeschlossen oder eingetreten hatte. Aber meine Mutter ... Es tut mir so leid, über einen Menschen herzuziehen, der so traumhaft Räume betritt! Ich bin den Speichel nicht wert, mit dem ich angespuckt werden müßte!
Drittens: Sie konnte – übrigens, hätten Sie mir zugetraut, daß ich meine Mutter tatsächlich dreifach in den Himmel heben kann? Nun gut, sie hatte die Gabe – manchmal, nicht oft, nur hin und wieder, aber immerhin –, sie hatte die Gabe, die Dinge manchmal auf den Punkt zu bringen, und zwar in einer Klarheit und Schlichtheit, wie es ihrem kraftraubend-zerfaserten Naturell kaum zuzutrauen war. Ihr Zeitgemälde, erst vor wenigen Wochen während der »III nach neun«- Talkshow geseufzt: »Es gibt niemanden, der noch eine Idee hätte.« Dann schaltete sie ab. Sie brachte übrigens auch die nötige Respektlosigkeit auf, die Fernsehzuschauer als glotzende Masse abzuqualifizieren. Oder daß der Egoismus der vertrackteste Feind der Freiheit sei – ich brauchte Jahre, bis ich diese Bemerkung begriff und schließlich in mein Privatarchiv der Tausend Gesammelten Weisheiten aufnehmen konnte. Oh, Mr. Kitzelstein! Alles, was sie sagte, waren Prinzipien. Verstehen Sie, Prinzipien! Die einzigen Worte, die es wirklich wert waren, ausgesprochen zu werden, waren prinzipielle Worte. Da kannte sie kein Erbarmen, die wurden eingerammt wie Pflöcke. Die drei Worte, die sie auf eine einsame Insel mitnehmen würde: HIER! DAS! GILT! Ihr Kreuzzug gegen Jeans ist mir noch gut in Erinnerung. Was soll denn daran schick aussehen. Früher oder später bekommt man davon Krampfadern,dann ist es vorbei mit dem angeblichen Schick. Gerade Beinkleider müssen luftig sein. Da nutzt Baumwolle gar nichts. Wenn man da transpiriert. Das gibt doch Hautflechten. Und der Geruch. Ich frage mich,wieso sich Menschen in Hosen zwängen,die nur abschnüren. Wie soll da natürliche Darmbewegung funktionieren. Und gerade Männer. Was sie sich da antun. Es gibt Untersuchungen. Wissen Sie, warum die USA den Vietnamkrieg verloren haben? Weil mit Jeanskrüppeln kein Krieg zu gewinnen ist. Oder wie sie über Tätowierte herzog. Oder über Fußballspieler. Das sind doch erwachsene Menschen. Und die haben nichts Besseres zu tun,als einem Ball hinterherzurennen. Ich weiß ja nicht. Tiefste Fremdheit empfand sie gegenüber Menschen, die ungewaschen waren. Sie konnte mit einer Empörung, mit einer Verzweiflung, die Formulierung »Der war un-ge-waschen ...« benutzen, daß ihr eine Welle von Mitleid entgegenflutete – bloß weil ihr ein un-ge-waschener Mensch über den Weg gelaufen war. »Es ist doch wahrlich nicht zuviel verlangt, daß sich ein Mensch heutzutage ein Stück Seife kauft, um wenigstens das Nötigste rein zu halten!« Wie kann man da widersprechen!
Auch ihr Eintreten für hygienische Belange unseres Haushalts wurde entweder mit den Worten »Es ist doch wahrlich nicht zuviel verlangt ...« oder mit »Ich verlange doch wirklich nichts Unmögliches, aber ...« eingeleitet. So waren wir dank ihres Drängens mit einem Zweitstaubsauger gegen drohende Verwahrlosung gewappnet, falls der große 1100-Watt-Staubsauger eines Tages in Reparatur gegeben werden müßte. Unvergeßlich, mit welcher Militanz sie den Mikroben nachstellte! Jede »Ritze« in Küche und Bad wurde »versiegelt«, weil sich sonst »Mikroben einnisten« oder »Keime absetzen«. Undenkbar ein Restaurantbesuch ohne ihren Kommentar »Wie es in der Küche aussieht, will ich lieber nicht wissen!« Mit Begriffen wie »Wofasept«, »Eintrittspforten«, »Infizierung«, »Bakterien« und »Jodtinktur« war ich früh genug vertraut, um ermessen zu können, wie riskant eine Geburt auf einem Wohnzimmertisch war, noch dazu in einer Sommernacht auf dem Land, umgeben von Fliegen, »von denen kein Mensch weiß, wo die eben noch saßen«. Bei dem Gedanken daran wird mir jedesmal unbehaglich; habe ich sie nun, weil ich »nie die Zeit abwarten kann«, an den Rand des »nein, ich will lieber nicht daran denken« gebracht? Ich war noch gar nicht richtig da und hatte meine Mutter schon so gut wie auf dem Gewissen? Und trotzdem ging sie danach nicht arbeiten, sondern brach ihre Facharztausbildung ab, ersparte mir den Kindergarten und hielt mir ein Taschentuch hin, wann immer mein Näschen lief? War ich es wert?
Was wäre ich ohne sie? Wenn ich nur an meine Einschulung denke: Alle Kinder wurden in eine Aula geführt und auf die vorderen Plätze gesetzt; weiter hinten saßen die Eltern. Nun erlebte ich das erste Mal, wie schwierig mein Name ist; die Lehrerin, die uns auf die Klassen einteilte und mühelos alle Namen von einer Liste las – Lesen war in meinen Augen noch eine nahezu übermenschliche Fähigkeit –, kam plötzlich ins Stocken. »Klaus Uh... Uhl... Ultschl...«, stammelte sie, und da ich nicht annehmen konnte, daß sich mein Name schwieriger entziffern lasse als alle anderen, ahnte ich nicht, daß ich gemeint war, und blieb sitzen. Die Lehrerin zeigte die Liste dem Direktor, und gemeinsam puzzelten sie etwas zusammen, daß Ähnlichkeit mit Klaus Uhltzscht hatte – und ich blieb immer noch sitzen, bis ich die Stimme meiner Mutter hörte, die mir behutsam aus der letzten Reihe zurief: »Klaus, du bist gemeint.« Da stand ich auf und ging nach vorn, in dem vollen Bewußtsein, daß ich ohne meine Mutter auf meinem Platz geblieben und meine Einschulung mißglückt wäre, ich demzufolge nie zur Schule gehen könnte und immer dumm bleiben müßte. Und wieso wußte die Lehrerin meinen Namen nicht, aber die von allen anderen Kindern? Ich und die waren vermutlich zweierlei. Das waren bestimmt alles Kindergartenkinder, die so entwurzelt waren, daß sie sich von jedem x-beliebigen aufrufen ließen. Die Fragen, ob ich die Verhältnisse außerhalb unserer Wohnung für »verwahrlost« und mich für etwas Besseres hielte, hätte ich selbstverständlich bejaht. (Und im Grunde meines Herzens hat sich daran bis heute nichts geändert.) Was meinen Verdacht erhärtete: Diese Kinder redeten in einer völlig fremden Sprache. Konsequent von den Niederungen der Gosse abgeschirmt, geriet ich in ein Milieu, in dem berlinert wurde. Da, wo ich herkam, wurde ein blendendes Hochdeutsch gesprochen. Und nun? Ich trat von einem Bein aufs andere und verstand nichts. Völlige Hilflosigkeit, wenn einer auf mich zukam und mir nach der Lautfolge Mach ma hintn meen Hemde sauba,damit meene Mutta nich meckert! den Rücken zudrehte. Wie? Was? Rätselhaften, aber freundlich vorgetragenen Worten folgt ein abruptes Wegdrehen? Ich kannte dieses Ritual nicht! Erst als das Kind die mysteriöse Situation mit dem Wort »Arschloch!« beendete, hellte sich meine Miene auf. Endlich! Endlich ein Wort, das ich verstand: Aschloch! Das mußte das untere Ofentürchen sein! Doch was wollte mein Mitschüler damit sagen? Wozu die Erwähnung des unteren Ofentürchens?
Solche Geschichtchen sollte ich immer beim Abendbrot erzählen, dem Forum für Begebenheiten des Tages; wir haben, wie es sich für eine ordentliche Familie gehört, jeden Tag gemeinsam Abendbrot gegessen. Mein Vater hatte die Angewohnheit, mir kommentarlos immer noch eine Scheibe Brot auf den Teller zu werfen, so daß mir, nachdem meine Mutter Du willst doch groß und stark werden gesagt hatte, nichts anderes übrigblieb, als sie zu schmieren und zu essen. Irgendwann nahm ich mir kein Brot mehr, weil ich mich darauf verlassen konnte, daß mir noch eine Scheibe aufgenötigt wird. Unvorsichtigerweise vergaß ich einmal, dazu ein lustloses Gesicht zu machen, so daß er mir von da an des öfteren noch eine zweite Scheibe auf den Teller warf. Es gab eine Zeit, da litt ich Todesängste während des Essens ... Kennen Sie den Bolustod? Hatten Sie keine Mutter, die Ihnen von Zeit zu Zeit aus dem Wörterbuch der Medizin vorlas? Wir haben im Kehlkopf ein Nervengeflecht, das uns einen reflektorischen Herzstillstand bescheren kann, wenn sich die Speiseröhre verdickt, und die enge Auslegung besagt – die Auslegung meiner Mutter ist immer die enge Auslegung –, daß jeder Happen lebensgefährlich werden kann. Wollte mich mein Vater umbringen, wenn ich genötigt wurde, mehr zu essen, als mir lieb war? Bitte, lachen Sie nicht! Ich war sieben oder acht Jahre, also ein Alter, in dem man sich ohne weiteres vor Gespenstern oder Gewittern fürchten darf, und der Bolustod kam bei mir als eine ganz alltägliche Todesursache an, wie Mord oder Holzsplitterverletzung. Was meine Todesangst noch verstärkte, war, daß ich fast immer mit ausgetrocknetem Mund aß – und deshalb Klumpen hinunterschluckte, die bestimmt die Speiseröhre verdickten und mich extrem gefährdeten. Denn wenn ich zur Rede gestellt wurde, mich rechtfertigen mußte oder sonstwie festgenagelt wurde, was immer beim Abendbrot geschah, bekam ich einen trockenen Mund, so daß ich gezwungen war, mein Abendessen klumpenweise hinunterzuwürgen. Klumpenweise! Jede Verdickung der Speiseröhre konnte den sofortigen Tod bedeuten! Als ich eines Nachmittags im Fernsehen ein Gerichtsdrama sah und danach an den Eßtisch mußte, war der Übergang nahtlos. An unserem Eßtisch ereigneten sich Szenen wie in einem amerikanischen Schwurgericht! Ich war der Angeklagte und saß meinen Eltern gegenüber, die gleichzeitig Ankläger, Richter, Zeugen und die zwölf Geschworenen waren. Manchmal legte meine Mutter ein gutes Wort für mich ein, manchmal ließ mein Vater oder meine Mutter die Anklage fallen, oft endete es sogar mit einem Freispruch für mich – aber trotzdem war ich immer der Angeklagte, vom Tode bedroht. Da mein Vater fast nie mit mir sprach, mußte er mit meiner Mutter über mich verhandeln, wobei ich immer mit er bezeichnet wurde – daß er nie meinen Namen sagte, das hatten wir schon? »So«, sagte er, stellte das Messer auf und blickte in die Runde, womit die Verhandlung eröffnet war, »und wer hat heute wieder vergessen, die Wohnungstür abzuschließen?« Ich natürlich. Irgendwann ging es mir in Fleisch und Blut über, all meine Verfehlungen als Steckbrief zu reflektieren: Gesucht wegen Nichtabschließens der elterlichen Wohnung ...Tot oder lebendig!
Sie, barmend: »Eberhard ...«
Er, trotzig: »Wie oft hast du ihm gesagt ...«
Sie: »War doch nicht mit Absicht ...«
Er: »Als ob das ...«
Sie: »Tut er ja nicht wieder ...«
Er: »Wie oft hat er das schon ...«
Mr. Kitzelstein, meine Strafe traf mich nicht einfach so – nein, zuerst wurde diskutiert! Ganz offen und in meinem Beisein! Und so kontrovers! Und so ausgiebig! Wo ist da die Willkür? Bei so viel Sorgfalt blieb mir ja nichts anderes übrig, als mir ihre Anschuldigungen zu Herzen zu nehmen. Zumal es um eine ernste Sache ging – das Abschließen der Wohnung. Schließlich gibt es Einbrecher! Diese unrasierten maskierten Männer mit einer Taschenlampe und einem Riesenschlüsselbund, die überall die goldenen Kerzenständer stehlen! Das war schon schrecklich genug, aber was mir diese Sorte Mensch wirklich unheimlich machte, war, daß sie einbrechen, obwohl Einbrechen gesetzlich verboten ist! Was sind das für Menschen, die sich nicht mal von Gesetzen schrecken lassen! Ich fühle mich schon ertappt, wenn ich ein Verbotsschild überhaupt sehe! Ich bin insgesamt dreimal durch Führerscheinprüfungen gefallen, weil ich jedesmal in Panik geriet, als mich von weitem ein Einfahrt-verboten!