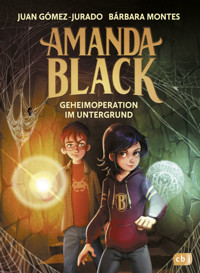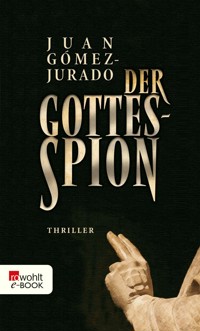9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Amanda Black-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen, eine Mission und kein Zurück.
Name: Amanda Black
Stärken: Geschicklichkeit, Kraft, Rätsel lösen
Status: Schatzjägerin & Superheldin
Ein mysteriöser Brief offenbart Amanda Black, dass sie die letzte Nachfahrin einer Schatzjäger-Familie ist. Ihre Mission? Gefährliche, magische Artefakte aus dem Verkehr ziehen, um die Menschheit zu schützen. Doch damit sie ihr Erbe antreten kann, muss Amanda bis ins Innerste der verlassenen Villa Black vordringen. Gelingt es ihr nicht, verliert sie mehr, als sie sich vorstellen kann ...
Start der atemberaubenden Action-Abenteuer-Reihe von Bárbara Montes und dem Meister des Thrillers Juan Gómez-Jurado
Alle Bände der
Amanda Black
-Reihe:
Amanda Black – Die Mission beginnt (Band 1)
Amanda Black – Geheimoperation im Untergrund (Band 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BÁRBARA MONTESJUAN GÓMEZ-JURADO
DIE MISSION BEGINNT
Aus dem Spanischen von Tamara Reisinger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die spanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Amanda Black – Una herencia peligrosa« bei B de Blok, einem Imprint von Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Text: © Bárbara Montes & Juan Gómez-Jurado 2021
Translation rights arranged by Antonia Kerrigan literary agency through SvH Literarische Agentur
Übersetzung: Tamara Reisinger
Umschlagillustration & Innenillustrationen: © David G. Forés 2021
Umschlaggestaltung: Guter Punkt GmbH & Co. KG
ah · Herstellung: aw/lh
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32557-2V002
www.cbj-verlag.de
Bárbara Montes widmet dieses Buch Alejandro, Jorge, Nerea und Cristina.Juan Gómez-Jurado widmet dieses Buch Andrea und Javi.
Kapitel 1
Ich bin zwölf Jahre alt, und morgen schreibe ich einen Test in Sozialkunde, für den ich noch nicht wirklich viel gelernt habe. Aber das ist gar nicht mein größtes Problem.
Mein größtes Problem ist, dass die Bank meine Tante Paula und mich noch vor dem Wochenende aus der Villa Black werfen wird. Zumindest war das mein größtes Problem – bis vor drei Sekunden.
Denn da wurde das Seil, an dem ich mich aus dem 180. Stock des Firmenhochhauses der Dagon Corporation (dem Dagonturm auf dem Dagonplatz 1) abgeseilt habe, durchgeschnitten.
Jetzt gerade stürze ich aus 477 Metern Höhe, mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 55 Metern pro Sekunde.
Nach meinen Berechnungen schlage ich in weniger als neun Sekunden auf dem Boden auf.
Aber auch das ist nicht mein größtes Problem.
Mein größtes Problem ist, dass derjenige, der das Seil durchgeschnitten hat, mein bester Freund ist.
Oder zumindest dachte ich, dass er das ist.
Kapitel 3
Ich kroch aus dem Lüftungsschacht und ließ meine Bücher, Hefte und Kulis zurück. Die würde ich später holen. Schnell rannte ich die Treppe nach oben bis in den vierten Stock und zu dem Fenster am Ende des Ganges. Ich hatte ziemliche Mühe, es zu öffnen. Alles an diesem Gebäude war in einem schlechten Zustand, aber niemand reparierte es. Nachdem ich eine Weile mit den Scharnieren gekämpft hatte, schaffte ich es endlich, das Fenster zu öffnen. Gerade noch rechtzeitig, denn ich war kurz davor, die Scheibe einfach einzuschlagen. Ein Schaden mehr oder weniger in diesem Haus würde auch nicht mehr auffallen.
Es regnete.
In Strömen.
Und ich hasse Regen.
Wenn es regnet, locken und kräuseln sich meine Haare, sodass ich aussehe wie ein frisch gewaschener Zwergspitz.
Grummelnd stieg ich durchs Fenster nach draußen und kletterte an der Dachrinne, die direkt daneben verlief, zum Fensterbrett im fünften Stock hinauf. (Das Fenster dort war mit Brettern zugenagelt, was ich wusste, weil ich es beim Spielen mit einem Kind aus der Nachbarschaft zerbrochen hatte. Daher war ich ja auch aus dem vierten Stock geklettert.)
Als ich mein Ziel erreicht hatte, drehte ich mich vorsichtig um, drückte mich mit dem Rücken an die Mauer und sah nach unten. Das hätte ich definitiv nicht tun sollen. Denn mir wurde sofort ein wenig schwindelig. Wenn ich hier runterfiel, endete ich als Aufkleber auf dem Gehweg. Und das würde bestimmt höllisch wehtun. Aber ich hatte es bis hierher geschafft, also musste ich auch weitermachen. Ich atmete ein paarmal tief durch und sprang dann auf das Gebäude gegenüber zu.
Kaum war ich in der Luft, wurde mir schlagartig klar, dass ich mich in der Entfernung verschätzt hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Vorsprung, den ich eigentlich hatte erreichen wollen, verfehlte, war hoch bis sehr hoch.
Ich schaffte es natürlich nicht.
Stattdessen erwischte ich gerade noch das Geländer eines Balkons. Ein paar Sekunden hing ich einfach nur da, bevor ich auf den Balkon hinaufkletterte. Allerdings hatte ich so viel Pech, dass ich wegen des Regens (habe ich schon erwähnt, dass ich Regen hasse?) mit einem Schuh abrutschte und beinahe wieder runtergefallen wäre.
Doch schließlich schaffte ich es, zurück nach oben zu klettern und mich am Geländer entlangzuhangeln, bis ich einen weiteren Vorsprung erreichte. Vorsichtig – um ja nicht noch mal abzurutschen – schob ich mich vorwärts.
Hinter einem der Fenster, an denen ich vorbeikam, sah ich ein paar kleine Kinder, die in einem Wohnzimmer mit Superheldenfiguren spielten. Ich zwinkerte ihnen durch die Scheibe zu, machte die Geste nach, die Spiderman macht, wenn er einen seiner Spinnfäden abschießt, und ließ mich dann aus ihrem Sichtfeld fallen. In Wahrheit sprang ich nur auf die Feuerleiter, aber ich bin mir sicher, dass die Kleinen den Tag nie vergessen werden, an dem sie glaubten, Spiderman gesehen zu haben – obwohl es sich tatsächlich nur um ein Mädchen handelte, das nicht viel älter war als sie.
So schnell ich konnte, stieg ich die Feuerleiter nach unten. Dabei berührte ich kaum die Streben, flog vielmehr Stockwerk um Stockwerk nach unten. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich das machte. Ich war selbst überrascht von meinen Fähigkeiten, vor allem wenn ich daran dachte, dass ich in Sport nicht gerade gut war.
Ich erreichte den ersten Stock … Und da endete die Feuerleiter. In die Mauer war allerdings so etwas Ähnliches wie eine Leiter eingelassen, ich musste das Ding nur aushängen und nach unten schieben. Und das versuchte ich auch, und wie, aber das Teil machte so laute Geräusche, dass ich sofort wieder aufhörte. In der Nachbarschaft wurde nur zu gern getratscht. Alle würden rauskommen, um nachzusehen, was hier los war, und ich würde gewaltig eins auf den Deckel kriegen.
Mir blieb nur eine Möglichkeit: von der Plattform, auf der ich mich gerade befand, nach unten auf den Boden springen.
Und da es die einzige Möglichkeit war, tat ich das Einzige, was ich tun konnte: Ich sprang.
Ich fiel durch den Regen, das rechte Bein unter meinem Körper angewinkelt, das linke zur Seite ausgestreckt, sodass sie ein Dreieck bildeten. Meinen linken Arm hatte ich über die Schulter nach hinten gebogen und die rechte Hand mit der Handfläche nach unten gerichtet, um mich abzufangen.
Ich dachte ja, ich würde mir ein Bein brechen oder wie ein Hackbällchen, das aus dem Topf entkommen war, über den Boden kullern. Aber nein: keine Knochenbrüche und auch kein kullerndes Hackbällchen.
Nur eine perfekte Landung und ein merkwürdig surreales Gefühl.
Scheinwerfer beleuchteten mich von vorne. Bremsen quietschten. Während ich mich aufrichtete, wurde eine Autotür geöffnet und dann wieder geschlossen, nachdem die Person auf der Fahrerseite ausgestiegen war. Schritte näherten sich mir.
Die Scheinwerfer blendeten mich, aber ich konnte trotzdem erkennen, dass die Person eine ungewöhnliche Statur hatte: Sie war sehr groß und sehr dünn. Sie trug die Uniform eines bekannten Transportunternehmens. Eine Mütze verdeckte fast ihr ganzes Gesicht, bis auf sehr schmale Lippen, die sich zu einem ironischen Lächeln verzogen.
»Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Amanda Black sind?«
»Ja, bin ich. Ich glaube, Sie haben einen Brief für mich.«
Der Mann nickte einmal, ehe er mit der Hand in die Innentasche seines Mantels griff, einen Umschlag hervorholte und ihn mir reichte.
Ich nahm ihn entgegen. Er war nicht beschriftet.
»Sie dürfen ihn erst heute Nacht um 23 Uhr 57 und fünfzehn Sekunden öffnen«, sagte der Mann. Mir kam der Verdacht, dass er kein gewöhnlicher Bote war. »Das hier ist kein gewöhnlicher Brief und ich bin auch kein gewöhnlicher Bote. Wenn Sie sich nicht an die Anweisung halten, wird sich der Brief selbst zerstören.«
Ich betrachtete erneut das Stück Papier, das ich in den Händen hielt. Ich hatte eine Menge Fragen, aber als ich wieder aufblickte, war der Bote bereits zurück ins Auto gestiegen und fuhr durch den Regen davon. Ich konnte nur noch die Rücklichter sehen.
Ich verbarg den Umschlag in meiner Hosentasche und strich mir mit einer Hand durch die Haare. Ich hatte es gewusst! Sie fingen schon an, sich zu locken. Sobald sie trocken waren, würden sie aussehen wie der Bommel einer Wollmütze.
Mit einem tiefen Seufzen ging ich zurück in Richtung meiner Haustür. Als ich das Haus erreichte, musste ich schnell in Deckung gehen, denn der Vermieter unterhielt sich immer noch mit dem Nachbarn. Diesen Eingang konnte ich also abhaken. Ich wollte auf keinen Fall, dass er mich entdeckte und mich mit Fragen wegen der ausstehenden Miete löcherte. Nicht, solange meine Gedanken damit beschäftigt waren, was in diesem Umschlag sein könnte, der mir gerade überreicht worden war.
Ich musste mir etwas überlegen.
»Hatschi!« Ich nieste, meine Haare waren inzwischen völlig nass.
Und zwar schnell.
Kapitel 4
Während meines Niesanfalls stieg mir die Lösung direkt in die Nase. Ich musste nur noch ein bisschen warten, aber nicht allzu lange. Der Geruch von Abendessen hing bereits in der Luft. Gleich würde das Signal kommen, auf das ich wartete.
Beinahe gleichzeitig wurden mehrere Fenster in unserem Gebäude aufgemacht, und die Erwachsenen steckten den Kopf raus, um ihre Kinder zu rufen. In diesem Viertel war es egal, ob es regnete – die Wohnungen waren so klein, dass der Großteil der Kinder nach den Hausaufgaben lieber im Park spielte, als zu Hause zu bleiben, wo sie dicht aufeinanderhockten und sich kaum bewegen konnten.
Auf dem Gehweg gegenüber sammelte sich eine Gruppe von zehn oder zwölf Kindern, die darauf warteten, die Straße überqueren zu können. Ich mischte mich unauffällig unter die vorbeigehenden Menschen und blieb schließlich im Schatten eines nahen Hauseingangs stehen. Sobald die Kinder die Straße überquert hatten, kamen sie auf dem Weg nach Hause an meinem improvisierten Versteck vorbei. Ich musste mich also nur zwischen ihnen verbergen, um unbemerkt von unserem Vermieter in die Wohnung zu kommen.
Die Kinder näherten sich mir. Ich behielt den Vermieter von meinem Versteck aus im Blick und … eins, zwei und drei …
Mit einem blitzschnellen Schritt mischte ich mich unter die Kinder.
»Oh, hallo, Amanda, ich hab dich gar nicht gesehen«, sagte ein Mädchen, das im selben Haus wohnte wie ich. »Warst du auch im Park?«
»Pscht«, zischte ich und hielt mir einen Finger an die Lippen. »Nein, ich war nicht im Park. Aber ich will nicht, dass der Pauldon mich sieht. Verhalte dich ganz normal.«
Das Mädchen lachte leise, nahm die Wollmütze ab, setzte sie stattdessen mir auf und zog sie mir bis fast zu den Augenbrauen ins Gesicht. »Wenn er dich damit sieht, hält er dich für mich. Gib sie mir einfach morgen in der Schule zurück.«
»Danke.«
Noch fünf Meter bis zur Haustür.
Herr Pauldon musterte unsere Gruppe, als wir uns dem Haus näherten.
Vier Meter.
Er reckte den Hals wie eine Giraffe in dem Versuch, unsere Gesichter zu erkennen und mich unter den anderen ausfindig zu machen.
Drei Meter.
Meine Nachbarin beugte sich näher zu mir, damit es so wirkte, als würden wir miteinander tuscheln.
Zwei Meter.
Die Augen unseres Vermieters leuchteten auf, als er mich erkannte.
Mist!
Einen Meter.
Ein paar der Jungs aus unserer Gruppe hatten das Haus bereits betreten, und einer von ihnen hielt die Tür auf, damit sie nicht wieder zufiel. Als ich ebenfalls hineinschlüpfen wollte, streckte Herr Pauldon den Arm aus, um mich aufzuhalten. Ich duckte mich darunter hinweg und hechtete zur Treppe.
Unser Vermieter versuchte sofort, mir zu folgen. Aber meine Nachbarin stellte ihm ein Bein, was dazu führte, dass er stolperte und beinahe zu Boden stürzte. Das verschaffte mir genau die Zeit, die ich brauchte, um den ersten Treppenabsatz zu erreichen. Nach ein paar Stufen hielt ich inne, drehte mich noch mal zu meiner Nachbarin um und formte mit den Lippen ein »Danke«, als sie mir zuzwinkerte. Sie winkte mir zum Abschied, und nur wenige Sekunden später öffnete ich auch schon die Tür zu der Wohnung, in der ich mit Tante Paula wohnte. Meine Hausaufgaben, die nach wie vor im Lüftungsschacht lagen, hatte ich völlig vergessen. Ich war viel zu aufgewühlt.
Tante Paula bereitete gerade das Abendessen auf der kleinen Kochplatte zu, die wir auf eine Obstkiste gestellt hatten und als Küche bezeichneten. Heute Abend gab es gekochten Kohl. Einen Kohlkopf. Den wir uns teilen mussten. Paula bewegte ihren dürren Körper mit ungewöhnlicher Schnelligkeit und wich dabei geschickt den wenigen Gegenständen aus, die wir besaßen. Einige Haarsträhnen waren aus dem für sie typischen tief sitzenden Haarknoten entkommen, was sie viel jünger aussehen ließ als die fast siebzig Jahre, die sie schon auf dem Buckel hatte – zumindest nahm ich an, dass sie so alt war, auch wenn ich nicht die geringste Ahnung hatte, ob das zutraf.
»Tante Paula, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist«, sagte ich, holte den Umschlag wieder aus meiner Tasche und zeigte ihn ihr.
»Natürlich werde ich dir glauben, warum sollte ich das nicht tun?«, fragte sie grinsend. Sie drehte die Kochplatte ab, ließ den Topf aber darauf stehen, da wir einfach keinen Platz hatten, wo wir ihn sonst hätten hinstellen können, und kam zu mir. »Dann los, erzähl mir, was passiert ist und warum du so aufgeregt bist.« Tante Paula ließ sich auf das Bett sinken, das beinahe unsere ganze Wohnung ausfüllte, und klopfte ein paarmal auf die Matratze, damit ich mich neben sie setzte.
»Ich habe einen Brief bekommen«, sagte ich grinsend.