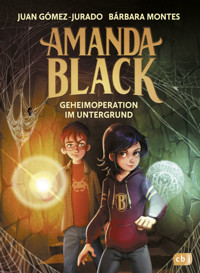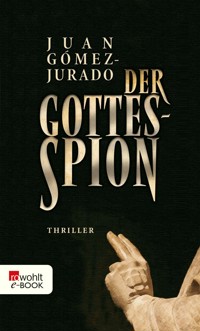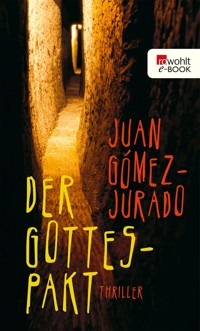9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die rote Königin
- Sprache: Deutsch
Der spektakuläre Nr.-1-Bestseller von Spaniens erfolgreichstem Thrillerautor
DU HAST NOCH NIE JEMANDEN WIE SIE GETROFFEN.
Antonia Scott ist speziell. Sehr speziell. Sie ist keine Polizistin und trägt keine Waffe. Und dennoch hat sie Dutzende Verbrechen aufgeklärt. Seit einem tragischen Vorfall weigert sie sich jedoch, ihre Wohnung in Madrid zu verlassen. Aber genau dazu soll Inspector Jon Gutiérrez sie bewegen. Denn Antonia ist die vielleicht intelligenteste Frau der Welt und die Einzige, die den aktuellen Fall lösen kann: Ein skrupelloser Täter hat es auf die Reichsten und Mächtigsten des Landes abgesehen. Er hinterlässt keinerlei Spuren, und die Polizei ist völlig ratlos. Doch Antonia ist keine Polizistin, sie ist besser ...
DU HAST NOCH NIE EINEN THRILLER WIE DIESEN GELESEN.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Inspector Jon Gutiérrez ist frisch vom Dienst suspendiert, als ein ominöser Mann namens Mentor ihn aufsucht. Gemeinsam mit Antonia Scott, der vielleicht intelligentesten Frau der Welt, soll er für die europäische Geheimorganisation »Rote Königin« arbeiten. Ihr erster Fall führt Jon und Antonia in eine Luxuswohnanlage in Madrid, wo der Sohn einer mächtigen Bankpräsidentin ermordet aufgefunden wurde. Kurz darauf verschwindet die Tochter eines schwerreichen Textilfabrikanten. Offenbar hat es ein skrupelloser Täter auf die Reichsten und Mächtigsten des Landes abgesehen. Er hinterlässt keinerlei Spuren, und die Polizei ist völlig ratlos. Doch Antonia Scott sieht mehr als alle anderen …
Autor
Juan Gómez-Jurado, geboren 1977 in Madrid, ist Journalist und einer der erfolgreichsten Schriftsteller Spaniens. Seine Romane werden in vierzig Sprachen übersetzt und ziehen Millionen Leser weltweit in ihren Bann. Mit »Die rote Jägerin« gelang ihm sein bisher größter Erfolg: Der Roman war in Spanien sowohl 2019 als auch 2020 das meistverkaufte Buch des Jahres.
JUAN GÓMEZ-JURADO
Die rote Jägerin
Thriller
Aus dem Spanischen von Sybille Martin
Die spanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Reina Roja« bei Ediciones B, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona.
Die Übersetzung dieses Werkes wurde gefördert durch Acción Cultural Española, AC/E.
Das Zitat stammt aus: Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln. Aus dem Englischen von Christian Enzensberger. © der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Frankfurt am Main 1974. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Insel Verlag Berlin.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2021
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Juan Gómez-Jurado
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagfoto: Mark Owen/Trevillion Images
Redaktion: Carola Fischer
LS · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-26099-6V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Babs
Eine Störung
Antonia Scott erlaubt sich nur drei Minuten am Tag, an Suizid zu denken.
Für andere Menschen mögen drei Minuten sehr wenig Zeit sein.
Nicht für Antonia. Man könnte sagen, ihr Verstand hat ordentlich PS unter der Haube, aber Antonias Kopf ist kein Sportwagen. Man könnte auch sagen, er ist zu vielschichtigen Arbeitsprozessen fähig, aber Antonias Kopf ist auch kein Computer.
Antonias Verstand ist eher ein Dschungel, ein Dschungel voller Affen, die sich rasend schnell von Liane zu Liane schwingen und dabei allerlei mitreißen. Ihr Kopf ist voller Dinge, die in der Luft aufeinandertreffen, und Affen, die sich gegenseitig die Zähne zeigen.
Deshalb ist Antonia – mit geschlossenen Augen, barfuß im Schneidersitz – fähig, Folgendes in diesen drei Minuten zu berechnen:
Mit welcher Geschwindigkeit ihr Körper am Boden aufschlägt, wenn sie aus dem Fenster springt.Wie viel Milligramm Propofol sie für den ewigen Schlaf braucht.Wie lange und bei welcher Temperatur sie in einem eiskalten See liegen müsste, bis die Unterkühlung zum Herzstillstand führt.Sie überlegt, wie sie an ein verschreibungspflichtiges Medikament wie Propofol kommt (indem sie einen Pfleger besticht) und wo sie zu dieser Jahreszeit einen eiskalten See findet (Laguna Negra in Soria). Über den Sprung aus ihrer Mansardenwohnung denkt sie lieber nicht nach, denn das Fenster ist ziemlich schmal, und sie ist davon überzeugt, dass sich das widerwärtige Essen der Krankenhaus-Cafeteria direkt in Hüftgold verwandelt hat.
Die drei Minuten, in denen sie darüber nachdenkt, welche Methode geeignet wäre, sind ihre drei Minuten.
Sie sind ihr heilig.
Sie helfen ihr, nicht den Verstand zu verlieren.
Deshalb gefällt es ihr gar nicht, von den nahenden Schritten eines Unbekannten bei ihrem Ritual gestört zu werden.
Es ist niemand von den Nachbarn, deren Gang kennt sie genau. Es kann auch kein Postbote sein, denn es ist Sonntag.
Wer auch immer es sein mag, Antonia ist davon überzeugt, dass er sie holen kommt.
Und das gefällt ihr noch weniger.
Erster Teil Jon
»Nun, in unserer Gegend«, sagte Alice, noch immer ein wenig atemlos, »kommt man im allgemeinen woandershin, wenn man so schnell und so lange läuft wie wir eben.«
»Behäbige Gegend«, sagte die Königin. »Hierzulande mußt du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst. Und um woandershin zu kommen, muß man noch mindestens doppelt so schnell laufen!«
Alice hinter den Spiegeln
Lewis Carroll
1 Ein Auftrag
Jon Gutiérrez mag keine Treppen.
Es ist keine Frage der Ästhetik. Die Treppe ist alt (das Gebäude wurde 1901 erbaut, stand auf dem Schild neben der Haustür), sie knarzt und ist nach hundertneunzehn Jahren in der Mitte durchgetreten, aber sie ist stabil, gepflegt und lackiert.
Das Treppenhaus ist schlecht beleuchtet, die 30-Watt-Birnen an der Decke vertiefen die Schatten. Aus den Wohnungen dringen fremde Stimmen, exotische Gerüche und fremdartige Musik von sonderbaren Instrumenten. Kurzum, wir befinden uns in Lavapiés, mitten in Madrid, es ist Sonntagabend und bald Essenszeit.
Nichts von alldem stört Jon, denn er ist den Umgang mit Relikten des letzten Jahrhunderts gewohnt (er lebt bei seiner Mutter), er kennt genügend dunkle Orte (er ist schwul) und hat oft mit ausländischen Mitbürgern mit zweifelhaften Einkünften und zweifelhaftem Aufenthaltsstatus zu tun (er ist Inspector bei der Polizei).
Jon Gutiérrez nervt an Treppen, dass er sie hochsteigen muss.
Verfluchte Altbauten. Kein Platz für einen Fahrstuhl. Das gibt es in Bilbao nicht.
Nicht dass Jon dick wäre. Zumindest nicht so dick, dass es dem Comisario aufgefallen wäre. Inspector Gutiérrez’ Oberkörper hat die Form eines Fasses, und die Arme passen dazu. Innerlich, wenn auch unsichtbar, hat er die Muskeln eines baskischen Steinehebers. Sein persönlicher Rekord als Harrijasotzaile liegt bei 293 Kilo, und das ohne großes Training. Einfach als Hobby, als Zeitvertreib am Samstagmorgen. Damit ihm die Kollegen nicht auf die Eier gehen, nur weil er schwul ist. Denn Bilbao ist Bilbao, und Polizisten sind eben Polizisten, viele von ihnen haben eine Einstellung, die altmodischer ist als diese verfluchte hundertjährige Treppe, die Jon gerade mühsam erklimmt.
Nein, Jon ist nicht so dick, dass ihn sein Chef dafür tadeln würde, aber der Comisario hat bessere Gründe, ihm die Leviten zu lesen. Die Leviten zu lesen und ihn aus dem Polizeidienst zu entfernen. Tatsächlich ist Jon offiziell suspendiert: kein Dienst, keine Bezüge.
Er ist nicht wirklich dick, aber der Fasstorso thront auf zwei Beinen, die im Vergleich dazu wie Zahnstocher wirken. Deshalb würde niemand mit gesundem Menschenverstand Jon einen leichtfüßigen Typen nennen.
Auf dem Absatz zur dritten Etage entdeckt er eine wunderbare uralte Erfindung: eine Bank. Es handelt sich um ein schlichtes Holzbrett in Form eines Viertelkreises, das an der Wand befestigt ist. Ein Geschenk des Himmels. Jon sinkt auf die Bank. Um wieder zu Atem zu kommen und um sich auf das Treffen einzustimmen, auf das er überhaupt keine Lust hat, aber auch um darüber nachzudenken, warum zum Teufel sein Leben so schnell den Bach runtergegangen ist.
Ich sitze ganz schön in der Scheiße.
2 Ein Flashback
»… ein ganz schöner Scheißdreck, Inspector Gutiérrez«, endet der Satz des Comisarios. Sein Gesicht hat die Farbe eines Hummers, und er schnauft wie ein Schnellkochtopf.
Wir befinden uns auf dem Kommissariat der Policía Nacional in der Calle Gordóniz in Bilbao, einen Tag bevor Jon in einem Haus im Madrider Stadtteil Lavapiés sechs Stockwerke erklimmen muss. Im Augenblick sieht er sich mit Vergehen wie Dokumentenfälschung, Beweismittelmanipulation, Behinderung der Justiz und beruflicher Untreue konfrontiert. Und mit einer Gefängnisstrafe von vier bis sechs Jahren.
»Wenn der Staatsanwalt sauer wird, kann er bis zu zehn Jahre verlangen. Und der Richter wird sie dir liebend gern aufbrummen. Niemand mag korrupte Polizisten«, sagt der Comisario und haut auf den Tisch.
Sie befinden sich im Vernehmungsraum, einem Ort, den niemand gern als Ehrengast aufsucht. Inspector Gutiérrez kommt in den Genuss einer Sonderbehandlung: aufgedrehte Heizung irgendwo zwischen brütender Hitze und Erstickungstod, grelles Licht, leere Wasserkaraffe auf dem Tisch.
»Ich bin nicht korrupt«, sagt Jon und widersteht dem Impuls, sich die Krawatte zu lockern. »Ich habe nie auch nur einen Cent angenommen.«
»Als wäre das wichtig. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht, verdammt noch mal?«
Jon hat an Desiree Gómez alias Desi alias die Brilli gedacht. Desi ist erst neunzehn Jahre alt, von denen sie schon drei auf der Straße verbracht hat. Die sie mit Füßen tritt, die sie betäubt, die ihr Blut vergiftet. Nichts, was Jon nicht schon oft gesehen hätte. Aber manche dieser Mädchen schleichen sich in dein Herz, ohne dass du es merkst, Zuckerpüppchen, Schlangenleder-Tanga, und plötzlich ist alles ein Lied von Joaquín Sabina. Nichts Ernstes. Ein Lächeln, eine Einladung zum Kaffee um sechs, aber nie am Morgen. Und plötzlich stört es dich, dass der Zuhälter sie verprügelt. Und du redest mit dem Kerl, damit er aufhört. Aber der Zuhälter hört nicht auf, denn ihm fehlen so viele Tassen im Schrank wie Zähne im Mund. Und sie weint sich bei dir aus, und du wirst stinksauer. Und ohne groß nachzudenken, hast du fast vierhundert Gramm Stoff im Auto des Zuhälters deponiert. Genug, damit sie ihm sechs bis neun Jahre aufbrummen können.
»Ich habe mir gar nichts dabei gedacht«, antwortet Jon.
Der Comisario fährt sich mit der Hand übers Gesicht und reibt sich die Wangen, als wolle er seinen Ausdruck der Ungläubigkeit fortwischen. Es hilft nichts.
»Also wirklich, wenn du sie wenigstens gevögelt hättest, Gutiérrez. Aber du stehst ja nicht auf Frauen, stimmt’s? Oder fischst du jetzt auf beiden Seiten des Ufers?«
Jon schüttelt den Kopf.
»Der Plan war gar nicht mal so schlecht«, fährt der Comisario ironisch fort. »Diesen Dreck von der Straße zu fegen war eine verdammt gute Idee. Dreihundertfünfundsiebzig Gramm Heroin, damit geht’s direkt in den Knast. Ohne Strafmilderungen oder sonstiges Tamtam. Ohne lästige Bürokratie.«
Der Plan war ausgezeichnet. Das Problem war nur, dass er ihn so gut fand, dass er Desi davon erzählte. Damit sie kapierte, dass es mit den Veilchen, den blauen Flecken und den angebrochenen Rippen vorbei war. Doch der zugedröhnten Desi tat der arme Zuhälter leid. Also hat sie es ihm erzählt. Daraufhin postierte der Scheißkerl Desi an einer Straßenecke, wo sie mit dem Smartphone heimlich alles aufgenommen hat. Und am Tag nach seiner Festnahme wegen Drogenhandels hat Desi das Video für dreihundert Euro an den Fernsehsender La Sexta verkauft – die haben es ihr regelrecht aus der Hand gerissen. Dann war der Teufel los. Schlagzeilen auf allen Titelblättern, das Video auf allen Kanälen.
»Ich wusste doch nicht, dass die mich filmt, Comisario«, erklärt Jon beschämt. Er kratzt sich am Kopf mit dem gelockten rötlichen Haar. Er rauft sich den dichten schon ergrauten Bart.
Und erinnert sich.
Desi hat gezittert wie sonst was, und die Fokussierung war grässlich, aber für die Aufnahme hat es gereicht. Und ihr Puppengesicht machte sich im Fernsehen auch sehr gut. Oscarreif spielte sie die Rolle der Freundin eines Mannes, der zu Unrecht von der Polizei beschuldigt wird. Den Zuhälter zeigten sie in den Nachmittags- und Abend-Talkshows nicht so, wie er jetzt aussieht – verschwitztes Hemd, braune Zähne. Nein, sie zeigten ein zehn Jahre altes Foto, auf dem er gerade mal die Kommunion hinter sich zu haben scheint. Ein gefallener Engel, die Gesellschaft ist schuld, diesen ganzen Scheiß eben.
»Du hast den Ruf dieses Kommissariats in den Dreck gezogen, Gutiérrez. So blöd muss man erst mal sein. Blöd und naiv. Hast du wirklich nichts gerochen?«
Jon schüttelt wieder den Kopf.
Er erfuhr von der ganzen Sache erst, als das Video über WhatsApp bei ihm auftauchte. Keine zwei Stunden später ging es im ganzen Land viral. Jon fand sich sofort im Kommissariat ein, wo der Staatsanwalt schon lautstark seinen Kopf forderte, und seine Eier als Beilage.
»Es tut mir leid, Comisario.«
»Und es wird dir noch mehr leidtun.«
Der Comisario steht schnaubend auf und verlässt, getrieben von gerechter Empörung, den Raum. Als hätte er nie Beweise manipuliert, das Recht gebeugt oder hier und da eine Falle gestellt. Von wegen. Er war schlicht nicht so blöd, sich dabei erwischen zu lassen.
Jetzt darf Jon ordentlich im eigenen Saft schmoren. Man hat ihm Uhr und Handy abgenommen, ein Standardprocedere, damit er das Zeitgefühl verliert. Seine übrigen persönlichen Gegenstände stecken in einem Umschlag. Wenn man nichts hat, womit man sich ablenken kann, vergehen die Stunden extrem langsam und lassen einem viel Raum, sich angesichts der eigenen Dummheit mit Selbstvorwürfen zu quälen. Nachdem er den medialen Prozess bereits verloren hat, bleibt nur noch die Frage, wie viele Jahre er im Gefängnis von Basauri absitzen muss. Wo ihn ein paar Freunde erwarten, mit geballten Fäusten und großer Lust, dem Bullen, der sie eingebuchtet hat, eine Abreibung zu verpassen – drei gegen einen. Oder vielleicht schicken sie ihn zum eigenen Schutz weit weg, an einen Ort, wo ihn seine Amatxo nicht mit einem Topf ihrer berühmten Fischbäckchen besuchen kann. Neun Jahre, fünfzig Sonntage pro Jahr, das macht vierhundertfünfzig Sonntage ohne Fischbäckchen. Grob geschätzt. Eine schwere Strafe, findet Jon. Und seine Mutter ist schon alt. Sie bekam ihn mit siebenundzwanzig, ein spätes Mädchen. Jetzt ist er dreiundvierzig und sie siebzig. Wenn Jon wieder rauskommt, gibt es keine Amatxo mehr, die Fischbäckchen zubereitet. Wenn sie nicht gleich vor Schreck tot umfällt, sobald sie die Nachricht erhält. Und die wird ihr bestimmt von der Nachbarin aus der 2° B hinterbracht, dem gerissenen, doppelzüngigen Weib, so wie sie sich mit den Geranien aufgeführt hat.
Es vergehen fünf Stunden, obwohl sie Jon wie fünfzig vorkommen. Er konnte noch nie lange an einem Ort verweilen, weshalb ihm eine Zukunft hinter Gittern unerträglich erscheint. Er denkt nicht daran, sich etwas anzutun, denn für Jon steht das Leben über allem anderen, und er ist ein unverbesserlicher Optimist. Einer von denen, über die Gott am lautesten lacht, wenn er eine Tonne Ziegelsteine über ihm auskippt. Und trotzdem hat er keine Ahnung, wie er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen soll, die er sich selbst um den Hals gelegt hat.
In solcherart tiefschwarze Gedanken ist Jon versunken, als die Tür aufgeht. Er denkt, der Comisario kehre zurück, aber es ist ein großer, schlanker Mann. Um die vierzig, dunkles Haar mit großen Geheimratsecken, dünner gestutzter Schnurrbart und Knopfaugen, die eher wie gemalt als echt wirken. Zerknitterter Anzug. Aktenkoffer. Beides teuer.
Er lächelt. Schlechtes Zeichen.
»Sind Sie der Staatsanwalt?«, fragt Jon verwundert.
Er hat ihn noch nie gesehen, aber der Unbekannte scheint sich hier auszukennen. Er schiebt einen der Metallstühle beiseite, der auf dem Zementboden quietscht, und setzt sich ihm gegenüber an den Tisch, ohne dass sein Lächeln erlischt. Er holt ein paar Unterlagen aus seinem Aktenkoffer und blättert darin, als würde Jon ihm gar nicht gegenübersitzen.
»Sie sind doch der Staatsanwalt?«, insistiert Jon.
»Hm … Nein, ich bin nicht der Staatsanwalt.«
»Dann also Anwalt?«
Der Unbekannte schnaubt, es klingt irgendwie empört und amüsiert zugleich.
»Anwalt? Nein, ich bin auch kein Anwalt. Sie können mich Mentor nennen.«
»Mentor? Ist das ein Vorname oder ein Familienname?«
Ohne aufzublicken, studiert der Unbekannte weiter seine Papiere.
»Ihre Lage ist ziemlich kritisch, Inspector Gutiérrez. Sie sind suspendiert und ohne Bezüge, das schon mal vorab. Und es liegen mehrere Anklagepunkte gegen Sie vor. Aber jetzt kommt die gute Nachricht.«
»Sie haben einen Zauberstab, um sie verschwinden zu lassen?«
»So etwas in der Art. Sie sind über zwanzig Jahre im Dienst und haben eine gute Verhaftungsquote vorzuweisen. Ein paar Klagen wegen Insubordination. Wenig Toleranz gegenüber Machtbefugten. Sie nehmen gern den kürzesten Weg.«
»Man kann Dienstvorschriften nicht immer wortwörtlich einhalten.«
Mentor schiebt die Unterlagen bedachtsam wieder in den Aktenkoffer.
»Mögen Sie Fußball, Inspector?«
Jon zuckt mit den Schultern.
»Gelegentlich ein Spiel von Athletic Bilbao.«
Aus Bequemlichkeit. Weil Athletic eben sein Heimatclub ist.
»Haben Sie schon mal eine italienische Mannschaft spielen sehen? Die Italiener haben eine Maxime: Nessuno ricorda il secondo – niemand erinnert sich an den Zweiten. Es interessiert sie wenig, wie sie gewinnen, solange sie gewinnen. Einen Elfmeter vorzutäuschen ist keine Schande. Zuzutreten gehört zum Spiel. Ein weiser Mann nannte diese Philosophie Drecksspiel.«
»Welcher weise Mann?«
Jetzt zuckt Mentor mit den Schultern.
»Sie sind ein dreckiger Spieler, Ihre Heldentat mit dem Kofferraum des Zuhälters ist der Beweis. Allerdings sollte der Schiedsrichter nichts davon mitbekommen, Inspector Gutiérrez. Und noch viel weniger sollte eine Aufnahme der Aktion unter dem Hashtag #Polizeidiktatur in den sozialen Medien landen.«
»Hören Sie, Mentor, oder wie immer Sie heißen«, erwidert Jon und legt seine kräftigen Arme auf den Tisch. »Ich bin müde. Meine Karriere ist im Arsch, und meine Mutter dürfte schon wahnsinnig sein vor Sorge, weil ich zum Abendessen nicht zu Hause war und ihr noch nicht sagen konnte, dass sie mich eine ganze Weile nicht mehr sehen wird. Also kommen Sie zum Punkt, oder scheren Sie sich zum Teufel.«
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie tun, was ich will, und ich erlöse Sie von diesem ganzen … wie nannte es Ihr Chef noch? Scheißdreck.«
»Sie wollen mit der Staatsanwaltschaft reden? Und den Medien? Also wirklich, Mann. Ich bin doch nicht von gestern.«
»Ich verstehe, dass es Ihnen schwerfällt, einem Unbekannten zu vertrauen. Sie haben bestimmt eine bessere Adresse, an die Sie sich wenden können.«
Jon hat keine bessere Adresse, an die er sich wenden kann. Keine bessere und keine schlechtere. Das ist ihm in den letzten fünf Stunden klar geworden.
Er gibt sich geschlagen.
»Was wollen Sie?«
»Ich will, Inspector Gutiérrez, dass Sie eine alte Freundin kennenlernen und sie zum Tanz ausführen.«
Jon lacht auf, aber in diesem Lachen steckt kein Funken Freude.
»Hören Sie, ich fürchte, was meine Vorlieben angeht, sind Sie falsch informiert. Ich glaube kaum, dass Ihre Freundin mit mir tanzen will.«
Mentor lächelt erneut von einem Ohr zum anderen, und dieses Lächeln ist noch besorgniserregender als das bei seinem Eintreten.
»Natürlich nicht, Inspector. Also, ich zähle auf Sie.«
3 Ein Tanz
Also erklimmt Jon Gutiérrez ziemlich schlecht gelaunt den letzten Treppenabsatz des Hauses Nummer 7 der Calle Melancolía im Madrider Stadtteil Lavapiés. Der Comisario wollte ihm auch nichts Genaueres sagen, als Jon ihn nach Mentor gefragt hat.
»Wo kommt der denn her, verdammt noch mal? Vom Geheimdienst? Vom Innenministerium? Von Captain Americas Rächern?«
»Tu, was er dir gesagt hat, und stell keine Fragen.«
Jon ist weiterhin suspendiert und ohne Bezüge, doch die Strafanzeige gegen ihn wird nicht weiterverfolgt. Und das Video, auf dem man sieht, wie er den Stoff im Wagen des Zuhälters deponiert, ist – wie durch Zauberhand – aus Fernsehen und Presse verschwunden. Genau wie Mentor es versprochen hat, wenn er seinen seltsamen Vorschlag annimmt.
In den sozialen Medien reden die Leute weiter darüber, aber das ist Jon egal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Hyänen von Twitter einen neuen Kadaver zum Abnagen finden und von ihm nur saubere weiße Knochen übrig lassen.
Inspector Gutiérrez atmet schwer, und sein Herz ist verkrampft. Nicht nur wegen der Treppe. Denn Mentor reicht es nicht, dass Jon seine Freundin Antonia Scott kennenlernt. Er hat noch etwas anderes verlangt. Und nach dem wenigen, was Mentor erklärt hat, wird dieses andere viel schwieriger sein.
Als Jon in der sechsten Etage anlangt, steht er vor der Tür zu einer Mansardenwohnung. Grün lackiert. Verdammt alt. Abgeblättert.
Und sperrangelweit offen.
»Hallo?«
Verwundert tritt er ein. Die Diele ist leer. Kein einziges Möbelstück, kein Kleiderständer, nicht mal ein trauriger Aschenbecher mit einer Bonuskarte von Carrefour. Nichts außer einem Stapel leerer, schmutziger Tupper-Boxen. Sie riechen nach Curry, Couscous und sechs oder sieben weiteren Ländern. Dieselben Gerüche, die aus den Wohnungen drangen, an denen Jon vorbeigekommen ist.
Hinter der Diele beginnt ein Flur, ebenfalls leer. Ohne Bilder oder Regale. Zwei Türen auf der einen Seite, eine Tür auf der anderen, eine weitere am Ende. Alle stehen offen.
Die erste Tür führt ins Badezimmer. Jon schaut hinein und sieht lediglich eine Zahnbürste, eine Tube Colgate Erdbeergeschmack, ein Stück Seife. In der Dusche ein Duschgel. Ein halbes Dutzend Anti-Cellulitis-Cremes.
Aber hallo, sie scheint also an Magie zu glauben.
Auf der rechten Seite befindet sich ein Schlafzimmer. In dem offen stehenden Einbauschrank kann er ein paar Bügel ausmachen. Nur auf einigen wenigen hängen Kleidungsstücke.
Jon fragt sich, was für ein Mensch so wohnt, mit so wenigen Dingen. Er denkt, dass sie weggegangen ist. Und fürchtet, zu spät gekommen zu sein.
Weiter vorn auf der linken Seite befindet sich eine winzige Küche. Im Spülbecken stehen Teller. Die Ablage ist ein Ozean aus weißem Silestone-Quarzstein. Ein schmutziger Kaffeelöffel treibt auf die Spüle zu.
Am Ende des Flurs befindet sich das Wohnzimmer. Eine Mansarde. Die schrägen Wände sind aus nacktem Backstein, die Balken aus dunklem Holz. Dazwischen fällt durch zwei Dachluken schwaches Licht herein. Und durch ein Fenster.
Draußen geht die Sonne unter.
Drinnen sitzt Antonia Scott im Lotussitz auf dem Boden. Sie ist Mitte dreißig, trägt eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt. Sie ist barfuß. Vor ihr steht ein iPad, an dem ein langes Kabel hängt.
»Du hast mich gestört«, sagt Antonia. Sie legt das iPad mit dem Display nach unten auf den Holzboden. »Ganz schlechtes Benehmen.«
Jon gehört zu den Menschen, die zum Gegenangriff übergehen, wenn sie beleidigt werden. Vorbeugend. Aus sportlichen Gründen. Um den Macker zu spielen.
»Lässt du immer die Tür offen? Weißt du nicht, in was für einem Viertel du wohnst? Und wenn ich ein Psychopath und Vergewaltiger wäre?«
Antonia blinzelt irritiert. Sarkasmus gehört nicht gerade zu ihren Stärken.
»Du bist kein Psychopath und Vergewaltiger. Du bist Polizist. Und Baske.«
Bezüglich des Basken macht sich Jon nichts vor, sein Akzent lässt keinen Zweifel daran. Aber dass sie ihn als Bullen identifiziert hat, überrascht ihn schon. Normalerweise kann man einen Bullen riechen. Aber Jon, der keine Miete zahlen muss und sein ganzes Geld in Klamotten investiert, wirkt in seinen maßgeschneiderten dreiteiligen Anzügen und mit seinen italienischen Schuhen eher wie ein Marketing-Direktor.
»Woher weißt du, dass ich Polizist bin?«, fragt Jon und lehnt sich an den Türrahmen.
Antonia zeigt auf die linke Seite seines Jacketts. Obwohl der Schneider versucht hat, die Ausbuchtung der Waffe zu kaschieren, ist ihm das nicht ganz gelungen. Und Jons Ernährungsstil trägt auch nicht dazu bei.
»Ich bin Inspector Gutiérrez«, räumt er ein. Er will ihr schon die Hand reichen, besinnt sich aber eines Besseren. Mentor hat ihn darauf hingewiesen, dass Antonia keinen Körperkontakt mag.
»Mentor schickt dich«, sagt sie. Es ist keine Frage.
»Hat er mein Kommen angekündigt?«
»War nicht nötig. Hierher kommt nie jemand.«
»Aber deine Nachbarn bringen dir was zu essen. Sie müssen dich sehr mögen.«
Antonia zuckt mit den Schultern.
»Das Haus gehört mir. Also eigentlich meinem Mann. Statt Miete gibt’s Essen.«
Jon überschlägt rasch im Kopf. Fünf Stockwerke mit jeweils drei Wohnungen zu monatlich tausend Euro.
»Aber hallo, ganz schön teures Couscous. Dann ist es bestimmt gut.«
»Ich koche nicht gern«, erwidert Antonia mit einem Lächeln.
Da erkennt Jon, dass sie hübsch ist. Nicht unbedingt eine Schönheit, das wäre übertrieben. Auf den ersten Blick ist Antonias Gesicht eher gewöhnlich, es wirkt wie ein weißes Blatt Papier. Das glatte, auf Schulterlänge geschnittene schwarze Haar macht es auch nicht besser. Doch wenn sie lächelt, leuchtet ihr Gesicht wie ein Weihnachtsbaum. Und man entdeckt, dass die braun wirkenden Augen in Wirklichkeit olivfarben sind und dass sich um den Mund Grübchen bilden, die zusammen mit dem Kinn ein perfektes Dreieck zeichnen.
Dann wird sie wieder ernst, und der Eindruck löst sich auf.
»Geh jetzt«, sagt Antonia und wedelt in Jons Richtung.
»Nicht bevor du dir angehört hast, was ich dir zu sagen habe«, erwidert der Inspector.
»Glaubst du, du bist der Erste, den Mentor zu mir schickt? Vor dir waren schon drei andere da. Der Letzte erst vor sechs Monaten. Und allen sage ich dasselbe: Ich bin nicht interessiert.«
Jon kratzt sich am Kopf und atmet tief ein. Um diesen gewaltigen Torso zu füllen, braucht es ein paar Sekunden und viele Liter Sauerstoff. Oder er will nur Zeit schinden, denn er weiß verdammt noch mal nicht, was er zu dieser seltsamen einsamen Frau sagen soll, vor der er seit drei Minuten steht. Alles, was Mentor von ihm verlangt hat, ist: Du musst sie dazu bringen, dass sie in den Wagen steigt. Versprich ihr, was du willst, lüge, drohe ihr, umschmeichle sie. Aber sie muss in den Wagen steigen.
Sie muss in den Wagen steigen. Mentor hat nicht gesagt, was danach geschehen soll. Und das beschäftigt Jon sehr.
Wer ist diese Frau, und warum ist sie so wichtig?
»Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Couscous mitgebracht. Was ist, warst du auch Polizistin?«
Missmutig schnalzt Antonia mit der Zunge.
»Er hat es dir nicht gesagt, stimmt’s? Er hat dir nichts erzählt. Er hat von dir verlangt, mich dazu zu bringen, in den Wagen zu steigen, dir aber nicht gesagt, wohin die Fahrt gehen soll. Wieder einer seiner lächerlichen Aufträge. Nein danke. Ohne ihn geht’s mir viel besser.«
Jon zeigt auf die nackten Wände in dem leeren Raum.
»Das sieht man. Jeder träumt davon, auf dem Boden zu schlafen.«
Antonia zuckt zusammen und verdreht die Augen.
»Ich schlafe nicht auf dem Boden. Ich schlafe im Krankenhaus«, fährt sie ihn an.
Das hat sie getroffen. Und wenn sie etwas trifft, macht sie den Mund auf.
»Was ist los mit dir? Nein, nicht mit dir. Es geht um deinen Mann, stimmt’s?«
»Das geht dich nichts an.«
Plötzlich passen die Teile zusammen, und Jon kann einfach nicht die Klappe halten.
»Ihm ist was passiert, er ist krank, und du willst bei ihm sein. Das ist verständlich. Aber versetz dich mal in meine Lage. Ich wurde gebeten, dich zu überzeugen, in den Wagen zu steigen, Antonia. Wenn mir das nicht gelingt, wird das Konsequenzen für mich haben.«
»Das ist nicht mein Problem.« Antonias Stimme klingt eisig. »Es ist nicht mein Problem, was einem dicken, inkompetenten Bullen passiert, der es so verkackt hat, dass man ihn zu mir schickt. Verschwinde jetzt. Und sag Mentor, er soll sich die Mühe sparen.«
Mit versteinertem Gesicht macht Inspector Gutiérrez einen Schritt zurück. Er weiß nicht, was er noch zu dieser Bekloppten sagen soll. Er verflucht sich dafür, sich auf diese Sache eingelassen zu haben, reine Zeitverschwendung. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als nach Bilbao zurückzukehren, dem Comisario gegenüberzutreten und sich den Konsequenzen seiner eigenen Dämlichkeit zu stellen.
»Na schön«, sagt Jon, bevor er mit eingezogenem Schwanz den Rückzug antritt. »Aber er hat mich gebeten, dir zu sagen, dass es diesmal anders ist. Dass er dich diesmal wirklich braucht.«
4 Ein Skype-Gespräch
Antonia Scott sieht den breiten Rücken des Inspectors im Flur verschwinden. Sie zählt seine langsamen, schweren Schritte bis zur Tür. Bei dreizehn stellt sie das iPad wieder auf.
»Jetzt können wir weiterreden, Grandma.«
Auf dem Monitor ist eine alte Dame mit freundlichen Augen und toupiertem Haar zu sehen. Ihr faltiges Gesicht hat mehr Furchen als ein Rioja-Weinberg. Was ein ganz passendes Bild ist, denn die alte Dame trinkt gerade ein Glas Rotwein.
»Warum hast du mich angerufen? Es ist doch noch gar nicht zehn.«
»Ich habe dich angerufen, als ich die Schritte auf der Treppe gehört habe. Ich wollte dich dabeihaben, falls es hässlich wird.«
Beide sprechen Englisch. Georgina Scott lebt in Chedworth in der Nähe von Gloucester, einem winzigen Dorf auf dem Land, wo die Zeitrechnung vor Jahrhunderten stehen geblieben ist. Ein Postkartendorf. Römischer Ortskern. Mit Moos überwachsene Mauern. Mit Highspeed-Internet, weshalb Großmutter Scott und Antonia zweimal am Tag skypen.
»Dieser Mann wirkt attraktiv. Er hat eine schöne Stimme«, sagt die alte Dame, die sich wünscht, Antonia möge sich endlich von den Spinnweben der Vergangenheit befreien.
»Er ist schwul, Grandma.«
»Blödsinn, Kindchen. Keiner ist schwul, wenn du erst mal Hand anlegst. Früher habe ich etliche von denen geheilt.«
Antonia verdreht die Augen. Für Georgina Scott heißt »politisch korrekt« Winston Churchill.
»Das ist ziemlich gemein, Grandma.«
»Ich bin dreiundneunzig Jahre alt, Kindchen«, sagt die alte Frau zu ihrer Rechtfertigung und schenkt sich Wein nach.
»Mentor will, dass ich wieder arbeite.«
Beim Einschenken tropft ein wenig Bordeaux auf den Tisch. Unerhört. Großmutter Scott kann kaum noch unterschreiben, aber beim Einschenken von Wein hat sie normalerweise die ruhige Hand eines plastischen Chirurgen.
»Aber du willst nicht, stimmt’s?«, sagt sie mit der Stimme eines Unschuldslamms, hinter dem der Wolf lauert.
»Nein, das weißt du doch«, räumt Antonia ein, die nicht wieder mit ihr streiten möchte.
»Natürlich, meine Liebe.«
»Es ist meine Schuld, dass Marcos seit drei Jahren in diesem Bett liegt. Es ist meine Schuld, wegen dieser Arbeit.«
»Nein, Antonia«, erwidert die Großmutter und senkt die Stimme. »Es ist nicht deine Schuld. Schuld daran ist dieser Mistkerl, der auf ihn geschossen hat.«
»Und den ich nicht stoppen konnte.«
»Ich bin nur eine trottelige Greisin, Schätzchen«, jetzt klingt der Wolf durch, »aber mir scheint, dass du dich der Sünde der Tatenlosigkeit schuldig machst, wenn du dich weiter verkriechst.«
Antonia schweigt. Beim erfolglosen Versuch, diesem Dilemma zu entkommen, arbeiten die Affen in ihrem Kopf auf Hochtouren.
»Warum tust du mir das an, Grandma?«, protestiert sie.
»Weil ich es satthabe zuzusehen, wie du allein in deiner Mansarde vergammelst. Weil du dein Talent verschwendest. Aber vor allem aus purem Egoismus.«
»Egoismus? Du, Grandma?« Antonia ist überrascht.
Mit neunzehn Jahren hat sich Georgina Scott freiwillig zum Lazarettdienst gemeldet und ist siebzig Stunden nach dem D-Day in der Normandie gelandet, der riesige Helm saß auf ihrer Nasenspitze, und die Hände umklammerten einen Pappkoffer voller Morphinspritzen. Die Nazis waren nur einen Steinwurf entfernt, aber sie harrte unverdrossen aus, amputierte Beine, nähte Wunden und injizierte Schmerzmittel. Dass ihre Großmutter auch nur einen Funken egoistisch sein könnte, ist für Antonia schlicht unvorstellbar.
»Ja, Egoismus. Du bist eine schreckliche Langweilerin geworden. Hockst den ganzen Tag in der Wohnung, und nachts ist es noch schlimmer. Ich vermisse die Zeiten, als du gearbeitet und mir davon erzählt hast. Mir bleibt nicht mehr viel im Leben. Das hier …«, die alte Frau hebt ihr Glas, »und du. Selbst der Wein schmeckt nicht mehr so wie früher.«
Antonia lacht ungläubig auf. Ihre Großmutter glaubt, Wasser benötige man nur im Badezimmer und zum Kochen von Meeresfrüchten. Aber Antonia durchschaut, was sie beabsichtigt. Seit das passiert ist – seit sie das getan hat –, hat sich die Welt weitergedreht. Sie natürlich nicht. Nur die Welt, eine Welt, in der kein Platz mehr für sie ist. Eine Welt, in der die Tage eine endlose Litanei der Schuld und Langeweile sind, wie sie höchst widerwillig einräumen muss.
»Vielleicht hast du recht«, sagt Antonia schließlich. »Vielleicht tut es mir ganz gut, meinen Kopf ein wenig zu beschäftigen. Nur für heute Nacht.«
Ihre Großmutter trinkt noch einen Schluck Wein und schenkt ihr ein frommes Lächeln, das Versprechen einer Belohnung.
»Nur für eine Nacht, Kindchen. Was sollte da schon schiefgehen?«
5 Zwei Fragen
Jon geht die Treppe genauso langsam hinunter wie hinauf. Das tut er normalerweise nicht. Normalerweise pflegt er sich beim Runtergehen an den verfluchten Treppen zu rächen, indem er den Sog der Schwerkraft nutzt, der in seinem Fall beträchtlich ist (nicht dass er dick wäre). Aber jetzt, nach seiner Niederlage bei dieser so absurden wie scheinbar einfachen Mission, weiß er nicht, was er tun soll, die Unentschlossenheit bremst ihn aus.
Auf dem Absatz des dritten Stocks klingelt sein Handy. Jon setzt sich auf die Bank und nimmt den Anruf entgegen. Er telefoniert nicht gern im Gehen, niemand soll sein Keuchen hören.
Eine unbekannte Nummer, aber Jon weiß, wer es ist.
»Sie hat Nein gesagt«, erklärt er unumwunden.
Am anderen Ende der Leitung knurrt Mentor ungehalten.
»Das ist aber sehr enttäuschend, Inspector Gutiérrez.«
»Ich weiß nicht, was Sie erwartet haben. Diese Frau ist nicht richtig im Kopf. Sie lebt in einer leeren Wohnung, kein einziges Möbelstück. Sie lässt sich von den Nachbarn ernähren, bei aller Liebe. Und sie faselt irgendwas von einem kranken Mann.«
»Ihr Mann ist seit drei Jahren im Krankenhaus, er liegt im Koma. Scott gibt sich die Schuld daran. Er könnte der Hebel dafür sein, sie wieder auf Touren zu bringen, aber ich rate Ihnen davon ab. Wenn Sie wieder mit ihr reden …«
»Wie bitte? Hören Sie, ich habe meinen Auftrag erfüllt und Ihre Nachricht überbracht. Und jetzt will ich, dass Sie Ihr Versprechen halten.«
Mentor seufzt. Es ist ein langer, theatralischer Seufzer.
»Wenn Wünsche ein Schokoladenkuchen wären, Inspector, wäre alle Welt dick. Lassen Sie sich etwas einfallen, aber wir brauchen Scott jetzt sofort in diesem Auto.«
Jon startet einen Versuchsballon.
»Vielleicht lassen Sie mal die ganze Geheimniskrämerei und sagen mir, um was es eigentlich geht …«
Am anderen Ende der Leitung herrscht Schweigen, ein langes Schweigen. Jon sieht den Ballon langsam aufsteigen.
»Sie müssen verstehen, dass dies alles höchst vertraulich ist. Es könnte schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben.«
»Selbstverständlich.«
Und plötzlich hat der Ballon entgegen jeder Prognose sein Ziel erreicht.
»Ich will, dass Antonia mir in einem sehr komplizierten Fall hilft. Ich werde Sie diesbezüglich ins Bild setzen.«
Dann beginnt Mentor zu erklären. Er redet kaum eine Minute, aber das reicht. Jon hört zu, anfangs noch skeptisch, schließlich glaubt er, seinen Ohren nicht zu trauen. Ohne es zu bemerken, ist er aufgestanden und hat, ganz gegen seine Gewohnheit, begonnen im Kreis zu gehen, ebenfalls ohne es zu bemerken.
»Verstehe. Sagen Sie mir wenigstens, für wen Sie arbeiten?«
»Das ist jetzt unwichtig. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sage ich Ihnen, was Sie wissen müssen. Jetzt sollten Sie sich ausschließlich darum kümmern, Antonia Scott zu der Adresse zu bringen, die ich Ihnen gerade auf Ihr Handy geschickt habe.«
Jon spürt das Handy an seinem Ohr vibrieren.
»Warum ist Scott so wichtig? Es gibt doch bestimmt genug Experten in der Kriminaltechnik, Spezialisten für operative Fallanalyse, die …«
»Die gibt es«, unterbricht Mentor ihn, »aber keiner von ihnen ist Antonia Scott.«
»Was zum Teufel macht diese Señora denn so besonders? Ist sie etwa Clarice Starling, und ich habe es nicht gemerkt?«, raunzt Jon, der langsam die Nase voll hat.
Mentor räuspert sich. Seine Antwort klingt etwas gezwungen. Widerwillig. Als wolle er nicht damit herausrücken, was er gleich sagen wird. Und er will es auch nicht.
»Inspector Gutiérrez … Diese Señora, wie Sie sie nennen, ist weder Polizistin noch Kriminalistin. Sie hatte noch nie eine Waffe in der Hand und trägt auch keine Polizeimarke, trotzdem hat sie Dutzende Leben gerettet.«
»Wie bitte?«
»Ich könnte es Ihnen erklären, will Ihnen aber nicht die Überraschung verderben. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass sie in den Wagen steigt und sich an die Arbeit macht. Jetzt sofort.«
Mentor legt auf. Jon will sich schon umdrehen und die Treppe wieder hinaufgehen, als er eine Stimme hört.
»Inspector.«
Er beugt sich über das Treppengeländer. Drei Etagen weiter unten steht Antonia im Halbdunkel und winkt ihm zu.
Diese Frau ist eine Sorgin, eine Hexe, verdammt noch mal. Wenn er mit sich selbst spricht, pflegt er sich ziemlich derbe auszudrücken – und manchmal auch, wenn er mit anderen spricht.
Als er unten ankommt, lächelt Antonia.
»Ich muss dir zwei Fragen stellen. Wenn die Antwort richtig ist, werde ich dich heute Abend begleiten.«
»Was …?«
Antonia hebt den Zeigefinger. Sie reicht Jon gerade mal bis zur Brust und dürfte – mit Schuhen – nicht größer als einen Meter sechzig sein. Und dennoch beeindruckt sie. Da sie ganz nah vor ihm steht, erkennt Jon Hautveränderungen an ihrem Hals. Vernarbte Haut. Alte Narben. Sie verlieren sich unter ihrem T-Shirt.
»Erste Frage: Was hast du getan? Ich weiß, dass du es ordentlich versaut haben musst. Mentor sucht sich immer Leute, die keine andere Wahl haben. Er hat die absurde Theorie aufgestellt, dass niemand freiwillig mit mir arbeiten möchte.«
»Wirklich eine absurde Theorie«, kontert Jon.
Sarkasmus perlt an Antonia ab wie Regen an einer neuen Goretex-Jacke. Sie beschränkt sich darauf, ihn erwartungsvoll anzusehen, und zupft dabei am Riemen ihrer Umhängetasche, die sie quer über der Brust trägt. Jon bleibt keine andere Wahl, er muss antworten.
»Ich … habe dreihundertfünfundsiebzig Gramm Heroin im Kofferraum eines Zuhälters deponiert.«
»Schlecht.«
»Er ist ein Schwein, das eines seiner Mädchen vertrimmt hat. Er hätte sie fast umgebracht.«
»Trotzdem schlecht.«
»Ich weiß, aber ich bedaure es nicht. Bedauerlich ist nur, dass ich dabei erwischt wurde. Ich war so blöd, es der Prostituierten zu erzählen, und die hat mich dabei gefilmt. Dann war der Teufel los. Ich könnte im Gefängnis landen.«
Antonia nickt.
»Du hast wirklich ein Problem.«
»Wie scharfsinnig von dir. Und die zweite Frage?«
»Gehört diese Art von Unregelmäßigkeiten zur Ausübung deines Berufes? Behindern sie deine Arbeit, und beeinflussen sie dein Urteilsvermögen?«
»Klar, ich manipuliere Beweismittel, wo ich nur kann, ich lüge, ich schlage Zeugen, ich besteche Richter, damit es zur Verurteilung kommt. Was glaubst du wohl, wie ich Inspector geworden bin?«
Antonia blinzelt nicht einmal. Aber etwas in Jons Tonfall verrät ihr, dass sie seine Antwort nicht ganz wörtlich nehmen sollte.
»Ich stelle dir die Frage einfacher. Bist du ein guter Polizist?«
Die Beleidigung überhört Jon geflissentlich. Denn die Frage ist zu wichtig. In Wirklichkeit bedeutet sie alles.
»Ob ich ein guter Polizist bin?«
Genau diese Frage stellt er sich seit dem ganzen Schlamassel ebenfalls. Und sein kindischer Fehler hat ihn bis jetzt davon abgehalten, die Wahrheit zu erkennen.
»Ja, das bin ich. Ich bin ein Superbulle.«
Antonia mustert ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. In ihren Augen stehen Abwägung, Berechnung und Einschätzung. Jon hat das Gefühl, beurteilt zu werden, und so ist es auch.
»In Ordnung«, sagt sie schließlich. »Heute Abend fahre ich mit. Und anschließend lasst ihr mich in Ruhe.«
»Warte mal, jetzt habe ich eine Frage. Wie zum Teufel bist du runtergekommen, ohne dass ich dich gesehen habe?«
Sie zeigt über seine Schulter.
»Da hinten ist ein Fahrstuhl.«
Mit offenem Mund starrt Jon die Tür an. Sie ist kaum zu sehen. Und schon gar nicht bei diesem Schummerlicht. Als er sich wieder gefangen hat, trottet er hinter Antonia her, die bereits auf dem Weg zur Haustür ist.
»Ich hoffe, es ist keine Zeitverschwendung. Da es das letzte Mal sein wird, hoffe ich, dass es sich lohnt.«
»Dass es sich lohnt?«
»Dass es interessant wird.«
Beim Gedanken daran, was Mentor ihm alles am Telefon erzählt hat, muss Jon grinsen. Interessant, sagt sie.
»Ach Schätzchen, du wirst ausflippen.«
6 Eine Autofahrt
Beim Anblick des Wagens – drei Räder auf dem Gehweg, Sonderrecht der Polizei – muss Antonia lächeln. Ein großer Audi A8. Schwarzmetallic, getönte Scheiben, Leichtmetallfelgen, gut hunderttausend Euro wert. Jon hatte noch nie was mit teuren Autos am Hut – er fährt einen Toyota Prius Hybrid, um Typen der Generation Millennials aufreißen zu können –, aber er versteht ihr Lächeln.
»Gefällt dir die Karre, die mir dein Freund Mentor geliehen hat?«
Antonia nickt.
Jon nutzt die Gelegenheit und lässt den Schlüssel wie eine Babyrassel klirren. Nach der schlauchenden Fahrt von Bilbao nach Madrid hat er jetzt wahrlich keine Lust mehr, Auto zu fahren, nicht einmal einen Wagen, der größer ist als Mutters Wohnzimmer.
»Willst du fahren?«
Antonia schüttelt den Kopf.
Und darauf beschränkt sich ihre Konversation. Nicht dass sich Inspector Gutiérrez nicht bemühen würde. Tatsächlich versucht er während der Fahrt mehrmals, Antonia Informationen zu entlocken, verpackt in gut gemeinte Fragen. Doch merkwürdigerweise beißt Antonia nicht an, sondern beschränkt sich darauf, die Augen zu schließen und den Kopf an die Scheibe zu lehnen.
Wie ein Baby. Wenn du es in ein Auto setzt, schläft es sofort ein, denkt Jon, der alles, was er über Kinder weiß, bei Modern Family gelernt hat.
Zwanzig Minuten später kommt der Audi mit einem sanften Ruck bei der Adresse zum Stehen, die ihm Mentor per WhatsApp geschickt hat. Antonia richtet sich auf.
»Sind wir schon da?«
»Fast.«
Sie halten vor einer Sicherheitsschranke: Zwei Wachmänner kommen aus ihrem Häuschen und umrunden den Wagen, jeder auf einer Seite. Das kräftige LED-Licht einer Taschenlampe blendet Jon und die verschlafene Antonia.
»Seid doch so gut und nehmt die Taschenlampe runter, Herzchen«, sagt Jon und hält seine Marke aus dem Fenster.
Der Wachmann kommt näher. In der Dunkelheit ist sein Gesicht kaum zu erkennen, was auch an der tief in die Stirn gezogenen Schirmmütze liegt, aber Jon spürt, dass er ziemlich nervös ist. Er mustert die Marke aufmerksam, fasst sie aber nicht an. Gleich darauf macht er dem Kollegen ein Zeichen, die Schranke zu öffnen.
»Sie können weiterfahren.«
»Waren Sie vorletzte Nacht auch da?«
Pause.
»Nein, ich hatte frei.«
Er lügt oder verheimlicht etwas, argwöhnt Jon.
»Und Ihr Kollege?«
»Hier hat niemand was gesehen. Fahren Sie immer geradeaus bis zum zweiten Kreisel, dort biegen Sie rechts ab und fahren bis ans Ende der Straße.«
Jon will nicht insistieren und startet den Wagen, weil die Schranke inzwischen offen ist. Die Xenon-Scheinwerfer fallen auf ein glänzendes Metallschild, auf dem der Name der Wohnanlage steht: LA FINCA.
Sie sind jetzt sechs Lieder von Joaquín Sabina und ebenso viele Welten von Lavapiés entfernt, konstatiert Jon, als sie Hunderte von Metern perfekter und makelloser Privatstraßen entlangfahren.
Am Anfang stehen noch mehrere Reihenhäuser an der Hauptstraße, die aber immer seltener werden, je näher sie den großen und teuren Luxusvillen kommen, deren Lichter sich wie Inseln von der Finsternis abheben.
»Über diesen Ort habe ich was gelesen. Eine Superluxus-Wohnanlage für Millionäre, die viel Wert auf ihre Privatsphäre legen«, sagt Antonia. Sie zieht ihr iPad aus der Tasche und sucht im Internet nach Informationen. »Unternehmer, Fußballspieler. So ein Haus kann bis zu zwanzig Millionen Euro kosten. Es heißt, dies sei der sicherste Ort in ganz Europa.«
Jon erinnert sich flüchtig an eine Fernsehreportage über La Finca. Die Hälfte der Spieler von Real Madrid lebt in diesem lebensgroßen Modell einer heilen Welt. Allerdings wurde in der Reportage nicht mehr gezeigt als diese synthetischen, gut beleuchteten Gehwege, an denen sie gerade entlangfahren. Bei Nacht wirkt der sicherste Ort in ganz Europa eher unheimlich.
»Ich weiß nicht, ob es hier wirklich so sicher ist, wie behauptet wird«, sagt Jon und denkt daran, was ihm Mentor erzählt hat.
Er fährt mit offenem Seitenfenster im Schritttempo und versucht, dieses fremde Universum zu erfassen. Weit und breit keine Menschenseele. Man hört lediglich das Zirpen der Grillen auf dem makellosen Rasen und die leichte Brise über dem künstlichen See, den Jon nach dem zweiten Kreisel rechts hinter sich gelassen hat. Hier passieren sie eine weitere Sicherheitsschranke, die der Wachmann, kaum dass sie durchgefahren sind, schnell wieder schließt.
Wie eine VIP-Zone in einer VIP-Wohnanlage.
In dieser Zone sind die Zufahrtsstraßen breiter. Auf den Gehwegen stehen weniger Straßenlaternen. Mauern und Einfahrtstore zu den Häusern sind höher. Einen halben Kilometer nach der Schranke macht Jon das Ende der Straße aus. Direkt vor dem Eingangstor des letzten Hauses steht mitten auf der Straße ein ähnlicher schwarzer Audi A8, wie er selbst einen fährt.
»Die müssen gerade im Angebot gewesen sein«, sagt Jon, als er am Straßenrand hält.
An dem anderen Audi lehnt Mentor und schaut mit gespielter Ungeduld auf seine Armbanduhr. Er trägt denselben Anzug wie am Vortag, hat aber das Hemd gegen ein frisch gebügeltes eingetauscht. Doch das kann den gräulichen Farbton seines müden Gesichts im Licht der Straßenlaterne ebenso wenig beleben wie den wässrigen Glanz seiner Knopfaugen.
Jon stellt den Motor ab und steigt aus. Antonia bleibt sitzen.
»Gut gemacht, Inspector Gutiérrez«, sagt Mentor, ohne sich von der Stelle zu rühren.
Jon geht zu ihm und zeigt hinter sich. Mission erfüllt.
»Hier haben Sie Ihr Maskottchen. Wir sind quitt.«
»Wenn wir uns wortwörtlich an unsere Abmachung halten«, sagt Mentor nach einem Räuspern, »sind wir tatsächlich quitt. Aber ich unterstelle mal, dass Ihre beruflich bedingte Neugier regelrecht danach schreit zu erfahren, was das alles soll, stimmt’s? Und weder Ihr Chef, der Comisario, noch ich wollen, dass diese Neugier unbefriedigt bleibt.«
Jon stößt ein entrüstetes Schnauben aus. Dieser Scheißkerl denkt überhaupt nicht daran, ihn endlich in Frieden zu lassen. Er verflucht sich selbst für seine Dummheit.
»Sie haben gesagt, dass ich Antonia Scott dazu bringen soll, ins Auto zu steigen, das wäre alles. Sie haben eine ganze Reihe von Leuten erpresst, und ich bin der Erste, der nicht an der Mauer zerschellt ist, die diese Frau um sich errichtet hat.«
»Und genau deshalb kann ich Sie nicht nach Hause gehen lassen, Inspector«, erklärt Mentor, wobei er jede Silbe betont, als wäre der Grund, weshalb er die Bedingungen ihrer Abmachung einfach ändert, so offensichtlich und empörend wie ein Pickel auf der Nase.
»Sie hat mir versprochen, dass sie heute Nacht mitkommt. Dann geht sie wieder nach Hause. Und ich werde Ihnen kaum noch von Nutzen sein.«
Mentor zuckt mit den Schultern.
»Ich habe das Gefühl, dass Scott weitermachen wird, wenn sie das da drin gesehen hat. Und deshalb müssen Sie unbedingt auf sie aufpassen. Das kann sie nämlich gar nicht gut.«
»Was Sie nicht sagen.«
»Wir sind uns also einig.«
Jon überlegt einen Moment. Es stößt ihm bitter auf, dass Mentor ihn getäuscht hat, das hat er wirklich nicht erwartet. Von dem wenigen, was sein Vater ihm beibrachte, bevor er abgehauen ist, erinnert er sich am besten an den Satz, den er immer wieder gern umschifft: Wenn dir eine Abmachung zu gut erscheint, um wahr zu sein, stell dir den Rest vor.
Nicht dass er eine Wahl hätte. Er weiß nicht, was dieser elegante und geheimnisvolle Kerl getan hat, um Desis Video aus den Schlagzeilen verschwinden zu lassen, befürchtet aber, dass er diesen Zauber mit einem Fingerschnippen wieder rückgängig machen kann. Karriere zum Teufel, Mutters Fischbäckchen zum Teufel.
Und in einer Sache hat Mentor recht: An diesem Punkt angelangt muss Inspector Gutiérrez unbedingt erfahren, was die ganze Geheimniskrämerei zu bedeuten hat.
»Was bleibt mir anderes übrig? Sie haben mich doch schon bei den Eiern«, gibt er sich geschlagen.
»Freut mich, dass Sie das auch so sehen.«
Jon dreht sich um und sieht, dass Antonia immer noch im Wagen sitzt.
»Warum steigt sie nicht aus?«
Mentor ergreift ihn am Ellenbogen und zieht ihn von dem Audi weg.
»Schauen Sie sie jetzt nicht an, sie bereitet sich vor. Das Ganze dürfte nicht einfach für sie sein.«
7 Eine Übung
Antonia sitzt allein im Auto und atmet schwer. Die kurze Fahrt mit geschlossenen Augen hat nicht zu ihrer Beruhigung beigetragen.
Sie hat mehrere ihrer altbewährten Tricks ausprobiert, darunter:
Die Zahl der Umdrehungen der Räder während der Fahrt zu berechnen (ungefähr 7300).In umgekehrter Reihenfolge die Liste der Gotenkönige herunterzubeten (bei Gesalech ist sie zweimal hängen geblieben, weil Jon ununterbrochen redete).Im Geiste den kürzesten Weg von ihrer Wohnung zum Retiro-Park abzustecken, aber ohne die Straßen, die mit einem Vokal beginnen (elf Minuten mehr, wenn viel Verkehr ist).Es hat nicht viel genutzt. Ihr Herzschlag hat sich beschleunigt, der Atem geht stockend. Und jetzt, da Jon nicht mehr im Wagen sitzt, steigt Panik in ihr auf. Oder vielleicht ist es eher so, dass sie die Panik nur dann aufsteigen lässt, wenn es keine Zeugen gibt.
Nachdem sie so lange vor dem, was ist, und dem, was sie tun könnte, davongelaufen ist, hat die Wahrheit sie schließlich eingeholt. Antonia hat den schwarzen Gürtel darin, sich selbst zu belügen, aber sie ist durchaus imstande, sich einzugestehen, dass sie gleichermaßen wünscht und fürchtet, auszusteigen und zum alten Spiel zurückzukehren.
Auch wenn es keine gute Idee ist.
Auch wenn sie sich geschworen hat, nicht zurückzukehren, wegen allem, was sie dem Mann angetan hat, den sie liebt.
Auch wenn das bleierne Gewicht in ihrer Magengrube sie anfleht, sich hinter das Lenkrad zu setzen, den Wagen anzulassen, das Gaspedal durchzutreten und aus diesem goldenen Käfig zu fliehen. Mit wehendem Haar und quietschenden Reifen.
Dann wirft sie einen Blick aus dem Fenster und entdeckt zu ihrer Überraschung die glitzernde Oberfläche des künstlichen Sees.
Mångata.
Mondstraße.
Auf Schwedisch: das Reflektieren des Mondes auf dem Wasser.
Antonia hatte – hat, hat, hat, wiederholt sie so laut, dass man sie fast hören kann – ein Spiel mit Marcos. Unmögliche Wörter finden, Wörter, die schöne und unübersetzbare Gefühle ausdrücken, Wörter, für die man auf Spanisch einen ganzen Absatz bräuchte. Wenn einer von ihnen ein solches Wort gefunden hatte, bot er es dem anderen wie einen Schatz dar. Und ausgerechnet jetzt – eine Windbö und die Wolken lockern auf – materialisiert sich eines ihrer Lieblingswörter vor ihren Augen, eine silberne Linie, flackernd und schillernd.
Mångata.
Ein Zeichen des Universums wie jedes andere, das bedeuten kann, was sich Antonia auch immer wünscht. Deshalb schickt uns das Universum ja Zeichen, die wir nach Belieben deuten können.
Der Druck in ihrer Brust lässt nach, die Atmung beruhigt sich. Die Affen in ihrem Kopf werden leiser. Das ist das Schöne an Gewissheiten, auch wenn sie nur vorübergehend sind. Sie erfüllen uns mit einer gewissen Erleichterung.
Antonia atmet aus, weil sie die Luft angehalten hat, und öffnet die Wagentür.
8 Ein Szenario
Der Weg zum Haus wird erleuchtet von Bodenstrahlern, die in die großen Kalksteinfliesen eingelassen sind. Je näher sie kommen, desto deutlicher erkennt Jon die Ausmaße dieser Villa und erinnert sich an Antonias Worte, dass einige Häuser der Wohnanlage La Finca bis zu zwanzig Millionen Euro teuer seien. Alle Lichtquellen scheinen eingeschaltet zu sein, es sind so viele, dass sie außer den Räumen auch der weißen Fassade einen goldenen Schimmer verleihen. Der Swimmingpool, vom Haupteingang aus teilweise zu erkennen, dürfte mindestens zehn Meter lang sein. Der Außenbereich ragt über den künstlichen See und endet an einer dicken Glasscheibe. Jon stellt sich vor, wie beide Wasserflächen optisch zu einer verschmelzen, wenn man sie tagsüber vom Haus aus betrachtet.
»Gehen wir hinten rum«, sagt Mentor.
Die beiden haben sich nicht begrüßt. Antonia ist ihm einfach gefolgt.
Ein Pfad aus demselben Stein wie Weg und Fassade führt um das Haus herum zum Swimmingpool. Als sie um die Ecke biegen, gelangen sie auf eine Terrasse mit Designerstühlen unter einer schmiedeeisernen Pergola. Der Holzboden erstreckt sich vom Swimmingpool über die Terrasse bis zu der riesigen offen stehenden Glastür des Salons. Dicke Vorhänge mit Faltenwurf verwehren einen Blick ins Innere des Hauses.
Auf einem der Designerstühle sitzt eine große Frau im weißen Schutzanzug der Spurensicherung, in der einen Hand eine Zigarette, in der anderen das Handy.
»Die Dinger werden Sie noch umbringen, Frau Doktor«, begrüßt Mentor sie.
Ohne vom Handy aufzublicken, murmelt die Frau etwas Unverständliches und nimmt einen weiteren Zug von ihrer Zigarette.
Mentor schnalzt missbilligend mit der Zunge und dreht sich zu Antonia um, die ihn erwartungsvoll anblickt und dabei wie ein Läufer am Start ihr Gewicht von einem Bein auf das andere verlagert. Mentor beugt sich ein wenig hinunter, bis seine Lippen fast ihr rechtes Ohr berühren, und sagt:
»Wie war dein Gesicht vor der Geburt?«
Statt ihm zu antworten, setzt Antonia einen Fuß in den hell erleuchteten Salon.
Was zum Teufel war das denn?
Jon will ihr schon folgen, aber Mentor legt ihm eine Hand auf die Brust.
»Eine Sache noch. Bevor Sie reingehen, muss ich Sie darauf hinweisen, dass das, was Sie dort sehen werden, diese Ermittlungen, meine Existenz oder die von Señora Scott absolut vertraulich sind. Sie werden Dinge sehen und hören, die Ihnen seltsam vorkommen, mit denen Sie nicht einverstanden sind. Sind Sie ein guter Soldat?«
»Ich mochte es noch nie, an der Leine geführt zu werden«, erwidert Jon und will schon weitergehen.
Mentor ist kräftig – viel kräftiger, als er in seinem sündhaft teuren Anzug wirkt –, aber kein ernstzunehmender Gegner für den Körperbau eines Jon Gutiérrez, also zieht er widerwillig den Arm zurück. Der Abdruck, den seine Hand auf Jons Brust hinterlässt, erhöht dessen große und zunehmende Lust, ihm eine reinzuhauen.
»Zwingen Sie mich nicht, Druck auszuüben«, insistiert Mentor. »Das ist wirklich nicht zu viel verlangt. Sie sollen nur schweigen und mitspielen.«
Neuerliches Kräftemessen, jetzt mit Blicken. Die Waage neigt sich zur Gegenseite. Jon muss seine Wut hinunterschlucken. Irgendwann wird er explodieren, aber jetzt ist nicht der geeignete Moment dafür.
»Dann spielen wir halt«, sagt sein Mund, obwohl seine Augen eine ganz andere Sprache sprechen.
Mentor gibt sich mit einem Waffenstillstand zufrieden und lässt ihn durch.
Draußen ist die Nacht mild. Drinnen ist es eiskalt. Jemand hat den Thermostat auf Gefrierstufe runtergestellt, denkt Jon, als er den schweren Vorhang zur Seite schiebt.
Als er den Salon betritt, bekommt er Zweifel an zwei Dingen, die er zu wissen glaubte.
Erstens glaubte er zu wissen, wenn auch aus der Ferne, was Luxus ist. Seine Mutter war Grundschullehrerin mit Leib und Seele und verdiente gerade genug, um irgendwie zurechtzukommen – zusammen mit den drei Groschen, die sein Vater ihr zahlte, nachdem er sie für eine andere verlassen hatte. Aber Amatxo hatte Freunde, die sie manchmal besuchten, ein paar in Bilbao, ein paar andere in Vitoria. Doppelte Familiennamen, Ländereien, Autos. Handgeschnittener Joselito-Schinken als Tapa, Vega-Sicilia-Wein am Abend und gelegentliche Sonntagsausritte verschlangen zwei Drittel ihres Vermögens. Und nach diesen Besuchen kehrte Jon in die Wohnung am anderen Ufer des Nervión zurück und schlief in dem Glauben ein, im Himmel gewesen zu sein.
Aber jetzt, Jahre später, betritt er diesen Salon und begreift, dass er nicht einmal die Farbe des Himmels kennt.
Der Raum ist unermesslich groß, obwohl sich der Architekt sehr bemüht hat, ihn einem menschlichen Maßstab anzupassen. Doppelte Deckenhöhe, offenes Obergeschoss, Oberlichter, vier Meter hohe Fensterfronten. Auf einer Seite das Esszimmer mit offenem Kamin, dahinter eine Wand zur Eingangshalle mit Springbrunnen und allem Drum und Dran. Geschmackvolle Bilder an den Wänden. Jon erkennt einen Rothko und zwei Miró. Er kennt noch eines, der Name des Malers liegt ihm auf der Zunge, bestimmt ein Holländer. Am Ende gibt er auf und beschränkt sich auf eine vorsichtige Schätzung: Die Bilder im Salon sind zehnmal mehr wert als das Haus.
Niemand, der so wohnt, kann auch nur im Ansatz die Bodenhaftung behalten, und er hat auch nicht die geringste Ahnung, was es heißt, ein Mensch zu sein. Dieser Gedanke schießt ihm blitzartig durch den Kopf und hinterlässt eine gewisse Irritation.
Am anderen Ende des Salons befindet sich das Wohnzimmer. Ein 80-Zoll-Fernseher, so dünn, dass er wie auf die Wand gemalt wirkt. Glattledersofas und in einer Ecke etwas, das Jons zweite feste Überzeugung ins Wanken bringt.
Bullen ähneln ein wenig Hunden: Ein Lebensjahr entspricht sieben Jahren der Seele.
Nach über zwanzig Dienstjahren hat Jon mehr als genug Tote gesehen. Aufgeschlitzte Junkies auf der Straße, einen Jungen, der von der Miraflores-Brücke gesprungen war, zwei alte Männer, die von ihren jugendlichen Nachbarn mit Messerstichen durchlöchert wurden. Wenn man das alles gesehen hat, wird einem klar, dass jeder Tod immer nur eine Wiederholung ist. Ein Aussetzen des Herzschlags, zerspringendes Glas und am Ende die Einsamkeit. Du legst dir ein dickes Fell zu und glaubst, nichts könnte dich mehr überraschen oder dir nahegehen.
Und dann siehst du den Jungen auf dem Sofa und begreifst, wie sehr du dich geirrt hast.
»Verdammte Scheiße!«, entfährt es Jon.
Er kann höchstens sechzehn oder siebzehn sein. Er trägt ein weißes Hemd und eine weiße Hose, die sich kaum von dem Ledersofa und seiner Haut abheben, die mal braun war und jetzt blass, fast durchsichtig ist. Jeder Hauch von Leben ist aus dem unfassbar dünnen Körper gewichen, und trotzdem sitzt er aufrecht, die rechte Hand auf dem Knie, in der linken ein Glas, randvoll mit einer zähen schwärzlichen Flüssigkeit. Er trägt weder Schuhe noch Strümpfe, die nackten Füße wie auch die Lippen haben eine bläuliche Färbung. Die Augen sind offen und die Lederhaut gelb.
Der zu einem grotesken Lächeln verzogene Mund ist das Obszönste. Geronnenes Blut an der Unterlippe sowie in einem Grübchen am Kinn.
Jon bezwingt den erbarmungslos aufsteigenden Brechreiz. Um seinen Mageninhalt bei sich zu behalten und nach außen den Profi zu geben, ballt er vor Wut und Mitleid die Fäuste.
Als er sich wieder gefasst hat, schaut er zu Antonia hinüber, die vor der Leiche in die Hocke gegangen ist und das Gesicht des Opfers untersucht. Ihre Gesichter sind so nah beieinander, dass es aussieht, als würden sie sich küssen.
»Scott«, ruft Mentor sanft. »Erzähl uns, was du siehst.«
Jon hat ihn nicht eintreten hören, doch der geheimnisumwitterte Mann steht nur wenige Schritte hinter ihm. Seine Stimme zeigt doppelte Wirkung: Es gelingt ihr, Jon zu beruhigen und Antonia in die Wirklichkeit zurückzuholen. Zumindest kommuniziert sie mit ihnen, wo auch immer sie gerade gewesen sein mochte.
»Es gibt keine Anzeichen von Gewalt«, sagt sie so leise, dass Jon näher gehen muss, um sie zu verstehen. »Weder oberflächliche Verletzungen noch Abwehrspuren an Händen oder Armen.«
Sie hält inne, als koste es sie große Kraft weiterzusprechen.
»Todesursache?«, fragt Mentor.
Antonia zieht aus ihrer Umhängetasche ein paar Nitril-Handschuhe, streift sie über und drückt auf den Daumen der Leiche.
»Hypovolämischer Schock oder Hypoxämie oder beides. Seine Nieren dürften im selben Moment versagt haben, als sein Herz kein Blut mehr durch den Körper pumpte. Ein langsamer und qualvoller Tod. Die Zyanose ist nur gering ausgebildet, nur an Lippen und Füßen. Er dürfte sediert gewesen sein und gelegen haben, ansonsten wären die Verfärbungen auch an den Händen deutlich sichtbar. Kopfschmerzen und Schwindel hätten dazu geführt, dass er sich nach vorn gebeugt und gekrümmt hätte. Dann hätte er seine eigenen Fingerabdrücke auf der Haut.«
»Das heißt was?«, fragt Jon.
»Er ist verblutet«, sagt eine Stimme hinter ihm.
9 Ein Sohn
»Darf ich Ihnen unsere Gerichtsmedizinerin Doktor Aguado vorstellen? Sie ist seit gestern Nachmittag vor Ort«, sagt Mentor.
Die Frau von draußen hat sich zu ihnen gesellt. Sie hat die Kapuze des Overalls abgenommen, sodass ihr langes blondes Haar sichtbar ist, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden trägt. Um die vierzig. Lange Wimpern, dezentes Make-up, Nasenpiercing, müdes Lächeln, verschmitzter Langmut im Blick. Sie reicht ihnen nicht die Hand, und Jon dankt es ihr insgeheim. Vor den Händen von Gerichtsmedizinern graust es ihm.
»Verblutet? Wie? Durch einen Messerstich, einen Schuss?«
»Der Mörder hat ihm eine Kanüle in die Halsschlagader gesteckt und anschließend das Blut ablaufen lassen«, antwortet sie.
»Und das ganz langsam«, fügt Antonia mehr zu sich selbst hinzu. »Er hat sich Zeit gelassen.«
Das erklärt die extrem dünne Leiche. Der menschliche Körper enthält zwischen vier und fünf Litern Blut. Ohne diese Flüssigkeit bleibt von ihm nur eine leere Hülle wie die vor ihren Augen. Als Jon Gutiérrez sich die letzten Momente des Jungen vorzustellen versucht, überkommt ihn eine Welle des Mitleids.
»Sie haben gesagt, es gibt keine Abwehrspuren. Wie ist es ihm gelungen, das Opfer zu überwältigen?«, fragt er.
»Ich habe Proben von der Schleimhaut genommen und Spuren von Benzodiazepinen gefunden. Mehr kann ich Ihnen vor der Obduktion nicht sagen.«
»Darüber haben wir schon gesprochen, Aguado. Die Familie hat ihre Zustimmung verweigert, also bestehen Sie nicht darauf«, erklärt Mentor.
Jetzt versteht Jon gar nichts mehr. Bei ihrem Telefonat in Antonias Treppenhaus hatte Mentor ihm gesagt, dass es einen unmöglichen Mord gegeben habe, dass der Mörder in einen Ort mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen eingedrungen und, ohne Spuren zu hinterlassen, wieder verschwunden sei. Mit solchem Unsinn hat Jon nicht gerechnet.
Die Entscheidung, bei einem Gewaltverbrechen eine Obduktion anzuordnen, wird nicht von den Familienangehörigen, sondern vom Ermittlungsrichter gefällt. Der allerdings durch Abwesenheit glänzt. Alles an diesem Tatort, an dieser Ermittlung ist falsch, sie folgt weder einem Protokoll, noch hält sie sich an die Strafprozessordnung oder die etablierten Normen. Eine einzige Gerichtsmedizinerin? Ohne zusätzliche Einheiten, ohne Kriminalbeamte – ihn ausgenommen natürlich? Was kann dazu führen …?
Jon unterbricht seine Gedanken. Das sind natürlich keine wichtigen Fragen.
»Wer ist das Opfer?«
Doktor Aguado verlässt kurz den Raum und kommt mit einer Mappe zurück. Darin befindet sich ein Foto eines großen, schlanken Jungen mit lockigem Haar und traurigem Blick. Er posiert lustlos am Strand, wie es seinem Alter und seinem Stand entspricht. Unsterblich, unverwundbar, ohne die geringsten Sorgen. Das Foto dürfte aus diesem Sommer stammen, schlussfolgert Jon. Mein Gott, wie er Fotos von früher hasst. Er hasst es, den lebendigen Menschen, der keine Ahnung von seinem Schicksal hat, das ihm mit gefletschten Zähnen auflauert, mit den Überresten von ihm in Einklang zu bringen.
Der Junge hält ein ungefähr acht- oder neunjähriges Mädchen an der Hand, das einen Plastikball unterm Arm hat. Den Mund voller Zahnlücken lächelt sie in die Kamera.
Ein Mädchen, das nie wieder mit seinem Bruder spielen wird, denkt Jon. Ich frage mich, wie sie ihr das beibringen wollen. Das ist immer das Schwierigste. Jemandem ins Gesicht zu sehen und ihm zu sagen, dass seine Welt in tausend Scherben zerbrochen ist. Dass man sie auch nicht wieder zusammensetzen kann, weil jemand Teile davon entwendet hat.
Unten auf den Rand hat Aguado den Namen des Opfers geschrieben. Jon liest ihn laut und stockt beim Familiennamen. Klangvoll. Unverwechselbar.
»Warten Sie mal, Álvaro Trueba. Ist der Junge …«
»Ja. Der Sohn. Einer der Söhne«, unterbricht Mentor ihn. »Haben Sie bei der Bank seiner Mutter ein Konto, Inspector?«