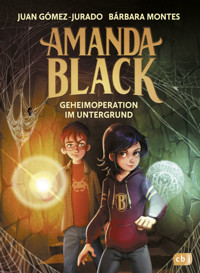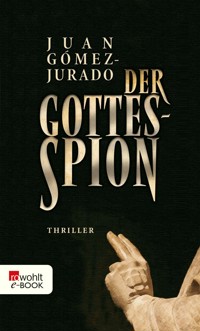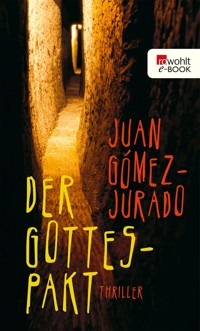8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die rote Königin
- Sprache: Deutsch
Der grandiose Abschluss der Trilogie von Spaniens erfolgreichstem Thrillerautor
»Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen. Wollen wir spielen?« Antonia Scott weiß genau, wer ihr diese Nachricht geschickt hat: der mysteriöse Mister White, dem sie seit Jahren auf der Spur ist. Sie weiß auch, dass es schier unmöglich ist, gegen ihn zu gewinnen. Aber wenn sie dieses Spiel verliert, bezahlt Inspector Jon Gutiérrez mit seinem Leben. Antonia und Jon bekommen noch eine letzte Chance: Sie müssen drei Fälle aufklären, die als unlösbar gelten. Ein Spiel um Leben und Tod beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Seit Jahren jagt Antonia Scott, die wahrscheinlich intelligenteste Frau der Welt, den mysteriösen Mister White. Nun kommt sie ihm so nah wie nie zuvor: White fordert sie zu einem tödlichen Spiel heraus. Antonia hat keine andere Wahl, als sich darauf einzulassen, denn White hat ihren Freund und Kollegen, Inspector Jon Gutiérrez, in seiner Gewalt. Antonia und Jon müssen drei Verbrechen aufklären, an denen bislang alle Ermittler gescheitert sind. Gelingt es ihnen nicht, wird Jon mit dem Leben bezahlen …
Weitere Informationen zu Juan Gómez-Jurado sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
JUANGÓMEZ-JURADO
Der weiße Spieler
Thriller
Aus dem Spanischen von Sybille Martin
Die spanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Rey Blanco« bei Ediciones B, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2023
Copyright © 2020 by Juan Gómez-Jurado
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: Trevillion Images/Stephen Carroll
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
LS · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30285-6V001
www.goldmann-verlag.de
Für Babs, weil ich sie liebeFür Carmen, für ihre TreueFür Antonia, weil sie mir ihren Namen geliehen hat
Ein Ende
Antonia Scott hat knapp drei Minuten Zeit.
Für andere Menschen mögen drei Minuten sehr wenig Zeit sein.
Nicht für Antonia. Man könnte sagen, ihr Verstand ist fähig, gewaltige Datenmengen zu verarbeiten. Man könnte sagen, sie kann detailgenau den Madrider Stadtplan visualisieren, aber Antonias Kopf ist kein Navi.
Antonias Verstand ist eher ein Dschungel, ein Dschungel voller Affen, die sich rasend schnell von Liane zu Liane schwingen und dabei allerlei mitreißen. Ihr Kopf ist voller Dinge, die in der Luft aufeinandertreffen, und Affen, die sich gegenseitig die Zähne zeigen.
Inzwischen hat Antonia es jedoch geschafft, sie zu zähmen.
Das ist auch notwendig. Denn Antonia Scott bleiben keine drei Minuten Zeit. Zwei Männer mit Ski-Masken – und eine Frau mit freundlichem Gesicht – haben soeben ihren Kollegen Inspector Jon Gutiérrez entführt.
Antonia Scott läuft dem Transporter nicht hinterher. Sie ruft nicht nach Hilfe. Sie ruft auch nicht verzweifelt die Polizei.
Antonia Scott tut nichts dergleichen, denn Antonia Scott ist kein gewöhnlicher Mensch.
Sie bleibt einfach stehen.
Zehn Sekunden. Mehr gönnt sie sich nicht.
In zehn Sekunden – mit geschlossenen Augen und an eine Hauswand gestützt, um die Furcht in den Griff zu bekommen – ist Antonia fähig:
Die drei wahrscheinlichsten Routen aus der Altstadt zu berechnen.Sich im Geiste alle Einzelheiten des Transporters und der Entführer zu vergegenwärtigen.Sich zu überlegen, wie sie Jons Leben retten kann.Sie öffnet die Augen.
Und wählt eine spezielle Telefonnummer. Bei dieser Nummer weiß Mentor, dass er vor dem Auflegen nichts sagen muss. Nur zuhören und gehorchen.
Antonia diktiert ihm den genauen Wortlaut für den Notruf (10 – 00 Inspector Gutiérrez, 10 – 37 Mercedes Vito, höchste Dringlichkeitsstufe), das Kennzeichen des Wagens (9344 FSY) und seine Farbe (natürlich weiß). Dann muss sie sich für eine der drei möglichen Routen entscheiden. An der Straßenkontrollen eingerichtet werden müssen.
Pirámides, Madrid Río, Legazpi.
Von diesen drei ist Madrid Río die schwierigste, die langsamste und die unwahrscheinlichste. Der Paseo de Santa María de la Cabeza ist immer verstopft. Und an dessen Ende befindet sich eine Dienststelle der Policía Municipal.
Antonia verwirft sie sofort.
Es bleiben Legazpi und Pirámides.
Sie entscheidet sich für die Glorieta de las Pirámides. Die kürzeste, die schnellste, die unkomplizierteste Route.
Es ist nicht leicht. Inspector Gutiérrez’ Leben steht auf dem Spiel. Wenn das Leben von einem der drei Menschen, die dir auf der Welt am wichtigsten sind, in deiner Hand liegt, solltest du eine rationale Entscheidung treffen.
Doch rational ist es nicht. Es ist eine Lotterie.
Und das gefällt Antonia überhaupt nicht.
Ein Notruf
Ruano setzt den Blinker im letzten Moment. Statt zur Dienststelle abzubiegen, wendet er.
»Noch eine Runde, okay?«
Sein Kollege schaut missmutig auf die Uhr. Es ist schon spät, sein Dienst ist seit elf Minuten beendet, und er will nach Hause zu seiner Frau. Aber Osorio hat Verständnis für den Neuen. Nicht dass Ruano zu wenig Knöllchen verteilt hätte. Dass die Policía Municipal eine Bußgeldquote erfüllen muss, ist natürlich nur ein Großstadtmythos.
»Wie viele brauchst du noch?«
»Fünfzehn.«
»Das ist doch nichts, Mann. Die verteilen wir morgen an diejenigen, die an der Glorieta Carlos V in der zweiten Reihe parken.«
Es ist keine gute Idee, »mal kurz« vor dem Restaurant El Brillante zu halten. Für die Streifenbullen, denen noch Knöllchen fehlen, bedeutet das, wie in einem Fass Fische zu angeln. Zwei Runden im Kreisel, den parkenden Wagen überprüfen und den unvorsichtigen Hungrigen begrüßen, wenn er mit dem üblichen, sorgfältig in Alufolie eingewickelten Calamares-Bocadillo im weißen Plastikbeutel auftaucht. Bei dem unverwechselbaren Geruch knurrt jedem Madrilenen, der etwas auf sich hält, sofort der Magen. Dem Unvorsichtigen jedoch vergeht der Appetit, wenn die Polizei ihm die Quittung aushändigt. Dann enthüllt der Geruch seine wahre Natur: Gestank nach Panade und Frittierfett für zweihundert Euro.
Es ist ein blöder Nachmittag, ein aufgeweckter Streifenpolizist erfüllt seine Quote.
Aber das ist nicht Ruanos Ding. Der Junge ist ein Idealist. Ein Träumer. Also ein Spinner. Vielleicht hat es mit seiner früheren Arbeitsstelle zu tun. Oder es liegt schlicht daran, dass er so jung ist. Wenn er erst mal Fett am Hintern angesetzt hat und zur Vernunft gekommen ist, wird ihm der Eifer schon vergehen.
Ruano möchte für seinen Lebensunterhalt richtig schuften. Er will Streife fahren und echte Verbrecher schnappen. Solche, die volle Kanne eine schmale Straße entlangrasen, oder solche, die an Straßenecken mit Drogen dealen. »Wenn ich echte Verbrecher schnappen wollte, wäre ich ein echter Polizist geworden«, sagt Osorio dann immer.
Jedes Mal, wenn er das hört, schaut Ruano ihn an und lacht. Ein entspanntes Lachen, das eines selbstsicheren Millennials. Ruano findet alles witzig.
»Du wirst schon sehen, wenn du erst mal in mein Alter kommst.«
»Du bist erst siebenunddreißig, Osorio!«
»Und fahre immer noch mit Frischlingen Streife.«
»Wenn du dich vielleicht ein bisschen mehr …«
»Wenn du vielleicht mal die Klappe halten würdest …«
Ruano fährt jetzt Richtung Nordwesten. Er weiß den Weg auswendig, fährt nach Gefühl. Sie kennen dieses Dreieck ganz genau. Diese Tour fahren sie täglich zehnmal. Im Jahr unzählige Male. Sie würden sie noch öfter fahren, wäre der Paseo de Santa María de la Cabeza nicht ständig verstopft. Zu jeder Uhrzeit und um diese ganz besonders.
Auf Höhe der Calle Arquitectura trifft per Funk ein Notruf ein. Osorio runzelt die Stirn, Ruanos Gesicht verdüstert sich. Ein Inspector der Polizei. Entführt. In einem weißen Transporter. Er will etwas sagen, aber ein lautes Piepen hält ihn davon ab.
Piep, piep, piep.
Der Monitor am Armaturenbrett leuchtet kräftig orange, und darin blinkt ein Kennzeichen.
9344 FSY
Der Streifenwagen ist mit einer AKLS ausgerüstet, einer automatischen Nummernschilderkennung. Mehrere Kameras auf dem Dach, an der Windschutzscheibe und auf den Kotflügeln scannen die Nummernschilder und vergleichen sie mit den entsprechenden Datenbanken. Für den Fall der Fälle.
Das System ist nicht perfekt, aber manchmal gibt es einen Notruf. Mit einem Kennzeichen und dem Grund, warum dieser Wagen überprüft werden soll. Weil er gestohlen wurde, weil der Fahrer tausend Euro Bußgeldschulden hat, weil damit ein Inspector der Polizei entführt wurde.
»Ich verstehe gar nichts mehr«, sagt Osorio verwundert. »Das AKLS meldet ›gelber Megane‹. Stimmt nicht mit dem Notruf 10 – 00 überein.«
»War es nicht ein weißer Transporter?«, fragt Ruano mit starrem Blick in den Rückspiegel.
Osorio dreht sich um. Sie sind gerade an einem Vito vorbeigefahren. Er kann ihn sehen, er steht in der Schlange vor der roten Ampel an der Plaza de las Peñuelas. Das Nummernschild kann er nicht erkennen.
»Melde ihn per Funk«, sagt Ruano.
Während Osorio spricht, setzen sich die Autos wieder in Bewegung. Doch der Frischling fährt nicht weiter. Ein Fahrer hupt, aber der Streifenwagen rührt sich nicht von der Stelle.
»Ich werde ihm folgen.«
»Du kannst nicht über die Fahrbahntrennung wenden. Sie ist zu hoch.«
Ruano trommelt mit den Fingern aufs Lenkrad. Die nächste Lücke in der Fahrbahntrennung befindet sich gut hundert Meter weiter vorn. Zu weit entfernt.
»Einheit M58. Bestätigen Sie Sichtkontakt zum verdächtigen Fahrzeug, over«, sagt die Stimme aus dem Funk.
»Die hauen ab.«
Der Transporter verschwindet aus dem Rückspiegel, und Ruano überlegt nicht länger. Er reißt das Lenkrad herum, steuert die Fahrbahntrennung an und drückt das Gaspedal durch. Dabei bleibt die Stoßstange des Nissan Leaf auf der Strecke, und weiße Plastikteile verteilen sich über das Blumenbeet, was zu einem Hupkonzert der nachfolgenden Fahrer führt, doch er schafft es, das Hindernis zu überwinden und auf die Gegenfahrbahn zu gelangen.
»Einheit M58, Richtung Südwesten auf der Santa María de la Cabeza. Wir verfolgen Mercedes Vito, Code 10 – 00«, gibt Osorio per Funk durch. Er lässt den Knopf los und starrt Ruano besorgt an. »Du bist ja völlig durchgeknallt, Junge.«
»Die wollten abhauen«, erwidert Ruano mit gerecktem Kopf.
Er schaltet das Blaulicht ein, aber nicht die Sirene. Das reicht, damit die Autofahrer vor ihnen eine Gasse bilden. Es herrscht ein beträchtlicher Stau, aber zwei Spuren machen es leichter. Und die Angst vor Bußgeldern auch. Denn beim Anblick der berüchtigten weiß-blauen Quadrate der Policía Municipal fährt ein Madrilene doppelt so schnell zur Seite wie bei einer Ambulanz oder einem Wagen der Policía Nacional.
Ein paar Sekunden später sehen sie das weiße Dach des Transporters wieder.
»Wenn sie den Tunnel von Acacias nehmen, sind sie am Arsch. Wir machen Meldung und fertig. Die Policía Nacional kann sie am anderen Ende abfangen.«
»Wenn sie die Brücke nehmen, können wir einen Scheiß melden«, erwidert Ruano und beißt sich auf die Lippen.
Osorio schnaubt. Der Frischling hat recht. Auf der anderen Seite der Brücke vervielfältigen sich die Fluchtmöglichkeiten für den Transporter. Sie könnten in Usera oder Opañel abtauchen. In einem unendlich labyrinthischen Straßengeflecht mit vielen Ausfallstraßen. Zu vielen.
»Einheit M58, nicht eingreifen, ich wiederhole, nicht eingreifen. Wir schicken örtliche Streifenwagen von Pirámides. Ankunft: in vier Minuten.«
»Dafür ist es zu spät, Zentrale«, meldet Osorio über Funk. Distanziert, fast wie zu sich selbst.
Im Abschnitt zwischen dem Paseo de la Esperanza und Santa María de la Cabeza wird die letzte Ampel gerade rot. Der Transporter ist das dritte Fahrzeug in der Schlange.
»Einheit M58, ich wiederhole, nicht eingreifen. Verraten Sie den Verdächtigen nicht Ihre Position.«
Auch dafür ist es etwas zu spät. Das Blaulicht des Streifenwagens, das ihnen den Weg geebnet hat, reflektiert sich bereits auf der Karosserie des Mercedes. Nur ein Fahrzeug steht noch zwischen ihnen.
Die blinkende Ampel kündigt den Wechsel an. Der letzte Fußgänger erreicht den gegenüberliegenden Bürgersteig. Das erste Auto fährt los.
Der Transporter rührt sich nicht von der Stelle.
Der Fahrer vor Ruano und Osorio hupt und schlägt aufs Lenkrad, bevor er in die Nebenspur wechselt. Die anderen Fahrzeuge setzen sich in Bewegung, einige hupen, andere lassen das Fenster herunter und brüllen etwas zum Transporter hinüber, der sich noch immer nicht von der Stelle gerührt hat.
Ruano sieht Osorio an und beißt die Zähne zusammen.
»Was sollen wir tun?«
»Gib ein Warnsignal, mal sehen, was passiert.«
Ruano drückt kurz den Sirenenknopf. Das kurze, trockene Aufheulen verstummt, nichts geschieht.
»Also wirklich, verdammt noch mal«, schimpft Osorio und öffnet die Wagentür.
»Wo willst du hin?« Ruano will ihn am Aussteigen hindern. Er beugt sich zum Beifahrersitz hinüber und erwischt ihn an der Jacke.
»Nirgendwohin, wenn du mich nicht loslässt.«
Der Frischling schaut seinen Kollegen befremdet an. Solcherart Verhalten ist er nicht von ihm gewöhnt. Aber das ist keine normale Notsituation. Ruano wirft einen schnellen Blick auf den Transporter. Darin wird vielleicht ein Inspector gegen seinen Willen festgehalten.
»Uns wurde gesagt, wir sollen nicht eingreifen.«
Genervt schnalzt Osorio mit der Zunge.
»Ich will auch nicht eingreifen, dafür werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich will mich nur vergewissern, dass die sich nicht von der Stelle rühren, bis die …«
Ruano lässt etwas locker. Genug, damit Osorio einen Fuß auf die Bordsteinkante setzen kann. Der Stiefel verursacht ein schmatzendes Geräusch, als er auf den Asphalt trifft. Ein Geräusch, das eigentlich kaum zu hören ist, das sich aber in Ruanos Ohren grässlich vervielfältigt. Und sogar das metallische Schnarren der Seitentür des Vito übertönt, als diese geöffnet wird. Das noch in seinem Kopf widerhallt, als die ersten Schüsse fallen.
Ruano hört sie nicht.
Er spürt das Aufschlagen von Blei auf der Karosserie, riecht das Öl, als der Motor von Kugeln durchsiebt wird, ihn aber vor den Projektilen schützt.
Er spürt die Luft, die durch die offene Beifahrertür hereinströmt und wegen der geborstenen Windschutzscheibe zur Zugluft wird.
Er spürt die Glassplitter, die über seinem Kopf niedergehen, in den Hemdkragen fallen und sich in seine Haut bohren.
Von seinem Kollegen Osorio, dem Mann, der ihn vor Kurzem einlud, Weihnachten mit seiner Familie zu verbringen – »Der Arme soll schließlich nicht allein sein, meine Liebe, was macht schon einer mehr« –, von dem gutmütigen und sympathischen Griesgram, der ihm ständig auf den Sack geht, sieht er wenig. Nur seine Schulter, in einem unnatürlichen Winkel verdreht über der zerschossenen Tür.
Ruano hört die Schüsse nicht, weder die entsetzten Schreie der Leute noch das Quietschen der Reifen des davonrasenden Transporters. Und auch das Echo des Geräuschs, das Osorios Stiefel bei der Berührung mit dem Asphalt gemacht hat, verstummt, als Osorio stirbt, ohne seinen Satz zu vollenden.
Erster Teil Antonia
Wer aber soll die Wächter selbst bewachen?
Juvenal
1 Ein Flugzeug
Es ist nur ein Punkt am Morgenhimmel.
Der Tag ist noch nicht angebrochen, als der Bombardier Global Express 7000 aus Richtung Westen zur Landung ansetzt. Er muss auf keine Landeerlaubnis warten, der Flugplatz Madrid-Cuatro Vientos wurde für den Flugverkehr gesperrt, mit Ausnahme dieses Privatjets.
Antonia lässt ihn während der Landung nicht aus den Augen. Sie sitzt auf der Motorhaube des Wagens, weit weg vom heraufziehenden Morgengrauen, bis der Flieger vor ihr zum Stehen gekommen ist.
Die Tür des Bombardier wird geöffnet, und in dem erleuchteten Rechteck zeichnet sich eine bekannte Silhouette ab. Antonia rutscht von der Motorhaube und geht mit einer Hand auf dem Rücken näher, die Krämpfe in den tauben Beinen ignoriert sie.
»Du bist spät dran«, sagt sie.
»Wir hatten in Gloucester Probleme beim Abflug«, antwortet die Gestalt in dem erleuchteten Rechteck.
Antonias Hand ist noch immer hinterm Rücken versteckt, als sie langsam die acht Stufen erklimmt. Erst, als sie sich sicher ist, dass es sich um die Frau handelt, auf die sie gewartet hat, löst sie ihre Finger vom Holster der SIG Sauer P290 am Gürtel.
»Du hast eine andere Haarfarbe.«
»Das ist meine Originalfarbe. Blond hatte ich satt.«
Carla Ortiz lächelt warmherzig, trotz der Müdigkeit und Angst, die in ihren großen braunen Augen steht. Sie streckt die Hand aus, zieht sie aber gleich wieder zurück.
»Nein, ich mag keinen Körperkontakt«, entschuldigt sich Antonia.
»Ich weiß. Das wurde mir gesagt. Das und anderes.«
»Beschämendes vermutlich.«
»Richtig vermutet, Kindchen«, erklingt eine Stimme auf Englisch aus dem Flugzeuginneren.
Antonia steigt ein und kniet sich vor die erste Sitzreihe. Knorrige Hände voller Ringe, eiskalt wie Bettdecken im Winter, fahren ihr zärtlich durchs Haar.
»Du siehst grässlich aus«, sagt Großmutter Scott und zeigt auf die violetten Augenringe ihrer Enkelin.
»Und du bist …«, erwidert Antonia im Versuch, ihre Rührung über die zärtliche Geste zu verbergen.
Großmutter Scott und Marcos waren die einzigen Menschen, nach deren Berührung sie sich immer sehnte. Ihr Mann ist vor ein paar Stunden gestorben, Antonia hat nach Jahren der Unvernunft endlich die lebenserhaltenden Apparaturen abschalten lassen. Und Großmutter Scott bleibt nicht mehr viel Zeit. Die dieser Überraschungsflug mitten in der Nacht auch nicht gerade verlängert.
Sie betrachtet die knochige Frau in dem geblümten Kleid. Die freie Hand umschließt ein Glas Whiskey.
Antonia sieht sofort, dass am Glas keine Lippenspuren zu erkennen sind, auch ihr Atem riecht nicht nach Alkohol, und sie begreift, dass die Großmutter den linken Arm nicht mehr bewegen kann. Sie will sie gerade danach fragen, als ihr ein Gedanke durch den Kopf schießt. Ein Gedanke mit baskischem Akzent und kräftiger, aber nicht dicker Stimme.
Sie hat sich sehr bemüht, es vor dir geheim zu halten. Lass sie in dem Glauben.
»… schöner denn je«, beendet sie gequält ihren Satz.
»Ich habe das Jahrhundert bald geschafft, Kindchen. Seit Jahrzehnten die einzige Gewissheit.«
Beim Blick in die blassblauen Augen der Großmutter spürt Antonia, wie sich ihr Herz zusammenzieht. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass sie sich von Angesicht zu Angesicht sehen. Sie möchte sie in den Arm nehmen, sie wünscht es sich inständig, aber sie kann es nicht.
»Mach schon, Kindchen«, entschuldigt die Großmutter sie mit einer letzten zärtlichen Abschiedsgeste. »Mach deine Arbeit und erzähle mir später davon.«
Antonia nickt und steht auf. Sie überprüft lange Minuten die Flugzeugkabine, ignoriert Carlas Versuche, mit ihr ins Gespräch zu kommen, und spürt, wie ihre Furcht wächst. Schließlich beendet sie die Überprüfung, so oberflächlich sie auch sein mag.
Zu mehr reicht die Zeit nicht.
Sie geht zu Carla.
»Irgendwelche Nachrichten von Inspector Gutiérrez?«, fragt die Unternehmerin.
»Der Transporter ist entkommen. Im Augenblick wissen wir gar nichts.«
Carla zögert, sie hat Angst, traut sich aber schließlich doch.
»Sie … Sie war es, stimmt’s?«
Antonia nickt. Es entsteht ein ungemütliches Schweigen, eines von denen, das sie sich früher mit Versprechungen zu füllen gezwungen sah. Große, beruhigende Versprechen. Für andere Menschen leere Versprechen.
Für andere Menschen ist ein Versprechen, das in einem solchem Moment gegeben wird, nichts außer Worte.
Nicht für Antonia.
Für Antonia ist ein Versprechen ein Vertrag. Ein Vertrag, für den sie auch bezahlt, wenn sie ihn nicht einhält. Mit Schuldgefühlen und Gewissensbissen, eine inflationäre Währung.
Deshalb füllt Antonia derartige Schweigen nicht mit Worten wie »Ich werde Inspector Gutiérrez finden« oder »Ich werde die Frau, die dich entführt und gefoltert hat, schnappen«. Nein, Antonia hat in den letzten Monaten etwas über Versprechen gelernt.
Deshalb sagt sie zu Carla:
»Mein Beileid zum Tod deines Vaters.«
Ein Schatten huscht über das Gesicht der jungen Frau, als sie den Blick abwendet.
»Er war sehr alt.«
»Konntest du mit ihm sprechen, bevor …«
Diese drei Pünktchen enthalten ganze Enzyklopädien.
»Ich wollte es nicht, und er konnte es nicht«, sagt Carla schulterzuckend.
Carla
Nach einem Schlaganfall vor einigen Monaten war Ramón Ortiz nur noch ein sabberndes Häufchen Elend gewesen. Der Tod streicht niemanden von seiner Liste, nicht einmal den reichsten Mann der Welt. All die Macht und all der Reichtum hatten ihm nur einen besseren Ort zum Sterben beschert, den Tod aber nicht erspart.
Die reiche Erbin hatte sich in der Zeit ihrer Entführung durch Ezechiel verändert.
Aus der Kanalisation war eine andere Frau gestiegen. Ihre Launenhaftigkeit und ihre Marotten hatte sie in der Finsternis der Gefangenschaft zurückgelassen. Ihr früherer Egoismus und ihr Bedürfnis nach Bestätigung waren einer düsteren und irritierenden Großzügigkeit und Selbstsicherheit gewichen. Sie lächelt nur noch selten, aber wenn doch, dann ist es ein aufrichtiges Lächeln.
Und nein, sie hat sich mit ihrem Vater nie ausgesöhnt. Der Unternehmer stand neben dem Kanaldeckel in der Calle Jorge Juan, umgeben von einem Haufen Fotografen und Reportern. Sie lehnte seine versöhnlich ausgestreckte Hand ab und stützte sich lieber auf Inspector Gutiérrez, den Mann, der in einem Tunnel voller Sprengstoff alles riskiert hatte und angeschossen wurde, um sie zu retten. Regungslos ließ sie Ramóns Umarmung über sich ergehen, lächelte nicht und vergoss auch keine Träne. Dann wandte sie sich an die Reporter. Mit überraschend klarer Stimme dankte sie ihnen für ihr Interesse und erklärte, es ginge ihr bestens und sie könne sofort wieder an die Arbeit gehen. In den Morgennachrichten hörte die ganze Welt ihre ruhigen Erklärungen, und die Firmenaktien stiegen um sechs Prozent.
Privat hat sie nie wieder mit Ramón gesprochen. Hunderte Male war sie versucht gewesen, ihn zu fragen, warum er sie ihrem Schicksal überlassen hatte. Warum er Ezechiels Forderung nicht erfüllt hatte, wie sie es ohne zu zögern getan hätte, wäre ihr Sohn in Gefahr gewesen.
Ihr Sohn, der jetzt zugedeckt auf einem Sofa im Privatjet schläft, war alles, was sie interessierte. Sonst nichts. Ihn wieder umarmen zu können war das Einzige, was sie sich während der Entführung gewünscht hatte. Für ihn würde sie alles aufgeben. Bis zum letzten der tausend Millionen Euro, die sie besitzt, einschließlich des Kleingelds in ihrem Portemonnaie, wenn es verlangt würde.
Erst als Ramón starb – um drei Uhr an einem Samstagnachmittag, als gerade die Schlagzeilen der Fernsehnachrichten liefen – verstand sie alles. Er lag im Krankenhaus, schaute fern und schüttelte dabei sanft den Kopf, als würde er gleich einschlafen. Und plötzlich war er tot. Ohne das geringste Geräusch war er einfach gegangen. All das erzählte ihr eine der vier Krankenschwestern, die ihn Tag und Nacht pflegten. Als Carla um 15:08 den Anruf entgegennahm, wusste sie bereits – diese Dinge weiß man immer –, dass ihr Vater gestorben war. Sie legte auf und starrte auf den Fernseher, wo noch immer die Nachrichten liefen. Doch sie nahm weder die banalen Ereignisse wahr noch die grausame Ironie, dass sie beide nur acht Kilometer voneinander entfernt vermutlich genau dasselbe gesehen hatten.
Sie hatte soeben ein Imperium geerbt, mit dem Wert einer zwölfstelligen Summe. Eine eins, gefolgt von elf Nullen. Eine unmögliche, irrwitzige Summe, der sie zu Ramón Ortiz’ Lebzeiten genauso wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte wie gerade den aktuellen Nachrichten. Genau wie diese Bilder war das Geld schlicht und einfach da gewesen. Jenseits ihres Verantwortungs- und Einflussbereichs.
Zwar hatte sie sich für die Firma aufgeopfert und viel Zeit in die Arbeit investiert. Aber sie hatte es getan, um das Einzige, das sie nicht haben konnte, zu erlangen. Den Respekt ihres Vaters.
Sie sah schon die Bilder in den Nachrichten des Folgetages auf dem riesigen 100-Zoll-Bildschirm. Der Fernseher war teuer, aber auch nicht zu teuer. Sie sah sich selbst ganz in Schwarz die geladenen Trauergäste bei der Aufbahrung empfangen. Das Königspaar, den Ministerpräsidenten, ein paar Minister. Auch andere wichtige Persönlichkeiten wie Laura Trueba oder Bill Gates. Unvermittelt war sie eine andere. Jetzt lastete große Verantwortung auf ihr. Das Leben von hunderttausenden Mitarbeitern und die Investitionen von Millionen Menschen hingen jetzt von jeder einzelnen ihrer Handlungen ab. Ein falscher Tonfall, ein falsches Wort zur Unzeit könnte alles ruinieren.
In dem Moment begriff sie, warum ihr Vater sie verraten hatte. Nur zu gerne hätte sie ihn angerufen und ihm gesagt, dass sie ihn verstand. Dass sie ihm nicht verzieh – das konnte sie einfach nicht –, aber dass sie ihn verstand.
Denn mit dieser exorbitanten Zahl, dieser Eins mit elf Nullen, hatte sie eine knallharte und grelle Wahrheit geerbt, bestehend aus nur sechs Worten:
Sie hatte sie nicht selbst verdient.
2 Ein Würfel
»Lass uns den Plan noch mal durchgehen«, sagt Antonia auf dem Weg zum Cockpit.
Beim Anblick dieser zarten Frau, fast einen halben Kopf kleiner als sie, verspürt Carla Ortiz einen seltsamen Neid. Antonia Scott ist zwar nicht hässlich, aber auch keine Schönheit. Carla beneidet sie weder für ihr Aussehen noch für ihren Verstand. Sondern für ihre ungebrochene Durchsetzungskraft. Antonia hat ihr im Tunnel Goya Bis das Leben gerettet, weshalb Carla für immer in ihrer Schuld steht.
Als Antonia sie vor wenigen Wochen anrief, glaubte Carla, sie wolle etwas von ihr. Eine Art Entschädigung. Natürlich wäre sie dazu bereit. Sie wünschte es sogar.
Der billigste Gefallen ist noch immer der, den man mit Geld aufwiegen kann.
Stattdessen erzählte Antonia Scott ihr eine Geschichte, die ihr auf den Magen schlug und den Schlaf raubte. Die Geschichte einer unbekannten Frau – nennen wir sie der Einfachheit halber Sandra Fajardo –, die einen Geisteskranken manipulierte und ihn glauben ließ, sie sei seine Tochter. Dass die beiden sie unter dem Vorwand, ihren Vater zu erpressen, entführt hatten. Dass die Leiche der falschen Sandra nie aufgetaucht war.
Dass alles, was sie zu wissen glaubten, eine ungeheuerliche Lüge war.
»Ich verstehe das nicht. Die Erpressung meines Vaters war nicht ernst gemeint?«
»Sie war nichts weiter als eine sorgfältig geplante Farce«, erwiderte Antonia. »Ich weiß zwar nicht genau, warum, aber das alles hat mit mir zu tun.«
Dann erzählte sie ihr von dem ungreifbaren, mysteriösen Mister White. Dem Mann, der bei Sandra Fajardo die Fäden zog.
»Ich kann es nicht glauben. Die vielen Polizisten, die beim Versuch, mich zu retten, gestorben sind. Die Frau in der Schule deines Sohnes. Wie viele Leben sind für diese Farce, wie du es nennst, ausgelöscht worden?«
»Acht, soweit wir wissen.«
»Ich dachte … es sei vorbei«, sagte Carla mit erstickter Stimme. Auf ein beruhigendes Wort von Antonia wartete sie vergeblich.
Da holte die Erinnerung sie ein.
Die Umleitung.
Der Mann mit dem Messer.
Die Verfolgungsjagd durch den Wald.
Der Stich in den Hals, als sie sich ergab.
Und dann der verzweifelte Kampf in der Dunkelheit. Die freundliche Stimme, die sich als Stimme ihrer Peinigerin herausstellte.
»Weißt du … Weißt du, was sie will?«
»Nein. Aber ich werde es herausfinden.«
Bevor sie auflegte, hatte sie Carla ganz klare Anweisungen dafür gegeben, was sie tun müsste, wenn ihr schlimmster Albtraum wahr werden sollte.
Vor zehn Stunden war es so weit.
Antonias Nachricht lautete:
Sie ist wieder da
Mehr brauchte Carla nicht. Eine Entschuldigung murmelnd verließ sie das Abendessen mit Geschäftspartnern, stieg in den Wagen und wies das Kindermädchen an, ihren Sohn zu wecken.
Der Flug von La Coruña nach Gloucester, um Großmutter Scott abzuholen, hatte zwei Stunden gedauert. Wieder abzuheben weitere vier Stunden. Aber jetzt waren sie endlich da.
Genau nach Plan.
»Keine Handys, keine elektronischen Geräte, auch keine Internetsuche über mich oder Nachrichten aus Spanien. Kein Abrufen meiner Mails, keinen Kontakt zu niemandem«, betet Carla herunter.
»Gib mir dein Portemonnaie.«
Carla wühlt in ihrer Tasche und reicht es ihr eher widerwillig. Antonia zieht die Kreditkarte, den Personalausweis und selbst die Bonuskarte von Sephora heraus, wirft sie in eine Spucktüte und diese in einen Papierkorb. Aus ihrer Umhängetasche holt sie ein Feuerzeug und eine brennbare Flüssigkeit und verwandelt damit Carlas Leben im Handumdrehen in eine stinkende Masse. Nur eine Karte in Schwarzmetallic bleibt verschont, die steckt sie in die eigene Jackentasche.
»Sei vorsichtig mit dieser Karte, Antonia. Sie hat kein Kreditlimit.«
»Ich neige nicht zu verschwenderischen Geldausgaben. Du wirst Geld brauchen.«
»Dieser Koffer steht seit Wochen bereit«, sagt Carla und zeigt auf einen großen Samsonite.
Antonia braucht ihn nicht zu öffnen. Sie weiß, was drin ist.
»Dollar?«
»Und Yen, Euro und Pfund.«
Antonia nickt zustimmend.
»Wohin sollen wir fliegen?«
»Es würde euch gefährden, wenn ich das weiß. Du darfst keine logische Entscheidung treffen. Aber ich habe etwas für dich, das dir helfen wird.«
Antonia drückt Carla einen zwanzig Millimeter großen Würfel in die Hand.
Carla starrt verdattert auf den Würfel, bis sie begreift, was Antonia damit sagen will.
»Für jede Entscheidung ein Wurf. Am nächsten Zielort nimmst du ein anderes Flugzeug. Und beim nächsten wieder, immer so weiter. Dann fährst du mindestens sechshundert Kilometer über Land und nimmst anschließend einen Linienflug. Danach fährst du in die entgegengesetzte Richtung wieder über Land. Es wird hart«, schließt sie mit Blick über Carlas Schulter hinweg.
Carla dreht sich zu Großmutter Scott um, die eingeschlafen zu sein scheint.
»Sei unbesorgt. Sie wird uns noch alle beerdigen.«
»Ich sehe nicht, warum mich das beruhigen sollte. Diese Möglichkeit ist zum Greifen nah.«
Erst Carlas entsetzter Gesichtsausdruck macht ihr bewusst, dass sie sich schon wieder von einer Redewendung in die Irre hat führen lassen. Wäre Jon da, hätte er mit einem flapsigen Kommentar die Situation erträglicher gemacht, aber er ist nicht da. Antonia entschuldigt sich auch nicht. Erstens, weil sie sich mit Trostpflastern nicht auskennt. Sie weiß nicht einmal, was der Ausdruck bedeutet. Und zweitens, weil die Gefahr tatsächlich sehr real ist.
Seit Sandras Wiederauftauchen ist niemand mehr in Sicherheit. Und erst recht nicht Carla – diese Trophäe ist ihr nur um Haaresbreite entgangen.
»Wir müssen los«, sagt die Unternehmerin und ringt sorgenvoll die Hände.
Antonia versteht, dass sie den Abflug nicht länger hinauszögern darf.
3 Ein Bündel
Antonia geht zur Flugzeugtür und macht jemandem ein Zeichen. Aus dem Wagen – einem Rolls-Royce Phantom, frisch restauriert – steigt ein großer, schlanker Mann mit eingefallenen Wangen. Im tadellosen Anzug und mit perfekt sitzender Krawatte, trotz der langen Stunden des Wartens im Auto. Auf dem Arm hat er ein wertvolles Bündel. Die andere Trophäe, die Sandra Fajardo entgangen ist.
»Wie lange wird das Ganze dauern?«, fragt der Mann.
Obwohl er Diplomat ist, zeichnet er sich persönlich nicht durch Flexibilität aus, das überlässt er anderen. Denn Sir Peter Scott, Botschafter des Vereinigten Königreichs in Spanien, ist ein reicher, englischer Gentleman mittleren Alters, bei dem solcherart überhebliches Gebaren eher typisch ist.
Das Morgengrauen und eine lange Nacht im Auto tragen auch nicht gerade zu besseren Umgangsformen bei. Mit gerecktem Kinn starrt er die Textilunternehmerin inquisitorisch an.
»Verzeihung, ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt«, sagt Carla.
»Sie wissen ganz genau, wer ich bin, und ich weiß ganz genau, wer Sie sind. Und jetzt hätte ich gerne eine Antwort, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
Antonia schüttelt den Kopf. Carla sagt nichts.
»Es dauert so lange, wie es dauern muss«, erklingt eine rauchige Stimme aus dem Flugzeuginnern.
Der Botschafter dreht sich um und trifft auf den gelassenen Blick von Großmutter Scott. Möglich, dass er insgeheim schlucken muss.
»Entschuldige, Mutter. Ich habe dich nicht gesehen.«
»Natürlich nicht. Du warst viel zu sehr damit beschäftigt, unhöflich zu sein. Wann hast du mich das letzte Mal angerufen?«
»Die Verpflichtungen meines Amtes …«
»Sind wichtiger als deine Mutter. Das hast du unmissverständlich klargestellt. Komm her, lass mich meinen Urenkel sehen.«
Jorge Losada Scott schläft schon seit Stunden und hat nichts von dem ganzen Drama mitbekommen. Er trägt seinen Baby-Yoda-Schlafanzug und ist in eine karierte Decke gehüllt. Er wacht auch nicht auf, als Großmutter Scott die Decke über seinem Gesicht lüftet. Seine Wangen leuchten rot, und sein Mund steht halb offen.
»Er hat deine Nase, Peter.«
»Stimmt«, bestätigt der Botschafter lächelnd.
»Zum Glück ist der Rest von Antonia. Und jetzt leg ihn dort auf das Sofa, bevor du den nächsten Bandscheibenvorfall kriegst, mein Junge.«
Sir Peter Scott gehorcht. Das Sofa mit rotem Pferdelederbezug knarzt leise, als er Jorge neben Carlas Sohn legt. Die Bündel sind fast gleich groß, denn beide Jungs sind altersmäßig nur ein paar Monate auseinander.
»Alles wird gut gehen«, sagt Carla.
»Garantieren können Sie das aber nicht.«
»Um Himmels willen, Peter!«, schimpft Großmutter Scott. »Diese Frau will dir doch nur sagen, dass sie alles tun wird, was in ihrer Macht steht. Wenn du Garantien brauchst, kauf dir einen Toaster.«
Der Botschafter wechselt das Gewicht von einem Fuß auf den anderen, und sein Blick wandert von seinem Enkel zu Großmutter Scott. Schließlich nickt er der alten Dame zu und verlässt mit großen Schritten und ohne Blick zurück das Flugzeug.
Nachdem sie sich verabschiedet und eine letzte Anweisung gegeben hat, folgt Antonia ihm zum Wagen. Das Flugzeug rollt bereits über die Piste, bevor sie bei ihm angekommen ist.
»Du hast mir nicht gesagt, dass deine Großmutter auch mitfliegt«, sagt Sir Peter.
»Sie ist auch ein Ziel.«
»Ich hätte es gerne gewusst, Antonia.«
»Du solltest auch mitfliegen.«
»Deine Großmutter und ich stundenlang auf engstem Raum? Was für eine pittoreske Vorstellung. Dann bräuchte uns kein Psychopath mehr ermorden.«
»Du wärst sicherer.«
»Durch die Welt stolpern soll sicherer sein als in meinem Büro zu sitzen, wo ich von einem SAS-Kommando beschützt werde?«, erwidert Sir Peter. »Ich weiß nicht, warum ich zulasse, dass Jorge …«
»Sandra Fajardo hat ihn schon einmal entführt, am helllichten Tag und von einem Ort, den wir sicher glaubten. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen?«
Der Botschafter schürzt frustriert die Lippen. Vor wenigen Stunden hatte ihn seine Tochter angerufen und gebeten, ihr bei der schwierigen Aufgabe zur Seite zu stehen, ihren Mann für immer zu verabschieden. Er war sofort zu ihr geeilt, das ist seine Vaterpflicht. Es war ein Schritt in die richtige Richtung zur ersehnten Versöhnung mit seiner Tochter. Von Marcos Abschied zu nehmen war auch ein erster Schritt, damit Antonia langsam zur verloren gegangenen Menschlichkeit zurückfindet. Für einen kurzen Moment hatte Sir Peter neben dem immer langsamer piependen Herzfrequenzmessgerät einen Anflug des heiteren, glücklichen Mädchens gesehen, das im Konsulat in Barcelona herumtobte, als sie nicht viel älter war als Jorge jetzt. Das heitere, glückliche Mädchen, das sie hätte sein können, wenn sie ein anderes Leben führen würde.
In der kleinen Frau, die neben ihm auf der Landebahn steht, ist von diesem Mädchen nichts mehr zu erkennen. Ihre Augen sind zwei Steine aus Obsidian.
Noch schlimmer ist, dass es wahr ist, was sie gerade gesagt hat, denkt der Botschafter.
»Dieses Risiko will ich tatsächlich nicht eingehen«, räumt er ein.
»Du solltest mitfliegen«, insistiert Antonia.
»Das Flugzeug hat schon abgehoben.«
»Wir können sie umkehren lassen.«
»Du solltest an Bord dieses Fliegers sein.«
»Ich kann mich selbst beschützen.«
Aus dem Schatten tritt einer der Bodyguards ihres Vaters. Antonia erinnert sich gut an ihn. Er hat sie aus Marcos’ Zimmer geschleppt. Ein Meter neunzig, siebenundachtzig Kilo und wenig Sympathie für Antonia. Eine Ziegelwand im Anzug, Elite-Ausbildung, Offizier des britischen Special Air Service.
Der Botschafter nickt dem Muskelprotz zu, als er die Wagentür öffnet.
»Danke, Noah.«
Dann wendet er sich noch einmal an seine Tochter. So klein, so allein.
»Ich habe jemanden, der mich beschützt, Antonia. Tag und Nacht. Du nicht.«
4 Ein Empfangstresen
Antonia steht allein auf der Startbahn, sie sieht, wie der Wagen sich entfernt, und denkt über den letzten Satz ihres Vaters nach.
»Ich habe jemanden, der mich beschützt. Du nicht.«
Was Antonia übersetzt in folgendes Wort:
Rakṣakuḍuha. Auf Telugu aus der dravidischen Sprachfamilie, das von vierundsiebzig Millionen Menschen gesprochen wird: Der Beschützer ohne Rüstung. Der nackt in Pfeilrichtung springt.
Antonia hatte so jemanden. Und jetzt nicht mehr. White hat ihn ihr ohne jegliche Vorwarnung weggenommen. Nur eine Nachricht geschickt:
Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen.Wollen wir spielen? W.
Ein schwarzer Audi A8 mit getönten Scheiben kommt näher. Die Beifahrertür wird geöffnet, damit sie einsteigt. Einen Moment lang hofft Antonia – entgegen jeder Logik, was höchst ungewöhnlich für sie ist –, dass Inspector Jon Gutiérrez hinterm Lenkrad sitzt. Ein kurzer Moment des magischen Gedankens, des festen Daumendrückens und Wünschens, Wünschens, Wünschens, dass es vorbei sein möge. Das Universum gibt Antonia die gewohnte Antwort. Nur dass im Falle Antonias noch eine Extraportion Beschämung hinzukommt, weil sie etwas so Gewöhnlichem erlegen ist.
Missmutig öffnet sie die hintere Wagentür und lässt sich auf den Rücksitz fallen.
»Bin ich jetzt dein Chauffeur, Scott?«
»Ich muss einen Moment die Augen schließen.«
»Der Beifahrersitz lässt sich komplett flachlegen.«
»Ja, aber hier hinten bin ich allein.«
Der Mann am Lenkrad dreht sich um. Dunkles Haar mit großen Geheimratsecken, dünner gestutzter Schnurrbart und Knopfaugen, die eher wie gemalt als echt wirken. Kurzer, kamelfarbener Mantel. Teuer.
»Pass auf, wo du die Füße hinstellst. Dahinten liegt eine Tschechow«, sagt Mentor.
Er hat ebenso wie Antonia stundenlang die Zufahrt zur Landebahn bewacht.
»Das ist keine Tschechow. Das ist eine Remington 870«, sagt Antonia, die ein Auge geöffnet hat und mit der Schuhspitze die Waffe anstupst.
»Es ist ein geladenes Gewehr«, erwidert Mentor nervös, als er sich im Sitz verrenkt, um es von Antonias Füßen wegzunehmen. »Du weißt ja, was Tschechow über Gewehre gesagt hat.«
»Keine Ahnung.«
»Wenn du im ersten Akt ein Gewehr zeigst, musst du es im dritten Akt auch einsetzen.«
»Wir befinden uns schon im dritten Akt.«
»Darauf wollte ich hinaus, Scott.«
Nach kurzem Kampf mit dem Sicherheitsgurt gelingt es Mentor, das Gewehr zu ergreifen und auf den Beifahrersitz zu legen.
»Wie war’s mit deinem Vater?«
»Wie soll es schon gewesen sein.«
»So schlecht also?«
Antonia antwortet nicht, sie starrt zum Fenster hinaus. Von weitem ist ein Donnern zu hören, zeitgleich mit dem Schnurren des Motors, als Mentor den Wagen anlässt. Die Regentropfen verwandeln sich in kleine Kometen, die sich auf der Windschutzscheibe jagen.
Auf der M40, in Höhe der Ausfahrt Plenilunio, herrscht zähflüssiger Verkehr. Antonia wird auf einen Wagen auf der Nachbarspur aufmerksam. Ein weißer Vito – mit einem Transporter dieser Marke wurde Jon entführt. Allerdings ein anderes Modell. Auf der Mittelbank sitzen zwei Kinder und werfen sich ein Spielzeug zu. Früher war es mal ein Dinosaurier, der jetzt eine unförmige, grüne Masse voller Löcher ist. Die Mutter dreht sich um und sagt etwas zu ihnen, ernst, nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, aber sie ist nicht wirklich verärgert.
Nur eine normale Familie auf dem Weg zu einem harmlosen Besuch im Einkaufszentrum, wie viele andere normale Familien. Antonia fragt sich, was sie für ein solches Leben getan haben, und was sie selbst getan hat, um ein Leben wie das ihre zu verdienen. Sie findet natürlich keine Antwort darauf. Nur …
Pothos.
Auf Griechisch, die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren.
Antonia sehnt sich, nicht zum ersten Mal, danach, eine Familie zu haben, bei der sie Zuflucht findet, einen Ort, wo sie sich verstecken kann. Aber es gibt nichts außer dem wilden Gekreische der Affen in ihrem Kopf. Angesichts dieser fragwürdigen Geräuschkulisse schläft sie ein.
Als sie wieder aufwacht, steht die Sonne schon hoch am Himmel.
Sie reibt sich die Augen und steigt mit voller Blase und pelziger Zunge aus. Sie befinden sich auf dem Parkplatz eines öden Industriegeländes mitten in einem öden Viertel. Rejas, im Süden des Flughafens Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ist ein namenloses Rechteck, das letzte Fleckchen Erde, das die Fahrgäste sehen, bevor ihnen der Taxifahrer mitteilt, dass die Fahrt ins Zentrum dreißig Euro kostet, vielen Dank auch. Stimmt schon, jedes Jahr frequentieren Millionen Menschen das Plenilunio, das größte Einkaufszentrum der Stadt. Aber weiter als bis zum Parkplatz traut sich kaum jemand. Obwohl es in der Nähe einen Vorort gibt. Doch wenige Kilometer Richtung Westen verändert sich das Panorama. Die einigermaßen ordentlich aneinandergereihten Gebäude verlieren sich im Chaos. Leere Lagerhallen neben baufälligen Einfamilienhäusern, Gemüsegärten mit Pferden, halbfertige Bürogebäude. Leerflächen, an deren Zäunen auf roten, von der Sonne ausgeblichenen Schildern zu verkaufen steht. Jetzt sind sie blassrosa und schmutziggrau, die Telefonnummern unleserlich. Wer sich ein wenig bemüht, kann sieben Zahlen erkennen.
Ein von Gott und den verantwortlichen Stadtplanern verlassener Ort.
Eine Handvoll Straßen mit Monatsnamen, von denen sich August und Dezember viel zu sehr ähneln.
Hier geht es nicht weiter, weshalb Mentor genau diesen Ort für das Hauptquartier des Projekts Rote Königin ausgewählt hat.
Von außen betrachtet ist es nur eine große Lagerhalle mit umzäuntem Parkplatz und dem respektablen Namen eines Granitwerkes, das Gebäude aus Aluminium, der Sockel aus Beton.
Mentor sitzt auf der Betontreppe davor und raucht eine Zigarette. Nach dem Haufen Kippen zu seinen Füßen zu urteilen hat er sich seit Stunden nicht von der Stelle gerührt.
»Du rauchst zu viel«, sagt Antonia, als sie vom Auto, das ihr als Bett diente, zur Treppe geht, die Mentor als Warteraum diente.
»Das sagt meine Frau auch. Aber es gibt nie den geeigneten Zeitpunkt, damit aufzuhören.«
»Warum hast du mich nicht geweckt?«
»Du weißt genau, warum. Du kommst von einer langen Mission zurück. Und hast die ganze Nacht nicht geschlafen.«
»Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
»Wenn du nicht schläfst, wirst du reizbar und launisch.«
Normalerweise würde Antonia protestieren und aufstampfen, aber sie ist ausgeschlafen, weshalb sie sich darauf beschränkt, tief durchzuatmen, und mit zwei Sätzen die Treppe erklimmt.
Hinter der Glastür – ohne Schloss oder Griff – erwartet den Besucher ein Tresen aus verblichenem Melamin, ein Linoleumboden, eine Wartezone mit zwei Sesseln, aus denen die Füllung quillt, und ein paar Fachzeitschriften über Granit, darunter die letzten Ausgaben von ANEFA, dem Fachmagazin der Branche. Titel der aktuellen Monatsausgabe: Alles über Quarzsand.
»Ihren Ausweis, bitte«, sagt der junge Mann am Empfangstresen.
Antonia blickt Mentor verdrossen an. Mentor zuckt mit den Schultern.
»Der Junge ist neu.«
»Der Junge ist pflichtbewusst«, erwidert der junge Mann.
»Ich kann die Vorschriften nicht lockern. Außerdem warst du schon lange nicht mehr hier. Er muss wissen, wer du bist.«
Antonia gibt nach und geht zu dem schmutzigen und notdürftig geklebten Gehäuse einer Webcam, die älter ist als Mark Zuckerbergs Facebook.
Darin verbirgt sich ein Netzhautscanner der neuesten Generation, die auf dem Monitor hinter dem Tresen einen Pfeifton auslöst.
»Alles klar, Señor.«
»Danke, Kollege. Komm schon, Scott«, sagt Mentor und zeigt auf die Tür. Sie schaut ihn an, ohne sich vom Fleck zu rühren.
»War’s das mit den Belehrungen?«
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
Verärgert folgt sie Mentor zu der Metalltür, die sich mit einem Summen öffnet. Mentor zieht am Griff, aber Antonia stellt den Fuß vor die Tür und hindert ihn am Öffnen.
»Du hast mich vier Stunden im Wagen schlafen lassen. Jetzt die Nummer mit dem Zutritt. Du willst mir damit doch was sagen, das ist mir nicht entgangen.«
»Scott, wir haben dich wirklich vermisst.«
»Wir würden Zeit sparen, wenn du es mir direkt sagen würdest.«
Mentor beißt sich auf die Unterlippe, versucht, sich in Geduld zu fassen.
»Die Botschaft ist, dass du in dieser Sache nicht allein bist und dass wir vorsichtiger sein müssen als je zuvor.«
»Botschaft ist angekommen. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, müssen wir endlich Jon Gutiérrez suchen.«
»Was denkst du denn, was wir gemacht haben, während du schliefst?«, erwidert Mentor, als er schließlich die Tür öffnen kann.
Beim Eintreten hält Antonia die Luft an. Sie hatte fast vergessen, wie imposant das Gebäude ist.
Fast. Denn Antonia vergisst nichts.
5 Ein Hauptquartier
Vom ramponierten Foyer mit Möbeln aus den neunziger Jahren gelangt man in ein weitläufiges, helles Areal mit einer sechs Meter hohen Decke. An ihr sind kräftige 1250 Watt-Strahler angebracht, die mehrere ineinander übergehende Module ausleuchten, deren Betonwände mit Stahlbalken am Boden befestigt sind. Ein Miniaturdorf. Der Zufahrtsbereich dient den umgerüsteten Audi A8 als Parkplatz. Von den vier Plätzen ist nur einer besetzt. Auf die restlichen hat jemand DIN-A4-Fotos der Schrottfahrzeuge auf den Boden geklebt.
Antonia huscht ein Lächeln übers Gesicht. Was Mentor nicht entgeht.
»Das ist überhaupt nicht witzig. Ihr habt in weniger als einem Jahr dreihunderttausend Euro geschrottet.«
»Ich nur hunderttausend. Die anderen beiden kannst du Jon in Rechnung stellen.«
»Ich überlege mir noch mal, ob ich ihn wirklich retten soll.«
Das erste Betonmodul, an dem sie vorbeikommen, hat eine kubische Form und ein großes Fenster an der Seite. Drinnen ist es dunkel, aber Antonia braucht kein Licht, um zu wissen, was sich darin befindet. Sie kennt den Trainingsraum bis in den letzten Winkel. Es sind keine glücklichen Erinnerungen.
Sie wendet den Blick ab und beschleunigt den Schritt. Vor Doktor Aguados Labor steht das MobLab, und dahinter befindet sich das Besprechungszimmer. Ein großer Raum mit einem riesigen Tisch in der Mitte und Dutzenden 30-Zoll-Monitoren an den Wänden.
Niemand hat sich die Mühe gemacht, auch nur einen Tropfen Farbe für die Wände des Hauptquartiers zu verschwenden. Es gibt nichts, was nicht funktional wäre oder wirkt, als wäre es in der Eisenwarenhandlung von Blade Runner gekauft worden. Vielleicht findet Antonia es deshalb so schön.
Trotzdem war sie seit fast vier Jahren nicht mehr im Besprechungszimmer.
Mentor geht zur Seite, um ihr den Vortritt zu lassen. Doch als er ihren Blick und die geballten Fäuste sieht, besinnt er sich eines Besseren.
»Wenn du bereit bist, Scott.«
Was offensichtlich nicht so schnell sein wird.
Antonias Herzschlag hat sich beschleunigt, die Atmung ist abgehackt. Jetzt, wo Jons Leben von ihr abhängt, erfasst sie Panik. Oder vielleicht lässt sie die Panik erst jetzt zu, weil sie keine Ausreden mehr hat.
Nachdem sie sehr lange vor dem, was sie ist und was sie kann, davongelaufen ist, hat die Realität sie eingeholt. Antonia hat den schwarzen Gürtel darin, sich selbst zu belügen, aber sie ist auch fähig zuzugeben, dass sie gleichermaßen wünscht und fürchtet, durch diese Tür zu gehen und diesen Raum erneut zu betreten.
Auch wenn es keine gute Idee ist.
Auch wenn der Mann, dem sie versprochen hat, nie wieder diesen Raum zu betreten, jetzt beim Bestatter liegt, ohne eine Menschenseele, die bei ihm Totenwache hält.
Obwohl das Bleigewicht im Magen von ihr verlangt, sich umzudrehen und aus diesem Betonkäfig zu fliehen. Weg von diesem Ort, der sie für immer zu einem unendlich besseren, einem unendlich hassenswerten Wesen gemacht hat.
Sie schaut sich um und sieht auf allen Monitoren dasselbe fragmentierte Bild. Das Gesicht von Inspector Jon Gutiérrez. Mit seinem lockigen, rötlichen Haar, dem dichten, leicht ergrauten Vollbart. Mit diesem quadratischen Kinn von der Größe eines Lexikons. Mit zusammengekniffenen Augen wegen des gleißenden Blitzlichts.
Selbst in ihrem aufgewühlten Zustand ist sie sich Mentors schmutziger Tricks bewusst. Seine Fähigkeit, sie zu manipulieren, macht sie wütend.
»Nimm dir Zeit«, flüstert Mentor nahe hinter ihr.
Antonia öffnet den Mund und will etwas sagen, doch er kommt ihr zuvor. Seine Lippen dicht an ihrem Ohr. Sein warmer, bitterer Raucheratem verursacht ihr eine Gänsehaut.
»Wenn du mir sagen willst, dass du nicht kannst, vergiss es. Was auch immer in deinem Kopf vorgehen mag, reiß dich zusammen. Ich habe dir eine Nacht gewährt, um deine Familie in Sicherheit zu bringen, und einen Morgen zum Ausruhen. Das ist alles. Denn der Mann, dessen Gesicht du da siehst, hat dir öfter das Leben gerettet, als du zählen kannst.«
Als sie das hört, steigt in Antonia unvermittelt eine Gewissheit auf.
Der Druck auf der Brust lässt nach, die Atmung beruhigt sich. Die Affen in ihrem Kopf schreien etwas leiser. Das ist das Schöne an Gewissheiten. Sie bescheren uns kurzfristig Erleichterung.
Antonia atmet die angehaltene Luft aus und dreht sich zu Mentor um.
»Doch, ich kann es.«
»Das ist mein Mädchen.«
»Du hast mich missverstanden. Ich weiß, wie oft. Siebenmal«, sagt Antonia und betritt den Raum.
6 Eine Frage
Als Doktor Aguado Antonia erblickt, steht sie auf. Sie ist um die vierzig. Lange Wimpern, dezentes Make-up, Nasenpiercing und eine verschmitzte Langmut im Blick. Jetzt auch ein Funken Angst.
»Sie wissen nicht, wie leid es mir …«
Aguado bricht ab, denn eigentlich weiß sie nicht, was sie sagen soll. Antonia nickt respektvoll. Sie ist erfreut, die Pathologin zu sehen.
»Machen wir uns an die Arbeit.«
»Natürlich. Ach, fast hätte ich es vergessen«, sagt sie und hält ihr ein Glas Wasser und einen kleinen Plastikbecher mit einer roten Kapsel hin.
Antonia schüttelt den Kopf und hat Mühe, die Augen von dem Plastikbecher abzuwenden.
Aguado wirft Mentor einen befremdeten Blick zu, er macht ihr ein Zeichen, und sie zieht die Hand mit der Pille zurück. Erst dann setzt sich Antonia auf ihren Stammplatz vor den Monitoren. Die Rollen des Bürostuhls, ein Herman Miller Aeron (der kleinste, damit ihre Beine nicht baumeln), verursachen das typische Geräusch auf dem Beton, als sie sich dem Tisch nähert.
»Was haben wir?«
»Das ist alles«, sagt Mentor und zeigt auf den Glastisch vor ihr. Er ist voller Berichte und Fotos. Antonia stützt die Ellenbogen auf die Platte und lässt ihren Blick über die Unterlagen schweifen. Fünfzig Sekunden später hebt sie den Kopf.
»Mit anderen Worten, nichts.«
»Das Kennzeichen des Transporters war gefälscht, aber das weißt du ja schon.«
»Es ist dasselbe Kennzeichen wie das des Wagens, mit dem die echte Sandra Fajardo Suizid begangen hat«, fügt Aguado hinzu.
»Ein makabrer Scherz, Scott?«
»Sie hinterlässt ihre Signatur. Als wäre sie nicht schon überall präsent.«
Antonia kann sich noch gut daran erinnern, wie Sandra kurz stehen geblieben war und ihr zugewunken hatte, bevor sie in den Transporter mit Jon stieg. Eine elegante Frau mit freundlichem Gesicht.
Ein freundliches Gesicht, das nur sie kennt.
»Gibt es irgendwelche Sicherheitskameras? Verkehrsüberwachung, irgendwas?«
Mentor schüttelt den Kopf. Antonia kennt die Antwort schon. Gäbe es etwas, läge es vor ihr auf dem Tisch.
»Wir könnten anhand deiner Beschreibung ein Phantombild anfertigen lassen. Es könnte in einer halben Stunde in allen Nachrichten gesendet werden. Aber …«
»Aber«, wiederholt Antonia und klopft irritiert auf den Tisch.
Solange Jon Gutiérrez in Sandras Gewalt ist, können sie keine dieser Maßnahmen ergreifen. Viel können sie nicht tun.
»Die gesamte Belegschaft versucht die Spur des Transporters in Usera zu verfolgen. Sechs Neue als Springer bei der Policía Nacional, das IT-Team …«
»Selbst meine persönliche Assistentin«, fügt Aguado hinzu.
»Alle mit ihren Privatautos. Sie fragen überall, ob jemand den Transporter gesehen hat.«
»Das ist eine ziemlich abwegige Möglichkeit.«
»Wir haben keine andere, Scott. Es gibt weder Fotos von Fajardo noch Spuren, wir haben nichts. Nur einen toten Streifenpolizisten und einen weiteren, der vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln im Krankenhaus liegt.«
Die beiden hatten versucht, den Mercedes aufzuhalten, bevor er den Manzanares überqueren konnte. Sie wurden aufgefordert, nicht einzugreifen. Sie wollten sich eine Medaille verdienen und bekamen stattdessen hundert Kugeln als Geschenk.
»Sie kennen ja den Bericht der Ballistik«, sagt Aguado und zeigt auf ein Blatt Papier vor Antonia.
»5,56 x 45 mm NATO-Munition«, antwortet diese ohne einen Blick darauf. »Äußerst verbreitet. Praktisch jeder Soldat der Europäischen Union hat sie in den letzten Jahrzehnten benutzt. Und Tausende Polizisten.«
In der folgenden Stille ist das leise Geräusch von Reibung zu hören. Aguado und Mentor können sehen, wie Antonias linke Hand zu zittern beginnt und die Papiere durcheinanderbringt.
Aguado greift in ihre Kitteltasche, in der die rote Pille steckt. Mentor schüttelt mit hochgezogenen Augenbrauen bedächtig den Kopf.
Antonia scheint das Zittern auch bemerkt zu haben und umklammert mit der rechten Hand ihr Handgelenk. Ihre Lippen formulieren eine stumme Lüge.
»Ich bin in Ordnung.«
Auf eine Frage, die niemand gestellt hat.
Und schließlich laut:
»Wir verlieren nur Zeit. Damit werden wir Jon nicht finden«, sagt sie und schiebt die verräterischen Unterlagen in die Tischmitte, weit weg von ihren zittrigen Händen.
»Hast du eine bessere Idee?«, fragt Mentor.
»Wir müssen verstehen, was gerade passiert. Du musst mir erzählen, warum du in Brüssel warst.«
Was in Brüssel geschah
Mentor macht Aguado ein Zeichen, damit sie auf ihrem Laptop die entsprechenden Bilder abruft.
»Das geschah vor neun Tagen. Als ihr auf dem Weg nach Málaga wart, um Lola Moreno zu suchen.«
Auf dem Bild ist ein Hotelzimmer zu sehen. Luxuriös. Ein nackter Mann auf einem Zwei-Meter-Bett. Das Bettzeug ist zerwühlt. Sein Körper ist mit Messerstichen übersät. Doch es sind vier Füße zu erkennen. Zwei hängen über den Bettrand, sie gehören dem Erstochenen, zwei weitere befinden sich acht Zentimeter über dem Bett. Das nächste Foto zeigt, zu wem sie gehören, erhängt am Ventilator. Die Augen stehen weit aus den Höhlen, das Gesicht ist verzerrt, die Zunge hängt aus dem Mund.
»Das ist in England.«
»Wie hast du ihn erkannt? Ich bezweifle stark, dass seine eigene Mutter das gekonnt hätte.«
»Ich habe ihn nicht erkannt. Die Marke des Ventilators«, sagt Antonia und zeigt auf das winzige Logo an der Unterseite des Geräts. »Dieses Modell gibt es nur in England.«
»Callum Davis. Rote Königin von England«, bestätigt Mentor und zeigt auf die erhängte Leiche. »Und Rhys Byrne, sein Knappe.«
»Ein Liebespaar?«
»Das ist verboten, Scott.«
»Du hast nicht …«
»Doch, eigentlich habe ich geantwortet. Ja, das waren sie. Zwar nicht offen, aber in unseren Teams gibt es nur selten Geheimnisse«, sagt Mentor.
Antonia wendet all ihre Kraft auf, um nicht auf Aguados Kitteltasche mit den roten Pillen zu starren. Vergeblich.
»Callum und Byrne hatten eine ziemlich gefährliche Mission. Diamantenhändler in Glasgow, gefährliche Leute mit Kontakten zur Mafia. Wir dachten erst, die wären es gewesen.«
»Die Spurensicherung hat die Szenerie ausgewertet«, wirft Aguado ein. »Und hat herausgefunden, dass die Wahrheit noch viel schlimmer ist.«
Antonia steht auf und nähert sich mit zusammengekniffenen Augen dem Foto ihres englischen Kollegen. Sie hebt und senkt mehrmals den Arm, stellt mentale Einschätzungen an und analysiert schließlich das Bild.
»Er hat ihn umgebracht und sich dann erhängt.«
»Wie …?«
»Die Rückspritzer des Blutes auf dem Hemd. Dieses fast perfekte Halbrund um die anderen kleineren Flecken herum. Die konnten nur entstehen, wenn Callum zugestochen hat.«
Aguado räuspert sich unbehaglich und schaut Mentor an.
»Das stimmt«, bestätigt er. »Wir haben etwas länger dafür gebraucht als du, Scott. Das Messer lag nicht am Tatort. Es ist erst Stunden später im Garten gefunden worden. Aber zu dem Zeitpunkt war alles schon aus dem Ruder gelaufen.«
Weitere Fotos auf den Monitoren. Darauf zu sehen ein Audi A8, der auf dem Gehweg in einer Wohngegend steht. Diesmal muss Antonia nicht raten. Das rot-weiße Band mit der Aufschrift Politie, niet betreden sagt alles.
Auf einem anderen Monitor läuft ein Video, das mit einem Smartphone aufgenommen ist. Auf dem Beifahrersitz des Audi A8 sitzt die Leiche einer Frau mit grauem Blazer und Bleistiftrock. Das Eintrittsloch der Kugel ist klein, so groß wie eine Münze. Der Kontrast zur zerstörerischen Kraft bei ihrem Austritt ist enorm. Das Fenster ist ein abstraktes Gemälde. Eine Komposition in Rot mit einem Sprung in der Mitte, der Stelle, an der ihr Kopf gegen die Scheibe schlug, ohne dass sie zerbrach.
»Lotte Janssen, Rote Königin der Niederlande. Der Wagen wurde vor ihrem Haus in Rotterdam gefunden. Ihr Knappe wurde knapp zweihundert Meter entfernt festgenommen. Er irrte in katatonischem Zustand mit der Pistole in der Hand die Straße entlang.«
»Da habt ihr begriffen, dass etwas schiefläuft.«
»Eine Königin, die ihren Knappen tötet, ein Knappe, der seine Königin tötet. All das in wenigen Stunden. Ja, da konnten selbst einfach gestrickte Menschen wie wir zwei und zwei zusammenzählen, Scott.«
»Lass es besser.«
»Was?«
»Jons Rolle spielen. Das steht dir nicht.«
Mentor holt eine Zigarette aus der Jackentasche und zündet sie an.
»Ich vermisse ihn auch, Scott. Aber wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen.«
Antonia denkt ein paar Sekunden über seine Worte nach. Dann gibt sie die einzig mögliche Antwort.
»Nein.«
»Die Möglichkeiten …«, setzt Aguado an.
»Was geschah, als ihr das in den Niederlanden entdeckt habt?«, unterbricht Antonia sie.
»Wir Teamchefs haben uns in Brüssel getroffen. Wir wussten, dass etwas passiert war, besaßen aber keinerlei Informationen. Alle waren extrem angespannt, schrien herum. Wir durchlebten unser eigenes 9/11. Den Knappen aus den Niederlanden hatten wir festgenommen, doch er sagte kein einziges Wort. Dann …«
Mentor verstummt und starrt zu Boden. Aguado wendet den Blick ab.
»Dann ging es weiter«, flüstert Antonia.
Auf den Monitoren erscheint ein weiteres Foto. Inmitten von Rauch und Trümmern kann Antonia ein fein gearbeitetes Chorgestühl, in Stein gemeißelte Heilige und eine ziselierte Bronzetür ausmachen. Sie braucht einen Moment, um sie zu erkennen. Kunst ist nicht ihre Stärke, erst recht nicht die Gotik. Doch der Anblick erinnert sie an eine Stunde im Kunstunterricht. Freitagnachmittag, die Jalousien in der stickigen Frühlingshitze Barcelonas heruntergelassen. An die Wand projiziert das Bild einer siebenhundert Jahre alten deutschen Kathedrale.
»Köln.«
»Es gab eine Explosion«, sagt Mentor. »Sieben Schwerverletzte. Zwei Tote.«
Das folgende Schweigen wird von Aguado gebrochen.
»Die Toten waren …«
»Ich weiß schon, wer sie waren, Doktor Aguado.«
Antonia scheint im Begriff, in Tränen auszubrechen. Oder sich mit jemandem prügeln zu wollen. Der Unterschied ist nicht zu erkennen.
»Er jagt uns«, sagt sie mit zornbebender Stimme. »Einen nach dem anderen. Alle Mitglieder des Projekts Rote Königin. Fünf Tote in nur zwei Tagen. England, die Niederlande, Deutschland. Was ist mit den anderen?«
»Der Knappe aus den Niederlanden ist wie gesagt in Gewahrsam. Isabelle Bourdeau aus Frankreich ist verschwunden, zusammen mit ihrer Königin. Paola Dicanti war mit ihrer Königin auf dem Weg zu einem sicheren Ort in Florenz, aber wir haben den Kontakt gestern Nacht verloren. Wir glauben, er wurde bewusst gekappt.«
Er macht eine Pause. Eine ziemlich lange. Dabei massiert er sich die Schläfen, als wolle er eine Erkenntnis heraufbeschwören – oder vielleicht nur die Verzweiflung vertreiben. Es scheint nicht viel zu nützen.
»Das ist alles, was ich weiß«, schließt er.
»Nein, das stimmt nicht.«
Mentor richtet sich befremdet auf.
»Ich habe dir alle gesagt, was …«
Antonia hebt einen Finger, um ihn zum Schweigen zu bringen.
»Als du mich heute Nacht angerufen hast, sagtest du, du wüsstest, was in England und in den Niederlanden passiert wäre. Dass mein Gespenst ganz real sei.«
Mentor hält ohne Wimpernschlag ihrem Blick stand.
»Anhand der Beweise, die du mir gerade gezeigt hast«, fährt Antonia fort, »kannst du nicht zu diesem Schluss gekommen sein.«
»Ich weiß nicht, ob mir dein Ton gefällt, Scott.«
»Vier Jahre. Vor vier Jahren ist dieses Monster in meine Wohnung eingedrungen, seit vier Jahren rede ich von ihm. Vier Jahre, in denen ich von dir nur nachsichtige Blicke bekommen habe, dazu die Anspielung, ich sei nicht richtig im Kopf.«
»Nach der Sache mit Marcos …«
»›Bring mir einen Beweis. Einen einzigen Beweis, und ich werde dir glauben, dass dieser Mörder existiert!‹ Wie oft habe ich das von dir gehört?«
»Du hattest nichts weiter als simple Gerüchte, Scott.«
»Und was hast du jetzt?«
»Den Modus Operandi …«
»Auf diesen Fotos ist kein Modus Operandi zu erkennen. Nur willkürliche Gewalt und Tod.«
Es stimmt nicht, dass bei einem Blickduell derjenige verliert, der zuerst den Blick abwendet. Es verliert der, der angesichts seiner Niederlage den Blick abwendet, um zu verhindern, dass der Gegner sie von seinen Augen abliest.
»Frau Doktor, würden Sie uns einen Moment allein lassen?«, fragt Mentor.
Antonia nickt der Pathologin zu, als sie hinter ihr vorbeigeht. Und wartet, bis sie die Tür geschlossen hat.
»Und jetzt … Sagst du mir jetzt, was in Brüssel wirklich passiert ist?«
Was in Brüssel wirklich geschah
Mentor lockert seine Krawatte, zieht seinen Laptop zu sich heran und entzündet, um Zeit zu gewinnen, die nächste Zigarette. Nachdem er den Rauch des ersten Zuges ausgeblasen hat, bleibt ihm keine Ausflucht mehr.
»Der Knappe aus den Niederlanden … hat geredet.«
»Du hast gesagt, er war in katatonischem Zustand.«
»Ein paar Stunden lang. Dann löste sich seine Schockstarre. Aber er wollte immer noch nicht reden.«
Mentor drückt eine Taste seines Computers, und dem Foto vom Kölner Attentat folgt ein anderes. Von einem dunkelhäutigen Mann mit markanten Gesichtszügen. Um die fünfzig, aber gut durchtrainiert.
»Michael Seedorf. Geboren in Surinam. Ex-Militärpolizist der Reserve. Wir haben ihn rekrutiert, als er in einer heiklen persönlichen Situation war.«
»Das übliche Vorgehen.«
»Er hatte gerade seine Tochter verloren. Sie war Genetikerin mit einem exzellenten Lebenslauf und hatte eine unglaubliche Zukunft vor sich. Ein Autounfall.«
»Und da kamt ihr ins Spiel.«
»Ich hatte nichts damit zu tun. Aber mein niederländischer Kollege hat hervorragende Arbeit geleistet. Seedorf und seine Königin waren perfekte Partner. Er liebte sie wie eine Tochter. Sie waren von Anfang an ein Team. Und haben ein paar ziemlich beschissene Fälle gelöst.«
»Ich habe gehört, dass sie sehr gut war.«
»Nicht so gut wie du, aber ja, das war sie.«
Antonia kaut auf ihrer Lippe herum und wartet, dass Mentor weiterspricht. Der drückt einen Knopf, und die Monitore werden schwarz.
»Du musst verstehen, dass wir ihn unbedingt zum Reden bringen mussten, Scott.«
Antonia atmet tief durch und schließt die Augen.
»Was habt ihr getan?«
»Die Teamchefs haben erbittert diskutiert. Die Lösung musste einstimmig sein.«
»Was habt ihr getan?«
»Die Lösung …«
Antonia wiederholt ihre Frage zum dritten Mal.
Mentor steht auf, knetet die Hände und lehnt sich an die Betonwand.
»Extremverhör«, sagt er schließlich.
Antonia reißt die Augen auf.
Was in ihrem Blick steht, ist genau das, was Mentor befürchtet hat. Er hat sich hinter dem Euphemismus verschanzt, was allerdings sinnlos ist bei einer Philologin, die präzise Sprache über alles liebt.
»Du hast einen von uns gefoltert«, sagt Antonia fassungslos.
»Wir haben getan, was wir tun mussten, Scott. Wir steckten fest.«
»Was wir tun mussten«, wiederholt Antonia und lacht trocken auf, frei von jeglichem Humor.
Sie schweigt einen Moment, wie es typisch für sie ist, und fährt dann fort:
»Kurz vor unserer Rückkehr aus Málaga hat Jon etwas gesagt, das mich nachdenklich gemacht hat. Über unsere Arbeit. Darüber, was wir tun. Welche Umwege wir nehmen, um das zu tun, was wir tun müssen. Ahnst du, was ich ihm geantwortet habe?«
Mentor schweigt.
»Immer geradeaus zu gehen führt auch nicht weit. Das habe ich gesagt. Weißt du, von wem der Satz stammt?«
Natürlich weiß er das. Aber er wird es nicht zugeben.
»Von dir, Mentor. Der Satz stammt von dir. Einer von denen, mithilfe derer wir Handlungen rechtfertigen, auf die wir nicht unbedingt stolz sind. Unsere Lügen, unsere Täuschungen, unsere Abkürzungen.«
»Glaubst du nicht, dass Jon …«
Antonia hebt den Finger.
»Wage es nicht. Wage es nicht, den Namen des besten und aufrichtigsten Menschen in den Mund zu nehmen, um dein Handeln zu rechtfertigen.«
»Wir mussten herausfinden, was passiert ist, Antonia. Er hatte seine Kollegin getötet. So was kommt nicht von ungefähr.«
»Also gut, erzähl mir alles.«
»Mehr kann ich dir nicht sagen, Scott.«