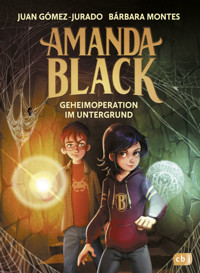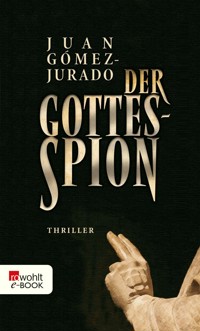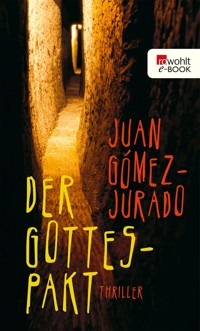
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Expedition in die Hölle Die junge Journalistin Andrea Otero darf exklusiv über eine wichtige Expedition in die jordanische Wüste berichten. Das Ziel der Archäologen: die Ausgrabung der alttestamentarischen Bundeslade. Der Fund käme einer Sensation gleich – und dürfte gleichzeitig religiöse Fanatiker weltweit auf den Plan rufen. Deshalb schickt der Vatikan Pater Anthony Fowler mit auf die Mission. Der zwielichtige Geistliche verfolgt allerdings ganz eigene Interessen. Aber auch er ahnt nicht, wer sonst noch das Expeditionsteam infiltriert hat. Als unerwartet ein Mitglied der Expedition stirbt, weiß Andrea nicht mehr, wem sie noch vertrauen kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Juan Gómez-Jurado
Der Gottes-Pakt
Thriller
Aus dem Spanischen von Luis Ruby
Informationen zum Buch
Expedition in die Hölle
Die junge Journalistin Andrea Otero darf exklusiv über eine wichtige Expedition in die jordanische Wüste berichten. Das Ziel der Archäologen: die Ausgrabung der alttestamentarischen Bundeslade. Der Fund käme einer Sensation gleich – und dürfte gleichzeitig religiöse Fanatiker weltweit auf den Plan rufen. Deshalb schickt der Vatikan Pater Anthony Fowler mit auf die Mission. Der zwielichtige Geistliche verfolgt allerdings ganz eigene Interessen. Aber auch er ahnt nicht, wer sonst noch das Expeditionsteam infiltriert hat. Als unerwartet ein Mitglied der Expedition stirbt, weiß Andrea nicht mehr, wem sie noch vertrauen kann …
Informationen zum Autor
Juan Gómez-Jurado, geboren 1977 in Madrid, hat als Journalist für Radio und Fernsehen sowie als Marketingdirektor gearbeitet. Für seine journalistischen Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet. In seiner Heimat Spanien gilt der Autor seit dem Bestseller-Erfolg «Der Gottesspion» als «der neue Papst des Verschwörungsromans». (Qué Leer).
Weitere Veröffentlichungen:
Der Gottesspion
Das Zeichen des Verräters
Für meine Eltern,
die unter dem Tisch Schutz vor den Bomben suchten.
Die Erschaffung des Feindes
Beginne mit einer weißen Leinwand
Skizziere in groben Zügen die Umrisse von Männern, Frauen und Kindern
Tauche in den Brunnen deines eigenen Dunkels einen breiten Pinsel und beschmiere die Fremden
mit der düsteren Farbe des Schattens
Male auf das Gesicht des Feindes die Gier, den Hass, die Achtlosigkeit, die du nicht zu beanspruchen wagst als dein Eigen
Verdunkle die freundliche Individualität auf jedem Gesicht
Lösche jeglichen Hinweis auf die unzähligen Lieben, Hoffnungen, Ängste, die durch das Kaleidoskop jedes endlichen Herzens leuchten
Verbiege das Lächeln, bis es den nach unten gekrümmten Bogen der Grausamkeit formt
Trenne Fleisch von Knochen, bis nur noch
das abstrakte Skelett des Todes bleibt
Überzeichne jeden Gesichtszug, bis der Mensch verwandelt ist
in Tier, Gewürm, Insekt
Fülle den Hintergrund mit tückischen Gestalten
aus alten Albträumen – Teufeln, Dämonen, Schergen des Bösen
Wenn die Ikone des Feindes fertig ist, wirst du fähig
sein zu töten ohne Reue, zu schlachten ohne Scham
Das Ding, das du zerstörst, ist dann nur noch ein Feind Gottes,
ein Hindernis für die heilige Dialektik der Geschichte.
SAM KEEN, Faces of the Enemy
Anochi Adonai Elohecha
Lo yehiyeh Lecha Elohim Acherim
Lo Tisa Et Shem Adonai Elohecha La’Shav
Z’chor Et yom Ha Shabbat L’kodsho
Kaved Et Avicha V’Et Imecha
Loh Tirtzach
Lo Tin’af
Lo Tignov
Lo Ta’aneh Bere’acha Et Shaker
Lo Tach mod
Ich bin der Herr, dein Gott.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen.
Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht ehebrechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst kein falsches Zeugnis reden.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
Dramatis Personae
ANDREA OTERO: Reporterin bei der Tageszeitung El Globo; Spanierin.
ANTHONY FOWLER: Geistlicher; Agent der CIA und der Sant’Alleanza; US-Amerikaner.
PATER ALBERT: ehemaliger Hacker; Systemanalyst der CIA und Verbindungsmann zum vatikanischen Geheimdienst; US-Amerikaner.
FRACESAREO: Dominikaner; Konservator im Reliquiensaal des Vatikans; Italiener.
CAMILO CIRIN: Generalinspektor der Vatikanpolizei; inoffizielles Oberhaupt der Sant’Alleanza, des vatikanischen Geheimdienstes; Italiener.
RAYMOND KAYN: millionenschwerer Besitzer einer Unternehmensholding; Staatsbürgerschaft unbekannt.
JACOB RUSSELL: Kayns persönlicher Assistent; Brite.
ORVILLE WATSON: Berater für Terrorismusfragen; Inhaber der Sicherheitsfirma GlobalInfo; US-Amerikaner.
CECYL FORRESTER: Archäologe; Spezialist für Bibelarchäologie; US-Amerikaner.
Archäologen: David Pappas, Gordon Durwin, Kyra Larsen, Stowe Erling und Ezra Levine.
Das Expeditionsteam:
MOGENS DEKKER: Sicherheitschef der Expedition; Südafrikaner.
Söldner: Aldis Gottlieb, Alryk Gottlieb, Tewi Waaka, Paco Torres, Louis Maloney und Marla Jackson.
DR. HAREL: Ärztin auf der Ausgrabung; Israelin.
TOMMY EICHBERG: Fahrer.
NURI ZAYIT: Koch.
RANI PETERKE: Kochgehilfe.
ROBERT FRICK: Techniker.
BRIAN HANLEY: Techniker.
Prolog
Kinderklinik Am Spiegelgrund
Wien
FEBRUAR 1943
Sie standen unter der riesigen Hakenkreuzfahne, die über dem Eingang der Klinik im Wind flatterte, als die Frau ein unwillkürliches Frösteln überkam. Ihr Begleiter missverstand dies und zog sie eng an sich, um sie zu wärmen. Der dünne Mantel schützte sie nur unzureichend vor dem eisigen Wind, dem Vorboten eines Schneetreibens, das in wenigen Stunden losbrechen sollte.
«Nimm meine Jacke, Odile», sagte der Mann und machte sich mit zitternden Fingern daran, das Kleidungsstück aufzuknöpfen.
Die Frau löste sich aus seiner Umarmung und presste das Päckchen noch enger an ihre Brust. Nach einem zehn Kilometer langen Marsch durch den Schnee war sie steif vor Kälte und völlig erschöpft. Drei Jahre zuvor hätte sie sich noch in einem Daimler chauffieren lassen, in einen Nerz gehüllt. Doch ihr Wagen gehörte jetzt einem Brigadeführer, und ihr Pelzmantel zierte an Theaterabenden die blassen Schultern irgendeines Naziflittchens mit überschminkten Lidern.
Odile fasste sich ein Herz und drückte kräftig auf den Klingelknopf. Drei Mal. Dann erst antwortete sie ihrem Begleiter: «Ich zittere nicht vor Kälte, Josef. Es ist gleich Sperrstunde. Wenn wir es nicht rechtzeitig zurückschaffen …»
Ihr Mann kam nicht mehr dazu, ihr zu antworten, denn schon öffnete eine freundliche Krankenschwester die Tür. Doch als sie die Besucher näher in Augenschein nahm, erstarb das Lächeln auf ihren Lippen. Juden erkannte sie mittlerweile auf den ersten Blick.
«Sie wünschen?»
Odile zwang sich, ihrerseits zu lächeln, obwohl ihr die aufgeplatzten Lippen schmerzten.
«Wir möchten zu Dr.Graus.»
«Haben Sie einen Termin?»
«Der Herr Doktor sagte, er würde uns empfangen.»
«Name?»
«Josef und Odile Cohen, Fräulein.»
Die Krankenschwester wich einen Schritt zurück, als sie ihren Verdacht durch den jüdischen Nachnamen bestätigt fand.
«Sie lügen! Sie haben keinen Termin. Gehen Sie zurück in das Loch, aus dem Sie gekrochen sind. Sie wissen, dass Sie hier nichts verloren haben.»
«Bitte. Mein Sohn ist hier. Bitte.»
Ihre Worte prallten an der schweren Tür ab, die nun heftig zugeschlagen wurde.
Josef und seine Frau starrten verzweifelt auf die dicken Mauern der Klinik. Odile taumelte vor Schwäche und Hilflosigkeit; Josef fing sie auf, als sie zusammenzubrechen drohte.
«Komm. Wir suchen uns einen anderen Weg.»
Sie liefen um das Gebäude herum, doch als sie um die Ecke bogen, hielt Josef seine Frau plötzlich zurück. Die Tür eines Seiteneingangs war soeben geöffnet worden, und ein Mann im dicken Wintermantel kam heraus und zog einenWagen voll Müll hinter sich her. Während der Mann im Hinterhof der Klinik verschwand, schlichen Josef und Odile an der Wand entlang zu der halbgeöffneten Tür.
Drinnen erstreckte sich der Versorgungstrakt, von dem ein Labyrinth aus Korridoren und Treppen abging. Auf den Gängen war schwaches, dumpfes Weinen zu hören, wie aus einer anderen Welt.
Die Frau spitzte die Ohren und lauschte vergebens, ob sie darunter die Stimme ihres Sohnes ausmachen konnte. Verstohlen huschte sie in die Klinik hinein. Josef musste sich beeilen, um mit seiner Frau Schritt halten zu können, die ihrem Instinkt folgte und an jeder Biegung allenfalls kurz innehielt.
Schließlich erreichten sie einen dunklen, L-förmigen Seitenflügel, wo unzählige Kinder in ihren Betten lagen. Viele von ihnen waren am Kopfende mit Gurten gefesselt und heulten wie geprügelte Hunde. Ein herber Geruch strömte durch den überheizten Raum.
Odile begann zu schwitzen. Die Hitze flutete immer heftiger durch ihren Körper, und sie spürte ein Stechen in den Gelenken, doch sie schenkte ihren Gefühlen keinerlei Beachtung. Ihr Blick huschte von einem Gesicht zum nächsten und suchte angstvoll nach dem ihres Sohnes.
«Hier ist der Bericht, Dr.Graus.»
Josef und seine Frau sahen sich erschrocken an, als sie die Stimme vom Flur vernahmen. Das war der Name des Arztes, den sie suchten. Der Mann, in dessen Händen das Leben ihres Sohnes lag.
Eilig traten sie aus dem Zimmer und sahen sich einer Gruppe gegenüber, die sich um eines der Feldbetten versammelt hatte. Ein attraktiver, blonder junger Mann imArztkittel saß am Bett eines etwa neunjährigen Mädchens. Um ihn herum standen eine ältere Krankenschwester, die ein Tablett mit medizinischen Geräten in der Hand hielt, und ein Arzt mittleren Alters, der sich mit gelangweilter Miene Notizen machte.
«Herr Dr.Graus!» Odile nahm all ihren Mut zusammen und ging ein paar Schritte auf das Grüppchen zu.
Der junge Mann machte eine abwehrende Handbewegung, ohne den Blick von seiner Arbeit zu wenden. «Jetzt nicht, bitte.»
Die Krankenschwester und der Arzt warfen den beiden Neuankömmlingen einen erstaunten Blick zu, sagten aber nichts.
Odile erhaschte einen Blick auf die Patientin und biss sich auf die Lippe, um nicht laut aufzuschreien. Das Mädchen schien halb ohnmächtig zu sein und war bleich wie eine Wand. Graus hielt einen ihrer Arme über eine Metallschüssel und setzte mit einem Skalpell zu einer Reihe von kleinen Schnitten an. Nur wenige Zentimeter Haut waren von der makabren Berührung der Klinge verschont geblieben. Das Blut floss langsam, füllte aber schon fast das gesamte Gefäß. Schließlich kippte der Kopf des Mädchens zur Seite, und Graus legte ihr ungerührt zwei schmale, elegante Finger an den Hals.
«Gut, kein Puls mehr. Die Uhrzeit, Dr.Stroebel.»
«Achtzehn Uhr fünfunddreißig.»
«Fast dreiundneunzig Minuten. Ausgezeichnet! Die Patientin hat auf geradezu wundersame Weise im Wachzustand ausgehalten, wenn auch bei niedrigem Bewusstsein und ohne offensichtliches Schmerzempfinden. Die Mischung aus Laudanum und Stechapfel ist zweifellos allem überlegen,was wir bisher ausprobiert haben, Stroebel. Glückwunsch! Nun bereiten Sie das Objekt für die Sektion vor.»
«Danke, Herr Doktor. Unverzüglich.»
Erst jetzt wandte sich der Arzt Josef und Odile zu. In seinen Augen stand eine Mischung aus Ärger und Überdruss.
«Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?»
Odile trat einen Schritt nach vorne und stellte sich neben das Bett. Sie gab sich Mühe, nicht auf das tote Mädchen zu schauen.
«Mein Name ist Odile Cohen, Dr.Graus. Ich bin die Mutter von Conrad Cohen.»
Der Arzt musterte sie kalt und sah dann die Krankenschwester an. «Ulrike, schaffen Sie diese Juden hier weg.»
Die stämmige Frau drängte sich zwischen Odile und den Arzt, packte die Fremde am Ellbogen und schob sie unsanft beiseite. Josef eilte herbei, um seiner Gattin zu helfen. Die drei begannen in einem seltsamen Knäuel miteinander zu ringen. Schwester Ulrike lief vor Anstrengung rot an.
«Herr Doktor, hier muss ein Missverständnis vorliegen.» Odile versuchte, den Kopf an den breiten Schultern der Schwester vorbeizurecken. «Mein Sohn ist nicht geistig behindert.»
Endlich gelang es ihr, sich aus der Umklammerung der Schwester zu befreien, und sie trat mutig auf den Arzt zu. «Gewiss, seit wir unser Zuhause verloren haben, spricht er nicht viel, aber den Verstand hat er nicht verloren. Er ist nur durch einen Irrtum hier. Wenn Sie ihn entlassen könnten, würde ich … Ich möchte Ihnen das Einzige anbieten, was uns geblieben ist.»
Sie legte das Päckchen aufs Bett, bemüht, die Leiche nicht zu berühren; dann wickelte sie das Zeitungspapier, das denInhalt verdeckte, langsam auseinander. Trotz des dumpfen Lichts auf dem Flur glitt ein goldener Schimmer über die Wände.
«Dies befindet sich seit unzähligen Generationen im Besitz meiner Familie, Doktor Graus. Ich würde eher sterben, als mich davon zu trennen. Aber mein Sohn, Herr Doktor, mein Sohn …»
Odile brach in Tränen aus und sank in die Knie. Der junge Arzt schien das nicht zu registrieren, sein Blick haftete an dem Gegenstand, der auf dem Bett lag. Dann öffneten sich seine Lippen und machten alle Hoffnungen des Ehepaars zunichte. «Ihr Sohn ist tot», erklärte er. «Fort jetzt.»
Draußen schlug ihnen die Kälte ins Gesicht. Odile legte den Arm um ihren Mann und marschierte eilig los. Sie hatte die Sperrstunde so klar im Bewusstsein wie nie zuvor. Denn sie konnte nur noch daran denken, rechtzeitig zu ihrem zweiten Sohn zurückzukehren, der am anderen Ende der Stadt wartete.
«Lauf, Josef. Lauf.»
Sie hasteten immer schneller durch den Schnee.
In seinem Büro in der Klinik legte Dr.Graus geistesabwesend den Telefonhörer auf und strich mit den Fingern über den seltsamen Gegenstand. Als Minuten später die Einsatzsirenen der SS-Fahrzeuge an sein Ohr drangen, sah er nicht einmal aus dem Fenster. Sein Assistent sagte etwas von irgendwelchen flüchtigen Juden, aber er schenkte ihm keine Beachtung.
Er war viel zu beschäftigt damit, im Geiste die Operation an dem kleinen Cohen vorzubereiten.
Wohnung von Heinrich Graus
Steinfeldstr. 6, Krieglach, Österreich
DONNERSTAG, 15. DEZEMBER 2005, 11:42 UHR
Sorgfältig trat der Priester Anthony Fowler die Schuhe an der Fußmatte ab, bevor er an der Tür klingelte. Er hatte den Mann fast vier Monate lang gesucht und ihn, nachdem er ihn in seinem Versteck ausfindig gemacht hatte, beinahe zwei Wochen lang überwacht. Nun war er sich der Identität des Monsters sicher. Der Moment war gekommen, ihm gegenüberzutreten.
Geduldig wartete er, bis Graus zur Tür kam. Mittags hielt dieser gern ein Nickerchen auf dem Sofa.
Die schmale Gasse in der Fußgängerzone war um diese Zeit meist menschenleer. Die braven Bewohner der Steinfeldstraße gingen ihrer Arbeit nach, nicht ahnend, dass hinter der Hausnummer 6 in einem kleinen Häuschen mit blauen Vorhängen ein Massenmörder vor dem Fernseher döste.
Schließlich wurde ein Schlüssel im Schloss gedreht, und in dem schmalen Türspalt erschien der Kopf eines alten Mannes. Eine Großvaterfigur wie aus der Bonbonreklame.
«Ja?»
«Guten Tag, Herr Doktor.»
Der Alte musterte sein Gegenüber von oben bis unten. Er sah einen kahlköpfigen Mann im Priestergewand und in schwarzem Mantel, um die fünfzig, groß gewachsen und schlank, dessen grüne Augen enorme Selbstsicherheit ausstrahlten.
«Ich glaube, Sie verwechseln mich, Pater. Ich war früher Klempner, jetzt bin ich in Pension. Außerdem habe ich erst neulich für die Pfarrei gespendet, wenn Sie mich also entschuldigen möchten …»
«Soll das heißen, Sie sind nicht Heinrich Graus, der bedeutende deutsche Neurochirurg?»
Dem alten Mann stockte kurz der Atem. Von dieser kaum merklichen Reaktion abgesehen, zeigte er keinerlei Regung. Doch dem Priester genügte dies schon. Das war sein endgültiger Beweis.
«Sie haben sich vertan. Mein Name ist Handwurz.»
«Das ist nicht wahr, und wir wissen es beide. Wenn Sie mich jetzt einlassen würden, kann ich Ihnen zeigen, was ich mitgebracht habe.» Er hob die linke Hand, in der er ein schwarzes Köfferchen hielt.
Anstatt zu antworten, öffnete der Alte nun gänzlich die Tür und hinkte in Richtung Küche. Die ausgetretenen Dielen knarrten erbärmlich unter seinen Schritten. Doch der Priester folgte ihm, ohne den Räumlichkeiten große Aufmerksamkeit zu schenken. Er hatte die Wohnung durchs Fenster hindurch drei Mal heimlich studiert und kannte die Aufstellung der billigen Möbel in- und auswendig. Lieber behielt er jetzt den Rücken des alten Nazis im Auge.
Graus ging mit gebrechlichen Schritten voran, als ob ihm das Gehen Schmerzen bereitete, aber Fowler hatte ihn hinten im Garten Kohlesäcke stemmen sehen, mit einer Beweglichkeit, um die ihn ein fünfzig Jahre Jüngerer beneidet hätte. Er wusste, Heinrich Graus war noch immer ein sehr gefährlicher Mann.
Die kleine Küche war dunkel, und der Geruch von Frittiertem hing in der Luft. Das Mobiliar bestand aus einem Gasherd sowie einem runden Tisch mit zwei ungleichen Stühlen. Graus deutete mit höflicher Geste auf einen davon. Dann holte er zwei Gläser aus dem Schrank, schenkte Wasser ein und nahm seinerseits Platz. Die Wassergläser blieben unangetastet auf dem Kiefernholz stehen, so regungslos wie die beiden Männer, die einander forschend ansahen.
Der Alte trug einen roten Flanellmorgenmantel, ein Baumwollhemd und eine abgewetzte Hose. Er war bereits vor zwanzig Jahren ergraut, und mittlerweile war sein schütteres Haar schlohweiß. Die große runde Brille hätte schon beim Fall des Eisernen Vorhangs nicht mehr als modisch gegolten. Seine Unterlippe hing ein wenig schlaff herunter und verlieh ihm den trügerischen Ausdruck eines gutmütigen Opas.
Nichts von alledem konnte den Priester täuschen.
Die fahlen Strahlen der Dezembersonne erzeugten zwischen Fenster und Tisch einen Lichtkegel, in dem Tausende von Staubpartikeln schwebten. Einige davon ließen sich auf dem eleganten Ärmel des Geistlichen nieder, der sie mit einer raschen Handbewegung wegwischte, ohne den Blick von seinem Gegenüber zu wenden.
Graus entging die unerschütterliche Sicherheit nicht, die aus dieser Geste sprach. Aber er hatte seine Fassung bereits wiedergewonnen und verschanzte sich nun hinter einer gleichgültigen Fassade.
«Möchten Sie wirklich nichts trinken, Pater?»
«Ich bin nicht durstig, Dr.Graus.»
«Handwurz. Mein Name ist Balthasar Handwurz.»
Der Priester ging darauf nicht ein. «Ich muss zugeben, dass Sie es ziemlich geschickt angestellt haben. Als Sie sich einen Pass beschafften, um nach Argentinien zu fliehen, konnte niemand ahnen, dass Sie Monate später nach Wien zurückkehren würden. Dort habe ich Sie erst ganz zuletzt gesucht. Nur siebzig Kilometer vom Spiegelgrund … Und während all dieser Zeit stellte Wiesenthal jahrelang Nachforschungen in Argentinien an, nicht ahnend, dass Sie eine kurze Autofahrt von seinem Büro entfernt leben. Finden Sie das nicht auch komisch?»
«Ich finde es lächerlich. Sie sind Amerikaner, nicht wahr? Ihr Deutsch ist ausgezeichnet, aber Ihr Akzent verrät Sie.»
Der Priester stellte sein Köfferchen auf den Tisch, ohne den Alten aus den Augen zu lassen. Er zog eine abgegriffene Mappe aus dem Gepäck. Zuoberst lag ein Foto von Graus in jungen Jahren; die Aufnahme war im Krieg entstanden, in der Klinik Am Spiegelgrund. Darunter lag ein zweiter Abzug desselben Fotos, auf dem man den Arzt dank der Bearbeitung mit einer speziellen Alterungssoftware als Greis sah.
«Finden Sie nicht auch, dass die moderne Technik wahre Wunderwerke fabriziert, Herr Doktor?»
«Das beweist doch überhaupt nichts. Jeder könnte so etwas anfertigen.» Aber Graus’ Tonfall verriet seine Unsicherheit.
«Sie haben völlig recht, das beweist nichts. Das hier jedoch sehr wohl.»
Der Priester legte ein vergilbtes Stück Papier auf den Tisch, an das ein Schwarzweißfoto geheftet war. Darüber prangte in sepiafarbenen Lettern der Beglaubigungsvermerk Testimonianza fornita sowie das Siegel des Vatikanstaats.
«Balthasar Handwurz. Blond, braune Augen, stämmig gebaut. Besondere Merkmale: eine Tätowierung am linken Arm mit der Nummer256441, die er während seiner Haft im Konzentrationslager Mauthausen von den Nazis erhielt. An einem Ort also, den Sie nie betreten haben. Die Nummer war irgendeine beliebige, aber das war das geringste Problem. Es hat funktioniert.»
Der alte Mann strich sich über den Flanellärmel seines linken Arms. Er war bleich vor Wut und Angst.
«Wer zum Teufel sind Sie?»
«Ich heiße Anthony Fowler, und ich möchte Ihnen eine Abmachung vorschlagen.»
«Verschwinden Sie aus meiner Wohnung! Raus.»
«Anscheinend habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Sie waren sechs Jahre lang Vizedirektor der Kinderklinik Am Spiegelgrund. Ein ausgesprochen interessanter Ort. Fast alle Patienten waren Juden mit geistigen Erkrankungen. ‹Unwertes Leben.› So hieß das doch bei Ihnen, nicht wahr?»
«Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden!»
«Niemand hat geahnt, was Sie dort taten. Die Experimente. Die Lebendsektionen. Siebenhundertvierzehn Kinder, Dr.Graus! Sie haben siebenhundertvierzehn Menschen mit Ihren eigenen Händen getötet.»
«Ich habe Ihnen doch gesagt, ich …»
«Und die Gehirne Ihrer Opfer haben Sie in Behältern aufbewahrt!» Fowler schlug mit der Faust auf den Tisch, so heftig, dass beide Gläser umfielen und ihr Inhalt sich über den Küchenboden ergoss. Zwei Sekunden lang war nur das Geräusch des tropfenden Wassers zu hören. Fowler atmete durch und versuchte, sich zu beruhigen.
Der Arzt wich dem Blick der grünen Augen aus, die ihn jetzt durchbohrten. «Arbeiten Sie für die Juden?»
«Nein, Graus. Sie wissen selbst, dass das nicht der Fall sein kann. Sonst würden Sie bereits in Tel Aviv am Galgen baumeln. Meine … Verbindung läuft über die Leute, die Ihnen 1946 zur Flucht verhalfen.»
Der Arzt erschauderte. «Die Sant’ Alleanza», murmelte er. «Und was will die Alleanza nach all den Jahren von mir?»
«Etwas, das sich in Ihrem Besitz befindet.»
Graus machte eine ausladende Geste. «Sie sehen ja, ich lebe nicht gerade im Überfluss. Mir bleibt kaum noch Geld.»
«Wenn es mir um Geld ginge, würde ich Sie an die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ausliefern. Auf Ihre Ergreifung sind immer noch 130000Euro Belohnung ausgesetzt. Nein, ich will die Kerze.»
Graus musterte ihn in gespieltem Erstaunen. «Was für eine Kerze?»
«Jetzt sind Sie es, der sich lächerlich macht, Graus. Die Kerze, die Sie vor zweiundsechzig Jahren der Familie Cohen gestohlen haben. Eine schwere Wachskerze ohne Docht, überzogen mit Gold. Ich will sie, und zwar sofort.»
«Gehen Sie doch mit ihren Märchen woanders hin. Ich weiß nichts von einer Kerze.»
Fowler seufzte. Er machte eine angewiderte Handbewegung, lehnte sich zurück und deutete auf die beiden umgefallenen Gläser. «Haben Sie vielleicht etwas Stärkeres da?»
«Hinter Ihnen.» Graus wies auf die Fensterbank.
Der Priester drehte sich um und griff nach einer halbvollen Flasche. Dann stellte er die Gläser zurück auf den Tisch und goss zwei Fingerbreit der klaren Flüssigkeit ein. Beide Männer leerten sie mit einem Zug.
Fowler griff abermals zu der Flasche und schenkte nach. Während er weitersprach, nahm er hin und wieder einen kleinen Schluck.
«Weizenkorn. Das hatte ich schon lange nicht mehr.»
«Vermisst haben Sie das Zeug wohl kaum.»
«Sicher nicht. Aber es ist nicht teuer, stimmt’s?»
Graus zuckte die Achseln, erwiderte aber nichts. Der Priester zeigte mit dem Finger auf ihn.
«Ein Mann wie Sie, Graus. Brillant, eitel. Und Sie wählen das hier? Vergiften sich langsam in einem nach Urin stinkenden Dreckloch? Aber wissen Sie was? Ich kann das verstehen.»
«Was wollen Sie schon verstehen.»
«Bewundernswert. Sie beherrschen die Techniken des Reichs noch immer. Offiziersreglement, dritter Abschnitt: ‹Im Falle der Gefangennahme durch den Feind ist jeglicher Vorwurf abzustreiten. Es sind möglichst kurze Antworten zu geben, die den Offizier nicht kompromittieren.› Aber hören Sie mal gut zu, Graus: Kompromittiert sind Sie bis über die Ohren.»
Der Alte verzog das Gesicht und goss sich den übrigen Schnaps ein.
Fowler achtete genau auf die Körpersprache seines Gegenübers und bemerkte, wie die Mauer der Entschlossenheit allmählich Risse bekam.
«Sehen Sie sich meine Hände an, Doktor», sagte er und legte sie auf den Tisch. Es waren zerfurchte Hände mit feinen Fingern. An den ersten Fingergliedern, direkt über den Knöcheln, lief eine dünne weiße Linie entlang; sie war schnurgerade und setzte sich bis an beide Ränder fort.
«Eine hässliche Narbe. Wie alt waren Sie da, zehn, elf?»
«Zwölf. Ich übte gerade Klavier: eines von Chopins Präludien, Opus 28. Mein Vater stellte sich neben mich und knallte ohne Vorwarnung den Deckel des Steinway-Flügels zu, so hart er konnte. Dass ich meine Finger nicht verlor, grenzt an ein Wunder, aber mit dem Klavierspielen war es vorbei.» Der Priester packte abermals sein Glas. Doch bevor er fortfuhr, starrte er einige Sekunden lang in die helle Flüssigkeit. Er hatte diesen Teil seiner Biographie bisher keinem offenbaren und ihm dabei in die Augen sehen können. «Mein Vater … Er hat mir wiederholt Gewalt angetan. Seit ich neun war. An jenem Tag drohte ich ihm, jemandem davon zu erzählen, wenn er es nochmal täte. Da hat er mir einfach die Hände kaputt gemacht. Später hat er dann geweint, mich um Verzeihung gebeten und die besten Ärzte gerufen, die man für Geld bekommen konnte … Ah-ah-ah. Denken Sie gar nicht erst dran.»
Graus hatte den Arm unter die Tischplatte gleiten lassen und versucht, etwas aus der Besteckschublade zu ziehen. Ruckartig zog er die Hand zurück.
«Ich kann Sie also verstehen, Doktor. Mein Vater war ein Monster, dessen Schuld seine Fähigkeit, sich zu verzeihen, bei weitem überstieg. Aber er war wesentlich mutiger als Sie. Er hat eines Tages mitten in einer scharfen Kurve das Gaspedal durchgetreten und meine Mutter mit in den Tod genommen.»
«Was für eine rührende Geschichte, Pater», höhnte Graus.
«Wenn Sie das sagen. Sie leben ja nun seit vielen Jahren auf der Flucht vor Ihren Verbrechen. Aber jetzt werden Sie von Ihrer Schuld eingeholt. Doch ich kann Ihnen etwas verschaffen, was mein Vater nicht gehabt hat: eine Chance.»
«Ich höre.»
«Geben Sie mir die Kerze. Dafür überlasse ich Ihnen diese Mappe mit sämtlichen belastenden Dokumenten. Sie können dann bis an Ihr Lebensende in Ihrem Versteck bleiben.»
«Soll das alles sein?», fragte der Alte ungläubig.
«Soweit es mich angeht, ja.»
Graus wog den Kopf, lachte in sich hinein und erhob sich. Er öffnete einen der Küchenschränke und zog ein mit Reis gefülltes Einmachglas hervor. «Ich hatte noch nie eine Schwäche für dieses Schlitzaugenfutter. Bekomme davon Sodbrennen.»
Er leerte das Einmachglas, und ein Strom von Körnern ergoss sich auf den Tisch. Dann folgte ein dumpfes Geräusch. Halb von Reis zugedeckt, kam ein Päckchen zum Vorschein.
Fowler beugte sich vor, doch Graus’ knochige Hand packte ihn am Handgelenk.
«Ich habe Ihr Wort darauf, ja?», fragte der Alte nervös. Seine Hände zitterten.
«Gilt es Ihnen denn etwas?» Der Priester sah ihn an.
«Mir schon.»
«Dann haben Sie es.»
Der Arzt ließ die Beute los, und Fowler griff danach. Behutsam wischte er den Reis beiseite und hob das in ein dunkles Tuch gehüllte Päckchen hoch, das mit Schnüren zugebunden war. Langsam und mit sicherer Hand löste er die Knoten und wickelte das Tuch auf.
Die schwachen Strahlen der österreichischen Wintersonne erzeugten ein goldenes Funkeln in der speckigen Küche, das kaum zu einem solchen Ort passte. Ganz im Gegensatz zu dem angegrauten, schmutzigen Wachs der dicken Kerze auf dem Tisch. Einst war sie über und über mit einer dünnen Goldschicht überzogen gewesen, die eine verschlungene Zeichnung gebildet hatte. Nun war das Edelmetall fast völlig verschwunden, und auf dem Wachs blieben nur mehr ein paar oberflächliche Spuren der Filigranarbeit übrig. Von dem Gold war allenfalls noch ein Drittel vorhanden.
Graus lachte freudlos. «Der Rest davon ist im Pfandhaus geblieben, Pater.»
Fowler antwortete nicht. Er zog ein Zippo-Feuerzeug aus der Hosentasche und zündete es mit einer Hand an. Dann stellte er die Kerze hin und hielt die Flamme gegen das obere Ende. Obwohl die Kerze keinen Docht hatte, begann das Wachs unter der Hitze langsam zu schmelzen. Es verströmte dabei einen ekelerregenden Gestank. Graue Tropfen rannen auf die Tischplatte.
Während Graus dem Pater zusah, gab er weiter zynische Kommentare von sich. Er schien es zu genießen, dass er nach so vielen Jahren mit einem anderen Menschen über seine wahre Identität sprechen konnte.
«Mich bringt das wirklich zum Lachen. Der Jude aus dem Pfandhaus kauft jahrelang jüdisches Gold, um einen stolzen Vertreter des Reichs über Wasser zu halten. Und jetzt stehen Sie vor dem Ergebnis einer sinnlosen Suche.»
«Der Schein trügt, Graus. Der Schatz, den ich suche, ist nicht das Gold an dieser Kerze. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver für Tölpel.»
Auf dem Tisch hatte sich mittlerweile eine Lache gebildet, in der oberen Hälfte der Kerze klaffte bereits ein großes Loch. Und in der Mitte dieses Vulkans aus flüssigem Wachs erschien nun der grünliche Rand eines metallischen Gegenstands.
«Gut, es ist noch da», sagte der Priester. «Ich werde dann jetzt gehen.» Er stand auf und wickelte das Tuch wieder um die Kerze, wobei er darauf achtete, sich nicht an dem heißen Wachs zu verbrennen.
«Halt!» Graus musterte ihn erstaunt. Das Lachen war ihm vergangen. «Was ist das? Was war da drin?»
«Das geht Sie nichts an.»
Der Alte sprang auf und zog hastig ein Küchenmesser aus der Schublade. Mit zittrigen Schritten ging er um den Tisch herum und auf den Priester zu. In seinen Augen glomm das zwanghafte Feuer eines Mannes, der diesen Gegenstand nächtelang angestarrt hatte, ohne zu wissen, was er vor sich hatte. Doch Fowler stand reglos da und sah ihn nur an.
«Ich muss es erfahren.»
«Nein, Graus. Wir haben eine Abmachung getroffen. Die Kerze im Tausch gegen die Mappe, und die sollen Sie auch bekommen.»
Der Alte hob die Hand mit dem Messer, aber etwas im Gesicht seines unerwünschten Besuchers brachte ihn dazu, die Waffe wieder sinken zu lassen.
Fowler nickte und warf die Mappe auf den Tisch. Das Stoffbündel in der einen, sein Köfferchen in der anderen Hand machte er langsam ein paar Schritte zurück, bis er die Küchentür erreicht hatte. Sein Gegenüber ließ er dabei nicht aus den Augen.
Graus nahm die Mappe in die Hand. «Es gibt davon keine Kopien, oder?»
«Nur eine. Die haben die beiden Juden, die da draußen warten.»
Graus wirkte, als würden ihm jeden Moment seine Augen aus den Höhlen springen. Abermals hob er das Messer und machte einen Schritt auf den Priester zu.
«Sie haben mich belogen! Sie sagten, Sie würden mir eine Chance geben!»
Fowler warf ihm einen letzten gleichmütigen Blick zu. «Gott wird mir vergeben. Glauben Sie, dass Sie dasselbe Glück haben werden?»
Damit verschwand er ohne ein weiteres Wort im Treppenhaus.
Als Fowler auf die Straße trat, presste er sich das kostbare Stoffpäckchen an die Brust und entfernte sich rasch. Einige Meter vom Hauseingang entfernt warteten zwei Männer in grauen Mänteln. Fowler warnte sie im Vorübergehen:
«Er hat ein Messer.»
Der größere der beiden verschränkte die Hände, ließ die Knöchel knacken und schenkte ihm ein halbes Lächeln.
«Umso besser.»
ARTIKEL AUS DER TAGESZEITUNG EL GLOBO,
AUSGABE VOM 17. DEZEMBER 2005, SEITE 12
Herodes von Österreich tot aufgefunden
WIEN (Agenturmeldung) Die österreichische Polizei hat Dr.Heinrich Graus, «den Fleischer vom Spiegelgrund», aufgespürt, der sich über fünfzig Jahre lang erfolgreich dem Zugriff der Justiz entzogen hatte. Der berüchtigte Nazi-Kriegsverbrecher wurde in einem Häuschen in Krieglach, einem Dorf sechzig Kilometer von Wien entfernt, tot aufgefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war Herzversagen die Todesursache.
Der 1915 geborene Graus schloss sich 1931 der NSDAP an. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war er bereits Vizedirektor der Kinderklinik Am Spiegelgrund. Graus missbrauchte seine Stellung dazu, zahllose, vermeintlich verhaltensauffällige oder geistig behinderte jüdische Kinder in unmenschlichen Experimenten zu quälen. Bei mehreren Gelegenheiten erklärte Graus, das Verhalten dieser Patienten sei durch ihr Erbgut bestimmt und die Experimente seien gerechtfertigt, da es sich um «unwertes Leben» handle.
So impfte Graus gesunde Kinder mit Bakterien, die Infektionskrankheiten auslösten. Er nahm Lebendsektionen vor und spritzte seinen Opfern diverse Varianten eines von ihm entwickelten Betäubungsmittels, um anschließend ihre Schmerzempfindlichkeit zu testen. Vermutungen zufolge wurden hinter den Mauern der Klinik Am Spiegelgrund während des Zweiten Weltkriegs an die tausend Morde verübt.
Nach Kriegsende verschwand der Nazi-Arzt spurlos; zurück blieben nur die dreihundert in Formaldehyd konservierten Kindergehirne in seinem Büro. Trotz aller Bemühungen gelang es der deutschen Justiz nicht, Heinrich Graus ausfindig zu machen. Der berühmte Nazi-Jäger Simon Wiesenthal, der über 1100 Kriegsverbrecher vor Gericht bringen konnte, setzte bis zu seinem Tod alles daran, Graus zu fassen. Er bezeichnete ihn als seine «unerledigte Aufgabe» und suchte unermüdlich ganz Südamerika nach ihm ab. Vor drei Monaten starb Wiesenthal in Wien, ohne je erfahren zu haben, dass der Mann, den er so hartnäckig verfolgt hatte, keine Autostunde von seinem Arbeitsplatz entfernt als pensionierter Klempner lebte.
Inoffizielle Quellen der israelischen Botschaft in Wien haben ihr Bedauern darüber ausgedrückt, dass Graus starb, ohne jemals für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden zu sein, zeigten sich allerdings befriedigt über den plötzlichen Tod des alten Mannes. Vermutlich hätte sein hohes Alter einen Prozess oder eine Auslieferung ähnlich kompliziert gestaltet wie im Fall des chilenischen Diktators Augusto Pinochet. «Man kann nicht umhin, hinter Graus’ Tod die Hand des Schöpfers zu erkennen», verlautete aus besagten Quellen.
Kayn
«Er ist da, Sir.»
Der Mann auf dem Stuhl sank fast unmerklich in sich zusammen. Seine Hand zitterte leicht. Einem Menschen, der ihn weniger gut kannte als sein Assistent, wäre dieses Zeichen von Schwäche entgangen.
«Und? Wurde er eingehend durchsucht?»
«Ja, das wissen Sie doch, Sir.»
Ein lautes Seufzen. «Ja, Jacob. Du musst mich entschuldigen.» Während er das sagte, erhob sich der Mann von seinem Stuhl und umklammerte die Fernbedienung, über die er seine gesamte Umgebung steuerte, so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Er hatte schon mehrere Fernbedienungen zerbrochen, bis sein Assistent schließlich eine Sonderanfertigung aus extrahartem Plexiglas besorgt hatte, das speziell nach der Hand des Alten modelliert war. «Mein Verhalten ist sicherlich eine Belastung. Tut mir leid.»
Der Assistent antwortete nicht. Er wusste, dass sein Chef sich erst mal Luft machen musste.
«Weißt du, es schmerzt mich, den ganzen Tag hier herumzuhocken. Der Alltag bereitet mir immer weniger Freude. Was für ein seniler Schwachkopf aus mir geworden ist! Jeden Abend sage ich mir beim Schlafengehen: Morgen, morgen ist es so weit. Doch dann stehe ich auf, und die Entschlossenheit ist verschwunden – genau wie meine Zähne.»
«Wir sollten jetzt besser anfangen, Sir», sagte der Assistent, der sich diese Ausführungen in verschiedenen Varianten schon Dutzende Male hatte anhören müssen.
«Muss das wirklich sein?»
«Sie selbst haben es so gewünscht. Um das lose Ende zu überprüfen.»
«Ich könnte doch auch einfach den Bericht lesen.»
«Darum allein geht es nicht. Wir befinden uns bereits in Phase vier. Wenn Sie an der Expedition teilnehmen möchten, müssen Sie langsam damit anfangen, Begegnungen mit Unbekannten in Kauf zu nehmen. Dr.Hocher hat sich da ganz unmissverständlich ausgedrückt.»
Der alte Mann bediente den Touchscreen seiner Fernbedienung. Die Jalousien wurden heruntergelassen, das Licht erlosch. Dann setzte er sich wieder hin.
«Gibt es keine andere Möglichkeit?»
Sein Assistent schüttelte den Kopf.
«Also gut.»
Der junge Mann ging zur Tür, von wo noch ein wenig Licht ins Zimmer fiel.
«Jacob.»
«Ja, Sir?»
«Bevor du gehst … würdest du mir einen Moment lang die Hand halten? Mir ist bang.»
Der Assistent folgte seinem Wunsch. Die Hand des Alten zitterte immer noch.
Hauptsitz von Kayn Industries
New York
MITTWOCH, 5. JULI 2006, 11:10 UHR
Orville Watson trommelte unruhig auf der prallgefüllten ledernen Aktentasche herum, die auf seinem Schoß lag. Seit über zwei Stunden saß er sich im 38. Stock des Kayn Tower in diesem Vorzimmer seinen ausladenden Hintern platt. Bei einem Stundensatz von dreitausend Dollar hätte jeder andere Berater liebend gern bis zum Jüngsten Gericht gewartet. Aber nicht Orville Watson. Denn der junge Kalifornier begann sich zu langweilen. Und der Kampf gegen Langeweile war seit jeher die Triebfeder seiner Karriere.
Auf der Universität hatte er sich gelangweilt und das Studium deshalb gegen den Rat seiner Eltern im zweiten Jahr abgebrochen. Dann hatte er einen gutbezahlten Job bei CNET gefunden, einem aufstrebenden High-Tech-Unternehmen, doch bald schon kam erneut die Langeweile auf. Watson war stets auf der Suche nach neuen, aufregenden Herausforderungen. Probleme zu lösen war seine wahre Leidenschaft. An Unternehmergeist fehlte es ihm nicht, und so kündigte er zu Anfang des neuen Jahrtausends, um seine eigene Start-up-Firma zu gründen.
Sämtliche Einwände seiner Mutter, die täglich in der Zeitung las, dass die Dot-Com-Blase platzen würde, konnten Watson nicht davon abbringen. Er zwängte sich mit seinen einhundertvier Kilogramm, dem blonden Pferdeschwanz und einem Koffer voller Kleidung in einen abgehalfterten Pick-up und durchquerte damit die USA. In einem Halbsouterrain in Manhattan entstand GlobalInfo. Das Firmenmotto lautete: «Sie fragen – wir antworten». Das Vorhaben hätte der verrückte Traum eines jungen Mannes bleiben können. Eines Mannes, der nicht nur eine gravierende Essstörung und eine allzu große intellektuelle Unrast hatte, sondern auch ein ausgeprägtes Verständnis für den Cyberspace und die Art und Weise, wie das World Wide Web funktionierte.
Doch dann kam der 11. September, und Orville Watson begriff drei Dinge: Erstens, dass der Umgang der Regierung mit Informationen seit dreißig Jahren veraltet war. Zweitens, dass das neue Klima der political correctness, die sich in den acht Jahren der Regierung Clinton durchgesetzt hatte, die Datensuche erheblich erschwerte. Denn nun durfte man sich nur noch auf «verlässliche Quellen» berufen, was im Umgang mit Terroristen einfach lächerlich war. Drittens begriff er, dass Arabisch als Sprache des internationalen Geheimdienstgeschäfts das Russische abgelöst hatte.
Watsons Mutter Yasmina stammte aus Beirut, wo sie einen gutaussehenden Ingenieur aus Sausalito kennenlernte, der gerade ein Bauvorhaben im Libanon abwickelte. Bald schon heirateten die beiden und zogen in die USA. Von Heimweh befallen, brachte Yasmina ihrem Sohn neben Englisch auch ihre arabische Muttersprache bei.
Als der junge Mann Jahre später unter diversen Decknamen im Internet surfte, stellte er fest, dass das WWW ein Paradies für Extremisten darstellte. Rein geographisch mochte eine Handvoll Radikaler weit voneinander entfernt sein, im Web betrug die Distanz wenige Millisekunden, und die Anonymität war gewährleistet. Wie sektiererisch ihre Ideen auch waren: Hier fanden sie immer jemanden, der genauso dachte. Binnen weniger Wochen gelang Orville Watson etwas, das kein westlicher Geheimdienstagent zuwege gebracht hätte. Er schaffte es, sich in die radikalsten Netze des islamistischen Terrorismus einzuschleusen.
Anfang 2002 fuhr er nach Süden Richtung Washington, vier Kartons voller Papierausdrucke im Kofferraum. Er wurde im Hauptquartier der CIA vorstellig und bat, einen zuständigen Mitarbeiter für islamistischen Terrorismus sprechen zu dürfen. Er verfüge über wichtige Informationen. In der Hand hielt er zehn Blätter, auf denen er seine Erkenntnisse zusammengefasst hatte. Der düstere Analyst, der ihn nach zwei Stunden schließlich in Empfang nahm, überflog seinen Bericht mit zunehmendem Entsetzen. Dann rief er seinen Vorgesetzten an. Wie aus heiterem Himmel stürzten sich plötzlich vier Männer auf Watson, zwangen ihn zu Boden, zogen ihn nackt aus und sperrten ihn in einen Verhörraum. Während er diese demütigende Prozedur über sich ergehen ließ, frohlockte Watson innerlich. Er hatte ins Schwarze getroffen.
Als den CIA-Oberen klar wurde, welche außerordentlichen Fähigkeiten ihr unerwarteter Besucher mitbrachte, boten sie ihm einen Job bei der «Firma» an. Watson erwiderte nur, dass der Inhalt der vier Kartons (der zu dreiundzwanzig Festnahmen in den USA und in Europa führte) lediglich eine Gratisprobe sei. Wenn mehr davon gewünscht würde, müsse man künftig sein frisch gegründetes Unternehmen GlobalInfo beauftragen.
«Zu exorbitanten Preisen», fügte er hinzu. «Könnte ich jetzt bitte meine Unterhose wiederhaben?»
Viereinhalb Jahre später hatte Watson weitere fünf Kilo zugelegt, und das, obwohl (oder gerade weil) er hartnäckig die Atkins-Diät befolgte. Auch sein Bankkonto war dicker geworden. GlobalInfo beschäftigte mittlerweile siebzehn Mitarbeiter, die für die wichtigsten Regierungen der westlichen Welt ausgefeilte Analysen erstellten. Fast immer ging es dabei um Sicherheitsfragen. Orville Watson hatte es zum Millionär gebracht, und allmählich fing er wieder an, sich zu langweilen.
Bis zu diesem Auftrag.
GlobalInfo hatte eine Regel: Jede Anfrage musste tatsächlich als Frage formuliert werden. Und in diesem Fall hatte die konkrete Frage – zusammen mit den Worten «unbegrenztes Budget» und der Tatsache, dass sie nicht von einer Regierung stammte, sondern von einem Privatunternehmen – Watsons Neugier geweckt.
Wer ist Pater Anthony Fowler?
Watson erhob sich von dem sündhaft teuren Sofa und streckte seine müden Muskeln. Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und reckte die Arme so weit nach hinten, wie er konnte.
Eine Anfrage seitens eines Privatunternehmens war ein ungewöhnliches Ereignis, selbst wenn es sich um Kayn Industries handelte, eine Firma, die laut Fortune 500 zu den hundert erfolgreichsten gehörte. Außerdem war es eine ebenso konkrete wie seltsame Frage über einen einfachen Priester aus Boston.
Einen Typen, der wie ein einfacher Priester aus Boston daherkommt, verbesserte sich Watson im Stillen.
Ein dunkelhaariger, sehniger junger Mann in einem eleganten Carolina-Herrera-Anzug betrat den Vorraum und erwischte Watson mitten in seiner Dehnübung. Der Manager, der kaum dreißig Jahre alt sein konnte, warf Watson durch seine randlose Brille einen sehr ernsten Blick zu. Die Haut des Anzugträgers hatte einen Stich ins Orange und entlarvte ihn als einen Stammgast im Sonnenstudio.
«Mr.Watson. Ich bin Jacob Russell, der persönliche Assistent von Raymond Kayn. Wir haben bereits telefoniert.» Sein britischer Akzent klang so hochnäsig wie bei einem BBC-Sprecher.
Watson versuchte mit mäßigem Erfolg, seine äußere Erscheinung in Ordnung zu bringen, und hielt ihm die Hand hin.
«Mr.Russell, freut mich sehr. Tut mir leid, dass …»
«Das macht doch nichts. Bitte folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrer Besprechung.»
Die beiden durchschritten den mit Teppich ausgelegten Vorraum und gelangten am hinteren Ende zu einer Mahagonitür.
«Eine Besprechung? Ich dachte, ich soll Ihnen nur meine Ergebnisse vortragen.»
«Nun, die Pläne haben sich geändert, Mr.Watson. Ihr heutiges Publikum ist Raymond Kayn.»
Watson verschlug es die Sprache.
«Irgendein Problem damit, Mr.Watson? Ist Ihnen nicht gut?»
«Nein. Doch. Ich meine, kein Problem, Mr.Russell. Ich bin einfach ziemlich überrascht. Mr.Kayn …»
Russell zog an einer schmalen Klappe im Türrahmen, hinter der sich eine kleine Luke mit einer unscheinbaren Platte aus dunklem Glas verbarg. Der Assistent legte seine rechte Hand auf die Glasplatte, von der ein orange getöntes Licht ausging. Mit einem Summton öffnete sich das Schloss der Tür.
«In Anbetracht dessen, wie die Medien über Mr.Kayn berichten, kann ich Ihr Erstaunen nachvollziehen. Wie Ihnen vermutlich bekannt ist, legt mein Chef großen Wert auf den Schutz seiner Privatsphäre …»
Ein verdammter Einsiedler ist er, dachte Watson.
«… aber Sie sollten sich davon nicht einschüchtern lassen. Es ist ungewöhnlich, dass er jemanden von draußen zu sehen wünscht, aber wenn Sie sich an gewisse Regeln halten …»
Sie betraten einen sehr engen Korridor, an dessen Ende die Metalltüren eines Aufzugs zu sehen waren.
«Was heißt ‹ungewöhnlich›, Mr.Russell?»
Der Assistent hüstelte verlegen. «Nun, Sie sollten wissen: Mit Ausnahme der leitenden Angestellten unseres Unternehmens sind Sie in den drei Jahren, die ich für Mr.Kayn tätig bin, erst der vierte Mensch, den er zu einem persönlichen Gespräch trifft.»
Orville war so baff, dass ihm ein greller Pfiff entfuhr.
Sie erreichten einen Aufzug, für den es keine Ruftaste gab, sondern nur eine Tastatur an der Wand.
«Mr.Watson, wären Sie so freundlich, sich kurz umzudrehen?»
Der junge Kalifornier gehorchte. Aus der schier endlosen Folge von Pieptönen schloss er, dass der Assistent einen Nummerncode eingab.
«Danke, jetzt können Sie wieder hersehen.»
Die Aufzugtür öffnete sich, und die beiden Männer traten ein. Auch in der Kabine gab es keine Knöpfe, nur einen Magnetkartenschlitz. Russell holte eine Plastikkarte aus seiner Tasche und zog sie durch den Schlitz. Die Türen schlossen sich wieder, und der Aufzug setzte sich sanft in Bewegung.
«Ihr Chef scheint großen Wert auf Sicherheit zu legen», bemerkte Watson.
«Mr.Kayn hat schon mehrmals Morddrohungen erhalten. Vor ein paar Jahren wurde sogar ein Attentat auf ihn verübt, das er glücklicherweise unverletzt überlebte. Bitte lassen Sie sich von der Wolke nicht irritieren. Das ist eine reine Routinemaßnahme.»
Watson fragte sich gerade, was zum Teufel Russell mit «Wolke» meinen mochte, da wurde aus der Decke eine Myriade winziger Tropfen gesprüht. Beide Männer wurden in frischen Dunst gehüllt.
«Hören Sie mal, was ist denn das?» Watson blickte auf und sah, dass sich im oberen Teil des Aufzugs mehrere Zerstäuber befanden.
«Nur ein leichtes Antibiotikum-Spray, gesundheitlich völlig unbedenklich. Gefällt Ihnen der Duft?»
Scheiße, der Typ lässt seine Besucher desinfizieren, damit sie ihn nicht mit irgendwas anstecken können. Korrigiere: Der Bursche ist kein Einsiedler, der ist paranoid.
«Minze?»
«Eine Essenz aus Wildminze. Das erfrischt.»
Watson biss sich auf die Lippen, um nicht auszusprechen, was er davon hielt. Er zwang sich vielmehr, an die siebenstellige Summe zu denken, die er einstreichen würde, wenn er diesen goldenen Käfig wieder verließ. Das munterte ihn ein wenig auf.
Der Aufzug öffnete sich und gab den Blick frei auf einen lichtdurchfluteten Raum. Stockwerk Nummer39 war zur Hälfte ein riesiger verglaster Balkon, der auf den Hudson River hinausging. Dahinter erstreckte sich Hoboken, im Südosten Ellis Island.
«Ich bin beeindruckt.»
«Mein Chef erinnert sich gerne daran, wo er herkommt. Bitte folgen Sie mir.»
Die schlichte Ausstattung stand im krassen Gegensatz zu der imposanten Aussicht. Der Bodenbelag und die wenigen Möbelstücke waren weiß. Die zweite Hälfte des Stockwerks zeigte nach Manhattan und war durch eine ebenfalls weiß gestrichene Wand von dem verglasten Balkon abgetrennt. In der Wand befanden sich mehrere Türen. Russell blieb einige Meter vor einer davon stehen.
«Gut, Mr.Watson, Mr.Kayn wird Sie jetzt empfangen. Aber bevor Sie eintreten, möchte ich Sie noch auf ein paar einfache Verhaltensregeln aufmerksam machen. Erstens, sehen Sie ihn nicht direkt an. Zweitens, stellen Sie keine Fragen. Und drittens, versuchen Sie nicht, ihn zu berühren oder sich ihm auf andere Art zu nähern. Wenn Sie das Besprechungszimmer betreten, finden Sie auf einem Tisch eine Kopie Ihres Dossiers und eine Fernbedienung. Damit können Sie die PowerPoint-Präsentation steuern, die uns heute aus Ihrem Büro zugeschickt wurde. Bleiben Sie in der Nähe des Tisches. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie. Ich werde hier draußen auf Sie warten. Haben Sie alles verstanden?»
Watson nickte ein wenig nervös. «Ich werde mein Bestes tun.»
«Dann viel Erfolg», sagte Russell und hielt ihm die Tür auf.
Der junge Kalifornier blieb kurz stehen, bevor er über die Schwelle trat. «Ach, nur eines noch. GlobalInfo ist bei einer Routinerecherche im Auftrag des FBI auf etwas Interessantes gestoßen. Es gibt Hinweise darauf, dass Kayn Industries das Ziel islamistischer Anschläge werden könnte. Steht alles in diesem Bericht hier», sagte Watson und hielt dem Assistenten eine DVD hin. «Nehmen Sie das als freundschaftliche Geste unsererseits.»
«Vielen Dank, Mr.Watson», erwiderte der Assistent und nahm den Datenträger mit besorgter Miene entgegen. «Und nun alles Gute.»
Hotel le Meridien
Amman, Jordanien
MITTWOCH, 5. JULI 2006, 18:11 UHR
Tahir Ibn Faris verließ sein Büro im Wirtschaftsministerium später als gewohnt. Das lag nicht etwa an seinem vorbildlichen Arbeitsfleiß, sondern daran, dass er sich vor indiskreten Blicken schützen wollte. Er brauchte weniger als zwei Minuten, um sein Ziel zu erreichen. Anstatt wie sonst zur Bushaltestelle zu gehen, marschierte er in das luxuriöse Le Meridien, das beste Fünf-Sterne-Hotel von ganz Jordanien. Dort waren die beiden Gentlemen abgestiegen, die durch Vermittlung eines bekannten Unternehmers aus der Hauptstadt einen Termin mit ihm vereinbart hatten. Leider stand besagter Unternehmer nicht in dem Ruf, besonders saubere oder transparente Geschäfte zu machen. Tahir war sich also durchaus bewusst, dass hinter der Einladung auch zweifelhafte Motive stecken konnten.
In seinen dreiundzwanzig Jahren im Ministerium war er immer stolz auf seine absolute Ehrlichkeit gewesen, dennoch wünschte er sich allmählich etwas weniger Stolz und etwas mehr finanziellen Spielraum. Die anstehende Hochzeit seiner ältesten Tochter und die astronomisch hohen Kosten, die mit der Feier einhergehen würden, spielten dabei eine zentrale Rolle.
Auf dem Weg in eine der Executive Suites musterte sich Tahir neben dem Sicherheitsmann im Spiegel des Aufzugs. Er war kaum einen Meter siebzig groß. Der Bauchansatz, der graumelierte Bart und die beginnende Glatze ließen mehr an einen sympathischen Trinker denken als an einen bestechlichen Beamten. Tahir wollte jede Spur von Unbestechlichkeit aus seinem Erscheinungsbild tilgen.
Eines hatte er in über zwei Jahrzehnten des Anstands allerdings nicht lernen können: wie man unbefangen in eine solche Situation geht. Während der Beamte an die Tür zur Suite klopfte, schlotterten ihm noch immer die Knie. Schließlich gelang es ihm, sich vor dem Eintreten ein wenig zu beruhigen.
Ein gutgekleideter Amerikaner um die fünfzig begrüßte ihn freundlich und stellte sich als Mr.Fallon vor. Im geräumigen Wohnbereich wartete ein zweiter, jüngerer Mann; er saß rauchend da und telefonierte mit seinem Handy. Als er Tahir sah, beendete er sein Gespräch und erhob sich, um ihn ebenfalls willkommen zu heißen.
«Ahlan wa sahlan – herzlich willkommen», sagte er in tadellosem Arabisch.
Tahir war perplex. Ihm waren häufig Bestechungsgelder angeboten worden, damit er den Bebauungsplan für Grundstücke in Amman im Hinblick auf eine gewerbliche Nutzung änderte – für seine weniger skrupulösen Kollegen eine wahre Goldgrube. Doch wenn Tahir das immer abgelehnt hatte, so war das nicht nur aus Pflichtgefühl und Ehrbarkeit geschehen. Ihn störte einfach die beleidigende Arroganz der Westler, die drei Minuten nach dem ersten Händedruck ein Bündel Dollar auf den Tisch warfen.
Das Gespräch mit diesen beiden Amerikanern sollte völlig anders verlaufen. Vor Tahirs ungläubigen Augen setzte sich der Ältere an einen niedrigen Tisch, auf dem ein kleines Kohlenfeuer sowie vier dallahs, die Kaffeekannen der Beduinen, standen. Mit geübter Hand röstete er in einer gusseisernen Pfanne frische Kaffeebohnen und ließ sie abkühlen. Dann mahlte er den frischgerösteten Kaffee zusammen mit einigen reiferen Bohnen im mahbash, einem kleinen Mörser. Das nun folgende, banale Gespräch wurde nur unterbrochen vom rhythmischen Klopfen des Stößels. Dieser Klang gilt den Arabern als Musik, und der Gast ist angehalten, ihm mit feinsinnigem Entzücken zu lauschen.
Der Amerikaner fügte eine Handvoll Kardamomsamen und eine winzige Prise Safran hinzu und brühte den Kaffee auf, wobei er die Regeln der uralten Tradition bis ins kleinste Detail befolgte. Dem Gastgeber obliegt es, der bedeutendsten Person unter den Anwesenden zuerst einzuschenken. Tahir hielt höflich die henkellose Tasse hoch, während der Amerikaner sie bis zur Hälfte füllte, und schluckte das Gebräu dann mit einer gewissen Skepsis herunter. Mehr als eine Tasse beabsichtigte er nicht zu sich zu nehmen, schließlich war es schon spät. Doch nachdem er den Kaffee probiert hatte, trank er hocherfreut vier weitere Tassen. Und er hätte sich auch noch Tasse Nummer sechs gegönnt, wenn es nicht gegen die Regeln der Höflichkeit verstoßen würde, eine gerade Zahl von Getränken zu sich zu nehmen.
«Mr.Fallon, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ein Mann, der im Land von Starbucks geboren wurde, das gahwa-Ritual derart meisterhaft ausführen kann», sagte Tahir, der sich in der Gesellschaft der beiden Männer mittlerweile ausgesprochen wohlfühlte – auch wenn er immer noch nicht erfahren hatte, was zum Henker die Amerikaner eigentlich von ihm wollten.
Der jüngere der beiden Gastgeber hielt ihm zum wiederholten Mal ein goldenes Zigarettenetui hin.
«Mein lieber Tahir, verzichten Sie doch bitte auf unsere Nachnamen. Ich bin Peter, und mein Kollege heißt Frank. Das genügt völlig», sagte er und steckte ihm dabei eine weitere Dunhill an.
«Danke, Peter.»
«Gut, Tahir. Würden Sie es jetzt, da wir uns etwas ausgeruht haben, sehr taktlos finden, wenn ich zum geschäftlichen Teil überginge?»
Tahir staunte. Fast zwei Stunden waren bereits verstrichen, und da bat ihn der Amerikaner jetzt immer noch höflich um Erlaubnis. Für einen so wohlerzogenen Menschen hätte er selbst den Bebauungsplan für König Abdullahs Palast geändert.
«Aber woher denn, mein Freund.»
«Sehr schön. Es geht also um Folgendes: Wir benötigen eine Lizenz zum Abbau von Phosphaten für die Kayn Mining Co., mit einem Jahr Gültigkeit ab heute.»
«Das wird nicht einfach, mein Freund. Nahezu die ganze Küste des Toten Meeres ist in der Hand der einheimischen Industrie. Sie wissen ja, Phosphate und Tourismus sind heutzutage unsere Haupteinnahmequellen.»
«Ach, das ist kein Problem, Tahir. Uns geht es gar nicht um einen Standort am Toten Meer. Wir brauchen nur ein kleines Areal mit folgenden Koordinaten als Mittelpunkt.» Er hielt ihm einen Zettel hin.
«29˚, 34' 44" N, 36˚, 21' 24" O? Meine Freunde, das kann nicht Ihr Ernst sein. Das liegt ja nordöstlich von Al Mudawwara.»
«Ja, das Gebiet umfasst zehntausend Quadratmeilen unweit der saudiarabischen Grenze. Das wissen wir schon, Tahir.»
Der Jordanier sah die beiden Männer verwirrt an. «Aber da gibt es keine Phosphate. Das ist Wüste. Dort gibt es nur wertloses Gestein.»
«Wissen Sie, Tahir, wir haben großes Vertrauen in unsere Ingenieure, und die sind zuversichtlich, in dieser Gegend eine bedeutende Menge Phosphate abbauen zu können. Selbstverständlich würde dabei auch eine kleine Entschädigung für Sie herausspringen. Als Zeichen unserer Freundschaft.»
Tahir riss die Augen sperrangelweit auf, als der Amerikaner einen offenen Aktenkoffer vor ihn auf den Tisch stellte. «Aber das sind doch bestimmt über …»
«Genug, um die Hochzeit der kleinen Myiesha zu bezahlen, nicht wahr?»
Und dazu ein Häuschen am Strand, mit standesgemäßem Auto samt Garage, dachte Tahir.Zum Teufel, diese Amerikaner halten sich für ganz besonders schlau, die träumen davon, in der kargen Wüste auf Bodenschätze zu stoßen. Als hätten wir das nicht selbst schon tausendundeinmal überprüft. Na, ich werde nicht derjenige sein, der ihnen ihre Illusionen raubt.
«Meine Freunde, zweifellos sind Sie beide Männer von großer Integrität und Bildung. Ich bin sicher, dass Ihre geschäftlichen Aktivitäten im haschemitischen Königreich Jordanien mehr als willkommen sein werden.»
Trotz des süßlichen Lächelns seiner Gastgeber zerbrach Tahir sich noch lange den Kopf. Was zum Henker suchen die Amerikaner in der Wüste?
Doch sosehr er darüber nachgrübelte, er kam nicht annähernd an die Wahrheit heran, die ihn wenige Tage später das Leben kosten sollte.
Hauptsitz von Kayn Industries
New York
MITTWOCH, 5. JULI 2006, 11:29 UHR
Watson fand sich im Halbdunkel eines Konferenzraums wieder. Nur eine kleine Tischlampe beleuchtete das Pult, auf dem er sein Dossier liegen sah, daneben die angekündigte Fernbedienung. Er ging die drei Meter bis dorthin. Noch während er das Gerät inspizierte, ließ ihn ein plötzliches Aufleuchten zurückzucken. Zwei Meter von seinem Standort entfernt hatte sich ein sechs Meter breiter Großbildschirm eingeschaltet, darauf war die erste Seite seiner Präsentation mit dem roten Logo von GlobalInfo zu sehen.
«Äh, vielen Dank, Mr.Kayn, und guten Tag. Gestatten Sie mir, dass ich als Erstes sage, welch eine Ehre es für mich –»
Ein leiser Pfeifton ertönte, dann erschien auf dem Bildschirm eine neue Seite mit dem Titel der Präsentation und in riesigen Lettern die erste der beiden Fragen:
WER IST PATER ANTHONY FOWLER?
Offenbar hatte Mr.Kayn gern alles unter Kontrolle und mochte es lieber kurz. Er verfügte über eine zweite Fernbedienung und würde nicht zögern, sie einzusetzen, um den Bericht zu beschleunigen.
Also gut, alter Mann, ich hab’s verstanden. Dann also zur Sache.
Watson drückte auf den Knopf, um die nächste Seite aufzurufen. Das folgende Bild zeigte einen Priester mit einem schmalen, markanten Gesicht. Er hatte eine Halbglatze und trug sein schütteres Haar kurz geschoren. Watson begann, in die Dunkelheit zu sprechen.
«John Anthony Fowler, alias Pater Anthony Fowler, alias Tony Brent. Geboren am 16. Dezember 1951 in Boston, Massachusetts. Augenfarbe grün, Körpergewicht: 79 Kilogramm. Freier Mitarbeiter der CIA und ansonsten ein Rätsel. Die Antwort auf die Frage nach seiner Identität hat mich zwei Monate Arbeit gekostet. Zehn meiner besten Recherche-Mitarbeiter haben exklusiv an dieser Sache gearbeitet, und wir haben Unsummen ausgegeben, um gewisse Informationsquellen anzapfen zu können. So erklären sich auch die drei Millionen Dollar, die dieser Bericht Sie gekostet hat, Mr.Kayn.»
Das Bild wechselte wieder, und es erschien jetzt ein Familienfoto. Ein elegant gekleidetes Ehepaar im Garten einer Luxusvilla, daneben ein hübscher, etwa elfjähriger Junge mit dunklen Haaren. Die Hand des Vaters lag schwer auf seiner Schulter. Alle drei lächelten angespannt.
«Anthony Fowler ist der einzige Sohn des Unternehmers Marcus Abernathy Fowler, Chef von Infinity Pharma, einer Firma, die heute ein millionenschweres Biotech-Unternehmen ist. Fowler hat es 1984, als seine Eltern bei einem nie ganz geklärten Autounfall ums Leben kamen, für achtzig Millionen Dollar verkauft, zusammen mit dem Rest seines Erbes. Nur das Elternhaus in Beacon Hill hat er behalten. Es ist jetzt an ein Ehepaar mit Kindern vermietet, aber das oberste Stockwerk gehört weiter ihm. Er hat sich dort eine Wohnung mit ein paar Möbeln und einer umfangreichen Bibliothek eingerichtet. Dort wohnt er, wenn er gelegentlich nach Boston kommt.»
Das Foto der jungen Frau in einer Universitätsrobe füllte nun den Bildschirm.
«Daphne Brent war eine recht talentierte Chemikerin, die für Infinity Pharma arbeitete, bis der Firmenchef ein Auge auf sie warf und die beiden heirateten. Als Daphne schwanger wurde, verdonnerte Marcus Fowler sie über Nacht zum Hausfrauendasein. Mehr ist über John Anthony Fowlers Verhältnis zu seiner Familie nicht bekannt, bis auf die Tatsache, dass er zum Studium nach Stanford ging und nicht wie sein Vater am Boston College studierte.»
Das nächste Bild zeigte den jungen Anthony, fast noch als Teenager, über ihm ein Banner mit dem Schriftzug «Jahrgang 1971». Sein Gesichtsausdruck war ausgesprochen ernst.
«Mit zwanzig schloss er sein Psychologiestudium mit summa cum laude ab. Das Foto wurde einen Monat vor Ende des letzten Studienjahres aufgenommen. Am letzten Tag packte Anthony seine Sachen und meldete sich bei der Rekrutierungsstelle auf dem Campus freiwillig zum Militärdienst. Er wollte nach Vietnam.»
Als Nächstes war ein abgegriffenes, vergilbtes Prüfungsformular zu sehen, handschriftlich ausgefüllt.
«Das ist ein Abzug seines Eignungstests bei der Musterung. Fowler erzielte 98 von 100 Punkten. Der Ausbilder war so beeindruckt, dass er ihn unverzüglich zum Luftwaffenstützpunkt Lackland nach Texas schickte, wo Fowler eine Ausbildung zum Fallschirmspringer absolvierte, genauer gesagt bei einer Spezialeinheit zur Evakuierung von Piloten, die hinter den feindlichen Linien abstürzen. Dort lernte er Hubschrauber fliegen und wurde in Guerillataktiken ausgebildet. Nach anderthalb Jahren an der Front kam Fowler im Rang eines Leutnants aus dem Krieg zurück, dekoriert mit dem Purple Heart und einem Air Force Cross. In unserem schriftlichen Bericht finden Sie die Leistungen aufgeführt, für die er diese Auszeichnungen erhielt.»