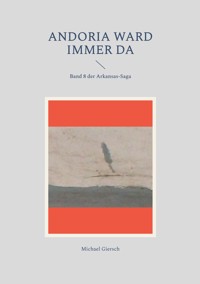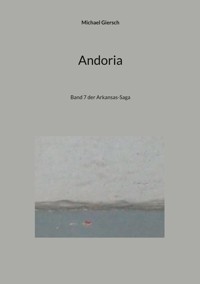Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eines Tages stolpert Arlinda Kandy Saskya Zacharias, genannt Arkansas über Leichen, wohin sie blickt. In ihrer Stadt und auch im ganzen Land sterben die Menschen wie die Fliegen. Aber nicht die Tiere, die bleiben seltsamerweise verschont. Und auch sie wird nicht von dieser Krankheit dahingerafft. Warum? Sie macht sich auf die Suche nach Menschen, die das Chaos vielleicht überlebt haben, und wird auch fündig. Aber sie stellt schnell fest, dass nicht alle Überlebenden ihr wohlgesonnen sind. Besonders eine Gruppe Neonazis ist ihr gar nicht koscher ... ›Weltuntergang mal (etwas) lustig‹ (Willimann)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sicher ist, dass nichts sicher ist, selbst das nicht.
(Joachim Ringelnatz)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Nachrichten
19.10. Freitag
Arkansas
Harry
Lilly
Lady D
Wilhelm Tetzlaff
Goebbels
Rechtsmedizin
Der Boss
Duisburg
Jenny
Kapitel II
Arge Nachrichten
23.10. Dienstag
Viola
Anna
Kapitel III
Letzte Nachrichten
(Jäger und Sammler)
24.10. Mittwoch
Folgen
Strubbel
Gefangen
Die Verhandlung
Kapitel I
Nachrichten
19.10. Freitag
Sie lag im feinen Sand, sie weinte, aber nicht wegen der Schmach, sondern wegen dieser fürchterlichen Schmerzen. Wieder drang einer in sie ein, der Schmerz explodierte in ihrem Unterleib. War es der dritte, oder der vierte? Sie wusste es nicht. Schreie drangen an ihr Ohr, ihr Traumprinz wurde gnadenlos zusammengeschlagen. Der Mann hinter ihr zuckte zusammen und machte Platz für den nächsten Schänder. Sie schaute auf und sah in das Gesicht ihres Peinigers, der ihr eine Maschinenpistole an den Kopf hielt. Das brutale Gesicht mit den rattengrauen Augen würde sie niemals vergessen. Der Peiniger übergab die Maschinenpistole einem anderen Mann und strich mit einer fahrigen Handbewegung über seine Glatze. Dann stellte er sich hinter die Frau. Wieder loderte der Schmerz in ihrem Unterleib auf. Neben ihr explodierte eine Maschinenpistolensalve, sie schaute nach rechts. Ihr Traumprinz lag mit zerschmettertem Kopf im Sand, sie hatten ihn hingerichtet. Der Häscher hinter ihr zuckte kurz, dann trat er vor sie, nahm seinem Kumpane die Maschinenpistole aus der Hand und richtete sie auf ihren Kopf. Sie sah Blut von seinem Schwanz abtropfen und blickte auf. Der Glatzkopf grinste sie wölfisch an und zog den Abzug der Waffe durch.
Schweißgebadet und schreiend erwachte sie. Ihre kleinen Hände in das zerwühlte Laken gekrallt, schlug sie schwer keuchend die Augen auf. Die junge Frau warf einen Blick auf ihren Funkwecker. Dieser scheußliche Albtraum verfolgte sie schon seit über drei Monaten. Und er wirkte real! Die blinkenden roten Zahlen zeigten 6:44 Uhr. Um neun Uhr begann ihre Schicht. Leise stöhnend schraubte sie ihre sehnigen Beine aus dem Bett. Dann schüttelte sie sich, um den Alb aus ihrem Kopf zu verscheuchen.
Nackt – sie schlief stets nackt – taumelte sie ins Bad und stellte sich unter die Dusche. Sie ließ zuerst eiskaltes Wasser über ihren sportlichen, bronzefarbenen Körper rauschen, bis Nadelstiche ihren Kopf malträtierten. Die kalten Wasserstrahlen vertrieben die lähmende Müdigkeit.
Die Frau stellte das Thermostat wärmer, trat zur Seite und schäumte sich mit einem Duschgel ein. Unentwegt musste sie an den Albtraum denken. »Kann mir mal jemand erklären, was der Traum soll?«, fragte sie die lindgrünen Fliesen. Doch die Fliesen hatten leider keine Antwort parat. Sie stellte sich erneut unter den Wasserstrahl und spülte den Schaum ab.
Das Seltsame an diesem Traum war, dass alle Beteiligten, außer der Glatzkopf mit den rattengrauen Augen und der unbekannte Traumprinz keine Gesichter hatten. Die anderen acht oder neun Beteiligten waren gesichtslos.
Sie stellte sich vor den Kristallspiegel, schlug ein grünes Handtuch aus kontrolliert angebauter Baumwolle um ihre schmalen Schultern und nahm ihre elektrische Zahnbürste zur Hand. Sie quetschte Zahnpasta aus der Tube auf die Zahnbürste. »Scheiß Traum«, nuschelte sie, als sie die Zahnbürste in den Mund steckte.
Nachdem sie sich angekleidet hatte, fütterte sie ihre beiden Wellensittiche. Hernach holte sie die Tageszeitung aus dem Briefkasten. Sie setzte sich an den Küchentisch und schlug das Blatt auf. Gibt ja tolles Wetter heute, dachte sie, als sie einen Blick auf den Wetterbericht warf.
Als der Kaffee durchgelaufen war, goss sie die schwarze Brühe in einen großen schwarzen Porzellanbecher. Dazu aß sie eine Stulle mit Zwiebelschmalz und studierte die Zeitung.
Um Punkt halb neun verließ die junge Frau ihre Wohnung, ging zur U-Bahn und fuhr zu ihrer Arbeitsstelle.
Sie sollte sich noch schwer wundern.
Christoph Kindlers goldenes Chronometer zeigte 7:09 Uhr. Er würde rechtzeitig im Dortmunder Hauptbahnhof ankommen, um noch im Bahnhofscafé ein Häppchen zu essen. Beim nächsten Halt musste er aussteigen und dann noch drei Stationen mit der U-Bahn fahren.
Ihm gegenüber saß ein Mann, der in einer Tageszeitung vertieft war. Der Mann hatte die Zeitung ausgebreitet, er studierte den Innenteil. Christoph sah, wie der Mann den Kopf schüttelte. Die schütteren blonden Haare bewegten sich von links nach rechts, er sah kein Gesicht. Er rückte seine Brille zurecht und schaute auf die erste Seite. Er suchte nach dem Wetterbericht.
Achtzehn bis zwanzig Grad, heiter bis wolkig, niederschlagsfrei, dachte er. Das wird ja ein toller Tag heute.
Die S-Bahn der Linie vier war mit vielen Menschen vollgestopft, sie war scheinbar total überladen. Zum Glück musste Christoph aussteigen, er hasste die Enge in den Zügen. Er hasste die Enge überhaupt! Andauernd wurde er von anderen Menschen berührt, angerempelt oder angetätschelt. Wer weiß, was die mit sich herumtragen! Er nahm seinen silbergrauen (warum sind diese scheiß Koffer eigentlich immer silbern?) Aktenkoffer, der mit Zahlenschlössern gesichert war, und stemmte seine neunzig Kilo in die Höhe. Sofort drängten zwei Leute – eine fette, nach Parfüm stinkende, große Frau und ein dünner, langer Kerl – zu seinem Platz und versperrten den Weg.
Da Christoph ziemlich klein war, musste er zu den Personen aufsehen.
»Aber meine Dame und mein Herr! Bitte lassen Sie mich doch erst einmal aussteigen, dann können Sie sich noch immer um meinen Platz streiten!«, dröhnte seine dunkle Bassstimme, die man ihm bei seiner Größe von einem Meter fünfundsechzig nicht zutraut. Die beiden Menschen sahen ihn erschrocken an und wichen zurück.
Der Zug wurde langsamer und hielt mit kreischenden Bremsen auf Gleis eins der Haltestelle Stadthaus. Als sich die Türen öffneten, drängten sich schon die ersten Personen in den Zug. Aber die Leute, die ausstiegen, drängten sie zurück. Geduldig wartete Christoph, bis die Reihe an ihm war. Endlich betrat er, befreit von der Enge des Zuges, den Bahnsteig.
Heute Morgen war er mindestens schon hundert Mal angefasst oder angerempelt worden, er verabscheute dieses!
Er hasste dies, seit seine Ex-Frau zu trinken begonnen hatte. Wenn sie dann besoffen war, fasste sie ihn mit ihren klammen Fingern an und wollte Sex, welch ein ekliges Gefühl! Ilona hatte zu saufen begonnen, als sie arbeitslos wurde. Kurz darauf ging die Malerfirma, bei der er schon seine Lehrzeit verbracht hatte, pleite. Christoph wurde arbeitslos und damit begann das ganze Dilemma. Seine Frau soff noch heftiger und er magerte vor Kummer und Sorge stetig ab. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit drohte Christoph mit fünfundvierzig Jahren in die Armut – damals noch Hartz-Sieben genannt – abzurutschen. Also beschloss er, sich selbstständig zu machen. Mit den Behörden samt diesen arroganten Beamten hatte er seitdem nichts mehr zu tun.
Christophs Selbstständigkeit bestand aus Hehlen, Schmuggeln, Dealen, Weiterleiten und Kassieren.
Nachdem der Beamte von der Arbeitsagentur (die vor ein paar Jahren wieder in Arbeitsamt umbenannt wurde) ihm mitgeteilt hatte, dass er mit fünfundvierzig nie wieder eine feste Arbeitsstelle bekommen würde, entschloss er sich zum freiberuflichen Handeln.
Christoph hatte es schon damals nicht ganz so genau mit den Gesetzen genommen. Hier mal ein Zimmerchen nebenbei, da mal gegen Nachbarschaftshilfe ein Häuschen gestrichen. Er sah das nicht so eng. Schließlich machten ihm die Politiker dieses doch vor! Hier ein Bestechungsskandal, da Schmiergelder. Dann und wann ein bestochener Minister. Dann darf ich das auch, dachte er sich.
Seitdem ging es Christoph so gut wie noch nie. Er trug Designerklamotten, Designerschuhe, einen Designermantel. Er hatte wieder zugenommen, und er war vor drei Wochen von seiner versoffenen Ilona geschieden worden.
Unterhalt brauchte er nicht zu zahlen, denn er bekam ja noch nicht einmal das mickrige Hartz-Acht-Geld, weil er zweimal eine zumutbare Arbeit abgelehnt hatte. Die erste war eine Stelle als Staplerfahrer bei einer Spedition für sechsfünfzig die Stunde. Brutto, versteht sich – und die zweite war eine Stelle als Maler bei einer Vermittlungsagentur für fünf Euro vierundneunzig die Stunde. Natürlich auch brutto, versteht sich. Die erste Baustelle wäre in der Slowakei gewesen. Anreise auf eigene Kosten, versteht sich!
Heute macht er dreißig bis vierzig, manchmal fünfzig Riesen. Im Monat, natürlich, versteht sich!
Nachdenklich schaute er auf seinen Aktenkoffer, darin war eine Million Euro in bar geparkt.
Echte Blüten. Superblüten. Versteht sich ja von selbst.
Eine Million Euro erstklassiges Falschgeld, von echtem so gut wie nicht zu unterscheiden. Dies ergab eine Provision von satten sechzig Riesen, in bar und netto. »Nächsten Monat mache ich frei und reise für vier oder sechs Wochen in die Karibik«, murmelte er in seinen imaginären Bart.
Christoph tauchte in den U-Bahnhof ein und wurde schon wieder angerempelt. Er verabscheute das! »Tschuldigung«, murmelte ein dicker Mann mit (rotem!) Hut, der in einer Blödzeitung vertieft war. Er betrat die (auf diesem Gleis fuhr jede Bahn über den Hauptbahnhof) nächstbeste U-Bahn in Richtung Hauptbahnhof, die hoffnungslos überfüllt war und fürchterlich nach Schweiß und Parfüm stank. Er quetschte sich als Letzter in den Waggon. Während der Fahrt wurde er permanent angerempelt und mit der Nase gegen die Scheibe der Tür gedrückt. Seine Designerbrille kratzte über das Glas. Er sah in seinem Spiegelbild, dass jemand einen Arm auf seine aschblonden Haare gelegt hatte. Er versuchte diesen Arm abschütteln. Aber es ging nicht, es war zu eng!
Zum wiederholten Mal verfluchte er den Augenblick, als er den Strafbefehl per Einschreiben bekommen hatte. Zwei Monate Fahrverbot, nur weil er in einer Tempo-30-Zone mit vierundneunzig Sachen gefahren war. Er fand es lächerlich. Der Staatsanwalt offenbar nicht, denn in dem Strafbefehl stand, dass diese Geschichte dreimal in einem Monat passiert wäre. Da Christoph kein Theater mit der Justiz haben wollte, hatte er keinen Widerspruch eingelegt. Außerdem war die Führerscheinsperre in vierzehn Tagen abgelaufen, das war so ziemlich seine letzte Fahrt mit Bus und Bahn.
Endlich kam Christoph am Hauptbahnhof an. Erleichtert flüchtete er aus der engen U-Bahn, ein nicht nachlassender Strom von Menschen folgte ihm. Er fuhr die Rolltreppe hinauf und achtete peinlichst darauf, dass ihn niemand berührt.
Sofort links neben der Rolltreppe befand sich ein Stehcafé. Christoph ging an die Theke und bestellte bei einer missmutigen jungen Frau, die sicher fünf Euro dreiundzwanzig – brutto, versteht sich – verdient, einen großen Kaffee und zwei belegte Brötchen mit Käse. Lustlos schob die Frau ihm einen Teller mit den Brötchen und einen Plastikbecher mit Kaffee über die Theke. Er bezahlte und ging an einen der runden Tische, die vor dem Café standen. Der Kaffee war lauwarm, der Käse stank nach Bahnhof, und die Brötchen waren weich wie die Gummipuppe, die er sich nach seiner Scheidung zum Vögeln zugelegt hatte.
Christoph aß die Käsebrötchen, spülte mit dem lauwarmen Kaffee nach und beobachtete die Leute. Als er fertig war, ging er in Richtung Nordausgang zum Gleis zehn, von dem der ICE nach Berlin-Ostbahnhof in zwanzig Minuten abfahren sollte. Seit etwa zehn Minuten war ihm seltsam warm, seine Kehle fühlte sich trocken an, regelrecht verdorrt. Er lockerte seine Hunderteurokrawatte und schob dieses Phänomen auf die vergammelten (die wahrscheinlich voller Keime waren) Brötchen. Er ging zum nächsten Kiosk, erwarb eine Flasche Mineralwasser, trank einen großen Schluck und steckte sie in seine linke Manteltasche. Bei dieser Gelegenheit tastete er in der Manteltasche nach seiner Fahrkarte, die er im Internet erworben hatte. Natürlich fuhr er Erste Klasse. Die Karte war noch vorhanden, niemand hatte sie geklaut.
Erneut wurde er von verschiedenen Leuten angerempelt, kein Arsch entschuldigte sich. Das hatten diese Wichser offenbar nicht nötig!
Sechzehn Minuten später saß Christoph Kindler im ICE nach Berlin-Ostbahnhof und fuhr seinem Verderben entgegen.
Der grüne Benz fuhr in die Parkbucht vor einem Café. Der etwa vierzigjährige Fahrer drehte den Zündschlüssel, der Motor erstarb. Der Mann löste den Sicherheitsgurt und legte den Stadtplan – in dem er mit einem Kugelschreiber einen Kreis um den Zielort gezeichnet hatte – in das Handschuhfach zurück. Er zog den Schlüssel ab, schraubte seine sportlichen achtzig Kilo aus dem Auto, warf die Tür zu und verschloss den Wagen.
Er hatte ein richtiges Auto, welches man noch abschließen konnte. Sein Wagen hatte auch keine Klimaanlage oder anderen technischen Firlefanz, wie etwa elektrische Scheibenheber und dergleichen Unsinn. Dies benötigte der Mann nicht. Hauptsache, die Karre brachte ihn von A nach B.
In der kleinen Seitenstraße war es erstaunlich ruhig, der Mann hörte wenig von dem lauten Großstadtrummel. Auch der Abgasgestank war einigermaßen erträglich. Rechts und links neben seinem Wagen standen zwei große Eichen, auf denen sich drei oder vier Amseln zwitschernd unterhielten – oder vielleicht stritten. Die ersten Blätter der Bäume hatten einen bräunlichen Farbton angenommen. Der Mann stützte sich mit beiden Armen an eine der Eichen und vollzog ein paar Dehnungsübungen, das tat nach dieser langen Fahrt gut. Er schwitzte ein wenig, für Ende Oktober war es noch sehr warm. Vom wolkenlosen Himmel strahlte die Sonne, kein Lüftchen wehte. Er nahm seine Sonnenbrille aus der Brusttasche seines Hemdes und setzte sie auf die Nase. Dann schaute er auf seine Uhr. Punkt 12. Da kann ich ja noch einen Kaffee trinken und ein Häppchen essen, der Treffpunkt ist hier ganz in der Nähe, dachte er und ging auf das Café zu.
Die Tür des Cafés stand auf. Der Mann betrat das gut gefüllte Lokal und war im ersten Augenblick blind. Er nahm die Sonnenbrille ab und steckte sie zurück in die Brusttasche. Die typische Atmosphäre dieser Gaststätten nahm ihn auf: Leises Klirren von Glas oder Tassen, das Scheppern von Tellern aus der Küche; irgendwo rauschte Wasser in ein Spülbecken. Gedämpfte Unterhaltungen der Gäste; dunkelbraune Grasfasertapeten, die vor Jahren vielleicht einmal heller gewesen waren. Umherhuschende Angestellte; die typischen kleinen runden Tische mit zwei oder drei Stühlen davor; kleine Lampen mit Stoffschirmen, die von der dunklen Decke hingen. Sie spendeten fahles, gelbes Licht. Und dann der Duft von Kaffee und Kuchen, er zog durch das Café und nötigte die Gäste, länger zu verweilen.
Der Mann schaute sich nach einem freien Platz um, es gab nur einen freien Tisch in der hintersten Ecke direkt am Fenster, mit Blick auf die Straße. Er schritt direkt auf den Tisch zu. Als er ihn erreicht hatte, zog er seine Sportjacke aus und hängte sie über die Rückenlehne des bequem aussehenden Stuhls. Dann setzte er sich und wartete auf einen Kellner oder Ober.
Gestern Morgen hatte er eine Nachricht bekommen, ein neuer Klient. Also hatte er sich heute früh in seinen Benz gesetzt und war von Norddeutschland hinunter ins Rheinland gefahren. Er zog den Zettel mit der entsprechenden Notiz aus der rechten Hosentasche seiner Jeans und sah ihn noch einmal an. Das hättest du dir auch merken können, oder schlägt Vatter Alzheimer schon zu?, dachte er und steckte den Zettel wieder weg.
Eine etwa dreißigjährige, hübsche, üppige Brünette mit einer ebenso üppigen Löwenmähne kam an seinen Tisch getrippelt. »Guten Tag, was darf ich Ihnen anbieten?«, lächelte sie und entblößte ein strahlendes, privat versichertes Gebiss.
»Guten Tag, ich möchte einen Kaffee ohne Milch und Zucker, ein Kännchen bitte ...«, er überlegte eine Sekunde, »... und einen großen gemischten Salat mit viel Peperoni und Oliven. Das Dressing bitte nur mit Essig und Öl.«
Ohne ein Wort zu sagen, drehte die Brünette sich um und tippelte auf ihren High Heels davon.
Der Mann sah gedankenverloren durch die Butzenscheibe auf die Straße. Die Menschen wieselten hektisch über den Gehweg und über die Straßen, hin und her, kreuz und quer, wie in einem Ameisenhaufen. Er schüttelte den Kopf.
Keine fünf Minuten später kehrte die Brünette mit seiner Bestellung zurück. Sie nahm das Kännchen und eine kleine Tasse von einem silbernen Tablett und stellte den Kaffee auf den Tisch, der Salat und eine kleine Gabel folgten. »Bitte schön. Guten Appetit. Darf ich sonst noch etwas für Sie tun?«
»Nein danke. Kann ich schon mal zahlen?«
Die Kellnerin zauberte einen Quittungsblock aus ihrer weißen Schürzentasche und schrieb mit einem kleinen Bleistift die Rechnung. »Das macht dann neun Euro fünfzig.« Sie legte die Quittung auf den kleinen Tisch. Der Mann holte einen zerknitterten Zehneuroschein aus seiner linken Hosentasche. Er hätte den Schein am liebsten in ihren üppigen Ausschnitt gesteckt. Aber er ließ es bleiben. Stattdessen legte er das Geld auf das Tablett. »Der Rest ist für Sie!«
»Danke schön, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.« Die hübsche Brünette deutete einen Knicks an und ging mit wackelndem Gesäß davon. Er schaute ihr hinterher, bis sie in der Küche verschwunden war.
Er entdeckte eine Blödzeitung, die auf dem Nachbarstuhl lag. Er nahm sie auf und schaute auf die erste Seite. Die Zeitung war die von heute, die roten und schwarzen Schlagzeilen schrien ihn an. Dieter Pohlen hat einen Furz quer sitzen, wen interessiert das überhaupt? Dachte er und drehte die Zeitung um, eine kleine Randnotiz auf der letzten Seite sprang ihm ins Auge. Dieses Jahr keine Grippewelle! Nach Ansicht der Blöd-Experten bla, bla, bla ... »Na denn«, sagte er, legte das Blatt an die Seite, schenkte Kaffee in die kleine Tasse und begann seinen Salat zu essen. Der schmeckt aber lecker, da hat sich das Girl aber viel Mühe gegeben, dachte er. Zwischendurch trank er einen Schluck Kaffee und beobachtete die Menschen, die hektisch hinter der gelben Butzenscheibe wie die Ameisen vorbeiwieselten.
Als er den Salat gegessen hatte, schaute er auf seine Uhr. Viertel vor, ich muss mich so langsam auf den Weg machen. Er stand auf, trank noch einen letzten Schluck Kaffee, zog seine Jacke über und verließ das Café. Die Quittung ließ er auf dem Tisch liegen.
Die warme Oktobersonne blendete ihn, er nahm die Sonnenbrille wieder aus der Hemdtasche und setzte sie auf seine krumme Nase. Die Krümmung der Nase war ein Andenken an eine lange zurückliegende Kneipenschlägerei. Er schritt schnurstracks auf sein grünes Fahrzeug zu.
Mann, o Mann, dachte er, die Sonne brutzelt ja ganz schön. Mir wird ganz schwindelig. Die Straße vor ihm war mit einem Mal ein bisschen verschwommen. Als er sein Fahrzeug erreichte, lehnte er sich gegen die Fahrertür und atmete tief durch. Doch sein Zustand wurde eher noch schlimmer. Das Karussell nahm Fahrt auf. Einsteigen und Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt! Er schloss die Augen. Weiße, schwarze und rote Blitze schossen wie bei einem Gewitter durch seinen Kopf. Er öffnete die Augen wieder. Die wenigen Fahrzeuge, die vorbeifuhren, dehnten und streckten sich wie Gummiautos. Sie schienen erst länger, dann kürzer zu werden. Und sie wuchsen gleichzeitig in den Himmel. Dem Mann brach der Schweiß aus.
Nicht nur die Fahrzeuge bestanden aus Gummi, sondern auch der graue Asphalt, auf dem er stand. Dieser zog sich auseinander und wieder zusammen, wobei er sich auch nach oben ausdehnte, um dann wieder in sich zusammenzusacken. Seine Schuhe versanken im Treibsand – dies war das Letzte, was er wahrnahm. Er brach zusammen wie ein nasser Zwiebelsack. Dass ihn kräftige Affenarme auffingen, bemerkte er nicht mehr.
Arkansas
Ihre Beine trommelten auf dem Asphalt, es war nicht mehr weit. Arkansas biss die Zähne zusammen und rannte wie noch nie in ihrem Leben! Keuchend schaute sie über ihre Schulter, um nach ihrem Verfolger Ausschau zu halten. Ihre halblangen Rastalocken flogen im Takt ihrer kurzen, schnellen Schritte wie kleine schwarze Schlangen hin und her. Er kam stetig näher! Fuck, das schaffst du nie, dachte sie. Ihr Verfolger holte ständig auf. Kein Wunder, er war mindestens so durchtrainiert wie sie. Wenn der mich einholt, dann habe ich verloren! Sie war fast am Ende, Seitenstiche kündigten sich an. Ihre Leistungsgrenze war beinahe erreicht. Die Haustür schien sie höhnisch anzugrinsen und gleichzeitig wegzulaufen. Nur noch fünfzig Meter, dachte sie. Sie erreichte die Wiese vor dem Haus, auf welcher die Kinder im Sommer Fußball spielen. Ihr Häscher war schon zu nah, er musste sie gleich erreicht haben. Sie drehte abermals den Kopf, um nach ihrem Verfolger Ausschau zu halten. Fuck, er hat mich gleich, dachte sie panisch.
Dann war der Jäger heran – und rannte an ihr vorbei!
Jochen, Arks Joggingpartner hatte sie doch noch eingeholt. Mit einem letzten Endspurt erreichte er die Haustür.
»Erster!«, rief er triumphierend.
»Fuck!«, rief Arkansas.
Endlich vor der Haustür angekommen, schnaufte sie wie die Pfeife eines Wasserkessels. Sie stützte sich mit beiden Händen an die Hauswand und vollzog Dehn- und Atemübungen. Sie war durchtrainiert wie eine Spitzensportlerin, dementsprechend beruhigte sich ihr Herzschlag sehr schnell. Jochen schien sich nicht sonderlich angestrengt zu haben.
»Du wirst immer besser. Ist nur ’ne Frage der Zeit, bis du mich schlägst. Du schuldest mir ein Abendessen bei Giovanni«, sagte Jochen. Er war wohl doch etwas außer Puste, denn auch er vollzog Dehn- und Atemübungen.
»Muss ich wohl, du frisst mir noch die Haare vom Kopf«, lachte Ark, »es wird Zeit, dass ich einmal gewinne!«
Arkansas verlor grundsätzlich gegen Jochen, aber das Rennen wurde stetig knapper. Kein Wunder, er war Marathonläufer und das sah man ihm auch an. Er war etwa einssiebzig groß und drahtig wie ein Hühnerkäfig. Er verfügte über eine Ausdauer wie ein Pferd. Manche seiner Bekannten nannten ihn deshalb gelegentlich Baumann, in Anlehnung eines ehemaligen Mittelstreckenläufers.
»Morgen früh um zwölf?«, fragte er.
»Natürlich. Aber denk dran, morgen gewinne ich«, antwortete Ark.
»Also dann, bis morgen«, sagte Jochen und trabte weiter.
Ark ahnte an diesem Nachmittag noch nicht, dass sie ihn vorerst nicht wiedersehen würde. Oder vielleicht auch niemals.
Sie kramte den Schlüssel aus ihrer Jogginghose, schloss die Haustür auf und betrat den Hausflur. Sie wohnte in einem Vierfamilienhaus zur Miete, sehr günstig. Diese typischen Mietshäuser einer großen Wohnungsbaugesellschaft. Graue Rauputzfassaden mit weißen Kunststofffenstern. Die Haustür bestand ebenfalls aus Kunststoff, scheinbar das Lieblingsmaterial der Gesellschaft. Das Dach war neulich neu gedeckt worden, es leuchtete jetzt rot wie Pumuckls Kopf. Nächstes Jahr würden die Fassaden renoviert werden, hatte der Bauführer ihr mitgeteilt. Sie ging die Terrazzostufen zum Erdgeschoss hoch, ihr Nachbar Willi Tetzlaff kam ihr entgegen. »Guten Tag, Frau Zacharias, schon fertig mit dem Joggen?«, fragte der ältere Herr.
Arkansas schaute in seine (seltsame, das linke nussbraun, das rechte mausgrau) Augen. »Ja. Es war wieder verdammt hart, ich bin gerannt wie eine Irre. Ich vermute, dass ich einen neuen Rekord über die zehn Kilometer gelaufen bin. Ich bin total fertig!«
Tetzlaff schüttelte den Kopf. »Wenn Sie mal in mein Alter kommen, dann werden Sie sich ein bisschen die Ruhe antun. Das Gerenne macht meine Pumpe nicht mehr mit.«
Willi Tetzlaff zählte schon über sechzig Lenze, aber er war noch sehr rüstig. Ark mochte ihn sehr, er war ein dufter Kumpel, befand sie. Eigentlich stets gut gelaunt, trotz seiner Arbeitslosigkeit. Und er war sehr hilfsbereit: War etwas zu erledigen, war er sofort zur Stelle, um zu helfen.
Ark wohnte unten links, Tetzlaff gegenüber. »Na denn, tschüss auch, Herr Tetzlaff«, sagte sie. Aber er war schon auf dem Weg in den Keller. Sie zuckte mit den Schultern, schloss die Wohnungstür auf und trat ein. Sie betrat die kleine Diele, in der es nach Wand- und Deckenfarbe roch. Sie hatte gestern die Diele gestrichen, nach vier Jahren war es mal wieder nötig. Die Raufasertapeten hatten sich schon ein wenig verfärbt. Decke und Wände weißeln – das war am einfachsten. Die Abdeckfolie lag noch auf dem schwarzen Teppich. Sie zog ihre Laufschuhe aus und stellte sie zum Ausmiefen in den Hausflur.
Hernach ging sie in die kleine Küche, die sie als Nächstes streichen musste. Natürlich auch ganz in Weiß, passend zu den schwarzen Möbeln und dem grünen Teppich. Sie fand das jedenfalls passend. Stan und Ollie begrüßten sie stürmisch.
Stan und Ollie, ihre beiden Wellensittiche, die den ganzen Tag zwitscherten und trällerten. Zum Glück nicht des Nachts. Sie ging an den Käfig, öffnete die Tür und sagte zu den beiden: »Auf in die Freiheit, Kameraden!« Die beiden Vögel quittierten ihre wiedergewonnene Freiheit mit einem fröhlichen Pfeifkonzert. Anschließend flogen sie eine Patrouille durch ihre kleine Wohnung. Sie lachte wieder, warf ihre Joggingklamotten in eine Ecke, ging ins Bad, zog sich BH, Slip und Socken vom Körper und sprang unter die Dusche.
Arkansas Zacharias, geboren in Waukegan, Wisconsin, einer Kleinstadt am Lake Michigan. Ihr Vater war schwarzer Amerikaner und ihre Mutter Deutsche. Arks Vorname lautete natürlich nicht Arkansas, sondern Arlinda Kandy Saskya. Ihre Eltern, die vor vier Jahren bei einem Autounfall in Bochum verunglückt waren, hatten ihr damals diesen ungewöhnlichen Namen gegeben. Was den Kindergärtnerinnen, sowie den Lehrern zu kompliziert war. Die Erzieherinnen bildeten aus Ar, Kan, und Sas Arkansas. Seit ihrer frühen Kindheit rief sie jeder nur Arkansas, noch Faulere einfach nur Ark. Schon zwei Jahre nach ihrer Geburt waren ihre Eltern mit der kleinen Ark nach Deutschland gezogen. So lebte sie seit zweiundzwanzig Jahren in Dortmund.
Nach dem Duschen stellte Arkansas sich, wie jeden Tag, auf die Waage. Die altmodische Waage, die sie vor zehn Jahren von ihrer Oma geschenkt bekommen (halte sie in Ehren, Kandy, sie lügt, hatte ihre Grandma damals gesagt) hatte, zeigte fünfundfünfzig Kilo an. Oma rief Ark stets Kandy. Warum, das wusste nur Oma selbst. Oder vielleicht auch nicht.
Ark lebte allein in ihrer Fünfzig-Quadratmeter-Wohnung. Nach dem Tod ihrer Eltern war sie hierher gezogen. Mit Männern hatte sie so ihre Probleme, sie kam mit dem Geschlecht nicht so richtig klar. Sie hatte schon ein paar Freunde gehabt, aber der richtige Märchenprinz war noch nicht dabei gewesen. Niemand versteht mich, pflegt sie stets zu sagen. Einer von diesen Männern hatte sie einmal bei einem kleineren Disput Negerschlampe genannt.
Mit Ark Streit zu bekommen war nicht schwer, sie ließ sich nicht gern etwas gefallen. Vor allem, wenn es um ihre Hautfarbe ging. Oder, wenn schwache Menschen, die sich nicht wehren können, unterdrückt werden.
Sie fackelte ehedem nicht lange und trat ihm in die Eier. Als er anschließend Klappmesser machte, konnte sie es sich nicht verkneifen, zu testen, ob eine Bierflasche oder Jimmys Kopf härter waren. Die Flasche hatte verloren. Auf eine Anzeige hatte Jimmy selbstredend verzichtet. Seit diesem Zwischenfall hatte sie ihn nie wiedergesehen.
Arkansas ging in die Küche, schaltete das Radio ein, füllte Kaffeepulver und Wasser für vier Tassen in die Kaffeemaschine und betätigte den ON-Schalter. Anschließend bereitete sie sich ein Sandwich mit Salat und Harzerkäse. Sie klaubte ein Nachrichtenmagazin vom Tisch und schlug es auf.
Stan und Ollie kehrten von ihrem Rundflug zurück und landeten auf dem Käfig. Sie stand auf, füllte frisches Wasser und Futter in die Näpfe und setzte sich zurück an den Tisch. Im Radio erzählte ein Typ, dass sein angepriesenes Bier das beste Bier auf der Welt sei. Werbung. Sie schaute auf die schwarze Mickey-Mouse-Uhr, welche sie über der Tür installiert hatte. Die roten Zeiger zeigten 16:58 Uhr, noch zwei Minuten bis zu den Nachrichten.
Inzwischen war der Kaffee durchgelaufen, das Verwöhnaroma zog durch die Küche. Sie schenkte die braune Brühe in ihren großen schwarzen Becher. Auf Milch und Zucker verzichtete sie, sie trank ihren Kaffee stets schwarz. Die Nachrichten begangen. Sie setzte sich wieder, trank einen Schluck und biss in das Sandwich. Der Nachrichtensprecher berichtete gerade von den Arbeitslosenzahlen, sie hörte nicht so genau hin. Sie hatte mit dem Kaffee, dem Sandwich und dem Magazin genug zu schaffen. Außerdem musste sie aufpassen, dass Ollie ihr nicht wieder auf die Schulter schiss, das tat er sehr gern. Stan tat es hingegen nie. Seltsam. Als wenn Ollie sie ärgern wolle. Grinste er nicht auch dabei? Vielleicht sogar ein unverschämtes Grinsen?
Der Radiosprecher sagte gerade: Die diesjährige Grippewelle wird wohl milder ausfallen. Wie das Bundesgesundheitsministerium heute mitteilte, wird es diesen Winter nur sehr geringfügige ...
Das Telefon klingelte. Arkansas schaute kurz auf und langte rüber zum schwarzen Beistelltisch, auf dem das Telefon stand, und hob ab. »Ark?« Da sie ein Stück Brötchen im Mund hatte, hörte es sich an wie Arrcchk. Zumindest so ähnlich. Sie schickte den Bissen mit einem Schlucken in die Verdauungstrakte.
»Hey Ark, ich bin’s! Bist du für heute Abend gut gerüstet? Mich juckt’s schon wie verrückt in den Fingern.«
Lilly plapperte am anderen Ende der Strippe, ihre dünne Piepstimme war unverkennbar. Eigentlich hieß Lilly Juliane, was sie aber gar nicht gern hören mochte. Lilly, Ark und Jenny, eine andere gute Freundin von Ark, spielten (fast) jeden Freitag um achtzehn Uhr einen zünftigen Skat. Dabei ging es dann (fast) immer ganz schön feuchtfröhlich zu.
»Klar Lilly, wo soll’s denn diesmal losgehen?«
»Ich glaube, diese Woche bin ich mal wieder dran, ich habe Jenny schon Bescheid gesagt. Bier ist reichlich hier und die Stullen werde ich gleich schmieren. Außerdem ist heute Freitag der dreizehnte. Ha, ha, ha.«
»Heute ist zwar nicht der dreizehnte, aber Freitag ist richtig. Wir haben heute den neunzehnten.«
»War ein Scherz, Mann. Wie sieht’s aus? In einer Stunde bei mir?«
»Klar, ich bin dabei, morgen früh hab ich frei«, reimte Ark. Sie war als Krankenschwester bei einer großen Dortmunder Klinik beschäftigt.
»Ich habe im Radio vernommen, dass es dieses Jahr keine Schnutzteufelswild geben wird. Was sagst du dazu, als Schnutzteufelswildexpertin?«, fragte Lilly. Sie nannte die Grippe stets Schnutzteufelswild, weil diese bei ihr immer wieder fürchterlich zuschlug.
»Die da oben erzählen viel, wenn der Tag lang ist, das sage ich dir. Gerade du kannst ja ein Lied davon singen, du krepierst ja fast jedes Jahr an Schnuteuwi«, erwiderte Arkansas. »Denk mal an letztes Jahr, da hast du sogar bei mir auf der Station gelegen.«
»Ohne deine fürsorgliche Pflege wäre ich über den Jordan gegangen. Ich glaube, das war die wildeste Schnuteuwi, die ich jemals hatte. Ich glaube, ich werde morgen früh in die Apo gehen und schon mal ein bisschen Nizidem holen, sozusagen als Prophylaxe.« Lil nannte Medizin stets Nizidem, eine ihrer Wortspielereien.
»Wenn du morgen schon gehen kannst, Schätzchen. Außerdem nützt das gar nix, eine Impfung reicht vollkommen. Bist du denn schon geimpft?«
»Klar, gegen alle Viren, die es im Universum gibt. So etwas wie letztes Jahr überlebe ich nicht noch einmal, das ist so sicher wie die Bohne im Kaffee.«
»Übrigens, was hat du denn für ein Bier am Start?«, fragte Kandy.
»Plopp!«
»Super, Schätzchen, dann kann das ja richtig abgehen. Du bist die beste Lil auf der Welt.«
»Ich habe dabei nur an dich und Jen gedacht, ihr trinkt das Gesöff doch so gern. Ach was: Ihr sauft es!«
»Du etwa nicht?«
»Na klar, watt Besseres gibt’s gar nicht. Also bis nachher.« Lilly legte auf, bevor Ark etwas erwidern konnte.
Sie nahm ihren Kaffeebecher und ihr Sandwich und ging ins Wohnzimmer, welches mit dem Mobiliar aus der Diele vollgestellt war. »Nach der Küche bist du dran«, sagte sie zu den grauen Wänden, die sie wie die Decke wieder weiß streichen wollte. Die Bilder, welche eigentlich die Wände zierten, hatte sie schon abgenommen und – wie das andere Mobiliar – vor den kleinen schwarzen Schrank gestellt. Auch einen neuen grünen Teppich beabsichtigte sie zu kaufen. Sie warf eine Live-CD von Deep Purple in den CD-Player, legte sich in die bequeme grüne Hängematte und bereitete sich mental auf den schwierigen Abend vor. Stan und Ollie kamen im Sturzflug angeflogen und landeten auf ihrem Bauch. Highway Star begann.
Harry
Harry kam vom Bäcker, bei dem er sechs Brötchen (zwei Mohn, zwei Roggen, zwei Kümmel) erstanden hatte. Mr. Postman stand schon vor seiner Haustür. Harry schaute auf seine Uhr, die ihm 8:30 Uhr zeigte. Der kommt auch immer früher, dachte er.
Mr. Postman wollte seine Post gerade in den Briefkasten stecken, als er ihn kommen sah. »Guten Morgen, Herr Schindler, dann brauche ich ja nicht ...« Mr. Postman drückte ihm einen dicken Stapel Umschläge in die Hand.
»Moin, Moin«, sagte Harry.
»Haben wir es nicht einen wundervollen Oktober? Das nenne ich wirklich einen Goldenen! So könnte der ganze Herbst und von mir aus auch noch der Winter bleiben«, schwärmte der Postbote wie eine Diva im Negligé.
Harry erwiderte nichts.
»Also dann, ich muss weiter. Bis Montag, schönen Samstag noch.« Der Postmann drehte sich um, stieg in sein gelbes Auto und verschwand. »Ja tschüss«, murmelte Harry, nahm die Tageszeitung aus dem Briefkasten, klemmte die Brötchentüte unter den Arm, schloss die Tür auf und betrat sein Haus.
Und stolperte prompt über eine Handkreissäge (die hatte er vollkommen vergessen) die auf dem grauen Flurteppich lag.
Er hatte vor, seine Flurdecke mit Holz zu verkleiden, musste aber gestern mangels Lust abbrechen. Jetzt lagen allerlei Werkzeuge – Hammer, Sägen, Zollstock, Nägel und Bleistifte – auf dem Boden herum.
Aus dem Gleichgewicht gekommen, musste Harry die Arme ausbreiten und einen Ausfallschritt machen. Er stolperte über ein Bund Latten, die Tüte knallte auf seinen rechten Oberschenkel und platzte auf. Er konnte sich soeben noch an dem Sägebock, vor dem die Latten lagen, abstützen. Dadurch flog seine Zeitung durch die Gegend. Gleichzeitig verteilten sich die Brötchen zwischen den Paneelbrettern, die an der rechten Wand gestapelt waren. Er flog wie ein Torpedo auf dem Bauch in die Küche. »Scheiße!« rief er, rieb sich den Kopf, mit dem er die Tür aufgestoßen hatte, und stand auf. Er ging zurück in den Flur und sammelte seine Brötchen und die Zeitung – die noch immer fein säuberlich gefaltet war – wieder auf. Das kann auch nur dir passieren, dachte er.
Er betrat die Küche, warf die Post auf einen Stuhl, ging zur Kaffeemaschine, die er schon vor seinem Gang zum Bäcker angestellt hatte, und goss Kaffee in einen großen Becher. Der Duft der braunen Bohnen zog durch seine Nase.
Er warf einen Blick auf die Zeitung. Hat Oberbürgermeister Leder eine Millionensumme veruntreut? Stand in dicken schwarzen Lettern auf der ersten Seite fixiert. In letzter Zeit gab es mehr Skandale als alles andere in der Politik. Das ist ja schlimmer als in einer Bananenrepublik, dachte er, drehte die Zeitung um und schaute auf den Wetterbericht. Achtzehn bis zwanzig Grad, heiter bis wolkig, niederschlagsfrei. Das ist ja ein Wetter wie im Sommer, dachte er und nippte an seinem Kaffee. Er setzte sich an den Küchentisch, stellte den Becher ab und begann seine Tageszeitung zu studieren.
Harry wohnte in einem kleinen Haus in Hamm, das ihm seine reichen Eltern vor vier Jahren geschenkt hatten. Seine Eltern hatten Kohle wie Dreck, sein Vadder (er nannte seinen Vater stets Vadder) war Immobilienmakler. Also jemand, der andere Leute bescheißt. Darüber hinaus schacherte er so ziemlich mit allem, was nicht niet- und nagelfest war. Muddern war von Beruf Geldausgeberin: das Geld, welches Vaddern hereinholte.
Harry machte sich nicht viel aus Geld, er zog es vor, von seinen Eltern unabhängig zu leben. Er lebte sein eigenes Leben und er war ganz zufrieden. Vaddern oder Muddern wollten ihm gelegentlich mal einen kleinen Obolus zustecken – für die beiden war ein kleiner Obolus tausend oder noch mehr Euro – aber er lehnte immer dankend ab. Den Bungalow hatte er allerdings allerliebst angenommen.
Finanziell ging es Harry auch ohne seine Eltern recht gut. Er war bei der Stadt als Müllkutscher beschäftigt und saß am Steuer des Mülltrucks. Was bei seiner stattlichen Körpergröße von einem Meter fünfundneunzig nicht immer ganz einfach war. Aber angesichts von offiziell über fünf Millionen Arbeitslosen war er froh, überhaupt arbeiten zu dürfen.
Leider war Harry mit seinen neunundsiebzig Kilo viel zu leicht. Damals in der Schule hatten die anderen Schüler ihn deshalb stets langer Schlacks gerufen. Er konnte das Essen schubkarrenweise in sich hineinschaufeln, er nahm nicht ein Gramm zu. Sein Stoffwechsel sei auf Turbo, hatte ihm sein Hausarzt einmal gesagt. In der Tat war er stets etwas unter Strom, eben so ein richtig langer Schlacks, dem auch schon mal etwas aus den Händen fiel. Oder irgendetwas in seiner Umgebung kippte einfach um, wenn er dagegen stieß. Aber wenn er auf seinem Truck saß, dann war er die Ruhe selbst.
Und beim Zeitunglesen.
Das Telefon störte seine Lesefreude, es stand direkt neben ihm auf dem Küchentisch. Nach dem vierten Läuten hob er ab.
»Ja?«
»Haaarrraaald, ich bin es, deine geliebte Mutter!«, kreischte es aus seinem sprechenden Knochen. Der Hörer sah tatsächlich wie ein Knochen aus, nur war er nicht elfenbeinfarben, sondern schwarz.
Ich hab’s geahnt, dachte er und hielt den Knochen etwas weiter von seinem Ohr entfernt. Muddern schrie ständig ins Telefon, als wenn er taub wäre.
»Ich habe von deinem Pech mit Angelika gehört, dass ihr euch getrennt habt. Dieses muss ja eine schreckliche Sache für dich gewesen sein, brauchst du etwas Geld?«
Typisch Muddern, alles wird mit Geld geregelt. »Muddern«, sagte er, »ich weiß nicht, wer dir das wieder geflüstert hat, aber Angelika und ich haben uns vorerst, nicht endgültig getrennt. Vielleicht renkt sich das ja wieder ein. Ich brauche kein Geld, Muddern. Ich werde auch nicht verhungern oder in der Gosse landen, falls du das denkst. Nichts wird so heiß gegessen, wie’s gekocht wird!«
»Aber Haaarrraaald ...« Muddern zog Harrys Name stets so lang wie einen ICE, mit einem rollenden R in der Mitte. »... ich fürchte, das überlebst du nicht! Sie ist doch so eine nette, gebildete und hübsche Frau, das sagt sogar dein Vater!« Harry wusste, dass an dem nicht so war, denn Vaddern hielt sich weitgehend aus seinen Angelegenheiten heraus.
Plötzlich wechselte Muddern das Thema, sie war für ihre schnellen Themenwechsel bekannt. Das Wechseln der Themen schien offensichtlich Mode unter den reichen Säcken zu sein.
»Du kommst doch nächsten Dienstag zu meinem Geburtstag? Ich werde eine nette Party geben. Lauter nette Leute. Tante Isolde hast du bestimmt schon fünf Jahre nicht gesehen. Und zieh dir bitte einen Schmoooking an!«
Harry liebte diese Veranstaltungen. Junge, bist du aber groß geworden. Aber so düüün. Klara, gibst du deinem Jungen nicht genug zu essen? Mach ihm doch mal eine Hüüühnersuppe! Als wenn er mit seinen achtundzwanzig Jahren noch gefüttert werden müsste.
Oder: Karl, ist dein Junge denn schon in deiner Firma beschäftigt? Ich hoffe doch, in einer gehobenen Position!
»Bei aller Liebe, Muddern. Du weißt doch, in so eine scheiß Jacke bekommst du mich nicht rein. Das habe ich dir schon tausend Mal gesagt. Ich bleibe lieber bei meiner Jeans und bei meinem Sweatshirt, die anderen Klamotten sind mir zu spießig. Aber ich komme, darauf kannst du dich verlassen. Aber wenn du auf einen Smoking, und womöglich auch noch auf Lackschuhe bestehst, dann werde ich meinen Arsch nicht nach Dortmund bewegen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche überflüssig ist.«
Muddern, jetzt etwas leiser: »Na gut, Haaarrraaald, dann eben ohne. Aber zieh dir wenigstens Schuuuhe an. Und bitte, bitte ein Jackett. Tschüss, bis dann!«
»Ich habe kein ...«
Klara unterbrach die Verbindung, bevor Harry ausreden konnte. Offenbar war sie sauer. Oder der Schmuckhändler war gekommen ... äh ... erschienen.
Er legte auf und bereitete sich ein kräftiges Frühstück. Die Brötchen belegte er mit Honig und allerlei Sorten Wurst und Käse. Dazu verzehrte er reichlich Peperoni, Schafskäse und Oliven. Dazu trank er einen halben Liter Milch (drei Komma fünf Prozent Fett) und zwei Kannen schwarzen Kaffee. Beim Frühstücken vertiefte er sich immer wieder in seine Zeitung.
Daraufhin ging er ins Wohnzimmer zu seiner Anlage, warf eine CD von Motörhead ein, drehte die Lautstärke auf die mittlere Stufe und ging ins Bad. Lemmy Kilmister begann, mit seiner Tausend-Liter-Whiskey-Stimme zu grölen: You look like the ghost of Cinderella ... Unter der Dusche sang Harry aus vollem Hals mit.
Als er fertig war, ging er die Treppe zum Schlafzimmer hinauf und zog seine blaue Jeans an. Lemmy und er sangen weiter um die Wette. Er streifte sich ein T-Shirt über, darüber einen Sweater mit Lemmys Konterfei, schlüpfte in seine schwarzen Schlappen, setzte seinen schwarzen Stetson auf den Kopf und verließ den Bungalow. Die Musik ließ er laufen.
Er schwang sich auf sein Fahrrad und fuhr zum Trimm-dich-Pfad.
Die Morgenluft war noch ziemlich kühl, aber der strahlend blaue Himmel versprach einen schönen Tag. Es herrschte völlige Windstille.
Er fuhr etwa hundert Meter, dann endete die Sackgasse, in welcher er wohnt. Er musste links abbiegen, auf dieser breiteren Straße war natürlich mehr Verkehr und es war für Radfahrer viel gefährlicher. Mächtig viele Vehikel waren unterwegs. Nach fünfhundert Metern verließ er die Straße, indem er links abbog. Schellingstraße, las er auf dem blauen Verkehrsschild. Auf dieser schmaleren Straße war wieder weniger Verkehr und es ging leicht bergab. Er ließ das Fahrrad rollen, nach einem weiteren halben Kilometer gelangte er an eine Kreuzung. Er hielt an, ließ ein paar Autos und einen Trecker vorbei und schaute noch einmal nach links und rechts. Freie Bahn! Er stieg wieder in die Pedale, überquerte die Vorfahrtsstraße und rollte in eine verkehrsberuhigte Zone. Es ging noch immer leicht bergab, er ließ das Rad gemütlich rollen. Das Fahrrad rollte auf eine Bundesstraße, die er überqueren musste, zu. Das schaffte er nach längerem Warten, wenigstens war hier ein Radweg. Er legte einen – sehr lahmen – Zwischenspurt ein und bog die nächste rechts ab. Am Pilsholz, las er. Jetzt war es nicht mehr weit. Diese Straße war eine Sackgasse, die abrupt endete, indem sie von einer Bahnschiene gekreuzt wurde. Er stieg ab und schob das Rad durch die rot-weiß gepinselten Umlaufsperren.
Warum heißen die Dinger eigentlich Umlaufsperren, dachte er, das kann doch nur Amtsdeutsch sein. Warum heißen sie nicht einfach nur rot-weiße Stangen?
Bis zu der Holzbank, die er seine Bank nannte, weil er zum Ausruhen stets diese eine Bank benutzte, war es nicht mehr weit.
Am Quäl-dich-Pfad angekommen, lehnte er sein Fahrrad an eine Eiche. Er wollte sich gerade auf seine Bank setzen, als diese vor seinen Augen verschwamm. Sie wurde einen Moment lang regelrecht durchsichtig. Auch die Luft roch mit einem Mal seltsam, nach Wasser oder nach See. Aber nach einer Sekunde war wieder alles vorbei.
Er zuckte mit den Schultern und schob das Phänomen auf die Sonne und seine seltenen sportlichen Aktivitäten. Er setzte sich, drehte eine Zigarette, zündete sie an und wartete. Erste Blätter fielen von den Bäumen, das Blatt einer Birke segelte auf seinem Schoß. Er nahm es in die Hand und betrachtete es nachdenklich. Eine Gruppe Jogger kam den Weg entlanggehechelt. Er sah kurz auf, warf das Blatt beiseite und dachte: Sport ist Mord. Sein einziger Sport bestand aus (aber nicht besonders oft) Fahrradfahren.
Es dauerte nicht lange, bis Doris (die von allen nur Ditz genannt wurde) um die Ecke geradelt kam. Harry kannte Ditz seit ihrer gemeinsamen Grundschulzeit, sie waren immer gute Kumpels gewesen.
»Moin Harry, altes Haus. Alles Banane? Hasse gehört, dieses Jahr gibt’s keine Grippewelle!«, rief Ditz, als sie ihr Fahrrad abgestellt hatte.
»Moin Ditz. Alles klar bei mir, bei dir auch? Wie laufen die Geschäfte?«
Die beiden klatschten ab, Ditz setzte sich neben Harry auf die Bank.
Eine weitere Gruppe Jogger lief vorbei. Sie keuchten, stöhnten und schwitzten um die Wette.
»Bestens! Zehn Gramm, wie immer? Ich biete dir heute einen Sonderpreis, weil das Wetter so schön ist. Sechs Euro das Gramm, was hältst du davon? Leben und leben lassen«, sagte Doris.
Ditz war Harrys Stamm-Dealerin, sie hat ihn noch nie beschissen. Sie hat stets sehr gutes Dope zu fairen Preisen, dafür war sie in der Szene bekannt.
»Sechs Teuro ist ein sehr guter Preis, da kann man beileibe nicht meckern«, erwiderte er.
Ditz zog das Dope aus der vorderen rechten Tasche ihrer ausgebleichten Jeans und übergab es Harry. Der übergab Ditz (die das Geld in die linke vordere Tasche ihrer Jeans steckte) sechzig Euro. Das Ritual war jeden Monat dasselbe. Harry reichten zehn Gramm im Monat, er zog sich nur ab und zu mal einen durch.
Ein Opa mit einem schwarzen Rauhaardackel (der humpelte) kam vorbei und warf den beiden einen strafenden Blick zu.
»So könnte der ganze Herbst und von mir aus auch der Winter bleiben, was meinst du?«, fragte Ditz, nachdem der Dackelopa weitergegangen war. Hernach blinzelte sie in die Sonne. »Dann laufen die Geschäfte bestens.«
Harry sah sie von der Seite her an. Ditz erwiderte den Blick, ihre blauen Augen sprühten. Sie war ein hübsches Mädchen von achtundzwanzig Jahren mit einem strahlenden Lächeln und immer guter Laune, was vielleicht auch mit dem Dope zusammenhing. Harry fragte sich, ob sie jemals irgendeine legale Arbeit angenommen hatte.
»Übrigens: Was macht die Vögelei?«, fragte Ditz. Sie war immer ziemlich direkt.
Harry zog tief an seiner handgedrehten Zigarette. »Angelika und ich haben uns vorerst getrennt, in letzter Zeit lief es nicht so gut. Aber vielleicht kommt das ja wieder in Ordnung, mal sehen.«
»Naja, so ist das Leben, Kumpel. Das wird schon wieder. Alter, ich muss mich wieder vom Acker machen. Du weißt doch, ich hab’s andauernd mächtig eilig. Mach’s gut, alter Schwede. Bis nächsten Monat!«
Ditz schwang sich auf ihr Fahrrad und verschwand wie der Wind.
»Jau, tschüss, mach es gut, man sieht sich!«, rief Harry ihr hinterher. Aber Ditz war schon um die Ecke geflitzt. Wahrscheinlich hatte sie seine letzten Worte nicht einmal mehr vernommen.
Harry ahnte nicht, dass er Doris nie wiedersehen würde.
Er rauchte seine Zigarette auf, trat sie sorgfältig (wegen der Waldbrandgefahr) auf dem Waldboden aus, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr nach Hause. Der lange Berg, den er vorhin lässig hinuntergerollt war, erwies sich jetzt als fast unüberwindliches Hindernis. Er zog es vor, sein Rad zu schieben.
Zivilfahnderin Simone Strawulla saß auf einer Holzbank im Park und wartete. Sie hatte die Aufgabe, den Trimm-dich-Pfad zu observieren.
In letzter Zeit hatte die Dealerei in diesem Park explosionsartig zugenommen, befand ihr Vorgesetzter, Konrad Sylvester.
Dieses Arschloch! Simone konnte den Kerl nicht leiden. Er nahm sich immer so furchtbar wichtig. Als wenn ohne ihn die Welt untergehen würde.
Die paar Gramm, die in diesem Park verkauft wurden, das waren doch Peanuts! Aber Simone musste laut Befehl Informationen sammeln. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Dealerin und ihre Kunden hopsgenommen würden. Die Kleinen werden gefangen, die Großen lässt man laufen, dachte Simone. Wie immer und überall!
Zehn Gramm hier, zehn Gramm da, da kommt im Laufe der Zeit so einiges zusammen, sagt ihr Chef (das Arschloch) ständig.
Simones Problem bestand darin, dass sie selbst ab und an etwas bei dieser Dealerin kauft. Sie nahm sich vor, Ditz einen unauffälligen Tipp zu geben.
Keine besonderen Vorkommnisse, Chef, hörte sie sich nach ihrer Schicht zu Sylvester sagen.
Der Kunde erschien. Er schob sein Rad durch die Umlaufsperre, stellte es an eine Eiche, setzte sich und – ward verschwunden.
Einfach weg!
Plopp!
Simone erhob sich und rieb mit ihrer rechten Hand ungläubig über ihre Augen. Das konnte doch nicht sein, eben war der Mann doch noch da! Und dann – weg, einfach in Luft aufgelöst! Das war sicherlich eine Fata Morgana oder sie war kurz eingenickt und hatte sich beim Aufwachen verguckt. Kein Wunder, das schöne Herbstwetter machte Simone schläfrig. Außerdem hatte letzte Nacht ihr Freund Bruno bei ihr übernachtet. Sie hatten fast die ganze Nacht gevögelt. Diese Potenzpillen sind aber auch der Hammer. Sie wartete noch fünf Minuten, gleich musste Ditz erscheinen. Sie erschien aber nicht.
Simone wartete noch zwanzig Minuten, Ditz erschien noch immer nicht. Sie nahm sich vor, dieses seltsame Phänomen ihrem Chef gegenüber nicht zu erwähnen. Sonst würde Konrad Sylvester sie noch in die Klapsmühle stecken. Keine besonderen Vorkommnisse, Chef!
Sie verließ den Trimm-dich-Pfad nach weiteren fünf Minuten.
Lilly
Lilly schob den Stock an ihre rechte Seite. »Herz Hand!«
»Mit Musik«, sinnierte Jenny.
»Re!«
»Bock!«, schickte Ark hinterher.
Ark lag mit neuntausendfünfhundertzwanzig Punkten genau einen Punkt hinter Lilly. Jenny war mal wieder in Hochform, sie hatte erst achttausend und ein paar kaputte Punkte.
Sie spielten immer, bis eine der Frauen die Zehntausendergrenze überschritten hatte. Oder bis alles Bier in den Kehlen verschollen war.
»Ich sitze hinten«, meinte Ark, »Jenny kommt raus.«
Jenny notierte auf dem Block drei Striche. »Kontra, Re, Bock, alles notiert.«
Sie kam mit dem Pikass raus, Lil bediente mit Pik Dame, Ark warf ihren Pik König auf die Karten. Sie trank einen Schluck Bier und überlegte, wie sie Lilly beim Wickel bekommen konnte.
Jenny schickte sofort die Pik Zehn nach. »Stich oder stirb.«
Lil nahm vorsichtshalber den Kreuz Buben, was sich im Nachhinein als Fehler herausstellen sollte. »Verarschen kann ich mich allein.«
Arkansas überlegte einen Augenblick, dann warf sie die Kreuz Acht ab. Da sprechen wir uns wieder, überlegte sie.
Lilly spielte den Kreuz König vor.
Ark ließ sich nicht veralbern und warf die Kreuz Neun auf den Tisch, Jenny warf die Pik Neun ab.
Lil starrte Ark mit ihren goldenen Augen an und rückte ihre altmodische Hornbrille (die schon wieder neumodisch war) zurecht. Lil war ein bisschen zu dick, um nicht zu sagen, fett. Sie hatte bestimmt fünfzehn Kilo Übergewicht, ganz das Gegenteil von Jenny. Aber sie hatte stets ein strahlendes Lächeln auf ihren Lippen, das nie erlosch. Sie strich mit einer Hand durch ihre blonde Löwenmähne und trank einen Schluck Bier. Ihre kleine Nase zuckte nervös, was sie immer tat, wenn sie etwas trank. Ein Phänomen, das Ark nur bei ihr bestaunen durfte. »Bei dir brütet doch schon wieder was im Hirn.«
Ark grinste sie nur an.
Lilly spielte die Herz Neun vor. »Trumpf, die Kleinen ziehen die Großen!«
Ark warf den Herz König auf den Tisch, Jenny übernahm mit der Herz Zehn. »Damit bist du wieder Mittelhand«, frohlockte sie.
Jenny warf das Karoass auf den Tisch. »Ich hab Kontra gesagt, dann muss ich auch so spielen.« Jenny redete beim Skat immer viel. Ein Umstand, der Ark und Lilly nicht weiter störte. Schließlich spielten sie nicht in einem Skatverein, wo strikte Regeln herrschen.
Lil stach mit ihrem Herzass ein, Ark bediente mit der Karo Sieben.
»Scheiße«, meinte Jenny, »das hätte ich nicht tun dürfen. Tut mir leid, Ark.«
Lil kümmerte sich nicht um das Gerede, sie spielte Herz Acht vor. Arkansas warf ihren letzten Trumpf, den Pik Buben, Jenny bediente mit der Herz Dame.
»Nächste Woche spielen wir aber bei mir«, meinte Ark und schnippelte den Karo König auf den Tisch.
»Na klar!«, sagte Jenny und bediente mit der Karo Acht.
Lil kam ins Grübeln. Und wenn das Kreuzass im Stock liegt? Und wenn ich Kreuz Sieben abwerfe? Dann ist meine Zehn blank? Sie entschied sich für die falsche Variante, sie stach mit der Herz Sieben ein. Aber eigentlich blieb ihr nichts anderes übrig.
Jenny drehte eine Zigarette und zündete sie an.
Ark zog eine Stulle, die mit Schinken belegt war, vom Teller und kaute nachdenklich darauf herum.
Lillys Blick wanderte besorgt zu ihrer Decke. Sie war wie Ark Nichtraucherin. »Wenn ich demnächst meine Küche streichen muss, dann besorgst du mir die Farbe. Du qualmst mir ja die ganze Bude voll!«
»Die habe ich schon längst im Keller stehen. Den Kübel bringe ich beim nächsten Mal mit. Mach weiter, du kommst.«
Lilly machte einen großen Fehler: Sie spielte sie die Kreuz Zehn vor, anstatt mit ihrem Herz Buben den letzten Trumpf herauszuziehen. »Sekt oder Selters!«
»Großer Fehler«, meinte Ark und warf die Kreuz Dame auf den Tisch. Jenny stach mit dem Karo Buben.
»Juhu, das Kreuzass liegt drin, ich gewinne!«, frohlockte Lil.
Jenny grinste nur. Sie wusste so ungefähr, was Ark vorhatte. Sie hatte nur noch Pik Acht und Sieben, sie spielte die Acht vor.
Lil nahm an, dass das Kreuzass in Stock lag und stach mit dem Herz Bauer. »Gewonnen!«
Ark warf ihre Karo Zehn dazu.
Lilly spielte ihre letzte Karte, die Kreuz Sieben vor. »Ihr habt verloren, das Kreuzass liegt bestimmt im Stock!« Ark nahm ihre letzte Karte und legte sie triumphierend auf die Kreuz Sieben. Das Kreuzass. »Vertan, Schätzchen. Karo Dame und Karo Neun liegen im Stock. Wir haben dreiundsechzig Punkte.«
Jenny warf ihre letzte Karte, die Pik Sieben auf den Tisch und trank hernach einen großen Schluck Bier.
Lillys Augen quollen aus ihrem hübschen Gesicht. Auch sie trank einen Schluck des Gerstensaftes. »Du hast das Kreuzass drei Mal besetzt und schnippelst wie ein Weltmeister. Du bist verrückt!«
»Ja, ja so isse«, meinte Jenny und nahm ihren Stift. »Mit einem, gespielt zwei, Hand drei. Verloren sechs. Dann Kontra zwölf, Re vierundzwanzig, Bock achtundvierzig. Das Ganze mal zehn ergibt vierhundertachtzig Punkte! Du hast genau Zehntausendundeins, du hast verloren.«
»Warum spielst du nicht Pik, du Mauerschwester? Schließlich kommst du selber raus!«, schnauzte Lilly Jenny an.
»Mäusken, du hast losgereizt wie die Feuerwehr. Ich dachte, du hast eine Granate auf der Hand«, gab Jenny gelassen zurück.
»Das bekommt ihr nächste Woche wieder.«
Arkansas schaute auf die Wanduhr – die gleiche wie ihre – und gähnte demonstrativ. »Wir haben auch schon Mitternacht und mein Kopf ist schon ganz fludderich.« Zur Bestätigung leerte sie ihre Flasche. »Wird Zeit, dass wir Feierabend machen.«
»Kommt ihr denn nicht mehr mit auf einen Absacker zu Tanja? Das machen wir doch sonst auch immer?«, fragte Lilly erstaunt.
Tanja war der Eigentümerin der Stammkneipe von Lilly, in welche die Skatschwestern nach dem Skatspielen des Öfteren einkehrten.
»Heute nicht«, gähnte auch Jenny, »nächste Woche vielleicht. Heute bin ich zu kaputt.« Sie drückte ihre Kippe in dem übervollen Aschenbecher aus und erhob sich.
Lilly nahm den Ascher, öffnete das Fenster und stellte ihn auf die Fensterbank. »Dann gehe ich eben allein, ihr seid mir ja ein paar Schlappige. Morgen früh habt ihr doch frei.«
»Ich habe morgen Flurwoche, ich gehe nach Hause«, meinte Ark und erhob sich ebenfalls. »Ich rufe dich morgen an.«
»Ich auch.« Jenny ging schon zur Wohnungstür.
»Na gut, dann macht’s gut. Ich gehe noch eine Stunde zu Tanja.« Lilly zog ihre braune Cordjacke vom Haken ihrer Garderobe und streifte sie über. »Vielleicht sind Sven und Michaela da, dann können wir noch eine Runde dreschen.« Sie ging zum Radio, das die ganze Zeit im Hintergrund geplärrt hatte. Und nun die Nachrichten. Sie stellte den Kasten ab. »Dann kann ich auch noch ein paar Pilskes schlürfen.«
Jenny und Ark verabschiedeten sich mit einem Kuss von Lilly und verließen mit leicht schwankendem Gang die Wohnung.
Lilly steckte ihre Haustürschlüssel ein und machte sich auf den Weg zu Tanjas Kneipe, die nur zwei Straßen weiter lag. »Wer nicht will, der hat schon.«
Sie stolzierte in ihr Verderben. Ein Umstand, den sie nicht wissen konnte.
Lady D
TOCK TOCK TOCK. TOCKTOCKTOCK. Der Specht hackte unablässig in seinem Kopf. TOCK. Kleine, bösartige Zwerge bearbeiteten sein Gehirn mit ’nem Abbruchhammer. BRRRRRRRTTT! BRRRRRRRTTT! AUFHÖREEEN! Der Specht und die Zwerge schienen ihre Arbeit nicht unterbrechen zu wollen. Und zwischendurch: TICK ... TICK ... TICK ...
Der Mann versuchte, die Augen zu öffnen. Mann, du solltest nicht soviel saufen, du hast es gestern wieder übertrieben, dachte er. Quatsch, du hast doch gestern gar nicht gesoffen, verbesserte er sich. Seine Augenlider waren schwer wie ein Sack Zement. Das linke öffnete sich langsam, wodurch sich hunderttausend Nadeln in sein Hirn bohrten. Das rechte Auge zog es vor, weiter geschlossen zu bleiben. Er stöhnte auf, sein Kopf schien doppelt so groß und doppelt so schwer geworden zu sein. Und dieser DURST! Seine Zunge klebte an seinem Gaumen wie ein nasser Duschvorhang an einem nackten Bein. Er öffnete vorsichtig auch das rechte Auge, die Stechnadeln ließen langsam nach. Der Specht und die Zwerge scheinen ganz allmählich in die Mittagspause zu gehen. Wo bin ich? Wie bin ich hierhergekommen? Er schloss die Augen wieder und kniff sie ganz fest zusammen. So, wie er es immer tat, wenn er einen über den Durst getrunken hat. Hernach öffnete er sie, so langsam nahmen seine Pupillen ihre normale Sehschärfe an.
Der Mann schaute sich um, er lag auf einer fahrbaren Krankentrage in einem kleinen, öden Zimmer. Leer, bis auf einem kleinen Tisch in der Mitte. Schwarze Betonwände. Auch die Decke, gegen die er schaute, war schwarz getüncht. Die Tür gegenüber der Bahre war dunkelrot gestrichen, der Betonboden hellgrau. Auf dem Tisch standen ein Glas und eine gläserne Karaffe, die mit einer gelblichen Flüssigkeit gefüllt war. Vor dem Tisch stand ein Stuhl. Keine Fenster. Über der Tür hing eine große Wanduhr. Daher das Ticken, dachte er. Die Uhr zeigte 9:32 Uhr. Licht spendete eine flackernde Neonröhre unter der Decke. Der Mann schaute auf die Uhr, er überlegte. Irgendetwas war da doch. Seine Stirn warf Falten, so angestrengt dachte er nach. Plötzlich fiel es ihm wieder ein.
Ich hatte doch einen Termin um dreizehn Uhr. Wenn die Uhr richtig geht, dann habe ich den Termin im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen. Dann ist jetzt Samstag ... scheiß was auf den Termin. Erstmal muss ich wissen, wie ich hier hingekommen bin. Und vor allem: Wie komme ich wieder hier raus?
»Guten Morgen, der Herr. Haben Sie gut geschlafen? Ich hoffe, dass Ihr Kopf nicht allzu sehr brummt. Ihre Entführung war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Ich entschuldige mich schon einmal im Voraus«, holte ihn eine verzerrte Stimme aus seinen Gedanken.
Der Mann erschrak im ersten Augenblick, als er die blecherne Lautsprecherstimme hörte. Er sah an der linken Wand ein Gitter, welches er zuerst für ein Lüftungsgitter gehalten hatte. Das war offenbar ein Lautsprecher, aus dem eine Frauenstimme quakte. Eine Kamera sah er nicht. Aber es musste eine vorhanden sein, schließlich sprach die Stimme ihn direkt an.
Vielleicht ist in der Uhr eine Kamera, überlegte er.
»Auf dem Tisch steht ein wirkungsvolles Gegenmittel und Orangensaft, die Medizin schmeckt etwas bitter. Mein Mitarbeiter wird Sie gleich abholen!«
Der Mann setzte sich auf. Er musste einen Augenblick warten, bis der Schwindel nachließ. Er atmete tief und stoßweise durch. Dann ging er an den weißen Tisch, nahm ein kleines weißes Tütchen ohne Aufdruck und riss es auf. Er schüttete den Inhalt in seinen trockenen Mund und spülte mit dem Orangensaft nach. War doch gar nicht so bitter, da hab ich schon andere Dinge geschmeckt.
Diese Situation gefiel ihm ganz und gar nicht. Er hatte es nicht gern, wie eine Figur auf einem Schachbrett hin-, und hergeschoben zu werden.
Die Tür wurde entriegelt, geöffnet, und ein Mann trat ein. Kein Mann, ein Ungeheuer: Der Koloss war mindestens zwei Meter fünfundzwanzig groß, wog sicherlich hundertdreißig Kilo und war behaart wie ein Affe. Zumindest an den Armen, die der Mann sehen konnte, da der Riese nur ein weißes T-Shirt trug. Auf dem Shirt stand in roter Schrift Mamis Baby. Die langen Affenarme hingen neben der blauen Jeanshose, sie reichten fast bis zu den hochglänzenden schwarzen Schuhen. Auch der Kopf, der ungefähr die Ausmaße eines Basketballs hatte, konnte über einen Mangel an Haaren nicht klagen. Bis auf eine glänzend polierte Glatze schien das Gesicht nur aus Haaren zu bestehen. Ist das noch ein Bart oder ist das schon Fell?, dachte der Mann.
Zwei braune Fledermausäuglein schauten ihn an. Die Ohren waren naturgetreue Genscher-Ohren. Eine Waffe trug der Gorilla nicht. Die brauchte er auch nicht. Mit dem möchte ich auch nicht im Ring stehen, dachte der Mann.
»Wenn Sie mir bitte folgen würden«, sagte eine Stimme wie ein Gewittergrollen. Der Gorilla drehte sich um und ging. Dem Mann blieb nichts anderes übrig, als zu folgen.
Sie gingen durch einen schmalen Gang, der einem Kellergang glich, fahles Neonlicht und eine niedrige Decke. Auch hier waren Decke und Wände aus Beton geschaffen, diesmal aber weiß gestrichen. Der Betonboden war auch in dem Gang hellgrau. Der Riese musste gebückt gehen, damit er nicht mit dem Kopf an die Decke stieß. Jetzt könnte ich ihn angreifen, schoss es dem Mann durch den Kopf. Er verwarf seinen Gedanken wieder und wartete auf das, was ihm noch bevorstand. Er sah zurzeit keine unmittelbare Bedrohung. Wenn die Unbekannten ihn hätten killen wollen, dann hätten sie es schon längst getan. Der Mann hatte genug Erfahrung in seinem Metier, er war selbst Auftragskiller.
Am Ende des Ganges befand sich eine graue Betontreppe, der Gorilla stieg sie hinauf, der Mann folgte ihm. Am Ende der Treppe befand sich eine graue Brandschutztür. Der Hüne öffnete und sie betraten eine kleine, schmale Diele. Keinerlei Einrichtungsgegenstände und keine Fenster, die Tageslicht hineinließen. Der Boden bestand aus weißem Marmor, an den Wänden klebten weiß gestrichene Glasfasertapeten. Die Decke war mit Holz verkleidet. Auch hier spendete eine Neonleuchte (die unter der Decke montiert worden war) kaltes Licht. Aber sie flackerte nicht.
Diese Diele mündete in einen riesigen Raum, eher ein Vestibulum.
Der Mann versuchte, sich ein paar Einzelheiten einzuprägen. Eine alte Angewohnheit von ihm, dies verlangte schon allein sein Beruf. Der Boden bestand wieder aus weißem Marmor, an den Wänden hingen gelbe Seidentapeten. Er sah rechts eine prächtige weiße Marmortreppe mit einem goldenen Handlauf, die in die obere Etage führte. Drei Gemälde hingen an den Wänden. An der linken Wand ein riesiges Abendmahl in Öl, rechts daneben Napoleon vor dem brennenden Moskau. An der gegenüberliegenden Wand neben der Marmortreppe hing ein Gemälde, das eine Frau zeigte, die eine französische Nationalfahne in der rechten und ein Sturmgewehr in der linken Hand hielt. Zu ihren Füßen kniete ein Mann oder eine Frau, dahinter lagen zwei Tote. Bewaffnete Männer und Frauen folgten der Frau. Im Raum standen außerdem mehrere Marmorbüsten auf hohen Sockeln. Er sah Napoleon, Jesus Christus, Caligula, Beethoven