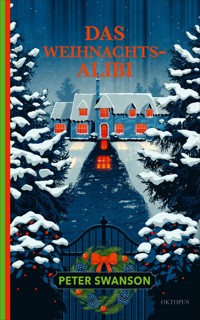9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie weiß, dass nebenan ein Mörder wohnt. Sie wird ihn überführen – und nun ist der richtige Augenblick gekommen!
Henrietta weiß, dass nebenan ein Mörder wohnt. Sie und ihr Mann Lloyd sind eben erst in die Bostoner Vorstadt gezogen, als sie während eines Dinners im Haus ihrer Nachbarn einen unglaublichen Fund macht: eine Trophäe, die von einem Tatort verschwand, an dem ein junger Mann ermordet wurde. Dass der sympathische Lehrer Matthew im Besitz dieses Objekts ist, scheint für Hen der untrügliche Beweis zu sein, dass er in die Tat verwickelt war. Heimlich beginnt sie, Matthew zu beschatten. Doch als es erneut zu einem Mord kommt, glaubt Hen als Einzige daran, dass ihr Nachbar der Täter ist. Wird sie beharrlich genug sein, um die Wahrheit aufzudecken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Henrietta weiß, dass nebenan ein Mörder wohnt. Sie und ihr Mann Lloyd sind eben erst in die Bostoner Vorstadt gezogen, als sie während eines Dinners im Haus ihrer Nachbarn einen unglaublichen Fund macht: eine Trophäe, die von einem Tatort verschwand, an dem ein junger Mann ermordet wurde. Dass der sympathische Lehrer Matthew im Besitz dieses Objekts ist, scheint für Hen der untrügliche Beweis zu sein, dass er in die Tat verwickelt war. Heimlich beginnt sie, Matthew zu beschatten. Doch als es erneut zu einem Mord kommt, glaubt Hen als Einzige daran, dass ihr Nachbar der Täter ist. Wird sie beharrlich genug sein, um die Wahrheit aufzudecken?
Autor
Peter Swanson studierte am Trinity College, der University of Massachusetts in Amherst und am Emerson College in Boston und hat Abschlüsse in kreativem Schreiben, Pädagogik und Literatur. Er veröffentlichte Kurzgeschichten und Gedichte in zahlreichen namhaften Magazinen wie The Atlantic. Mit seinem Thriller »Die Gerechte« gelang ihm ein internationaler Bestseller. Der Roman wurde von der Presse begeistert besprochen und für einen Ian Fleming Steel Dagger Award nominiert. Zudem schrieb Swanson weitere spannende Thriller, zuletzt »Angst sollst du haben«. Er lebt mit seiner Ehefrau in Somerville, Massachusetts.
Von Peter Swanson bereits erschienen:
Die Unbekannte
Die Gerechte
Alles, was du fürchtest
Ein Tod ist nicht genug
Angst sollst du haben
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
PETER SWANSON
ANGST SOLLST DU HABEN
Thriller
Deutsch von Fred Kinzel
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Before She Knew Him« bei William Morrow, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Peter Swanson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Bernd Stratthaus
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Magdalena Russocka/Trevillion Images
BL · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25640-1V001
www.blanvalet.de
Für drei Generationen der Galleranis (aber vor allem für Meghan)
TEIL 1 ZEUGIN
Kapitel 1
Die beiden Paare lernten sich bei einem Nachbarschaftsfest in ihrer Straße kennen, am dritten Samstag im September.
Hen hatte nicht hingehen wollen, aber Lloyd überredete sie. »Es ist nur ein Stück die Straße runter. Wenn du es furchtbar findest, kannst du gleich wieder nach Hause gehen.«
»Kann ich eben nicht«, sagte Hen. »Ich muss mindestens eine Stunde bleiben, sonst fällt es auf.«
»Niemand bemerkt so was.«
»Doch, na klar. Ich kann nicht einfach einen Blick auf meine neuen Nachbarn werfen und dann auf dem Absatz kehrtmachen und wieder verschwinden.«
»Wenn du nicht mitkommst, gehe ich auch nicht.«
»Schön«, zwang sie ihn, Farbe zu bekennen. Sie wusste, er würde allein gehen, wenn ihm nichts anderes übrigblieb.
Lloyd schwieg einen Moment. Er stand vor dem Bücherregal im Wohnzimmer und ordnete es neu. Sie hatten Anfang Juli ein Einfamilienhaus in West Dartford erstanden, während einer der schlimmsten Hitzewellen in der Geschichte von Massachusetts. Zwei Monate später hatte es abgekühlt, und Hen begann, das Haus als ihres zu empfinden. Die Möbel standen alle in den richtigen Räumen, Bilder hingen an der Wand, und Vinegar, ihr Maine-Coon-Kater, wagte sich gelegentlich aus seinem Kellerversteck nach oben.
»Was, wenn ich dich bitten würde, mir zuliebe mitzukommen?«
Mir zuliebe war ein uneingestandener Code zwischen ihnen, ein Schachzug, den Lloyd üblicherweise nur durchführte, wenn es Hen nicht gut ging. In der Vergangenheit hatte er sie auf diese Weise oft morgens aus dem Bett bekommen.
»Tu es nicht für dich. Tu es mir zuliebe.«
Manchmal störte sie der Ausdruck und die Art und Weise, wie Lloyd ihn einsetzte, aber sie verstand auch, dass er für Gelegenheiten reserviert war, die Lloyd für wichtig hielt. Wichtig für sie beide.
»Also gut, ich komme mit«, willigte sie schließlich ein, und Lloyd sah sie lächelnd an.
»Ich entschuldige mich im Voraus, falls es schrecklich wird«, sagte er.
Der Samstag war sonnig und sehr windig. Böen zerrten sporadisch an dem Plastiktischtuch, das von Schalen voller Nudelsalat, Hummus und Pita ohne Ende und Chips beschwert wurde. Dartford war ein wohlhabender Vorort von Boston, fünfundvierzig Minuten von der City entfernt, aber in West Dartford, auf der anderen Seite des Scituate River, waren die Häuser kleiner und standen dichter beisammen. Sie waren einst alle für die Arbeiter einer längst stillgelegten Fabrik gebaut worden, die man vor Kurzem in Ateliers für Künstler umgewandelt hatte. Die umgebaute Fabrik war einer der Gründe, warum sich Lloyd und Hen für diese Gegend entschieden hatten. Hen hatte ihr eigenes Atelier in fußläufiger Entfernung von zu Hause, und Lloyd konnte mit dem Vorortzug – der Bahnhof war ebenfalls zu Fuß erreichbar – zur Arbeit nach Boston fahren. Sie würden weiterhin nur ein Auto brauchen, die Kreditraten fielen geringer aus als für ihr Haus in Cambridge, und sie lebten praktisch auf dem Land, abseits des Trubels.
Aber auf dem von hippen jungen Paaren dominierten Nachbarschaftsfest fühlte sich West Dartford nicht so viel anders an als ihr früheres Viertel. Eine Frau namens Claire Murray – dieselbe, die persönlich die Einladungen zum Fest verteilt hatte – stellte Hen und Lloyd allen vor. Wie immer ergaben sich Gespräche nach Geschlechtern getrennt: Hen erklärte mindestens dreimal ihren Namen – »Kurzform von Henrietta« – und weitere dreimal, dass sie Vollzeit als Künstlerin tätig sei, und nein, erzählte sie zwei der Frauen, sie habe noch keine Kinder. Nur eine, eine Rothaarige mit dunklen Sommersprossen, die ein T-Shirt mit dem Logo einer Vorschule trug, fragte Hen, ob sie Kinder zu bekommen plane. »Wir werden sehen«, log Hen.
Nachdem sie wirklich köstlichen Nudelsalat und einen halben trockenen Cheeseburger gegessen hatte, fand sich Hen, zu ihrer Erleichterung mit Lloyd zusammen, im Gespräch mit dem offenbar einzigen anderen kinderlosen Paar auf dem Fest wieder. Wie sich herausstellte, wohnten Matthew und Mira Dolamore in dem Haus im holländischen Kolonialstil genau neben ihrem eigenen.
»Sie müssen zur selben Zeit gebaut worden sein, meint ihr nicht?«, fragte Lloyd.
»Alle Häuser in dieser Straße wurden zur selben Zeit gebaut«, erläuterte Matthew und rieb sich über die Stelle zwischen Unterlippe und Kinn. Als er die Hand wegnahm, sah Hen, dass er dort eine Narbe hatte wie Harrison Ford. Er sah gut aus, dachte Hen, nicht auf Harrison-Ford-Art, sondern in dem Sinn, dass alle seine Merkmale – das dichte braune Haar, die hellblauen Augen, das kantige Kinn – die Züge eines gutaussehenden Mannes waren, auch wenn sie zusammen etwas ergaben, was hinter den Einzelteilen zurückblieb. Seine Haltung war steif, und er trug ein Anzughemd, das in einer Jeans mit altmodisch hoher Taille steckte. Mit seinen breiten Schultern und seinen großen, knochigen Händen erinnerte er Hen an eine Schaufensterpuppe. Später, bei ihrem gemeinsamen Abendessen, würde sie zu dem Schluss kommen, dass er einer jener harmlosen, fröhlichen Männer war, die Sorte Mensch, bei denen man sich freute, wenn man sie traf, aber an die man nie dachte, wenn sie nicht da waren. Viel später sollte sie erkennen, wie falsch sie mit diesem ersten Eindruck gelegen hatte. Aber an diesem sonnigen Samstagnachmittag war Hen einfach froh, dass Lloyd wieder an ihrer Seite war und sie die Unterhaltung nicht allein bestreiten musste.
Mira, die etwa halb so groß war wie ihr Mann, rückte näher an Hen heran. »Ihr habt auch keine Kinder«, sagte sie, es war eher eine Feststellung als eine Frage, und Hen wurde klar, dass ihre neuen Nachbarn sie bei ihrem Einzug im Juli ganz offenbar beobachtet hatten. Es war merkwürdig, dass sie nicht herübergekommen waren, um sich vorzustellen.
»Nein, keine Kinder.«
»Ich glaube, wir sind die einzigen Paare in der Straße, die keine haben.« Sie lachte nervös. Hen konnte nicht umhin zu bemerken, dass Mira äußerlich das genaue Gegenteil ihres Mannes war, dass ihre Züge – eine etwas zu große Nase, ein tiefer Haaransatz, ausladende Hüften – sich zu etwas summierten, das weit attraktiver war als Matthew.
»Was arbeitest du?«, fragte Hen und ärgerte sich augenblicklich über sich selbst, weil sie sofort bei dieser Frage Zuflucht nahm.
Die vier unterhielten sich noch etwa zwanzig Minuten lang. Matthew war Geschichtslehrer an einer privaten Highschool drei Ortschaften weiter, und Mira war Vertreterin bei einem Unternehmen, das Unterrichtssoftware entwickelte, was bedeutete, dass sie mehr Zeit auf Reisen verbrachte als zu Hause, wie sie mehrmals betonte. »Ihr müsst ein Auge auf Matthew haben. Erzählt mir, was er so treibt, während ich fort bin.« Darauf folgte wieder das nervöse Lachen. Hen hätte sie eigentlich schrecklich finden müssen, aber aus irgendeinem Grund tat sie es nicht. Vielleicht hatte der Umzug sie tatsächlich milder gestimmt, aber wahrscheinlich rührte es eher von ihrer gegenwärtigen Medikation her. Ein weiterer noch kälterer Windstoß fegte durch die Straße und ließ die noch grünen Blätter der Bäume rascheln. Hen zog sich die Strickjacke um den Oberkörper und fröstelte.
»Ist dir kalt?«, fragte Matthew.
»Immer«, erwiderte Hen und fügte an: »Ich gehe vielleicht langsam nach Hause …«
Lloyd lächelte sie an. »Ich komme mit.« Dann wandte er sich an Matthew und Mira. »Ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind immer noch beim Auspacken. War nett, euch beide kennenzulernen.«
»War nett, dich kennenzulernen, Lloyd«, erwiderte Matthew. »Und dich, Hen. Ist das kurz für …«
»Henrietta, ja, aber von meiner Geburtsurkunde abgesehen hat mich nie jemand so genannt. Immer nur Hen.«
»Lasst uns mal was zusammen unternehmen. Kochen vielleicht, wenn es nicht zu spät wird.« Das kam von Mira, und die vage Zustimmung, die sie von allen Seiten erntete, ließ Hen zu dem Schluss kommen, dass es nie passieren würde.
Deshalb war sie überrascht, als Mira eine Woche später aus ihrer Haustür stürzte, als Hen gerade von ihrem Atelier nach Hause kam.
»Hallo, Hen.«
Wie üblich, wenn sie den ganzen Nachmittag gearbeitet hatte, fühlte sich Hen leicht benommen, aber auf eine gute Art. »Hallo, Miri«, antwortete sie und merkte sofort, dass sie einen falschen Namen benutzt hatte. Ihre Nachbarin korrigierte sie jedoch nicht.
»Ich wollte eigentlich heute Abend vorbeischauen, aber ich hab dich gerade die Straße runterkommen sehen. Möchtet ihr an diesem Wochenende zum Abendessen zu uns kommen?«
»Ähm …«, zögerte Hen.
»Freitag oder Samstag, das spielt keine Rolle«, fügte Mira hinzu. »Sogar Sonntag würde bei uns gehen.«
Hen wusste, sie würde sich nicht aus der Sache herauswinden können, schon gar nicht, wenn sie drei Abende zur Auswahl hatte. Sie und Lloyd hatten keine konkreten Pläne fürs Wochenende, also wählte sie den Samstag und fragte, was sie mitbringen sollten.
»Nur euch selbst. Super. Gibt es etwas, was ihr nicht esst?«
»Nein, wir essen alles«, erwiderte Hen und unterließ es, ihr von Lloyds Phobie vor jeglichem Fleisch zu erzählen, das noch an seinem Knochen hing.
Sie einigten sich auf sieben Uhr am Samstag, und Hen informierte Lloyd, als er am Abend nach Hause kam.
»Okay. Neue Freunde. Bist du dazu bereit?«
Hen lachte. »Eigentlich nicht, aber es ist doch angenehm, bekocht zu werden. Sie finden uns bestimmt sterbenslangweilig und laden uns dann nie wieder ein.«
Sie und Lloyd erschienen Punkt sieben mit einer Flasche Rot- und einer Flasche Weißwein. Hen trug ihr grün kariertes Kleid mit Leggins darunter. Lloyd, der wenigstens geduscht hatte, kam in Jeans und einem Bon-Iver-T-Shirt, das er manchmal zum Laufen trug. Sie wurden ins Wohnzimmer geführt – der Grundriss war identisch mit ihrem eigenen –, wo sie um einen niedrigen Kaffeetisch Platz nahmen, auf den genug Häppchen für eine kleine Party drapiert waren. Hen und Lloyd saßen auf einer beigen Ledercouch, Matthew und Mira in dazu passenden Sesseln. Der Raum war sehr weiß und steril und unfassbar sauber. An den Wänden hingen interessante Drucke, aber Hen glaubte, sie aus dem Einrichtungshaus Crate and Barrel wiederzuerkennen.
Sie machten eine Viertelstunde Small Talk. Hen fiel auf, dass man ihnen keinen Drink angeboten hatte – tranken die beiden etwa nicht? –, aber es störte sie nicht besonders, sie dachte nur an Lloyd. Aber als sich Mira gerade erkundigte, ob Hen am bevorstehenden Tag der offenen Tür in ihrem Atelier teilnehmen würde, stand Matthew auf und fragte: »Möchte jemand was trinken?«
»Was gibt es?«, entgegnete Lloyd eine Spur zu gierig.
»Wein oder Bier.«
»Ich nehm ein Bier«, sagte Lloyd, während Hen und Mira jeweils um ein Glas Weißwein baten.
Matthew ging hinaus, und Mira fragte noch einmal nach dem Tag der offenen Tür.
»Ich weiß nicht«, sagte Hen. »Ich hab mich gerade erst eingerichtet, quasi gestern. Es kommt mir komisch vor, dass plötzlich Leute da durchspazieren sollen.«
»Du solltest es tun«, sagte Lloyd.
»Ja, solltest du«, sagte Mira.
»Warst du schon mal beim Tag der offenen Tür?«, wollte Hen von Mira wissen.
»Ja. Wir gehen jedes Jahr hin. Ich zumindest. Manchmal kommt Matthew mit. Es macht Spaß, du solltest es unbedingt tun. Vielleicht verkaufst du sogar was. Ich habe diese Bilder dort erstanden.«
Mira zeigte auf die gerahmten Drucke an der Wand, und Hen bekam ein schlechtes Gewissen, weil sie geglaubt hatte, sie stammten aus einem Möbelladen. Matthew kam mit den Drinks zurück, und Hen bemerkte, dass er für sich selbst eine Dose Ginger Ale mitgebracht hatte.
»Erzähl uns von deiner Kunst«, bat Mira.
Ihren Beruf zu erklären war nicht gerade Hens Lieblingsbeschäftigung, aber sie gab sich Mühe, und Lloyd kam ihr heldenhaft zu Hilfe und übernahm das Ruder. Hen arbeitete seit dem College als Druckgrafikerin, erst im Blockdruckverfahren, später verwendete sie Kupfer- oder Zinkplatten. Jahrelang hatte sie Werke reiner Fantasie geschaffen, groteske, surreale Szenen, meist mit einer Textzeile darunter. Diese Illustrationen schienen aus Büchern zu stammen, häufig schaurige Kinderbücher, die nur in ihrem Kopf existierten. Sie war in ihren Zwanzigern recht erfolgreich gewesen, für mehrere Sammelausstellungen ausgewählt und sogar in einer neuenglischen Kunstzeitschrift porträtiert worden, aber sie hatte ihr Einkommen immer aufstocken müssen, indem sie in Künstlerbedarfsläden jobbte oder ab und zu Bilder für einen prominenten Maler aus dem Bostoner South End rahmte. All das änderte sich, als sie von einem Kinderbuchautor angesprochen wurde, ob sie tatsächlich Illustrationen für das erste Buch einer geplanten Fantasyreihe machen wolle. Sie hatte den Auftrag angenommen, das Buch hatte sich gut verkauft, was ihr den Kontakt zu einer Agentur eingebracht hatte, und inzwischen arbeitete sie in Vollzeit als Kinderbuchillustratorin und schuf nur noch gelegentlich ein Kunstwerk nach ihren eigenen Vorstellungen. Es machte ihr nichts aus. Insgeheim war sie dieser Tage damit zufrieden, wenn man ihr sagte, wie ihre Kompositionen aussehen sollten. Ihr gegenwärtiger Medikamentencocktail, darunter ein Stimmungsaufheller, ein Antidepressivum und etwas, das offenbar die Wirkung des Antidepressivums steigerte, verhinderte seit zwei Jahren, dass Hens bipolare Störung ihr hässliches Haupt erhob, aber sie hatte den Eindruck, dass er ihr außerdem jeden kreativen Antrieb geraubt hatte. Sie war immer noch in der Lage, ihre Arbeit zu erledigen, liebte sie im Grunde sogar, hatte aber selten eine Idee für eine eigene Kreation. Nicht dass sie Mira und Matthew von alldem etwas erzählt hätte. Mira interessierte sich hauptsächlich für die Fantasybücher, da sie schon von ihnen gehört hatte, und versprach, das erste in der Reihe zu kaufen. Matthew stellte mehrere Fragen zu ihrer künstlerischen Entwicklung, er beugte sich vor und hörte bei ihren Antworten aufmerksam zu.
Sie zogen schließlich ins Esszimmer um, wo das Essen auf Warmhalteplatten auf einem Sideboard bereitstand: Kartoffelbrei, Hähnchenschenkel in einer leuchtend gelben Sauce und grüner Salat.
»Genauso haben meine Großeltern das Essen serviert«, merkte Hen an. »Auf einem Sideboard.«
»Woher stammten sie denn?«, fragte Mira.
Hen erklärte, dass ihr Vater Brite war und ihre Mutter Amerikanerin und dass sie während ihrer Kindheit zwischen Bath in England und Albany im Staat New York hin- und hergependelt seien.
»Ich hatte gleich den Eindruck, als hättest du einen Akzent«, sagte Mira.
»Wirklich? Ich dachte eigentlich, ich hätte keinen.«
»Er ist schwach.«
»Bist du aus …?«
»Ich bin aus Kalifornien, aber meine Eltern kommen beide aus Nordengland. Eine Zeit lang haben sie auch in Pakistan gelebt, und sie haben sich sehr britisch benommen. Alle unsere Mahlzeiten, einschließlich dem Frühstück, wurden von einem Sideboard im Esszimmer serviert.«
»Wie schön«, sagte Hen.
Die Unterhaltung beim Essen war ganz nett, wurde aber nie wirklich lebhaft. Sie sprachen viel über ihre jeweilige Arbeit, die Nachbarschaft, den grotesk überteuerten Immobilienmarkt. Sooft Matthew das Wort ergriff, tat er es, um weitere Fragen zu stellen, meist an Hen. Nach seiner Frage, ob sie das Nachbarschaftsfest gut überlebt habe, war ihr klar, dass er ziemlich einfühlsam sein musste. In der Hoffnung, das Gespräch auf Sport zu lenken, fragte Lloyd, ob Matthew in Sussex Hall irgendwelche Mannschaften betreute. Matthew verneinte (»der einzige Sport, in dem ich je gut war, ist Badminton«). Hen, die unmittelbar nach dem College drei katastrophale Monate lang versucht hatte, Kunst in einer Vorschule zu unterrichten, fragte ihn, ob er Unterrichten als emotional erschöpfend empfinde, und er antwortete, die ersten beiden Jahre seien sehr hart gewesen. »Aber jetzt liebe ich es. Ich mag die Schüler, ich mag es, etwas über ihr Leben zu erfahren, zu beobachten, wie sehr sie sich in ihren vier Highschool-Jahren verändern.« Hen spürte, wie Lloyd ein Gähnen unterdrückte, während er sich methodisch durch mehrere Gläser Wein arbeitete.
Nach dem Dessert – warmer Reispudding mit Rosinen und Kardamom – entschied Hen, sie sollten sich besser auf den Heimweg machen, da sie am nächsten Morgen zu Lloyds Eltern fahren wollten. Es stimmte, aber sie würden frühestens am späten Vormittag aufbrechen.
Die beiden Paare standen im Flur vor der Eingangstür, und Hen sagte noch einmal, dass ihr die Einrichtung des Hauses sehr gefiel.
»Ach, wir sollten noch eine Führung für euch machen«, schlug Mira vor. »Das hätten wir eigentlich schon früher tun sollen.«
Überraschenderweise stimmte Lloyd zu, und Mira führte sie durch die renovierte Küche, zeigte ihnen die Veranda, die sie auf der Rückseite angebaut hatten, dann gingen sie nach unten in Matthews Arbeitszimmer. Der Raum unterschied sich so sehr von den hellen Farben und klaren Linien im Rest des Hauses, dass sich Hen in ein gänzlich anderes Haus versetzt fühlte, vielleicht sogar in eine andere Zeit. Die Wände waren dunkelgrün tapeziert, mit einem feinen Schraffurmuster, auf dem Boden lag ein abgetretener Perserteppich, und der ganze Raum wurde von einem riesigen Schrank mit Glasfront dominiert, voll mit Büchern und Fotos in Bilderrahmen. Es gab einen kleinen Schreibtisch mit einem gepolsterten Ledersessel; die einzige andere Sitzgelegenheit war ein Cordsofa. Nichts in dem Raum wirkte auch nur annähernd modern, und jede verfügbare Fläche wurde von Nippes oder gerahmten Fotos bedeckt, alle in Schwarz-Weiß. Hen, die sich zu kleinen Dingen und allem Alten hingezogen fühlte, machte zwei Schritte ins Zimmer hinein, dann entschlüpfte ihr ein »Oh«.
»Das ist Matthew, wie er leibt und lebt«, erläuterte Mira.
Hen drehte sich lächelnd um und bemerkte, dass Matthew, der während des größten Teils der Führung den Abwasch erledigt hatte, jetzt nervös im Eingang stand. Hen war unwohl zumute, als bekämen sie etwas weitaus Privateres als ein Arbeitszimmer zu sehen. »Ich liebe es«, sagte sie. »So viele interessante Dinge.«
»Ich bin ein Sammler«, sagte Matthew. »Mira ist die … Was ist das Gegenteil von Sammler? Wegschmeißerin?«
Es gab einen Kamin im Raum, und Lloyd fragte, ob er funktioniere, während Hen die Objekte auf dem Kaminsims flüchtig betrachtete. Es war eine merkwürdige Zusammenstellung – eine kleine Schlange aus Messing, hölzerne Kerzenhalter, das Miniaturporträt eines Hundes, ein Leuchtglobus und in der Mitte eine Siegestrophäe, die Figur eines Fechters mitten im Ausfallschritt auf einem silbernen Podest. Einen schrecklichen Moment lang befürchtete Hen, ohnmächtig zu werden. Vor ihren Augen verschwamm alles, und ihre Beine fühlten sich wie Wackelpudding an, dann fing sie sich wieder. Es ist wahrscheinlich nur ein Zufall, beruhigte sie sich und trat vor, um die Inschrift auf dem Sockel der Trophäe zu lesen. DRITTERPLATZDEGEN las sie, dann in kleinerer Schrift etwas, das wie JUNIOROLYMPICS aussah, und ein Datum, das sie nicht entziffern konnte. Sie wollte nicht zu nahe rangehen. Stattdessen drehte sie sich um und fragte Matthew in möglichst unbekümmertem Tonfall: »Bist du Fechter?«
»Um Himmels willen, nein. Mir hat nur die Trophäe gefallen. Ich habe sie auf einem Hofflohmarkt gekauft.«
»Alles in Ordnung, Hen?«, fragte Lloyd und sah sie beunruhigt an. »Du siehst irgendwie blass aus.«
»Ja, ja, mir geht’s gut. Bin nur ein bisschen müde.«
Die beiden Paare traten wieder in die Diele, um sich zu verabschieden. Hen fühlte, wie das Blut in ihr Gesicht zurückströmte. Es ist nur eine Fechttrophäe – davon muss es Tausende geben, redete sie sich ein, während sie noch einmal das Abendessen lobte und sich für die Führung bedankte, wobei Lloyd die ganze Zeit die Hand an der Türklinke hatte. Mira küsste Hen auf die Wange, und Matthew lächelte hinter ihr und sagte »Auf Wiedersehen«. Sie konnte es sich nur eingebildet haben, aber es erschien Hen, als hätte er sie genau beobachtet.
Als sich die Tür der Dolamores hinter ihnen geschlossen hatte und sie beide in der kalten, feuchten Luft draußen standen, sah Lloyd Hen an und sagte: »Alles okay? Was war los da drin?«
»Ach, nichts. Ich hatte nur einen kleinen Schwächeanfall. Es war warm da drin, nicht?«
»Eigentlich nicht«, widersprach Lloyd.
Sie waren bereits an ihrer Tür, und Hen wäre gern noch ein wenig länger durch die Nachtluft spaziert, aber sie wusste, Lloyd wollte unbedingt nach Hause und schauen, ob das Spiel der Red Sox noch lief.
Als Lloyd später neben ihr im Bett lag und schlief, versuchte sich Hen einzureden, dass es ein lachhafter Gedanke sei, dass die Welt voller Fechttrophäen sei, die wahrscheinlich alle gleich aussahen. Aber eigentlich ist es nicht lächerlich, oder? Matthew unterrichtet in Sussex Hall, und dort hat Dustin Miller die Highschool besucht.
Kapitel 2
Nachdem Mira eingeschlafen war, stand Matthew auf und ging nach unten in sein Arbeitszimmer. Er stellte sich auf dieselbe Stelle, an der die Frau von nebenan gestanden hatte, etwa anderthalb Meter vom Kamin entfernt, blickte auf die Trophäe und versuchte die Inschrift zu lesen. Er konnte Datum und Ort kaum ausmachen, und seine Sehkraft war einwandfrei, außerdem wusste er, was dort stand. Trotzdem, es war nicht ausgeschlossen, dass sie alles gelesen hatte. Es war dumm von ihm gewesen, die Trophäe einfach mitten auf das Kaminsims zu stellen, wo sie jeder sehen konnte – dumm und arrogant. Andererseits, wie hoch war verdammt noch mal die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Verbindung herstellte?
Aber sie hat sie hergestellt, nicht wahr?
Er hatte ihr angesehen, dass sie kurz davor stand, ohnmächtig zu werden. Er hatte jeden Moment damit gerechnet und sich gefragt, ob ihr nicht allzu heller Ehemann schnell genug sein würde, sie aufzufangen, wenn sie umkippte.
Er spürte diesen Knoten in der Brust, den er immer spürte, wenn er nervös war. Er stellte ihn sich als eine Kinderfaust vor, die abwechselnd geballt und geöffnet wurde. Er machte ein paar Hampelmänner, damit das Gefühl verging, und danach sagte er sich, dass er die Trophäe ganz loswerden, sie irgendwo verstecken musste. Der Gedanke erfüllte ihn mit etwas, was er für Trauer hielt.
»Es war gestern doch nett«, sagte Mira am nächsten Morgen noch einmal. »Ich mochte Hen wirklich.«
»Mich würde ihre Kunst interessieren«, sagte Matthew.
»Ich weiß. Lass uns zum Tag der offenen Tür in den Ateliers gehen. Weißt du, wann genau er ist?«
Matthew schaute auf seinem Handy nach, an welchem Wochenende der Tag der offenen Tür stattfand, während Mira Sachen fürs Frühstück aus dem Kühlschrank räumte. Es war eine ihrer wenigen gemeinsamen Gewohnheiten – ein üppiges, warmes Frühstück am Sonntagmorgen.
Nachdem sie Rührei und Hash Browns aus dem übriggebliebenen Kartoffelbrei vom Vortag verspeist hatten, sagte Matthew, er müsse noch Unterricht vorbereiten, ging in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür. Er blieb eine Weile in dem dunklen Raum stehen, atmete die Luft ein und stellte sich vor, wie Hen in seinem Zimmer ausgesehen hatte. Sie war klein, dunkel und hübsch. Braunes Haar, große braune Augen und leicht elfenhafte Züge. Der Gedanke, dass sie wusste, was er mit Dustin Miller angestellt hatte – auch wenn sie es nur vermutete –, erfüllte ihn zugleich mit großer Angst und etwas, das sich anfühlte, als würde ihm schwindlig vor Glück. Hatte er deshalb die Fechttrophäe überhaupt behalten? Hatte er gewollt, dass jemand erfuhr, was er getan hatte? Er nahm sie in die Hand. Jetzt würde er sie loswerden müssen, so viel war klar. Aber musste er sie genau in diesem Moment loswerden? Würde er noch heute Besuch von der Polizei bekommen? Möglich. Und was war mit dem Feuerzeug mit der Gravur in seiner Schreibtischschublade? Würde das jemand mit Bob Shirley in Verbindung bringen? Matthew durchströmte ein schmerzliches Bedauern. Ihre neue Nachbarin wäre dafür verantwortlich, dass er sich von seinen wertvollsten Stücken trennen musste. Er atmete langsam durch die Nase und überlegte dann, wie er die Souvenirs aus dem Haus schaffen, aber nicht gänzlich aus seinem Leben verbannen konnte.
Er ging in den Keller und fand dort eine Pappschachtel, die etwa die richtige Größe zu haben schien. Auf dem Weg zurück ins Arbeitszimmer begegnete er Mira; sie hatte sich umgezogen und trug eine Yogahose und ein altes T-Shirt.
»Gehst du spazieren?«, fragte er.
»Nein, ich mache nur mein Yogaprogramm im Fernsehen. Wofür ist die Schachtel?«
Er sagte, er wolle einige der Lehrbücher für Geschichte, die sich im Lauf der Jahre bei ihm angesammelt hatten, nach Sussex Hall zurückbringen.
»Heute?«
»Das hatte ich vor. Dann würde ich wenigstens mal vor die Tür kommen.«
»Es ist Sonntag. Du kannst sie doch auch morgen hinbringen, oder?«
»Eigentlich wollte ich dort auch noch einen Teil meines Unterrichts vorbereiten. Ein paar Daten auf das Whiteboard schreiben.«
Mira zuckte mit den Achseln.
»Komm mit, wenn du willst. Wir können hinterher um den See spazieren.«
»Okay, vielleicht«, sagte sie und ging in Richtung Wohnzimmer. Er sah ihr nach. Er hatte ihren Gang immer geliebt, wie sie sich bei jedem Schritt ein wenig auf die Zehen stellte. Sie hatte ihm erzählt, dass sie sich zwischen fünf und dreizehn Jahren für nichts außer Ballett interessiert hatte, aber ihr Traum war zerplatzt, weil es ihr nicht gelang, wesentlich größer als eins fünfzig zu werden. Sie hatte in der Highschool geturnt, und sie beherrschte immer noch einen Flickflack.
Zurück im Arbeitszimmer wickelte er die Fechttrophäe der Junior Olympics in Zeitungspapier und legte sie ganz unten in die Schachtel. Er packte Bob Shirleys Feuerzeug dazu, die Vuarnet-Sonnenbrille aus Jay Saravans BMW und schließlich die zerfledderte Schulausgabe der Schatzinsel, die Alan Manso gehört hatte.
Dann sammelte er mehrere Geschichtsbücher zusammen, die in seinem Arbeitszimmer herumlagen, – Bücher, die er in keinem seiner Kurse mehr verwendete –, und stapelte sie auf die vier Andenken. Zuletzt verschloss er den Karton mit Klebeband und sagte Mira dann, dass er zur Schule fuhr.
Sie war eben mit ihrem Yoga fertig geworden, und im Wohnzimmer war es warm und roch nach ihrem Schweiß, aber nicht unangenehm.
»Ich bin dann weg«, sagte Matthew. »Soll ich auf dich warten?«
»Nein, schon gut. Ich hab hier genug zu tun. Wie lange bist du fort?«
»Nicht lange«, erwiderte er und griff nach seinen Autoschlüsseln und der Sonnenbrille. Er stand noch einen Moment in der Diele und überlegte, ob er alles hatte. Dabei fiel ihm ein, dass Hen oder ihr Mann, Lloyd, vor ihrem Haus stehen oder aus dem Fenster schauen könnten. Sie hatten zwar gesagt, sie wollten irgendwohin fahren, aber was, wenn sie schon zurück waren und ihn mit einem Karton das Haus verlassen sahen? Wäre es offensichtlich, dass er die Trophäe verschwinden ließ? Glücklicherweise lag seine Zufahrt auf der von ihnen abgewandten Seite des Hauses. Er würde also nur ein paar Sekunden für sie sichtbar sein, wenn er das Haus verließ und zu seinem Auto ging. Das konnte er riskieren.
Es war warm draußen, mehr wie im Hochsommer als wie Ende September. Auf der anderen Straßenseite mähte Jim Mills schon wieder seinen Rasen, obwohl er es erst vor ein paar Tagen getan hatte, und von dem Geruch nach frisch geschnittenem Gras und Benzin wurde Matthew leicht übel. Es war eine seiner Aufgaben als Kind gewesen, den Rasen im Garten seiner Eltern zu mähen. Seine Nase lief immer, und seine Hände juckten vom Vibrieren des Mähers, den er schob, und an nassen Tagen bildete das geschnittene Gras Klumpen unter dem Rasenmäher und klebte an seinen Schienbeinen. Er stieg in seinen Fiat und schaltete die Klimaanlage an. Er stellte die Schachtel neben sich auf den Beifahrersitz. Wegen des Geruchs des Rasenmähers hatte er gar nicht mehr daran gedacht, dass Hen und Lloyd ihn mit dem Karton sehen könnten. Wahrscheinlich gut, dass er keinen schuldbewussten Blick auf ihr Haus geworfen hatte.
Es war eine zwanzigminütige Fahrt bis Sussex Hall, einer privaten Highschool mit rund siebenhundert Schülern, von denen eine Hälfte im Internat wohnte und die andere aus den wohlhabenden Städten in diesem Teil Massachusetts’ kam. Die Schule stand auf einem Hügel, und bis auf die neuere Turnhalle waren alle Gebäude zur vorletzten Jahrhundertwende aus Ziegel errichtet worden. Matthew liebte seinen Lehrerjob nicht immer, aber er liebte den Campus von Sussex mit seinen Wohnheimen im gotischen Stil und der keiner bestimmten Konfession geweihten Steinkapelle. Er parkte auf einem Lehrerparkplatz, obwohl Sonntag war und er überall hätte parken können. Er betrat das Gebäude durch die Hintertür und stieg sofort die schmale Treppe ins Untergeschoss hinab. Als eine seiner Zusatzaufgaben hatte Matthew die Verwaltung der geschichtlichen Lehrbücher übernommen, die größtenteils in einem der abgeschlossenen Lagerräume im verputzten Keller verstaut waren. Aber er hatte auch einen Schlüssel zum älteren Teil des Untergeschosses, wo die zusätzlichen Klappstühle für Abschlussfeiern lagerten und dahinter die ausgemusterte Einrichtung, Kreidetafeln hauptsächlich und alte Klassenzimmerstühle. In der hintersten Ecke gab es außerdem einen Stapel Kartons, die das ursprüngliche Besteck des Speisesaals enthielten. Dazwischen schob er seinen Karton mit Erinnerungsstücken, weil er sicher war, dass sie so nie gefunden würden, selbst wenn jemand nach ihnen suchen sollte. Und auch wenn jemand den Karton fand – er hatte alle seine Fingerabdrücke sorgfältig abgewischt und sich vergewissert, dass in keinem der alten Schulbücher sein Name stand.
Nachdem er sich oben in der Lehrertoilette die Hände gewaschen hatte, ging Matthew in sein Klassenzimmer, um seine Unterrichtsstunden für die kommende Woche vorzubereiten. Die meisten seiner Stunden hatte er schon Dutzende Male gehalten, aber in diesem Halbjahr hatte er sich bereiterklärt, ein Seminar über den Kalten Krieg für den Abschlussjahrgang zu geben, und er brauchte ein wenig Auffrischung. In dieser Woche konzentrierten sie sich auf die Neuordnung nach dem Krieg. Er hatte schon fast eine Stunde an seinem Schreibtisch gesessen, als er hörte, wie sich die Hintertür mit lautem metallischem Kreischen öffnete, dann folgte ein furchtsames: »Ist da wer?«
Er trat in den schwach beleuchteten Flur hinaus und rief: »Hallo.«
Michelle Brine kam die Treppe herauf und sagte: »Gott sei Dank. Ich hasse es, am Wochenende allein hier zu sein. Es ist unheimlich.«
Michelle hier zu sehen war keine Überraschung. Es war ihr zweites Jahr als Lehrerin, und er fragte sich, wie sie das erste überlebt hatte. Ängstlich, schüchtern und von der ehrlichen Überzeugung beseelt, dass sich ihre Schüler für Geschichte interessierten, war sie in diesem ersten Jahr häufig in Tränen ausgebrochen. Matthew hatte sie unter seine Fittiche genommen, ihr seine Unterrichtsvorbereitungen überlassen und ihr Strategien erklärt, mit denen er Disziplin herstellte. Gegen Ende des zweiten Halbjahrs hatte er sie dann auch in persönlichen Dingen beraten und sie in Bezug auf ihre Beziehung mit ihrem Arschloch von Freund gecoacht.
»Ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin, die in Panik gerät und an einem Sonntag hierherkommt. Ich bin jetzt schon wieder so weit im Rückstand.« Sie war Matthew zu dessen Klassenzimmer gefolgt. Sie trug Jeans, was sie nie tat, wenn sie unterrichtete, aber er erkannte die bis oben hin zugeknöpfte schwarze Bluse, die sie zusammen mit einem Rock manchmal in der Schule anhatte.
»Am Wochenende ist es angenehm hier, findest du nicht?«
»Ich hasse es, wenn ich die Einzige bin. Wie lange bleibst du?«
»Eigentlich wollte ich gerade gehen.«
»Oh nein.« Sie zog den Reißverschluss ihres Rucksacks auf. »Kannst du dir ganz schnell noch was anschauen? Etwas, was ich mit meinem zweiten Jahrgang vorhabe?«
Nachdem er ihre Vorbereitung für eine Stunde durchgegangen war, in der die Schüler selbst eine Verfassung erarbeiten sollten – »Vielleicht solltest du ihnen erst die echte Verfassung beibringen«, hatte er vorgeschlagen –, hatte sie sich sofort in eine neue Geschichte über ihren Freund Scott gestürzt: Vor zwei Tagen hatte er einen Auftritt mit seiner Band gehabt, von dem er erst um drei Uhr morgens nach Hause gekommen war. Während er am nächsten Tag ausschlief, hatte sie sein Handy überprüfen wollen, aber er hatte das Passwort geändert.
»Das klingt nicht gut«, sagte Matthew.
»Ich weiß, ich weiß. Er betrügt mich, oder?«
»Erzähl mir genau, was er gesagt hat, als du ihn darauf angesprochen hast.«
Matthew, der Mira bereits informiert hatte, dass es doch ein wenig später werden würde, lehnte sich hinter seinem Lehrerpult zurück und tat eins der Dinge, die er sehr gut konnte. Er hörte einer Frau zu.
Kapitel 3
Am Sonntag überlegte Hen, ob sie die Hinweisnummer der Polizei anrufen oder versuchen sollte, mit dem Detective Kontakt aufzunehmen, der die Ermittlung im Mordfall Dustin Miller geleitet hatte – es war inzwischen zweieinhalb Jahre her –, aber sie wusste, wenn sie die Polizei verständigte, würde sie es Lloyd sagen müssen, und das wollte sie noch nicht.
Stattdessen setzte sie sich nach Kaffee und Frühstück und als Lloyd zum Laufen gegangen war mit ihrem Laptop hin und tippte »Dustin Miller Tod« in die Suchmaschine. Sobald die Liste der Artikel auf dem Bildschirm erschien, überrollte Hen eine Welle aus Übelkeit und Aufregung. Vor drei Jahren hatte sie einer neuen Medikation zugestimmt, die ein neuer Psychopharmakologe nach Lloyds Jobwechsel und der damit verbundenen Änderung der Krankenversicherung empfohlen hatte. Das hatte zu einer manischen Phase geführt, in der sie nicht nur eine Unmenge Arbeit erledigt, sondern sich daneben auch obsessiv mit dem Mord an Dustin Miller beschäftigt hatte. Miller hatte in Hens und Lloyds ehemaliger Nachbarschaft gewohnt. Tatsächlich war sie sogar gerade im Huron Village von Cambridge spazieren gegangen, als sie gesehen hatte, wie die Rettungssanitäter eine Bahre mit einer Leiche darauf aus dem viktorianischen Haus rollten, das ein Stück weiter ihre eigene Straße hinunter stand. Sie war stehen geblieben und hatte beobachtet, wie Streifenwagen und Zivilfahrzeuge und schließlich zwei hochgewachsene Männer in grauen Anzügen eintrafen.
Am Abend berichteten dann die Nachrichten über den mutmaßlichen Mord an einem frischgebackenen Absolventen des Boston College, den man tot in seiner Wohnung aufgefunden hatte. Zunächst war Lloyd, schockiert über das Verbrechen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, genauso interessiert daran gewesen wie sie. Doch als mit der Zeit weitere Einzelheiten bekannt wurden, und als sich abzeichnete, dass die Polizei trotz »vielversprechender Spuren« keinen einzigen Verdächtigen ermittelt hatte, wurde Hens Verhalten immer obsessiver. Sie brütete über jeder noch so nebensächlichen Information, die die Polizei publik machte, und lief mehrmals täglich an dem rosafarbenen viktorianischen Haus vorbei. Es hatte kein Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gegeben, und Hen nahm an, dass Dustins Mörder ihn wahrscheinlich gekannt hatte. Man hatte ihn an einen Stuhl gefesselt gefunden, erstickt unter einer Plastiktüte über seinem Kopf, die mit Klebeband befestigt war. Einige Gegenstände hatten gefehlt, darunter seine Geldbörse, ein Laptop und eine Trophäe, die er bei den Junior Olympics im Fechten gewonnen hatte. Er hatte nicht am Boston College gefochten – dort hatte er Tennis gespielt –, aber er war Fechter in Sussex Hall gewesen, der privaten Highschool außerhalb von Boston, die er von der sechsten bis zur zwölften Klasse besucht hatte.
Dustin hatte eine Facebookseite hinterlassen, und Hen betrachtete sie stundenlang, nicht nur seine alten Posts und Bilder, sondern auch, was Freunde nach seinem Tod geschrieben hatten. Die meisten dieser Kommentare bezogen sich auf seinen letzten Post, eine Aufnahme von seiner Straße – Hens Straße –, die er selbst gemacht hatte, mit blühenden Birnbäumen und einem rosa gestreiften Himmel über den Hausdächern. In einer Ecke des Fotos bewegte sich eine Frau in einem kurzen Rock von Dustin fort. Die Bildunterschrift lautete: »Oh Gott, wie ich meine neue Straße liebe.« Hen las vor und zurück und versuchte dahinterzukommen, ob er sich schlicht auf die blühenden Bäume, die hübschen Häuser und den Frühling in der Luft bezog oder auf das langbeinige Mädchen, das er auf dem Bild eingefangen hatte.
»Du bist ein Mann, Lloyd. Was, denkst du, hat er gemeint? Hat er von dem Mädchen gesprochen?«
Lloyd hatte sich die Facebookseite einige Sekunden lang angesehen, ehe er antwortete: »Welche Rolle spielt das?«
»Er hat das Bild wahrscheinlich wenige Stunden vor seinem Tod aufgenommen.«
»Du glaubst, das Bild hat etwas mit dem Grund zu tun, warum er ermordet wurde?«
»Nein, das habe ich nicht gesagt. Es ist nur … findest du es nicht gruselig?«
»Doch, ich finde es sehr gruselig, und deshalb will ich nicht so viel darüber nachdenken und darüber reden. Und ich denke, du solltest es ebenfalls nicht tun.«
Seit Hen alt genug war, sich in der Bibliothek ihre eigenen Bücher auszusuchen, hatte sie eine morbide Ader besessen und sich mit dem Tod beschäftigt. Es war ihr nie als Belastung erschienen – sie hatte mit ihren düsteren, verstörenden Illustrationen mehrere Kunstauszeichnungen in der Highschool gewonnen –, aber in ihrem ersten Jahr am Camden College hatte sie dann ihren ersten manischen Schub gehabt, bei dem sich Anfälle ungezügelten Selbstbewusstseins in schneller Folge mit lähmender Unsicherheit abgewechselt hatten. Sie konnte nicht schlafen und blieb lange auf, um wie besessen ihre DVDs der ersten Staffel von Twin Peaks anzusehen. Im Morgengrauen schlief sie dann ein und begann ihre Vormittagskurse zu versäumen. Sie hatte unaufhörlich negative Gedanken, ihr Geist war ein Fiebertraum von Todesfantasien. Sie stellte sich ausgeklügelte Selbstmorde vor und kaute auf ihren Nägeln, bis sie bluteten. Etwa um diese Zeit fing sich Sarah Harvey, eine andere Erstsemesterstudentin auf ihrem Stockwerk, eine Grippe ein und wurde so krank, dass sie für den Rest des Semesters nach Hause abreisen musste. In Winthrop Hall machte das Gerücht die Runde, dass Sarahs Mitbewohnerin Daphne Myers absichtlich das Fenster in ihrem gemeinsamen Zimmer offen gelassen hatte, damit es Sarah noch schlechter ging. Hen entwickelte eine Fixierung auf Daphne – sie hatte sie vom ersten Moment an nicht gemocht, als sie sich im Einführungsseminar kennengelernt hatten –, und sie redete sich ein, dass Daphne nicht nur versucht hatte, Sarah kränker zu machen: Sie hatte versucht, ihre Mitbewohnerin zu töten. Es war absolut logisch. Die hochgewachsene, blonde Daphne mit den kalten Augen, die im Hauptfach Psychologie studierte, war eine Psychopathin.
Hen kam zu dem Schluss, dass ihr Lebenszweck, der Grund, warum sie zu genau dieser Zeit in Camden war, darin bestand, die Wahrheit über Daphne Myers herauszufinden. Sie begann sie pausenlos zu beobachten, und je mehr sie sie beobachtete, desto überzeugter war sie davon, dass Daphne ein böser Mensch war. Im November erzählte ihr Daphne, die allmählich immer freundlicher zu ihr wurde – was Hen sehr verdächtig vorkam –, sie werde von Psychologie zu Kunst wechseln, und fragte sie, welche Professoren sie empfehlen könne. Sie hatte Hen sogar eins ihrer Kunstwerke gezeigt, eine Bleistift- und Tuschezeichnung, die Hen wie eine dreiste Kopie ihres eigenen Stils erschien. Es war eine bewusste Provokation, und Hen ging erst zu ihrem Studienberater und dann zur Polizei, der sie erzählte, sie fühle ihr Leben durch Daphne Myers bedroht, die bereits versucht habe, Sarah Harvey zu ermorden. Bei beiden Gelegenheiten war Hen in hysterisches Weinen ausgebrochen. Ihre Eltern wurden verständigt, und Hens Mutter arrangierte einen Besuch, aber noch vor ihrer Ankunft lief Hen um drei Uhr morgens mit nichts weiter als einem übergroßen T-Shirt bekleidet aus Winthrop Hall. Ihre Haut knisterte vor Angst, und in ihrem Kopf surrte eine Kreissäge schrecklicher Gedanken, als sie einen Pflasterstein in Daphne Myers’ Fenster warf. Als Daphne aus dem eingeworfenen Fenster schaute, griff Hen sie an und schnitt sich dabei das Handgelenk an einer Glasscherbe auf. Sie wurde in der Notaufnahme behandelt und dann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, wo sie zehn Tage lang blieb. Sie verließ es mit der Diagnose einer bipolaren Störung und einer gerichtlichen Verfügung, die ihr verbot, sich Daphne Myers auf weniger als fünfhundert Meter zu nähern. Außerdem wurde sie wegen tätlichen Angriffs angeklagt.
Hens Vater, der Anwalt war, versuchte Daphne Myers’ Familie dazu zu überreden, dass sie die Klage fallenließen, aber sie weigerten sich. Am Ende wurde ein Vergleich erzielt. Hen stimmte fortgesetzter psychiatrischer Behandlung und gemeinnütziger Arbeit zu und erklärte sich außerdem – und nur zu gern – dazu bereit, Camden zu verlassen und nie mehr Kontakt mit Daphne aufzunehmen. Ihr Vater bat den Richter, die Zeugenaussagen unter Verschluss zu halten, und der Richter war einverstanden, aber nicht bevor etliche lokale Medien von der Sache Wind bekommen hatten. Daphne, das musste man ihr zugutehalten, sprach nie mit Reportern, und Hen tat es ebenfalls nicht, und so erkaltete die Sache schließlich trotz eines Artikels mit dem Titel: »Zickenkrieg zwischen Erstsemestern am Camden College nimmt tödliche Wendung.«
»Ich war mir sicher, dass es Schizophrenie ist, wegen deines Onkels«, sagte ihre Mutter, als sie mit Hen zurück nach Albany fuhr. »Aber jetzt stellt sich heraus, du bist nur total durchgeknallt wie alle andern in dieser Familie.« Sie lachte, dann entschuldigte sie sich. So war sie eben.
Nach einem Jahr, das sie wieder zu Hause verbracht hatte – sechs Monate davon in einem Loch, so tief und schwarz, dass sie glaubte, sie würde nie wieder Freude empfinden, und die andern sechs bei einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität –, schrieb sie sich an der State University of New York in Oneonta ein. Dort machte sie einer der Professoren mit der Technik des Gravierens bekannt, und ihr kam es vor, als hätte sie ihren Lebenszweck gefunden.
Lloyd, der alles über das Desaster von Hens erstem Jahr in Camden wusste, brachte es zur Sprache, als sie sich immer zwanghafter mit dem Tod von Dustin Miller beschäftigte.
»Das ist was anderes«, sagte Hen, und an Brust und Hals rötete sich ihre Haut vor Ärger.
»Inwiefern ist es anders?«
»Das hier ist ein Verbrechen, das tatsächlich passiert ist, in unserer Straße. Ich verfolge niemanden. Ich bin nicht paranoid.«
»Aber du bist zurzeit ein wenig manisch, das sehe ich dir an.«
Später, als alles schlimmer wurde, kam Hen zu der Überzeugung, dass Lloyd irgendwie auf einen Zauberknopf gedrückt hatte, als er das Wort manisch benutzte, und dass damit die dreimonatige Phase anfing, in der sie alle ungelösten Mordfälle der letzten zehn Jahre in Neuengland zu studieren begann und nach einer Verbindung zu Dustin Miller suchte. Zu dieser Zeit bekam sie außerdem Streit mit ihrer Schichtleiterin im Künstlerbedarfsladen, in dem sie in Teilzeit arbeitete. Sie ging nicht mehr hin und erklärte Lloyd, sie wolle sich ab jetzt nur noch ihrer Kunst widmen. Er sagte, dass sie es wahrscheinlich stemmen konnten, aber er wollte, dass sie dem Laden zumindest Bescheid gab.
»Vielleicht brauchst du eines schönen Tages ein Zeugnis«, gab er zu bedenken. »Ich finde einfach, du solltest diese Brücke nicht hinter dir abbrennen.«
»Du hast recht«, räumte Hen ein, aber sie konnte sich nicht dazu aufraffen, den Laden anzurufen. Sie hörte schlicht auf, das Haus zu verlassen, begrub sich in ihrer Arbeit und studierte ungelöste Mordfälle (inzwischen suchte sie auch außerhalb Neuenglands nach möglichen Spuren). Eines Tages im November wachte sie dann spät am Vormittag auf und war völlig durcheinander, alles tat ihr weh, und jedes Verlangen, ein Kunstwerk zu schaffen, war in ihr erloschen. Als Lloyd nach Hause kam, lag sie immer noch im Bett. Er versuchte mit ihr zu reden, aber sie konnte nicht aufhören zu weinen.
»Wir stehen das durch«, versprach er. »Aber du musst mir einen Gefallen tun, okay?«
»Okay.«
»Wenn du Selbstmordgedanken hast, musst du mir Bescheid sagen. Du darfst mich nicht verlassen, egal, was passiert. Du musst am Leben bleiben.«
Hen versprach Lloyd, dass sie ihn nicht verlassen werde, und am Ende hielt sie ihr Versprechen. Zwei Monate lang lebte sie in einer Welt aus Furcht und Beklemmung, und ihre einzigen konstruktiven Gedanken galten möglichen Methoden, sich umzubringen. Aber sie hatte Lloyd ein Versprechen gegeben, auch wenn sie in ihrem tiefsten Innern wusste, dass er ohne sie besser dran wäre. Schließlich, nach einem Tag, an dem sie sich ans Steuer ihres gemeinsamen Autos gesetzt hatte, weil sie ans Meer fahren wollte, um sich zu ertränken, erklärte sie Lloyd bei seiner Rückkehr von der Arbeit, dass sie ins Krankenhaus musste. Er fuhr sie noch am selben Abend in die Notaufnahme.
Hen verbrachte zwei Wochen auf einer psychiatrischen Station, dann weitere zwei in ambulanter Betreuung, bei der sie neben einem neuen Medikamentencocktail eine Reihe von Elektroschockbehandlungen erhielt. Allmählich begann sie sich besser zu fühlen. Ihr altes Leben kehrte zurück – sie wollte Kunst schaffen, Freunde treffen, Reisen planen. Mit der Zeit rückte diese schreckliche Phase in die Vergangenheit. Sie bekam mehr Aufträge für Illustrationen angeboten, als sie annehmen konnte, und ihre Fixierung auf Dustin Miller und ungelöste Mordfälle im Allgemeinen verschwand. Einer der Vorteile der Elektroschocktherapie war, dass ihre Erinnerung an die gesamte Episode bestenfalls verschwommen war, und manches war komplett verlorengegangen. Sie und Lloyd, die immer erwogen hatten, Kinder zu bekommen, trafen die endgültige Entscheidung, auf sie zu verzichten. Stattdessen einigten sie sich darauf, aus Cambridge wegzuziehen und sich ein größeres Haus irgendwo auf dem Land zu suchen.
Sie trank ihren Kaffee aus, der in der Tasse kalt geworden war. Jetzt, da sie sich wieder mit dem Fall Dustin Miller vertraut gemacht hatte, war sie noch überzeugter als am Abend zuvor, dass ihr neuer Nachbar Dustins Mörder war. Das meiste von dem, was sie gelesen hatte, waren alte Nachrichten, aber der Boston Globe hatte einen großen Sonderbericht über den ungelösten Mordfall gebracht. Er war im Juli erschienen, als Hen gerade ihren anstrengenden Umzug organisierte (»Wir ziehen danach nie wieder um, das ist dir klar?«, hatte Lloyd ihr versichert), und irgendwie hatte sie ihn übersehen. Er enthielt nicht wahnsinnig viele neue Informationen, aber es hieß darin, dass man Dustin in seiner Zeit in Sussex Hall beschuldigt hatte, eine Mitschülerin sexuell genötigt zu haben. Entweder Hen hatte dieses Detail vergessen, oder es war jetzt erst enthüllt worden. Nein, dachte sie, nie im Leben hätte sie das vergessen. Ausgeschlossen. Damit fügte sich alles zusammen. Der angebliche sexuelle Übergriff hatte sich während der Junior Olympics ereignet, die in jenem Jahr in St. Louis stattgefunden hatten. Ihr Nachbar Matthew Dolamore, der Lehrer in Sussex Hall war, kannte Dustin natürlich – wahrscheinlich war er einer seiner Schüler gewesen. Vielleicht wusste Matthew, dass der – niemals bewiesene – sexuelle Übergriff tatsächlich passiert war. Fünf Jahre später ermordete er Dustin aus Rache oder aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus und nahm die Fechttrophäe an sich. Es war irgendwie absurd, aber durchaus möglich. Hen musste die Trophäe jedoch noch einmal sehen und sich überzeugen, dass Datum und Ort darauf stimmten. Dann und nur dann würde sie die Polizei anrufen. Es war ihre Pflicht, oder etwa nicht? Vielleicht konnte sie es sogar anonym tun.
Hen klappte ihren Computer zu, trat auf die vordere Veranda hinaus und warf einen Blick auf das Haus der Dolamores nebenan. In der Einfahrt stand kein Wagen, aber wie bei ihrem Haus gab es am Ende der Zufahrt eine Einzelgarage. Trotzdem erinnerte sie sich, am Vorabend einen kleineren, dunklen Wagen dort gesehen zu haben. Wie sollte sie die Wahrheit über die Trophäe herausfinden? Sie konnte versuchen, sich ins Haus zu schleichen, während Matthew und Mira nicht da waren, oder noch besser, sie ließ sich von Mira noch einmal zu ihnen einladen. Vielleicht könnte sie ihr eine E-Mail schicken und fragen, ob sie sich noch einmal in ihrem Haus umsehen dürfe, um ein paar Einrichtungsideen zu bekommen. Immerhin hatten sie denselben Grundriss.
Draußen war es warm, wärmer als im Haus. Hen zog ihren Pullover aus, setzte sich in einen der Schaukelstühle und neigte das Gesicht Richtung Sonne. In dieser Haltung saß sie noch immer da, als Lloyd schweißtriefend und schwer atmend von seinem Lauf zurückkehrte.
»Hier gefällt es mir sehr«, sagte er, während er sich am Verandageländer festhielt und seine Beine dehnte.
»Meinst du das Haus oder die Stadt?«, fragte Hen.
»Beides«, erwiderte er. »Wie steht es mit dir?«
»Mir geht’s genauso«, entgegnete sie und stand auf. Der warme Wind wehte den Duft von frisch gekochtem Essen heran, und Hen war plötzlich hungrig.
Kapitel 4
Mira ging selten in sein Arbeitszimmer, aber am Sonntagabend traf Matthew sie dort an. Sie putzte sich die Zähne und betrachtete die Bücher im Regal.
»Ich brauche neuen Lesestoff«, erklärte sie, und Schaumflocken spritzten von ihren Lippen. »Sorry«, sagte sie und ging hinaus.
Sie kam ohne Zahnbürste wieder. Ihr Haar wurde von einem Stirnband zurückgehalten, sie hatte sich abgeschminkt, und ihre Haut glänzte noch von der Feuchtigkeitscreme, die sie jeden Abend auftrug.
»Wie wär’s mit dem?«, schlug Matthew vor und gab ihr Die Säulen der Erde.
»Es ist so dick«, sagte sie. »Außerdem brauche ich ein Taschenbuch.«
»Wann geht dein Flug?«, fragte Matthew. Ihm war eben eingefallen, dass sie am nächsten Tag nach Charlotte aufbrach.
»Erst um drei Uhr nachmittags. Ich hab den ganzen Vormittag frei.«
»Hast du Alibi für einen König gelesen?« Matthew gab ihr ein altes, abgenutztes Taschenbuch. Auf dem Cover war eine umgekippte Schachfigur zu sehen, der König.
»Es ist ein Kriminalroman, aber es geht um Richard III.«
»Okay. Gefällt mir. Es ist dünn.« Sie blätterte die erste Seite auf. »Wer ist Christine Truesdale?«
»Weiß ich nicht. Ich habe es gebraucht gekauft.«
Mira las den handschriftlichen Eintrag. »›Christine Truesdale, gelesen am 17. März 1999. Fünf Sterne.‹ Jedenfalls hat es ihr gefallen.«
»Du wirst es lieben. Es ist sehr gut.«
»Hey, was ist aus deiner Trophäe geworden?«, fragte Mira und sah zum Kaminsims, wo Dustin Millers Siegespreis gestanden hatte. Matthew hatte sie durch eine Nachbildung des Steins von Rosetta ersetzt, die er im British Museum gekauft hatte.
»Ach, ich hatte wohl einfach genug davon. Ich dachte, ich wechsle sie aus.«
Mira trat vor und berührte den Rosetta-Stein. »Hen von nebenan hat sich ziemlich für die Trophäe interessiert, hast du das bemerkt?«
»Nein, ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Vielleicht war sie früher Fechterin.«
Später im Bett lasen sie beide ihre Bücher, Mira fing mit Alibi für einen König an, während Matthew Der ferne Spiegel zu Ende las, wahrscheinlich zum dritten Mal. Er liebte Geschichte insgesamt, aber nichts fesselte ihn so sehr wie das Mittelalter, es musste an der Allgegenwart des Todes liegen, am geringen Wert des Lebens, der Rohheit und Lebendigkeit dieser Zeit.
»Glaubst du, wir sehen sie wieder?«, fragte Mira unvermittelt.
Matthew wusste, dass sie von ihren Nachbarn sprach, von Lloyd und Hen, aber er fragte dennoch nach: »Wen?«
»Hen und Lloyd von nebenan.«
»Die sehen wir bestimmt wieder und wahrscheinlich ziemlich oft. Sie wohnen ja direkt neben uns.«
»Du weißt, was ich meine. Ob wir noch mal was mit ihnen unternehmen?«
Matthew und Mira stritten sehr selten – keiner von beiden war auch nur im Entferntesten streitlustig –, aber Mira brachte häufig den Umstand zur Sprache, dass sie sich mehr Freunde wünschte. Sie hatte nie davon gesprochen, als sie noch aktiv versucht hatten, Kinder zu bekommen, aber jetzt, nachdem sie zu dem Schluss gekommen waren, dass es kein Kind geben würde, tat sie es oft.
»Ich weiß nicht. Es war nicht gerade ein prickelnder Abend, oder?« Er fühlte sich schlecht, kaum dass er es ausgesprochen hatte.
»Was? Dir hat es nicht gefallen?«
»Es hat Spaß gemacht. Es war nett. Nur … es ist nicht unbedingt ein Funke übergesprungen.«
Mira rieb sich die Schläfe. »Mit Hen hatte ich schon ein bisschen das Gefühl. Sie war interessant, findest du nicht?«
»Doch. Du solltest sie auf jeden Fall wiedertreffen. Wir müssen ja nicht immer alles als Paar machen.«
»Ich weiß. Aber es wäre trotzdem nett, wenn es funktionieren würde.«
»Geh doch mal mit ihr zum Lunch«, schlug Matthew vor.
»Das mache ich«, sagte Mira, dann fügte sie hinzu: »Du warst nicht so begeistert von Lloyd, oder?«
»Ach«, sagte Matthew, »er war okay. Aber nichts im Vergleich zu Hen. Ich denke, er hat Glück gehabt mit ihr.«
»Das sagst du immer.«
»Und meistens habe ich recht.«
Sie lasen weiter. Wie üblich legte Mira ihr Buch als Erste auf den Nachttisch, machte ihre Lampe aus und schmiegte sich an Matthew. »Ich weiß nicht, wo ich ohne dich wäre«, sagte sie wie jeden Abend, zumindest wenn sie zusammen im Bett lagen. Es war ihre Art, Gute Nacht zu sagen. Außerdem war es eine Art Gebet, dachte Matthew. Er hätte einmal fast eine entsprechende Bemerkung gemacht, aber dann wurde ihm klar, dass es sich anhörte, als hielte er sich für einen Gott.
Matthew las weiter, bis Mira eingeschlafen war. Sie brauchte nur etwa zehn Minuten. Dann drehte sie sich immer von ihm weg, ihre Atmung verlangsamte sich, und meistens murmelte sie unverständliche Worte vor sich hin. Matthew klappte sein eigenes Buch zu, löschte seine Lampe und legte sich dann auf den Rücken. Ein schummriges Grau beherrschte das Zimmer, es war nie so pechschwarz wie in dem Zimmer, in dem er die ersten siebzehn Jahre seines Lebens geschlafen hatte. Er war hellwach; das war er immer, wenn er mit dem Prozess des Einschlafens begann. Es war seine liebste Zeit des Tages, und er dachte darüber nach, welche Geschichte er sich selbst zum Einschlafen erzählen würde. In letzter Zeit war es immer eine von zweien gewesen: In der ersten reiste er in der Zeit zurück, fast genau ein Jahr, als er nach New Jersey hinuntergefahren war und Bob Shirley in der Wohnung ermordet hatte, die er vor seiner Frau geheim hielt. Bob, ein Stadtrat, der mit seinem Vater befreundet gewesen war, war alt und schwach gewesen, und Matthew hatte sich auf seine Brust gekniet und ihm Mund und Nase zugehalten. Die andere Geschichte, die er sich in letzter Zeit immer wieder erzählte, beschäftigte sich damit, was er mit dem Freund seiner Kollegin Michelle anstellen würde, falls sich ihm die Möglichkeit bot, mit ihm allein zu sein. Das war eigentlich die Bettgeschichte, die er sich im Moment am häufigsten erzählte. Aber wegen der Fechttrophäe und wie es sich angefühlt hatte, sie nach so vielen Jahren wieder in der Hand zu halten, beschloss er, sich einem Klassiker zuzuwenden: der Geschichte von Dustin Miller.