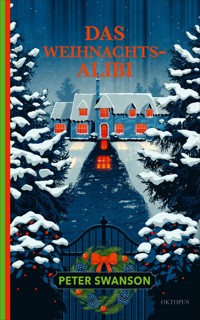Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Erinnern Sie sich an mich?« Als Joan Whalen unangekündigt in seinem Detektivbüro steht, ist für Henry Kimball mit einem Mal die Vergangenheit zurück. Schreckliche Erinnerungen werden wach, an eine Tragödie, die sich in seinem früheren Leben als Englischlehrer an einer Highschool ereignete. Joan war damals seine Schülerin, und sie hatte schon immer etwas Gefährliches an sich. Jetzt, fünfzehn Jahre später, beauftragt sie ihren einstigen Lehrer, ihren Mann zu beschatten. Joan weiß, dass er sie betrügt. Nur beweisen kann sie es nicht. Was wie ein routinemäßiger Fall von Ehebruch beginnt, nimmt eine völlig neue Wendung, als Kimball in einem leer stehenden Vorstadthaus zwei Leichen findet. Der Weg zur Wahrheit führt den Privatdetektiv an einen der schlimmsten Tage seines Lebens zurück. Weiß Joan mehr, als sie all die Jahre zugegeben hat?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Swanson
Drei sind einer zu viel
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Für David Highfill
Teil 1Das zarte Alter von Mördern
1Kimball
»Erinnern Sie sich an mich?«, fragte sie, als sie die Tür meines Büros öffnete.
»Ja«, sagte ich, bevor ich sie wirklich zuordnen konnte. Aber bekannt kam sie mir vor, und einen schrecklichen Augenblick lang fragte ich mich, ob sie eine Cousine von mir war oder eine verflossene Freundin, die ich komplett vergessen hatte.
Sie machte einen Schritt in den Raum hinein. Sie war klein und gebaut wie eine Turnerin, mit breiten Schultern und kräftigen Beinen. Ihr Gesicht war ein Kreis, die einzelnen Züge – blaue Augen, Stupsnase, runder Mund – in seiner Mitte gebündelt. Sie trug dunkle Jeans und eine braune Tweedjacke, was den Eindruck erweckte, als wäre sie gerade von einem Pferd gestiegen. Ihr schulterlanges, glänzend schwarzes Haar war auf der Seite gescheitelt. »Leistungskurs Englisch«, sagte sie.
»Joan«, sagte ich, als wäre mir der Name gerade gekommen, aber sie hatte natürlich einen Termin mit mir ausgemacht und dabei ihren Namen genannt.
»Inzwischen Joan Whalen, aber als ich Sie noch als Lehrer hatte, war ich Joan Grieve.«
»Stimmt, Joan Grieve«, sagte ich. »Natürlich erinnere ich mich an Sie.«
»Und Sie sind Mr. Kimball«, sagte sie und lächelte dabei zum ersten Mal, seit sie den Raum betreten hatte. Und als sie dabei ihre kleinen Zähne zeigte, erinnerte ich mich wirklich an sie. Sie war eine Turnerin gewesen, eine beliebte, kokette, überdurchschnittliche Schülerin, die es allein durch die Art, meinen Namen zu sagen, schaffte, dass ich mich ein wenig unbehaglich fühlte – etwa so, als wüsste sie etwas Nachteiliges über mich. Und dieses Unbehagen verflog nicht. Ich erinnerte mich nur sehr ungern an meine Zeit als Lehrer an der Dartford-Middleham High School.
»Sie können mich gern Henry nennen«, sagte ich.
»Irgendwie passt das nicht so richtig. Für mich sind Sie immer noch Mr. Kimball.«
»Ich glaube nicht, dass noch jemand Mr. Kimball zu mir gesagt hat, seit ich den Job in der Schule aufgegeben habe. Haben Sie gewusst, wer ich bin, als Sie diesen Termin mit mir vereinbart haben?«
»Gewusst habe ich es nicht, aber sagen wir mal, ich habe es vermutet. Ich wusste, dass Sie bei der Polizei waren, und dann habe ich gehört … na ja, Sie wissen schon, was alles passiert ist … und irgendwie hat es gepasst, dass Sie jetzt Privatdetektiv sind.«
»Na, dann kommen Sie rein. Es freut mich, Sie zu sehen, Joan. Trotz der Umstände. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Kaffee oder Tee? Wasser?«
»Nein danke, eigentlich nicht. Aber wenn Sie schon fragen, ein Wasser vielleicht.«
Während ich eine Flasche Wasser aus dem Minikühlschrank in der Südecke meines Zwanzig-Quadratmeter-Büros nahm, steuerte Joan auf das einzige Bild zu, das an den Wänden hing, einen gerahmten Druck eines Aquarells der Grantchester Meadows in der Nähe von Cambridge. Ich hatte das Bild vor ein paar Jahren auf einer Reise gekauft – nicht weil es mir besonders gut gefiel, sondern weil eines meiner Lieblingsgedichte von Sylvia Plath »Watercolor of Grantchester Meadows« hieß. Und ich fand, es konnte nicht schaden, so etwas zu besitzen. Nachdem ich das Büro angemietet hatte, kramte ich den Druck hervor. Ich wollte ein beruhigendes Bild an der Wand haben – so wie in Zahnarztpraxen und Kanzleien von Scheidungsanwälten immer tröstliche Kunst hängt, die ihren Patienten und Mandanten helfen soll zu vergessen, wo sie sind.
Während ich hinter meinen Schreibtisch ging, öffnete Joan die Wasserflasche und setzte sich. Ich verstellte wegen der schräg in den Raum fallenden Nachmittagssonne die Jalousie, und Joan nahm mit zusammengekniffenen Augen einen großen Schluck. Bevor ich mich ebenfalls setzte, stieg eine lebhafte Erinnerung in mir hoch, wie ich vor einem Dutzend Jahren mit vor Aufregung feuchten Achselhöhlen vor den Schülern meiner Englischklasse stand, die mich kritisch musterten. Fast konnte ich den Kreidestaub in der Luft wieder riechen.
Ich ließ mich in meinen Lederdrehstuhl sinken und fragte Joan Whalen, was ich für sie tun könnte.
»Eigentlich was ganz Banales«, sagte sie und verdrehte leicht die Augen.
Ich merkte, sie wollte, dass ich riet, weshalb sie mich aufgesucht hatte, aber ich blieb still.
»Es geht um meinen Mann«, sagte sie schließlich.
»Mhm.«
»Wie gesagt, ist das wahrscheinlich etwas, was Sie die ganze Zeit zu hören bekommen, aber ich bin ziemlich sicher … nein, ich weiß, dass er mich betrügt. Die Sache ist die, eigentlich ist es mir ziemlich egal – meinetwegen kann er tun, was er will –, aber obwohl ich weiß, dass er fremdgeht, habe ich noch keine Beweise. Ich weiß es nicht sicher.«
»Haben Sie vor, die Scheidung einzureichen, sobald Sie es sicher wissen?«
Sie zuckte mit den Achseln, und bei dieser fast kindlichen Geste roch ich erneut Kreide. »Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Was mich vor allem daran stört, ist, dass er damit durchkommt, dass er damit durchkommt, eine Affäre zu haben. Ich habe selbst versucht, ihm zu folgen, aber er kennt natürlich mein Auto, und ich will einfach Gewissheit haben. Ich will die Einzelheiten wissen. Wer sie ist. Obwohl ich auch das ziemlich sicher zu wissen glaube. Wohin sie gehen. Wie oft. Wie gesagt, es ist mir scheißegal, außer dass er damit durchkommt.« Sie schaute über meine Schulter zum einzigen Fenster des Büros. Wenn das Licht am Spätnachmittag darauf fiel, konnte man sehen, wie schmutzig es war, und ich nahm mir vor, es zu putzen, wenn ich die Zeit dazu fand.
Ich zog mein Notizbuch zu mir heran und schraubte die Kappe meines Füllfederhalters ab. »Wie heißt Ihr Mann, und was macht er beruflich?«, fragte ich.
»Er heißt Richard Whalen und ist Immobilienmakler. Er hat eine eigene Firma, Blackburn Properties. Sie haben Filialen in Dartford und Concord, aber meistens ist er in dem Büro in Dartford. Dort ist auch seine Chefsekretärin Pam O’Neil, und sie ist es auch, mit der er ins Bett geht.«
»Woher wissen Sie das?«
Sie hob die Faust und reckte dabei den Daumen. »Erstens ist sie die einzige wirklich hübsche Angestellte in seinem Büro. Und nicht nur hübsch, sondern auch jung, was ganz nach Richards Geschmack ist. Zweitens ist Richard zwar ein großer Lügner, aber kein besonders guter, und als ich ihm auf den Kopf zugesagt habe, dass er mit Pam was hat, konnte er mir nicht in die Augen schauen.«
»Haben Sie ihm schon früher vorgeworfen, Affären zu haben?«
»Die Sache ist die. Ich glaube nicht, dass er früher mal eine Affäre hatte, keine richtige jedenfalls. Er nimmt jedes Jahr in Las Vegas an so einem Pseudokongress für Makler teil, und ich bin sicher, dass er dort mit einer Stripperin oder jemandem in der Art angebandelt hat. Aber das ist nicht das Gleiche wie eine Affäre. Und dazu kommt noch, dass ich mit Pam eigentlich befreundet bin. Als sie bei Blackburn anfing, lud ich sie zu den Treffen meines Lesekreises ein, zu denen sie auch ein paarmal kam, obwohl niemand von uns den Eindruck hatte, dass sie eines der Bücher gelesen hatte.
Ich war nett zu ihr. Ich habe sie sogar mit dem Typen bekannt gemacht, der sich für meinen Mann um die Investments kümmert, und sie sind eine Weile miteinander ausgegangen. Ich war selbst mindestens dreimal was trinken mit ihr.«
»Wann, glauben Sie, ging das mit den beiden los?«
»Ich vermute, etwa um die Zeit, als Pam aufhörte, mir Textnachrichten zu schicken. Das war vor drei Monaten. Sie vertuschen es so schlecht, dass man fast denken könnte, sie wollen erwischt werden. Mit so was müssen Sie doch ständig zu tun haben?«
Es war das zweite Mal, dass sie das zur Sprache brachte, und ich verzichtete darauf, ihr zu sagen, dass ich nicht ständig mit so etwas zu tun hatte, weil meine einzigen festen Klienten eine Zeitarbeitsfirma, für die ich Hintergrundüberprüfungen durchführte, und eine achtzigjährige Frau waren, die gleich um die Ecke von meinem Büro wohnte und deren Katzen ständig verschwanden.
»Wenn Sie mich fragen«, sagte ich, »versuchen sie wahrscheinlich, es geheim zu halten, schaffen es aber nicht. Was vermutlich heißt, dass Ihr Mann und auch Pam vorher keine Affären hatten. Gut darin, so etwas zu verheimlichen, sind vor allem Leute, die darin schon Übung haben.«
Darüber dachte sie kurz stirnrunzelnd nach. »Wahrscheinlich haben Sie recht, aber eigentlich ist mir herzlich egal, ob mich mein Mann zum ersten Mal betrügt oder nicht. Ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber wenn ich ehrlich bin, ärgere ich mich über Pam deutlich mehr als über ihn. Ich weiß nicht, was sie sich eigentlich dabei denkt. Haben Sie übrigens noch weiter unterrichtet, nachdem wir vom Leistungskurs damals unseren Abschluss gemacht haben? Dass Sie im nächsten Schuljahr nicht mehr zurückgekommen sind, weiß ich.«
Das war ein abrupter Themenwechsel, und das hatte zur Folge, dass ich aufrichtig antwortete. »Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich noch mal einen Fuß in diese Schule hätte setzen können. Zwar hatte ich deswegen ein furchtbar schlechtes Gewissen, aber es waren sowieso nur noch zwei Wochen.«
»Sie haben danach nie mehr unterrichtet?«
»Nein, an einer Highschool nicht. Ich gebe zwar gelegentlich Lyrikseminare für Erwachsene, aber das ist etwas völlig anderes.«
»Der Basketballer«, sagte sie, und ihre Miene leuchtete auf, als wäre ihr gerade eine Frage eines Trivia-Quiz eingefallen.
Ich muss sie leicht verständnislos angesehen haben, denn sie fügte hinzu: »Jetzt fällt es mir wieder ein. Im letzten Monat haben Sie uns nur noch Gedichte lesen lassen. Sie wussten, dass unsere Konzentration für ganze Bücher nicht mehr reichen würde.«
»Richtig«, sagte ich.
»Und wir haben dieses Gedicht über einen Jungen gelesen, der …«
»Ach ja, stimmt. Von John Updike. Das Gedicht hieß ›Ex-Basketball Player‹. Daran habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr …«
»Und Sie hatten einen heftigen Streit mit Ally Eisenkopf, weil sie fand, Sie würden den Symbolcharakter des Gedichts künstlich hochspielen.«
»Einen heftigen Streit würde ich es nicht nennen, eher eine angeregte intellektuelle Diskussion.« Und jetzt erinnerte ich mich wieder an diesen Tag im Klassenzimmer, als wir das Gedicht Zeile für Zeile analysieren wollten. Ich hatte einen Stadtplan mit der im Gedicht beschriebenen Tankstelle und der Straße, in der sie lag, auf die Tafel gezeichnet. Ich versuchte zu demonstrieren, dass die einzelnen Elemente eines relativ einfachen Gedichts wie »Ex-Basketball Player« von John Updike so exakt ineinandergreifen konnten wie die Rädchen eines Uhrwerks und dass jedes Wort unter Berücksichtigung von Text wie Subtext ganz bewusst gewählt worden war. Die Schüler, die aufpassten, protestierten heftig; sie waren fest davon überzeugt, dass ich Dinge in das Gedicht hineinlas, die gar nicht da waren. Ich sagte ihnen, ich fände es erstaunlich, dass sie bereit seien zu glauben, dass jemand imstande war, zum Mond zu fliegen oder Computerprogramme zu entwickeln, es aber zugleich für ausgeschlossen hielten, dass die in einem Gedicht beschriebene Lage einer Tankstelle eine Metapher für das festgefahrene Leben eines ehemaligen Basketballcracks sein konnte.
Ally Eisenkopf, eine meiner meinungsstärkeren Schülerinnen, war sichtlich in Rage geraten und hielt mir vor, ich hätte mir alles nur aus den Fingern gesogen, etwa so, als wollte ich ihr weismachen, der Himmel sei nicht blau. Es überraschte mich, dass sich Joan ausgerechnet an diese Unterrichtsstunde erinnern konnte, und das sagte ich ihr auch.
»Ich habe ein gutes Gedächtnis, und Sie waren ein guter Lehrer. Ich war in diesem Schuljahr sehr beeindruckt von Ihnen.«
»Na ja«, sagte ich. »Sie vielleicht, aber sonst niemand.«
»Sie wissen schon, dass Richard, mein untreuer Ehemann, auch auf die DM ging.«
Ich brauchte eine Weile, bis ich schaltete, dass damals die Schüler die Dartford-Middleham High School DM nannten. »Nein, das wusste ich nicht. Hatte ich ihn auch als Schüler?«
»Nein, natürlich nicht. Er hat ganz sicher nicht den Leistungskurs Englisch belegt.«
Es überraschte mich, dass Joan ihren Highschoolfreund geheiratet hatte. Dartford und Middleham waren vielleicht nicht so nobel wie einige der umliegenden Städte wie Concord oder Lincoln, aber die meisten Schüler der staatlichen Highschool gingen anschließend auf vierjährige Colleges, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass viele von ihnen ihre Highschool-Sweethearts geheiratet hatten.
»Waren Sie damals schon mit ihm zusammen, auf der Highschool?«
»Mit Richard? Natürlich nicht. Ich kannte ihn natürlich, er war nämlich ein super Fußballspieler, aber es war purer Zufall, dass wir zusammengekommen sind. Kennengelernt haben wir uns in Boston, wo ich ein Jahr nach dem College gelebt habe, und er war noch an der Boston University und hat in Allston, wo ich gewohnt habe, als Barkeeper gejobbt.«
»Wo wohnen Sie beide jetzt?«
»In Dartford, muss ich leider sagen. Im Haus von Richs Eltern. Nicht mit ihnen zusammen. Sie leben inzwischen in Florida, aber sie haben uns das Haus verkauft, und das Angebot war so günstig, dass wir es unmöglich ausschlagen konnten. Wahrscheinlich brauchen Sie unsere Adresse und sonst alles, wenn Sie Rich beschatten werden?« Sie zog ihre Schulter leicht zurück und reckte den Kopf. Eine Geste, an die ich mich erinnerte.
»Wollen Sie wirklich, dass ich das für Sie tue? Wenn Sie bereits wissen, dass er fremdgeht …«
»Ich bin ganz sicher. Aber wenn ich keine Beweise habe, wird er es einfach abstreiten.«
Darauf sprachen wir über die Bedingungen, und ich einigte mich mit ihr auf ein Honorar, das etwas unter meinem üblichen Satz lag. Sie war eine ehemalige Schülerin, und es war nicht gerade so, dass ich keine Zeit hatte. Danach erzählte sie mir noch alles Mögliche über Richards Maklerbüro und weshalb sie überzeugt war, dass sich ihre Treffen auf die Bürozeiten beschränkten. »Und nur damit Sie’s wissen. Das ist der optimale Beruf, um eine Affäre zu haben«, erklärte sie mir.
»Lauter leere Häuser«, sagte ich.
»Genau. Jede Menge leerer Häuser, jede Menge Vorwände, sie aufzusuchen. Das hat er mir früher mal erzählt, als zwei seiner Angestellten was miteinander hatten und er dem Ganzen ein Ende machen musste.«
Ich erfuhr noch weitere Einzelheiten von ihr, dann sagte ich ihr, ich würde einen Vertrag aufsetzen und ihr per Mail zum Unterschreiben zuschicken. Und sobald ihre Unterschrift und die Anzahlung bei mir eingegangen seien, würde ich mich an die Arbeit machen.
»Konzentrieren Sie sich auf Pam«, sagte sie. »Er hat was mit ihr, ganz sicher.«
Nachdem Joan mein Büro verlassen hatte, stellte ich mich an das Fenster mit Blick auf die Oxford Street und beobachtete, wie sie abgefallene Ginkgoblätter von ihrem Acura zupfte, bevor sie einstieg. Es war ein schöner Tag, die Zeit des Jahres, wenn eine Hälfte des Laubs noch an den Bäumen ist und die andere vom Wind durch die Straßen geweht wird. Ich kehrte an den Schreibtisch zurück, öffnete eine Word-Datei und machte mir Notizen zu meinem neuen Fall. Es war eigenartig gewesen, Joan wiederzusehen, einerseits erwachsen und zugleich immer noch die Alte. Ich merkte, dass ich mir die Phase zu vergegenwärtigen begann, als ich zum letzten Mal mit ihr zu tun gehabt hatte, aber stattdessen versuchte ich, mich auf das zu konzentrieren, was sie mir über ihren Mann erzählt hatte. Eine Ehefrau hatte ich schon einmal beschattet, aber einen Ehemann noch nicht. In diesem früheren Fall, der etwas mehr als ein Jahr zurücklag, hatte sich herausgestellt, dass die Frau nicht fremdging, sondern eine Spielerin war und heimlich nach New Hampshire hochfuhr, um dort in Pokerzimmern ihrem Laster zu frönen. Diesmal glaubte ich allerdings, aus welchem Grund auch immer, dass Joans Mann genau das tat, was sie vermutete. Aber ich schärfte mir ein, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Mit den Ermittlungen für einen Fall zu beginnen, ließ sich am ehesten damit vergleichen, ein neues Buch aufzuschlagen oder sich hinzusetzen, um einen Film anzusehen. Am besten, man ging ohne irgendwelche Erwartungen an die Sache heran.
Als ich mein Büro abschloss und das Haus verließ, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass es bereits dämmerte. Auf dem Heimweg durch die laubübersäten Straßen von Cambridge war ich einerseits froh, einen bezahlten Auftrag zu haben, andererseits bedrückte es mich ein wenig, Joan nach so vielen Jahren wiedergesehen zu haben.
Es war Mitte Oktober, und jedes dritte Haus war mit Halloween-Dekorationen geschmückt: Kürbisse, künstliche Spinnweben, Plastikgrabsteine. Eines der Häuser, an denen ich regelmäßig vorbeikam, war von riesigen künstlichen Spinnen überzogen, und eine Mutter war mit ihren zwei Kindern, eines davon noch in einem Buggy, hergekommen, um es ihnen zu zeigen. Das ältere der zwei Kinder, ein Mädchen, deutete mit echtem Entsetzen auf eine der Spinnen und sagte seiner Mutter, dass jemand die grusligen Tiere zerquetschen solle.
»Aber nicht ich«, sagte die Mutter. »Dafür wäre ein Riese nötig.«
»Dann holen wir doch einen Riesen«, sagte die Kleine.
Die Mutter fing meinen Blick auf, als ich an ihnen vorbeiging, und lächelte. »Ich kriege das auch nicht hin«, sagte ich. »Ich bin zwar groß, aber kein Riese.«
»Dann lass uns lieber gehen«, sagte das Mädchen sehr ernst. Ich setzte meinen Weg fort und hing dunklen Gedanken nach, um sie jedoch, wie ich es mir beigebracht hatte, rasch wieder zu verwerfen.
2Joan
Bevor Joan mitbekam, dass Richard im Windward Resort war, lernte sie seinen Cousin Duane kennen. Es war ihre erste Nacht in dem Strandhotel in Maine, ein Samstag im August, heiß und schwül, die Luft voller Mücken, der Beginn eines zweiwöchigen Sommerurlaubs mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Joan war fünfzehn.
Duane machte sich an sie heran, als sie, um sich von ihrer Familie abzusetzen, zu einem Strandspaziergang am Kennewick Beach aufbrach. Er war ein muskulöser Teenager, wahrscheinlich in seinem letzten Highschooljahr.
»Hi, ich hab dich im Windward gesehen«, sagte er. »Seid ihr gerade angekommen?«
Auch sie hatte ihn gesehen. In der Lobby, wo er mit weit gespreizten Beinen auf einer der Couchen vor dem Speisesaal gesessen hatte. Er hatte eine schlechte Haltung und einen tiefen Haaransatz und sah deswegen ein bisschen wie ein Höhlenmensch aus.
»Ja, wir sind heute angekommen«, sagte Joan und ging einfach weiter.
»Ganz schön ätzend hier. Nur alte Leute im Hotel.«
»So schlimm finde ich es gar nicht«, sagte Joan, obwohl sie ihm grundsätzlich recht gab. »Und der Strand ist richtig klasse.«
»Ja, der Strand bringt’s echt. Ich hab ja auch nur das Hotel gemeint. Trotzdem, wenn es dunkel wird, ist hier tote Hose. Renn doch nicht so, was gehst du so schnell?«
Joan blieb stehen und drehte sich zu ihm um.
»Ich bin Duane«, sagte der Junge.
»Und ich Joan.«
»Also, wie gesagt, abends ist hier nichts los. Aber heute um zehn treffen sich ein paar von uns am Strand, um ein Feuer zu machen. Wäre super, wenn du auch kommst. Wenn du Lust hast.«
»Wer kommt da alles?«
»Derek, ein echt cooler Typ. Im Hotel arbeitet er als Hilfskellner, aber im Sea Grill ist er ein richtiger. Er hat mir schon ein paarmal Bier besorgt und tolles Gras. Sonst gibt es hier praktisch niemand Cooles. Ich habe einen Cousin, aber der ist ziemlich behindert. Deshalb dachte ich, du machst irgendwie einen coolen Eindruck, und vielleicht hast du ja Lust, einen draufzumachen.«
»Mal sehen«, sagte Joan. »Sind nur du und dieser Derek da?«
»Nein, nein.« Duane schüttelte den Kopf. »Auch ein paar Mädchen. Ihre Eltern haben ein Stück den Strand runter ein Haus gemietet. Sie kommen auch.«
»Na ja, mal sehen«, sagte Joan noch mal.
»Super«, sagte Duane. »Wie gesagt, gegen zehn. Und wir machen ein Feuer.«
Sie hatte nicht vorgehabt hinzugehen, aber Duane hatte recht. Abends war hier nichts los. Nach einem ekligen Abendessen im Speisesaal – panierter Fisch mit Kartoffelgratin – waren ihre Eltern in die Lobby weitergezogen, um einem alten Knacker am Klavier zuzuhören, und ihre Schwester Lizzie war aufs Zimmer gegangen, um zu lesen. Um zehn gingen auch ihre Eltern nach oben, um sich schlafen zu legen. Joan blieb in der Lobby und blätterte in einer Zeitschrift. Sie beschloss, an den Strand zu gehen und zumindest Hallo zu sagen. Vielleicht war Duane doch kein solcher Blödmann, wie sie zuerst gedacht hatte.
Sie verließ das Hotel, ging über die abschüssige Rasenfläche zur Micmac Road und überquerte sie zum Strand. Tagsüber war es richtig heiß gewesen, aber inzwischen war es ziemlich frisch, und Joan war froh, dass sie ihr dickstes Sweatshirt anhatte. Am Strand war es still und dunkel, aber in etwa zweihundert Meter Entfernung sah Joan das flackernde Licht eines Lagerfeuers und stapfte im weichen Sand darauf zu. Im Näherkommen sah sie, dass nur zwei Jungen da waren, und sie konnte schon von Weitem das Marihuana in der Luft riechen. Sie wollte bereits umdrehen, als Duane sie entdeckte. Er sprang auf und kam auf sie zugelaufen.
»Oh Mann«, sagte er, irgendwie zu laut. »Du bist ja doch gekommen.« Er drehte sich lachend zum Feuer um und rief seinem Freund zu: »Hab ich dir nicht gesagt, dass sie kommt?«
Joan beschloss, sich fünf Minuten zu ihnen zu setzen, nicht länger. Das Lagerfeuer bestand nur aus ein paar Stücken kokelndem Treibholz, und sie konnte kaum erkennen, wie Derek eigentlich aussah. Er war eine dunkle Gestalt mit einer Baseballkappe, die auf einem angespülten Baumstamm hockte. Duane bot Joan einen Sitz auf einer Kühlbox an und reichte ihr eine offene Dose warmes Bier. Sie bedankte sich und nahm einen Schluck. Duane entzündete ein Feuerzeug und rauchte etwas Gras aus einer Glaspfeife, die er dann Joan reichte. »Nein danke«, sagte sie.
»Rauchst du nicht?«
»Nein, eigentlich nicht. Ich bin Turnerin.«
Beide Jungen lachten schallend los, als sie das sagte, und fast wäre Joan aufgestanden und weggegangen, aber irgendetwas hielt sie zurück. Stattdessen fragte sie: »Was ist daran so komisch?«
»Es ist nicht komisch. Es ist echt heiß.« Das kam von Derek, dessen Gesicht immer noch im Schatten seines Mützenschirms verborgen blieb. Seine Stimme war rau und undeutlich.
Duane trat Derek gegen das Schienbein und sagte zu Joan: »Nein, du bist ein klasse Mädchen. Schon klar. Ist dein Team gut?«
Joan erzählte ein bisschen von ihrem ersten Jahr als Mitglied des Turnteams ihrer Highschool, während sie ihr Bier trank. Irgendwann sah sie, wie sich Duane seinem Freund Derek zuwandte und ihn durchdringend ansah. Darauf murmelte dieser etwas von, er müsse mal, stand auf und verschwand im Dunkeln. Das Feuer war inzwischen fast erloschen, nur ein Stück Treibholz verbreitete noch etwas orangefarbenes Licht. Duane sagte: »Ist dir kalt?«, rutschte auf der Kühlbox näher zu Joan heran und legte ihr den Arm um die Schulter.
»Eigentlich fühle ich mich ganz okay«, sagte Joan, und Duane lachte, als hätte sie gerade einen klasse Witz erzählt. Sie wusste bereits, was als Nächstes kommen würde, war aber doch etwas durcheinander, als er sie an sich zog und seinen Mund auf ihren drückte. Kurz ließ sie sich darauf ein – hauptsächlich, weil das einfacher war –, doch dann packte er ihre Hand und schob sie in seine Hose. Joan sagte: »Hey«, riss sich von ihm los und stand auf. Die Kühlbox kippte um, und Duane fiel in den Sand.
Sie dachte, er würde lachen, aber er sagte: »Echt jetzt, was soll der Scheiß?«, sprang auf und wischte sich den Sand von seinen Shorts.
»Ich muss jetzt los«, sagte Joan und wandte sich zum Gehen. In der Ferne, auf der anderen Seite der Straße, waren schwache Lichter zu erkennen, und sie hatte so zu zittern begonnen, dass sie sie nur noch verschwommen wahrnahm.
Duane holte sie ein und packte sie am Arm. »Bleib doch noch ein bisschen. Stell dich nicht so an.«
Joans Herz klopfte inzwischen wie wild, und ein bisschen fühlte sie sich, als stünde sie neben sich, fast so, wie wenn sie bei einem Wettkampf eine Übung machte. Eine innere Stimme sagte ihr, noch ein bisschen mit ihm rumzumachen und ihm vielleicht einen runterzuholen, damit er sie dann gehen ließ. Aber sie sagte: »Lass mich los.«
»Meinst du so?« Duane drückte ihren Arm fester und grub seine Finger in ihre Haut. Sie stieß einen Schrei aus, und er ließ sie los. Sie wirbelte herum und rannte los. Ihre Füße fühlten sich schwer an im weichen Sand, und sie hatte Tränen in den Augen. Sie schaute erst wieder zurück, als sie die Straße erreichte. Obwohl ihr Duane nicht folgte, rannte sie auch noch das letzte Stück zum Hotel, so schnell sie konnte, und ging dann auf ihr Zimmer, das sie sich mit ihrer Schwester teilte.
»Hi, Joan.« Fast wurde die Stimme vom Wind, der vom Meer herwehte, übertönt.
Sie lag auf einem großen rosa Strandtuch und drehte sich ruckartig herum, weil sie dachte, es wäre Duane. Aber es war ein blasser, schlaksiger Junge, der über ihr stand. »Ich bin’s, Richard, aus der Schule«, sagte er. »Wir waren in Mrs. Harris’ Sozialkundeklasse.«
»Oh, hallo, Richard.« Sie erkannte ihn und drehte sich auf den Rücken. Es war komisch, dass er sich als ein Mitschüler vorstellte. Sie waren nämlich beide in Middleham aufgewachsen und gemeinsam in die Grund- und Mittelschule gegangen. Trotzdem glaubte sie nicht, dass sie in dieser ganzen Zeit mal miteinander gesprochen hatten. Es war komisch, ihn in Maine zu treffen.
Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine abgenutzte grüne Badehose, die unmodisch kurz war, und trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Als die Sonne hoch oben am Himmel hinter einer verirrten Wolke verschwand, konnte sie ihn besser sehen. Sein Blick schien auf eine Stelle etwa dreißig Zentimeter über ihrem Kopf gerichtet. »Wie kommst du denn hierher?«, fragte sie.
»Meine Tante und mein Onkel machen mit meinem Cousin jeden Sommer einen Monat Urlaub hier, und dieses Jahr durfte ich mit ihnen kommen.«
»Einen ganzen Monat?«
»Zwei Wochen sind wir schon hier, also noch zwei Wochen, ja. Und du?«
»Ich bin erst gestern hergekommen, mit meinen Eltern und meiner Schwester. Für zwei Wochen. Im Windward.«
»Ach ja? Ich auch.« Er blickte über seine Schulter, als wollte er die Entfernung zum Hotel abschätzen, sagte aber nichts. Obwohl Joan klar war, dass sie Duane irgendwann wieder begegnen würde, war sie in der Hoffnung, ihm aus dem Weg zu gehen, so weit wie möglich den Strand hinuntergegangen.
»Ganz schön krass dort, nicht?«, sagte Joan.
»Findest du?« Es war, als sähe er sie erst jetzt zum ersten Mal an, und Joan hatte das Gefühl, dass sich sein Blick irgendwo auf ihrem Kinn festgesetzt hatte. Wenigstens starrte er nicht auf ihren Bikini, obwohl sie den Verdacht hatte, dass er sich gewaltig anstrengen musste, es nicht zu tun; sie war ziemlich sicher, dass Richard, seit der fünften Klasse hauptsächlich als Dick oder Dickless bekannt, wahrscheinlich noch nie mit einem Mädchen gesprochen hatte.
»Es stinkt«, sagte sie, »und das Essen ist grauenhaft. Das einzig Gute daran ist, dass es nah am Strand ist.«
»Und es gibt einen Pool«, sagte Richard.
»Gehst du in den rein?«
»Einmal war ich drin. Aber da war auch ein Haufen kleiner Kinder, und ich dachte, die pinkeln vielleicht alle rein.«
Joan lachte, drehte dann aber den Kopf, weil sie eine Gruppe Jugendlicher den Strand runterkommen sah. Nein, keine Jugendlichen, eher schon Studenten. Und einer von ihnen war Duane. Eines der Mädchen rauchte eine Zigarette, und Joan konnte den Rauch schon von Weitem riechen.
»Dann werden wir uns bestimmt noch öfter begegnen«, sagte sie zu Richard, der zwei Möwen zu beobachten schien, die sich in dem grasbewachsenen Bereich entlang der Straße ankreischten.
»Oh, klar«, sagte Richard und entfernte sich den Strand hinunter. Sie sah ihm eine Weile nach, dann drehte sie sich wieder auf den Bauch und starrte auf ein paar Sandflecken, die sich auf die Ecke ihres Handtuchs verirrt hatten. Sie schloss die Augen, aber der Sand ließ ihr keine Ruhe, und schließlich veränderte sie ihre Haltung so, dass sie ihn vom Handtuch wischen konnte.
Am Abend, sonnenverbrannt und ausgehungert, hielt Joan im Speisesaal des Hotels nach Duane Ausschau. An diesem Abend gab es Lasagne, mit Fleisch oder vegetarisch, und dazu Salat und Knoblauchbrot. Sie hatte Richard, ihren schüchternen Mitschüler, am anderen Ende des Saals entdeckt, wo er mit einer großen mageren Frau mit gelockten Haaren und einem dicken älteren Mann in Shorts und weißen Kniestrümpfen am Tisch saß. Was hatte ihr Richard erzählt? Dass er mit seiner Tante und seinem Onkel und einem Cousin hier war. Sie fragte sich kurz, ob dieser Cousin Duane sein könnte, und als hätte sie ihn mit ihren Gedanken heraufbeschworen, tauchte Duane plötzlich auf. Er schlurfte zwischen den Tischen hindurch und setzte sich zu Richard und den zwei Erwachsenen. Selbst aus der Ferne wurde Joan beim Anblick Duanes mulmig. Schon komisch, dass der dünne, nerdige Richard mit einem Trottel wie Duane verwandt war.
»Ich kann gar nicht fassen, wie viel Sonne du abbekommen hast, Schatz«, sagte Joans Mutter zum zweiten oder dritten Mal.
Joan drückte einen Finger in ihren Unterarm und beobachtete, wie ihre gerötete Haut kurz weiß wurde und dann wieder rot. »Jetzt habe ich immerhin eine Grundlage«, sagte sie. »Wenn ich schon zwei Wochen hierbleiben muss, will ich wenigstens knackig braun werden.«
»Das ist aber gar nicht gut für dich«, sagte ihre Schwester Lizzie. Sie war vier Jahre älter als Joan und hatte gerade ihr erstes Jahr am College in Bard hinter sich, und jetzt war Lizzie plötzlich Feministin und Vegetarierin und befasste sich mit Dingen wie den Folgen eines Sonnenbrands.
»Als du letztes Jahr in Florida warst, habe ich dich kaum mehr wiedererkannt, als du zurückgekommen bist, so schwarz warst du«, sagte Joan. Sie wusste zwar, dass sie zu laut sprach, ärgerte sich aber trotzdem, als ihre Mutter Pst! zischte.
»Und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Krebs«, sagte Lizzie. »Du solltest aus meinen Fehlern lernen, Joan. Es wird dich zu einem besseren Menschen machen.«
Um ihrer Bemerkung etwas von der Schärfe zu nehmen, lächelte Lizzie, aber Joan runzelte trotzdem die Stirn. »Was sagst du dazu, Daddy? Du bist doch Arzt.«
Ihr Vater, der gerade einen Schluck Kaffee nahm, blinzelte hektisch und klinkte sich wieder in die Unterhaltung ein. »Ich bin Zahnarzt. Was soll ich wozu sagen?«
»Dass ich mich diesen Sommer voll in die Sonne knalle und richtig braun werde.«
»Klar«, sagte er.
»Versprich mir nur eines«, sagte ihre Mutter. »Creme dich heute Abend mit Aloe ein und trag morgen mindestens Dreißiger-Sonnenschutz auf, ja? Du bist wirklich schon ganz schön rot.«
»Es brennt aber überhaupt nicht«, log Joan. Seit sie geduscht hatte, spannte ihre Haut merklich, und obwohl ihr klar war, dass das nicht möglich war, hatte sie das Gefühl, einen leichten Brandgeruch zu verströmen.
»Wusstet ihr, dass es im Hotel eine Bibliothek gibt?«, sagte Lizzie, um das Thema zu wechseln, wofür ihr Joan dankbar war.
»Tatsächlich?«, sagte ihre Mutter.
Joans Eltern und ihre Schwester begannen, über die Bücher zu sprechen, die sie im Urlaub lesen wollten, während Joan eine harte Kruste Knoblauchbrot auf ihrem Teller herumschob.
Sie behielt die ganze Zeit den Tisch im Auge, an dem Duane und Richard saßen. Sie überlegte, ob es Duane unangenehm war, ihr zu begegnen, und ob er sich fragte, ob sie jemandem erzählt hatte, was er getan hatte. Aber soweit sie das aus dieser Entfernung beurteilen konnte, wirkte er vollkommen entspannt. Er lümmelte auf seinem Stuhl und schaute ständig auf seine Uhr. Nach etwa fünf Minuten verließ er den Speisesaal. Richard stand auf und ging zum Buffet, um sich Nachtisch zu holen. Joan stand ebenfalls auf und folgte ihm.
»Was ist das?«, fragte sie, als sie so nahe war, dass Richard sie hören konnte.
»Milchreis«, sagte er. »Aber es gibt auch Schokoladenkuchen.«
»War das dein Cousin bei euch am Tisch?«, fragte Joan.
»Bis vor Kurzem, ja. Jetzt sitzen dort nur noch meine Tante und mein Onkel.«
»Wie ist dein Cousin so?«
»Duane?«
»Ja.«
»Er ist vermutlich der schrecklichste Mensch, den ich kenne.«
»Echt?« Joan versuchte erst gar nicht, ihre Aufregung zu verbergen. Das war, was sie zu hören gehofft hatte. »Warum ist er so schrecklich?«
»Das hat viele Gründe. Warum fragst du? Möchtest du ihn etwa kennenlernen?«
»Das hab ich bereits. Gestern.«
»Tatsächlich?«
»Ja, er hat mich eingeladen, nachts zu einem Lagerfeuer an den Strand zu kommen, und blöderweise bin ich hingegangen.«
»Ist er über dich hergefallen?«, sagte Richard, als fragte er sie, ob sie schon Nachtisch gehabt hatte.
»Oh Gott.« Ihre Stimme wurde automatisch höher, doch dann fügte sie flüsternd hinzu: »Er hat’s probiert, aber ich bin ihm entkommen.«
»Das wundert mich überhaupt nicht. Wie der über Mädchen redet. Da hast du vermutlich Glück gehabt.«
Auf der anderen Seite des Buffets stand jetzt ein großer bärtiger Mann, der gewissenhaft den Rand jeder Nachspeisenplatte berührte, bevor er sich das größte Stück Kuchen aussuchte.
»Ich sollte an unseren Tisch zurückgehen«, sagte Richard.
»Klar«, sagte Joan. »Vielleicht sehen wir uns ja morgen am Strand.«
»Oh, klar«, sagte Richard, als hörte er ihr gar nicht zu, und ging mit einer Schale Milchreis an seinen Tisch zurück.
Als Joan in dieser Nacht im Bett lag, konnte sie nicht schlafen. Ihr ganzer Körper fühlte sich an, als würde ihre Haut von winzigen Nadeln gepikst, und ihr war zu warm. Lizzie hatte den ganzen Abend im Bett ein Buch mit dem Titel Zähne zeigen gelesen und dabei Kopfhörer aufgehabt. Joan war auf der Suche nach etwas, was sie sehen wollte, durch die Kanäle gezappt. Im Hotel hatten sie nur zwölf Sender, und auf dreien davon kamen Baseballspiele. Schließlich schaute sie den Film mit Julia Roberts, in dem sie ihrem Mann wegläuft. Als er zu Ende war, fing er wieder von vorn an, und inzwischen lag Joan hellwach in ihrem Bett. Lizzie schlief.
Joan musste ständig daran denken, wie knapp sie am Abend zuvor bei der Begegnung mit Duane davongekommen war, aber auch Richard ging ihr ständig durch den Kopf. Obwohl er in derselben kleinen Stadt aufgewachsen war wie sie, hatte sie wahrscheinlich kein einziges Mal mehr an ihn gedacht, seit sie auf der Mittelschule in Mr. Barclays Klasse gewesen war und Mr. Barclay Richard einen Deostick in die Hand gedrückt hatte. Das war nicht weiter verwunderlich. Richard trug in der Schule praktisch jeden Tag dasselbe Hemd, und er stank. Joan war zum Mittagessen nach Hause gerannt und hatte allen davon erzählt, worauf Richard eine Weile nur noch Old Spice genannt wurde, was gegenüber Dickless sogar eine gewisse Verbesserung war.
Nach der achten Klasse gingen alle Kids aus Middleham auf die Dartford-Middleham High School, und Joan bekam Richard kaum mehr zu sehen. Er hatte zwischen Mittelschule und Highschool ordentlich zugelegt und wirkte nicht mehr ganz so sehr wie der dürre Junge mit den viel zu großen Klamotten und dem hausgemachten Haarschnitt. Ein totaler Außenseiter blieb er trotzdem. Umso eigenartiger fand Joan es, dass er ihr jetzt fast wie ein Freund vorkam. Sie hatten einiges gemeinsam. Sie waren nicht nur in derselben Stadt aufgewachsen und gingen in dieselbe Schule, sondern hatten jetzt auch einen gemeinsamen Feind. Sie hoffte, Richard am nächsten Tag wieder zu begegnen und mehr über Duane zu erfahren.
3Kimball
Am Abend nach der Begegnung mit Joan Grieve Whalen ging ich auf die Website der Firma ihres Mannes und fand dort Fotos und Kurzbiographien der Makler, Agenten und Bürokräfte von Blackburn Properties. Richard Whalens Profilbild zeigte ihn an einem sonnigen Tag vor dem Hintergrund einer Parklandschaft. Er hatte kurz geschnittenes graues Haar und ein markantes, attraktives Gesicht, das den Eindruck erweckte, als verbrächte er viel Zeit im Freien. In der Kurzbiographie, die sein Foto ergänzte, gab er Stand-up-Paddling, Angeln und Radfahren als Hobbys an. Von einer Frau war keine Rede.
Pam O’Neil, die Frau, die Joan im Verdacht hatte, mit ihrem Mann zu schlafen, nannte als Hobbys Reiten und Bodyboarding. Sie hatte lange blonde Haare und extrem weiße Zähne, aber es war nicht auszuschließen, dass das Foto mit Photoshop bearbeitet war. Sie sah aus wie Mitte zwanzig, etwa zehn Jahre jünger als Richard Whalen und Joan.
Es war nicht sonderlich schwer, sich die beiden zusammen vorzustellen. Wenn Joan glaubte, dass sie eine Affäre hatten, hatten sie wahrscheinlich wirklich eine. Ich versuchte mir einen Plan zurechtzulegen, wie ich in der Sache vorgehen sollte, musste aber feststellen, dass mir stattdessen ständig Joan durch den Kopf ging. Allerdings nicht die Joan, die vor ein paar Stunden in mein Büro gekommen war, sondern die Joan, die vor fünfzehn Jahren in meinem ersten Jahr als Lehrer in meinem Klassenzimmer gewesen war.
Was meine Zeit an der Dartford-Middleton High School angeht, war sie, schon lange bevor James Pursall mit einer Pistole in mein Klassenzimmer kam, von einer undefinierbaren Angst begleitet. Es begann in den Weihnachtsferien, als ich mich wie ein Besessener darauf vorbereitete, im Frühling meine Schüler zu unterrichten. Im Herbst war ich als Lehramtsassessor noch von einem alten Hasen namens Larry O’Donnell betreut worden, der den Lehrplan mit Vorliebe im Bullrun Pub mit mir durchging, wenn es um fünf Uhr öffnete. Das Gute an Larry war, dass er nicht sonderlich erpicht darauf war, sich in meinen Unterricht zu setzen, mich zu beobachten und mir dann später alles, was ich falsch gemacht hatte, um die Ohren zu hauen. Das war aber auch das Schlechte an Larry. Er machte in der Lehrmittelkammer ein Nickerchen, während ich unterrichtete.
Meine haarigsten Stunden waren die zwei Kurse Amerikanische Literatur für Zehntklässler, in denen ich laut Lehrplan Klassiker wie Walt Whitman, Mark Twain, Emily Dickinson, Hemingway und Fitzgerald behandeln sollte. Standardkost also. Die Kids interessierte der Stoff herzlich wenig, und wie sich herausstellte, hatte ich auch nicht gerade das Zeug zum Zuchtmeister. Ich war hauptsächlich damit beschäftigt, meiner Klasse möglichst nicht einmal ein paar Sekunden den Rücken zuzukehren. Meine dritte Klasse war der Leistungskurs Englisch, an dem auch Joan Grieve teilnahm. Im Großen und Ganzen waren die Schüler respektvoll, und zwei von ihnen schienen sogar Spaß daran zu finden, Bücher zu lesen und über sie zu reden. Die meisten hofften jedoch nur, dass sich der Leistungskurs in ihrer Bewerbung fürs College gut ausmachen würde. Sie benahmen sich anständig, interessierten sich aber nicht für den Stoff.
Anfang Dezember freute ich mich nur noch auf das Halbjahresende, zählte die Tage und fragte mich, ob meine Berufswahl die richtige gewesen war. Und dann, eines Nachmittags, meine letzte Klasse hatte sich gerade auf den Heimweg gemacht und ich wischte die Tafel sauber und ging im Kopf noch einmal die letzte Unterrichtsstunde durch, kamen Larry O’Donnell und Maureen Block, die Leiterin der Englisch-Abteilung, herein und schlossen die Tür hinter sich. Sie fragten mich, ob mir aufgefallen sei, dass Paul Justice, einer der altgedienten Lehrer, schon ein paar Tage nicht mehr in die Schule gekommen war. Aufgefallen war es mir, aber ich hatte mir deswegen keine großen Gedanken gemacht.
»Er wird nicht mehr zurückkommen«, sagte Maureen. »Und ich bin zwar noch nicht sicher, aber ich glaube, wir sind noch mal halbwegs glimpflich davongekommen. Das Mädchen, das die Beschwerde eingereicht hat, sagt, sie wird nicht zur Polizei gehen.«
»Oh«, sagte ich.
»Larry hat sich freundlicherweise bereit erklärt, im nächsten Semester Pauls Freshman-Klassen zu übernehmen, aber das heißt, jemand muss für die Leistungskurse und Pauls Aufsatzklassen einspringen. Wir hatten gehofft, dass Sie das vielleicht tun könnten.«
»Oh«, sagte ich noch einmal.
Sie gaben mir eine Nacht Bedenkzeit, und Dagmar, meine damalige Freundin, überzeugte mich, dass das eine gute Gelegenheit war, um beruflich voranzukommen. »Am Ende des Schuljahrs bieten sie dir bestimmt eine Vollzeitstelle an«, meinte sie. »Es ist eine gute Schule.« Dagmar und ich hatten uns im selben Master-Studiengang in Western Massachusetts kennengelernt, und sie unterrichtete Mittelschulklassen in Hudson. Ich hatte plötzlich eine Vision von uns beiden, wie wir ein Farmhaus in Central Massachusetts renovierten und den Rest unseres Lebens damit verbrachten, uns über Klassenarbeiten zu ärgern. Ich war noch unschlüssig, wie ich das finden sollte.
Ich nahm die Stelle an und igelte mich daraufhin im Dezember, Dagmar war bei ihrer Familie im Mittelwesten, in meiner versifften Wohnung in Cambridge ein und bereitete mich auf den Unterricht für meinen Leistungskurs vor. Da sie mir freie Hand ließen, plante ich eine ganze Unterrichtseinheit über Lyrik und eine über die Vorstadtliteratur der Jahrhundertmitte. Ich glaubte nämlich, die Kids müssten ein paar Cheever-Storys etwas abgewinnen können. Außerdem zog ich in Erwägung, Tiefe Wasser von Patricia Highsmith oder etwas von Richard Yates durchzunehmen. Ich las viel, und ich versuchte, Gedichte zu schreiben, aber ich spürte förmlich, wie sich mein Leben vor mir auffächerte, und es kam mir vor wie ein Leben, das sowohl etwas Beschauliches als auch etwas Resigniertes hatte. Und sobald sich dieser Gedanke einmal in meinem Kopf festgesetzt hatte, war es wie ein Frösteln, wenn man zu lange in kaltem Wasser geschwommen ist – ich konnte ihn nicht mehr abschütteln.
Im Januar begann ich wieder zu unterrichten, aber das Gefühl verflog nicht. Wenn ich jeden Morgen, nachdem ich von meinem unzuverlässigen Omega durch ein trübes, frostiges Morgengrauen über den Parkplatz gegangen war, das Klassenzimmer betrat, überkam mich eine Art existenzielles Grauen vor dem vor mir liegenden Tag. Hatte der Tag dann einmal begonnen, war es okay. Es gab sogar Momente der Freude. John Cheevers »Der Schwimmer« kam sehr gut an, obwohl die meisten Schüler unmöglich fanden, wie die Geschichte am Ende ins Surreale abdriftete. Sie klammerten sich fast zwanghaft an den Wortsinn, die gutsituierten Schulabgänger, die nur noch mit einem Fuß in den Highschools ihrer Heimatstädte standen, mit dem anderen bereits in renommierten Colleges oder Universitäten, die für sie das Sprungbrett zu gut bezahlten Jobs in Boston, New York oder Washington, D.C. darstellten. Sie verstanden zwar Vorstadt-Ennui, wollten ihn aber nicht spüren.
Ich würde mich gern besser an James Pursall erinnern können, aber eigentlich weiß ich nur noch, dass er ein stiller Einzelgänger war, der ganz hinten saß. Er machte seine Hausaufgaben und beteiligte sich am Unterricht, allerdings nur, wenn ich ihn aufrief. Seine mit Akne gesprenkelte Haut war sehr blass, und sein auffallend schwarzes Haar sah immer ungewaschen aus. Im Klassenzimmer war es kalt, und ich erinnere mich, dass er nie seine Jacke ablegte, einen dicken Parka, der dunkelblau oder schwarz war. Ich erinnere mich, dass er vor dem Zwischenfall der Junge für mich war, »der am ehesten Amok laufen würde«, und ich mir vorstellte, wie er plötzlich eine russische Maschinenpistole aus seiner voluminösen Winterjacke zog. Aber dass es wirklich dazu kommen könnte, glaubte ich nicht.
An Joan Grieve erinnere ich mich jedoch gut. Sie saß in der ersten Reihe und versäumte es nie, sich mindestens einmal in der Stunde zu Wort zu melden. Und nach Prüfungen und Aufsätzen kam sie fast immer zu mir und versuchte mich zu überreden, aus einer Eins minus eine glatte Eins zu machen oder aus einer Zwei plus eine Eins minus. Ich wusste, dass sie dem Turnteam der Schule angehörte, das in diesem Jahr sehr erfolgreich war, weshalb die Leute viel darüber redeten. Sie trug im Unterricht oft Leggings und Kapuzenshirts, und auf ihrem Pult stand immer eine große Wasserflasche. Ganz besonders ist mir an ihr im Gedächtnis haften geblieben, dass sie zu den Schülern gehörte, die mich immer genau beobachteten, wenn ich etwas erklärte oder eine Diskussion zu leiten versuchte. Sie war nicht die Einzige, die den Blick im Klassenzimmer nach vorn gerichtet hielt, aber viele von der Sorte gab es nicht. Die meisten Schüler starrten entweder ins Unendliche oder auf ihre zerkratzten und bekritzelten Pulte. Wenn sie nicht mitschrieb, beobachtete sie mich, aber statt mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich etwas bewirkte – Wenn man nur einen jungen Menschen erreicht –, fühlte ich mich durch ihre Blicke entblößt.
Unmittelbar vor den Osterferien kam es mit Joan zu einem eigenartigen Vorfall. Ich hatte der Klasse gerade einen Test zurückgegeben, weshalb Joan, erwartungsgemäß, am Ende der Stunde zu mir kam. Ich saß auf meinem Schreibtischstuhl, und sie stand. Trotzdem war ihr Kopf nur geringfügig über meinem, als sie mir vorhielt, der Test sei nicht ganz fair gewesen, weil ich die Klasse nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass sie alle Anne-Sexton-Gedichte lesen sollten, die ich ihnen aufgegeben hatte.
Während sie mit mir redete, war noch eine andere Schülerin im Klassenzimmer und packte ihre Sachen zusammen. Madison Brown war ebenfalls eine Turnerin – und eng mit Joan befreundet. Deshalb nahm ich an, sie ließe sich bewusst Zeit, um zu warten, bis Joan ihr Anliegen vorgebracht hatte. Doch sobald Madison den Reißverschluss ihres riesigen Rucksacks zugezogen hatte, schlang sie ihn über ihre Schultern und steuerte auf die Tür zu. Bevor sie das Klassenzimmer verließ, drehte sie sich um und sagte: »Passen Sie bloß auf, Mr. K., Joan hat mir erzählt, dass sie auf Sie steht.«
In der Hoffnung, die peinliche Situation etwas zu entschärfen, verdrehte ich die Augen, aber als ich Joan ansah, hatte sie einen knallroten Kopf. Zuerst dachte ich, es wäre aus Scham, aber ihr Blick war auf die Tür gerichtet, die gerade zugegangen war. Und ich merkte, dass es eher Wut war. Ich hatte sofort Maureen Blocks Stimme im Ohr: Bleiben Sie nie bei geschlossener Tür allein mit einer Schülerin und stand auf, um die Klassenzimmertür wieder zu öffnen. Und als ich zurückkam, hatte Joans Gesicht wieder seine normale Farbe angenommen.
»Keine Angst, Mr. Kimball«, sagte sie. »Madison ist einfach, verzeihen Sie den Ausdruck, ein Miststück.«
»Sind Sie denn nicht gut befreundet?«
»Wer? Madison und ich? Na ja, sie ist auch im Turnteam, das schon, aber besonders dick sind wir nicht miteinander. Und was sie über mich gesagt hat … Für einen Lehrer sehen Sie zwar ziemlich gut aus, aber Sie sind nicht mein Typ.«
Ich lachte. »Dann machen Sie sich deswegen mal keine Sorgen«, sagte ich, um dieses spezielle Thema zu beenden. »Und weil das gerade ein bisschen peinlich gewesen ist, schlage ich Ihnen einen Kompromiss vor. Schreiben Sie heute Abend ein paar Sätze über die tiefere Bedeutung von ›The Room of My Life‹, dann bekommen Sie eine bessere Note.«
»Danke, vielen Dank.« Sie wippte ein wenig auf ihren Sneakers und verließ das Klassenzimmer.
Zwei Wochen später verblutete Madison Brown auf dem Boden ebendieses Klassenzimmers, und James Pursall stand mit einer Pistole in der Hand über ihr. Ich bekam weiche Knie und starrte wie gelähmt auf dieses Bild einen Meter vor mir, und dann hob James die Pistole, richtete sie auf die Brust seines voluminösen Parkas und drückte ab.
Ich glaube, der ganze Vorfall – von dem Moment an, als James die Pistole aus den Tiefen seiner Jacke holte, bis zu dem Moment, als er neben Madison auf dem Boden lag – dauerte etwa zwei Minuten, eher sogar weniger, aber die Zeit verging in diesen zwei Minuten in ihrem eigenen grausigen Tempo. Von dem Moment an, in dem die Pistole zum Vorschein kam, waren es Stunden bis zu dem Moment, in dem die ganze Klasse, mich eingeschlossen, sie bemerkte. Ich hatte gerade über die nächste Rhetorik-Aufgabe gesprochen, die darin bestand, die Abschiedsrede des Jahrgangsbesten am Ende des Schuljahrs zu halten, und ich hatte die Klasse ausdrücklich dazu ermutigt, sich etwas einfallen zu lassen, weil ich keine Lust hatte, mir vierundzwanzigmal die gleiche Rede anzuhören. Und dann brüllte James plötzlich: »Alle auf den Boden«, aber erst einmal reagierte niemand. Ich hielt es zunächst für eine Art Scherz, vielleicht ein Beispiel für eine besonders unkonventionelle Abschiedsrede, doch dann stand er auf einmal mit der Pistole in der Hand auf seinem Stuhl, und die Hälfte der Schüler duckte sich unter ihre Pulte, und Missy Robertson – daran erinnere ich mich, weil sie inzwischen Wettermoderatorin im Lokalfernsehen ist – begann laut zu schluchzen.
»Alle«, sagte er lauter, und auch der Rest warf sich auf den Boden.
Ich lehnte an der Front meines Schreibtischs, mein üblicher Platz, wenn ich unterrichtete, und ich weiß noch, dass ich die Hände von mir streckte und etwas sagte wie: »Jetzt lass uns doch erst mal reden, James.«
Darauf drehte er sich zu mir und sah mich unter einer fettigen pechschwarzen Haarsträhne mit großen Augen an. Ich öffnete den Mund, um mehr zu sagen, brachte aber kein Wort heraus. Ich wollte am Leben bleiben, und irgendwie war mir klar, dass er mich erschießen würde, wenn ich einen weiteren Versuch unternahm, die Situation zu entschärfen. Diese Entscheidung, nichts zu sagen und wie die Schüler auf dem Boden stillzuhalten, veränderte meine ganze Körperchemie. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Meine Knochen fühlten sich hohl an, meine Organe flüssig und meine Brust so leer, als hätte ich mein Herz herausgezogen und James Pursall ausgehändigt. Ich stand da wie versteinert.
James stieg von seinem Pult, schritt, die Pistole schwenkend, zwischen den auf dem Boden liegenden Schülern hindurch und sagte mit einer bebenden, unwirklichen Stimme: »Eene, meene, muh.« Und ich erinnere mich, dass ich selbst damals schon dachte, dass er nicht mit ganzem Herzen dabei war, dass er zwar beschlossen hatte, den anderen Schülern einen gehörigen Schrecken einzujagen, das Ganze aber schnell hinter sich bringen wollte.
Im vorderen Teil des Klassenzimmers, nur ein, zwei Meter von mir entfernt, drehte er sich, machte ein paar kleine Schritte und blieb über Madison Brown stehen, die sich um ihren Rucksack gekrümmt hatte. Er richtete die Pistole auf sie und stabilisierte seine zitternde rechte Hand mit seiner linken, und in diesem Moment wusste ich, dass er abdrücken würde. Ich stellte mir vor, wie ich mich von meinem Schreibtisch auf ihn stürzte, meine Arme um seine Brust schlang, seine Hände nach oben riss, die Pistole seinem Griff entwand und ihn auf den Linoleumboden warf.
Stattdessen sah ich tatenlos zu, wie er zwei Schüsse auf Madison Brown abgab. Sie bewegte sich nicht einmal, als er es tat, fast so, als wäre sie schon tot.
Dann schien es, als wollte er die Pistole in seinen Parka zurückstecken. Aber stattdessen drückte er noch einmal ab und sank neben Madison zu Boden.
Seit diesem Tag habe ich diese schrecklichen Momente in meiner Erinnerung so oft Revue passieren lassen, dass ich mir des genauen Ablaufs selbst nicht mehr sicher bin. Ich hätte bestimmt auch alles schlimmer machen können, wenn ich eingegriffen hätte, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass ich in dieser Situation versagt habe. Ja, es hätte schlimmer kommen können. Aber es war auch so schon schlimm genug.
Deshalb überraschte es mich, dass Joan Whalen in ihrer momentanen Lebenskrise ausgerechnet bei mir Hilfe suchte. Ich hatte immer angenommen, dass mich die jungen Menschen in diesem Klassenzimmer nur als einen mittelmäßigen Lehrer in Erinnerung hatten – und als den Erwachsenen, der sie am schlimmsten Tag ihres Lebens im Stich gelassen hatte. Aber aus irgendeinem Grund hatte Joan einen anderen Eindruck von mir. Und ich fragte mich, warum.
4Joan
Am Montag, nach dem Abendessen – irgendwas Hähnchenmäßiges mit Speck und Käse –, streifte Joan in der Hoffnung, Richard zu finden – und seinem Cousin Duane nicht über den Weg zu laufen –, durch die Hotelanlage. Sie hatte beide an einem weit entfernten Tisch im Speisesaal entdeckt, aber bewusst jeden Blickkontakt mit ihnen vermieden.
Seit Samstagabend, als Duane am Strand über sie hergefallen war, dachte sie an nichts anderes mehr, als es ihm heimzuzahlen. Während des gesamten Abendessens – ihre Eltern und ihre Schwester planten den morgigen Ausflug – schmiedete sie Rachepläne und war sich dabei sehr deutlich der blauen Flecken auf der Innenseite ihres Arms bewusst, die davon herrührten, dass er sie so grob gepackt hatte. Sollte er jemals wieder mit ihr sprechen, würde sie ihm sagen, dass er aussah wie ein Affe und dass sie ihn körperlich abstoßend fand. Sie stellte sich vor, wie sie ihm mit aller Kraft in die Eier trat, und gab sich sogar Phantasien hin, in denen sie ihm noch Schlimmeres antat – etwa ihm mit einem Buttermesser die Augen auszustechen. Diese Vorstellung war mit einer seltsamen Mischung aus Lust und Ekel verbunden. Am glücklichsten war Joan immer dann, wenn sie einen Feind hatte.
Sie hatte nach seinem nerdigen Cousin Richard auf der vorderen Veranda des Hotels und im Barbereich Ausschau gehalten, wo sich die Jugendlichen aufhalten und Softdrinks trinken durften. Neben dem Speisesaal war ein Spielzimmer, ein lang gezogener, schmaler Raum mit zwei Flipperautomaten, einem Kicker und ein paar alten Spielautomaten. Bis auf zwei kleine Jungen und ihren Vater hielt sich niemand dort auf. Einer der Jungen stand auf einem Hocker und malträtierte einen der Flipperautomaten, obwohl er gar nicht an war.
Joan kehrte in die Lobby zurück und hielt nach einem leeren Sessel Ausschau. Aber weil in einer Ecke ein alter Folksänger einen Song über Margaritas sang, war die Lobby knallvoll. Sie zog zu den Souvenirläden weiter und drehte ein Gestell mit Taschenbüchern, als ihr einfiel, dass ihre Schwester gesagt hatte, dass es irgendwo im Hotel eine Bibliothek gab. Sie glaubte, dort könnte Richard am ehesten sein. Sie fragte das Mädchen an der Rezeption, das nicht viel älter war als sie, nach der Bibliothek. Das Mädchen sah sie zunächst verständnislos an, doch dann sagte es: »Ach so, du meinst die mit den Büchern, die irgendwelche Gäste hiergelassen haben? Die ist oben im zweiten Stock.«
»Ist sie offen?«
»Klar. Soviel ich weiß, ist sie immer offen.«
Joan stieg die Treppe in den zweiten Stock des Hotels hinauf, wo der Modergeruch besonders stark war. Sie hatte die Bibliothek rasch gefunden. Eigentlich war es nur ein Zimmer, das einem alten handgeschriebenen Schild zufolge ONKELMURRAYSBÜCHERECKE hieß und von deckenhohen Bücherregalen gesäumt war. Ein paar standen auch frei im Raum. In den zwei Ecken, die Joan einsehen konnte, befanden sich abgenutzte Ledersessel. Als sie ein Geräusch hörte, vielleicht eine umgeblätterte Seite, sagte sie zaghaft: »Hallo?«
»Äh, hallo«, kam eine Stimme zurück, und als Joan darauf um die Regale in der Mitte des Raums herumging, sah sie Richard mit einem Buch in einem der Ledersessel sitzen.
»Oh, hi«, sagte sie und versuchte, so zu tun, als hätte sie nicht nach ihm gesucht.
»Hi«, sagte auch er.
»Ist das deine Höhle?«
»Meinst du die Bibliothek? Doch, wahrscheinlich schon.«
Sie ging an eine der Regalwände und fuhr mit dem Finger über den Rücken eines Buchs. »Was liest du gerade?«
Er hielt eine Hardcoverausgabe mit einem schwarzen Einband hoch.
»The Bachman Books«, las Joan den Titel ab. »Das ist doch von Stephen King. Den liest meine Mutter, glaube ich, auch.«
»Ich habe das Buch sogar zu Hause, hab’s aber nicht mitgenommen. Und jetzt lese ich es noch mal.«
»Ist es gut?«
»Es sind vier Romane, die er unter einem Pseudonym geschrieben hat. Richard Bachman.«
»Magst du sie, weil er sich Richard genannt hat?«
Richard sah sie verständnislos an, dann schaute er auf den Einband. »Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass wir den gleichen Vornamen haben.«
»Echt? Mir fällt es sofort auf, wenn jemand Joan heißt, weil kein Mensch mehr so heißt. Nur noch alte Leute.«
»Jetzt, wo du’s sagst …«
»Vielen Dank«, maulte Joan.
»Wieso, alte Namen sind doch klasse. Oder würdest du lieber Madison oder so was heißen?«
»Das werde ich Madison sagen«, sagte Joan.
Richard zuckte mit den Achseln, und Joan merkte, dass er weiterlesen wollte.