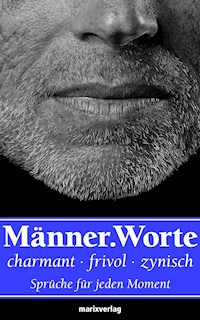30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Erotik
- Serie: Anonym 2019
- Sprache: Deutsch
Hier sind die dramatischen Geschichten aus dem wahren Leben, authentisch und voller Emotionen! Jede Menge ergreifende Schicksale und aufregende Bekenntnisse – aktuell, ehrlich und persönlich. Jetzt wird endlich mal deutlich Klartext geredet! Geschichte 1: Am Abgrund »Ich tat alles für ihn ...« Geschichte 2: Dunkle Vergangenheit »Was damals wirklich geschah ...« Geschichte 3: Tragisches Erlebnis »Plötzlich stand ich ihr gegenüber.« Geschichte 4: Sein Geheimnis »Erst nach seinem Tod erfuhr ich davon!« Geschichte 5: Partnertausch im Fussballclub »Ich war total schockiert!« Geschichte 6: Papis Liebling »Bin ich schuld an seinem Tod?« Geschichte 7: Neid und Verlustangst »Er gönnte mir meinen Erfolg nicht.« Geschichte 8: Bittere Wahrheit »Plötzlich war alles aus.« Geschichte 9: Einsam und allein »Keiner war für mich da.« Geschichte 10: Meine Beichte »Was ist schon die Wahrheit?« Geschichte 11: Verbotenes Verlangen »Ich verführte den Freund meines Sohnes.« Geschichte 12: Kampf gegen den Alkohol »Ich war die Komplizin meines Mannes.« E-Book 1: Am Abgrund »Ich tat alles für ihn ...« E-Book 2: Dunkle Vergangenheit »Was damals wirklich geschah ...« E-Book 3: Tragisches Erlebnis »Plötzlich stand ich ihr gegenüber.« E-Book 4: Sein Geheimnis »Erst nach seinem Tod erfuhr ich davon!« E-Book 5: Partnertausch im Fussballclub »Ich war total schockiert!« E-Book 6: Papis Liebling »Bin ich schuld an seinem Tod?« E-Book 7: Neid und Verlustangst »Er gönnte mir meinen Erfolg nicht.« E-Book 8: Bittere Wahrheit »Plötzlich war alles aus.« E-Book 9: Einsam und allein »Keiner war für mich da.« E-Book 10: Meine Beichte »Was ist schon die Wahrheit?« E-Book 11: Verbotenes Verlangen »Ich verführte den Freund meines Sohnes.« E-Book 12: Kampf gegen den Alkohol »Ich war die Komplizin meines Mannes.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Am Abgrund »Ich tat alles für ihn ...«
Dunkle Vergangenheit »Was damals wirklich geschah ...«
Tragisches Erlebnis »Plötzlich stand ich ihr gegenüber.«
Sein Geheimnis »Erst nach seinem Tod erfuhr ich davon!«
Partnertausch im Fussballclub »Ich war total schockiert!«
Papis Liebling »Bin ich schuld an seinem Tod?«
Neid und Verlustangst »Er gönnte mir meinen Erfolg nicht.«
Bittere Wahrheit »Plötzlich war alles aus.«
Einsam und allein »Keiner war für mich da.«
Meine Beichte »Was ist schon die Wahrheit?«
Verbotenes Verlangen »Ich verführte den Freund meines Sohnes.«
Kampf gegen den Alkohol »Ich war die Komplizin meines Mannes.«
Anonym – 1 –
Anonym
Diverse Autoren
Am Abgrund »Ich tat alles für ihn ...«
Roman von Doris M. (30)
Doris M. (30):
Ja, ich war dumm und naiv, wollte alles für
meine erste große Liebe tun, aus Angst, verlassen zu werden. Dafür habe ich sogar gestohlen. Ich habe meine Berufsehre verletzt, meinen Anstand und gute Erziehung verraten und letztlich fast alles verloren, was mir wichtig war.
Kriminalpolizei, öffnen Sie die Tür!« Ich erstarrte vor Schreck, obwohl ich auf den Besuch der Polizei vorbereitet war. Ich wusste, sie würden eines Tages kommen und mich verhaften. Ich wusste nur nicht, wann und wo. Inständig hoffte ich, es möge nicht im Büro geschehen. Zu sehr hätte ich mich vor den Kollegen und Kolleginnen geschämt. Sie würden es jetzt zwar auch erfahren, aber ich musste ihnen zumindest nicht in die Augen schauen. Dass ich mit den Beamten aufs Präsidium und anschließend in Untersuchungshaft musste, war mir klar.
Längst hatte ich eine kleine Reisetasche mit dem Nötigsten gepackt. Was darf man mitnehmen, wenn man ins Gefängnis muss? Ich hatte keine Ahnung. Bestimmt würde ich Anstaltskleidung tragen müssen. Handy, Tablet, Ladegerät – das alles ließ ich zu Hause. Ich ging davon aus, dass ich nun für etliche Zeit keinen Kontakt mit meinen Lieben aufnehmen konnte.
Vielleicht kann ich eine Gnadenfrist erschwindeln, dachte ich und verhielt mich still. Die Polizisten klopften laut und heftig gegen die Tür.
»Aufmachen!«
Dann hörte ich Schritte im Hausflur, die sich entfernten und war erleichtert. Sie zogen sich zurück, aber sicher nicht für lange. Bestimmt kommen sie noch am selben Tag wieder und dann werde ich mitgehen, nahm ich mir vor. Eigentlich hätte ich mich freiwillig stellen müssen, aber dazu war ich zu feige.
Still saß ich am Küchentisch und ließ in Gedanken die letzten Jahre Revue passieren. Wie konnte das nur geschehen? Wie konnte es so weit kommen? Was werden meine Eltern über mich denken, meine engsten Freunde und was meine Patienten, wenn sie es erfahren?
Ich schämte mich sehr. Mir war klar, dass die Strafe, die ich zu erwarten hatte, gerecht war. Ich hatte es verdient, ins Gefängnis zu müssen.
Meine gedankliche Reise in die Vergangenheit begann an jenem schicksalsschweren Tag vor fünf Jahren, an dem mein Unglück begann ...
*
Hi, ich bin Jens.« Der neue Kollege hatte seinen ersten Arbeitstag in der Sozialstation und wurde von allen schon hoffnungsvoll erwartet. Wir waren in der ambulanten Altenpflege ziemlich ausgelastet und freuten uns sehr über die längst fällige Verstärkung.
»Herzlich willkommen«, sagte meine Chefin Carmen und gab Jens die Hand. Einer nach dem anderen im Team folgte ihrem Beispiel. Als ich dran war, hielt er meine Hand einen ganz kleinen Moment zu lange fest und schaute mir tief in die Augen. Er gefiel mir vom ersten Augenblick an, obwohl er fünf Jahre jünger war als ich und äußerlich das glatte Gegenteil von meinem aufgeräumten, fast biederen Äußeren. Er trug seine Haare etwas strubbelig. Sie sahen aus, als hätte er sich nach dem Aufstehen an diesem Morgen nicht gekämmt. Seine Kleidung entsprach seinem lässigen Stil: abgewetzte Jeans, ein ausgeleiertes T-Shirt und weiße Turnschuhe, die auch schon bessere Tage gesehen hatten. Trotzdem hatte er in seiner Unbekümmertheit etwas an sich, das mir gefiel. Daher freute ich mich, als Carmen sagte, Jens solle an seinem ersten Tag mit mir Dienst machen. Er sollte alle elf Patienten, die ich versorgen sollte, mit mir zusammen besuchen. Am nächsten Tag sollte er dann seine eigene Tour bekommen.
So starteten wir und hatten einen ganzen Tag, an dem wir uns kennenlernen konnten. Er war sehr einfühlsam mit den alten Leuten. Als er mir erzählte, dass er sein Examen als Altenpfleger mit einem sehr guten Notenschnitt abgeschlossen hatte, wunderte mich das gar nicht. Trotzdem war er zu Anfang ein wenig unsicher, denn die Anstellung in der Sozialstation und in der ambulanten Altenpflege war sein erster Job nach seiner Prüfung.
Mir fiel auf, dass er manchmal etwas unkonzentriert wirkte. Aber ich schob das auf die Anspannung, die wohl jeder an seinem allerersten Arbeitstag hat.
Nach den ersten drei Patienten an diesem Tag machten wir im Auto eine kurze Pause.
»Machst du das schon lange?«, fragte Jens.
»Ein paar Jahre sind es inzwischen schon.«
»Immer in derselben Firma?«
»Ja, ich habe nach meiner Prüfung hier angefangen, so wie du.« Ich lächelte ihn an.
»Und? Hast du es je bereut?«
»Keine Sekunde. Ich liebe meinen Beruf, und die Firma ist völlig okay.« Ich meinte ernst, was ich sagte. Als ich vor fünf Jahren dort angefangen hatte, wurde ich von einem tollen, kollegialen Team aufgenommen. Mir gefiel meine Arbeit und im Kollegenkreis fühlte ich mich sehr wohl. Klar, oft standen wir alle ziemlich unter Zeitdruck, denn die paar Minuten, die von der Pflegekasse für die Betreuung der Patienten geplant und bezahlt werden, reichen hinten und vorn nicht. Ständig ist man in diesem Beruf in Eile und nicht selten hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu wenig Zeit für die einzelnen Patienten aufbringen konnte. Trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen, jemals meinen Beruf zu wechseln.
Als wir uns am Feierabend verabschiedeten, überraschte Jens mich mit der Frage, ob wir noch zusammen was trinken gehen wollen.
»Oder wartet zu Hause ein Mann auf dich?«
»Nein, ich lebe allein.« Normalerweise gab ich nicht so freimütig Auskunft über mein Privatleben, aber Jens gefiel mir und die Idee, noch etwas Freizeit mit ihm zu verbringen, gefiel mir noch mehr.
Schon an diesem ersten Abend küssten wir uns. Ich hatte mich Hals über Kopf in ihn verliebt. Er brachte mich zum Lachen und zum Träumen. So etwas war mir schon lange nicht mehr passiert. Ich ließ mich ohne Vorbehalte auf eine Affäre mit ihm ein.
*
Aus der Affäre wurde bald eine ernstzunehmende Liebesgeschichte. Ein halbes Jahr waren wir glücklich, bis zu dem Tag, als ich ihn überraschte, wie er im Bad irgendwelche Tabletten nahm.
»Bist du krank?«, fragte ich ihn besorgt. Ich hatte keine Beschwerden bei ihm feststellen können. Was nahm er denn da für Tabletten?
»Nein, keine Sorge«. Da war es wieder, sein sonniges Lächeln, das mich die Sache erst einmal vergessen ließ. Aber als ich dann selbst kurz ins Bad musste, fand ich den Beipackzettel, der ihm wohl vor Schreck auf den Boden gefallen war, als ich ihn überrascht hatte. Ich war schockiert! Was er da nahm, waren stärkste Aufputschmittel! Verschreibungspflichtig!
Natürlich sprach ich ihn sofort darauf an. Das hätte ich lieber nicht tun sollen, denn ohne Vorwarnung rastete er aus. Er schrie mich an, was mir einfiele, ihm nachzuspionieren. Außerdem wäre ich nicht seine Mutter! Ich hätte kein Recht dazu, ihn auszuhorchen, dann knallte er von außen die Wohnungstür zu.
Ich war erschüttert, auch darüber, weil ich nichts von seinem Medikamentenmissbrauch bemerkt hatte. Ich wusste aber auch, dass er seine Arbeit verlieren würde, wenn in der Firma bekannt würde, was er das nahm.
Meine Vermutung, er wäre abhängig von dem Zeug, bestätigte sich bei einem Gespräch, das wir einige Tage später in aller Ruhe führen konnten. Es war aber noch schlimmer, als ich dachte. Jens nahm nicht nur die Aufputschmittel. Er schluckte auch regelmäßig Beruhigungstabletten. Die brachten ihn zum Schlafen, und die Aufputschtabletten brauchte er zum Wachwerden. Mittlerweile war seine Abhängigkeit so weit entwickelt, dass er die Tabletten mehrmals am Tag nehmen musste. Sonst hätte er nicht arbeiten können.
Was ihn dazu gebracht hat, überhaupt damit anzufangen, wie er in die Sucht geschlittert ist und wie er an die Medikamente kam ... – diese Fragen blieben unbeantwortet.
Das war der Moment, an dem ich mich hätte zurückziehen müssen. Es ging ja aber nicht nur um eine Entscheidung über mein Privatleben. Eine mindestens genauso drängende Frage war, ob ich unseren Arbeitgeber hätte informieren müssen. Ich tat es nicht, obwohl ich dabei ein sehr schlechtes Gefühl hatte. Aber meine Liebe zu ihm war mittlerweile so groß, dass ich fest davon überzeugt war, dass wir gemeinsam das Problem in den Griff bekommen würden.
In langen Gesprächen, in denen er sich zerknirscht und manchmal sogar verzweifelt gab, legte ich ihm nahe, von selbst zu kündigen und sich einen anderen Job zu suchen. Er versprach, darüber nachzudenken und flehte mich an, ihn nicht zu verraten.
Wenn er mich dann zärtlich in die Arme nahm, mir abends die Füße massierte und mich wie eine Prinzessin behandelte, traten meine Bedenken und mein schlechtes Gewissen in den Hintergrund. Ich war überzeugt davon, dass er es mit meiner Liebe schaffen könnte, von dem Zeug wegzukommen. Ich liebte ihn über alles und wollte ihn auf keinen Fall verlieren. Immer, wenn ich ihn bat, eine Therapie zu machen, sich einem Arzt anzuvertrauen und seine Sucht zu bekämpfen, versprach er mir hoch und heilig, alles zu tun, was ich verlangte. Für mich. Er machte mir vor, dass er mich noch mehr liebte als ich ihn. Heute weiß ich, dass alles nur gelogen war.
*
Kannst du mir bitte etwas Geld leihen?«, fragte er eines Tages. »Ich bin pleite für diesen Monat. Ich gebe es dir sofort zurück, wenn der Lohn da ist.«
Irgendetwas in seiner Stimme ließ mich aufhorchen. Als ich nachbohrte, gab er zu, dass er die Medikamente längst nicht mehr vom Arzt verschrieben bekam. Da war der nächste Schlag für mich. Nicht nur, dass mein Freund von Aufputsch- und Beruhigungsmitteln abhängig war, er besorgte sich das Zeug auch noch illegal auf dem Schwarzmarkt. Das kostete sehr viel Geld. Mehr Geld, als er in seinem Job als ambulanter Altenpfleger verdiente. Ich stand nun vor der Frage, ob ich ihn in seiner Sucht unterstützen sollte, wenn ich ihm Geld lieh.
Andererseits hatte er auch kein Geld mehr, um im Supermarkt einkaufen zu gehen, also bog ich mir die Realität so hin, dass ich ihm nur mit Geld für Lebensmittel aushalf. Ich gab ihm nicht nur Geld. Als er seine Miete nicht mehr zahlen konnte, nahm ich ihn bei mir auf. Wir zogen zusammen. Die Kollegen freuten sich und beglückwünschten uns zu unserem Start ins gemeinsame Leben, aber tief in mir wuchsen die Zweifel immer mehr. Aber ich wagte nicht, mit jemandem darüber zu sprechen.
Schauen Sie mal, Doris. Das ist der Schmuck, den mir mein Georg damals zur Hochzeit geschenkt hat.« Stolz zeigte eine meiner Patienten, Frau Herrmann, ihre Schmuckschatulle. Darin lagen mehrere Ringe mit großen Steinen, einige Goldarmbänder und Halsketten. Dazu zwei Broschen mit funkelnden Brillanten.
»Das alles?«, fragte ich etwas naiv.
»Nein, natürlich nicht. Das da«, rief sie lächelnd und nahm eine Kette aus massivem Gold aus dem Kästchen. Ich durfte sie in die Hand nehmen und war über ihr Gewicht überrascht. Das Schmuckstück bestand aus mehreren Gliedern, die ineinander verflochten waren. Ein wunderschönes Stück, zeitlos und wahrscheinlich sehr wertvoll.
»Die ist aber sehr schön, Frau Herrmann. Wir legen sie wieder in die Schatulle. Wo soll ich Ihr Schmuckkästchen hinstellen? In Ihr Nachtkästchen?«
»Nein, lassen Sie es hier stehen bitte. Heute Nachmittag kommt mein Neffe, dem will ich eine Brosche schenken. Für seine Braut. Er heiratet am Samstag.« Sie strahlte über das ganze Gesicht und war sichtlich stolz, dass sie ihrem Neffen ein so wunderschönes und wertvolles Geschenk machen konnte.
Am Abend erzählte ich Jens von der Sache. Ich war so berührt vom Stolz und der liebevollen Geste, die Brosche an den Neffen zu verschenken, dass ich mein Erlebnis unbedingt los-werden musste.
»Und du weißt nicht, wo sie die Schatulle normalerweise aufbewahrt?«, fragte er scheinbar unbeteiligt.
»Nein, sie stand ja schon da, als ich dort war. Wieso?«
Was dann kam, entsetzte mich.
Jens schlug vor, ich sollte doch herausfinden, wo die alte Dame ihren Schmuck versteckte.
»Wenn du das weißt, reden wir weiter. Ich überlege mir inzwischen was.«
»Was denn? Was meinst du damit?«
»Bei so viel Schmuck wird sie nicht merken, wenn was fehlt. Die Oma trägt ihn wahrscheinlich nicht einmal, oder hast du sie schon mal mit den Klunkern gesehen?«
»Nein, das nicht, aber ...«
»Was aber? Wir nehmen niemandem was weg. Der Neffe wird mal alles erben. Da kommt es dann auf ein Schmuckstück mehr oder weniger auch nicht an.«
Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Jens wollte tatsächlich den Schmuck stehlen. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage! An diesem Abend hatten wir darüber einen sehr ernsthaften Streit. Jens warf mir vor, nicht genug für ihn zu tun. Er tue schließlich alles, was ich verlangte. Er habe sich einen Therapieplatz gesucht, den er aber selbst zahlen müsste, weil er mit seiner Sucht nicht offiziell bei der Krankenkasse in Erscheinung treten könnte. Seine Sorge, den Job zu verlieren, sprach dagegen. Das leuchtete mir ein. Es leuchtete mir auch ein, dass solche Therapie eine Menge Geld kosten würde. Geld, das wir nicht hatten, denn wie ich heute weiß, besorgte sich Jens von jedem Euro, den er bei mir finden konnte, seine Tabletten weiterhin auf dem Schwarzmarkt.
*
Als ich am nächsten Tag wieder bei Frau Herrmann war, stand die Schatulle immer noch auf dem Wohnzimmertisch.
»War Ihr Neffe gestern hier und hat er sich über die Brosche gefreut?««, fragte ich die alte Dame.
»Ja, und wie! Er ist mir gleich um den Hals gefallen.« Frau Herrmann strahlte über das ganze Gesicht. »Jetzt können Sie sie bitte wegräumen. Würden Sie meinen Schmuck bitte in den Schlafzimmerschrank stellen? Ganz oben, bei den Pullovern bitte.«
»Ist die Schatulle denn dort sicher genug?« Instinktiv versuchte ich, den Schmuck außer Reichweite von möglichen Dieben zu bringen. Am liebsten wäre es mir gewesen, ihr Neffe hätte den Schmuck noch gestern Abend weggeräumt, denn wenn ich das Versteck kannte, würde ich vielleicht doch in Versuchung geraten. Jens hatte mich ein bisschen überzeugt. Noch war ich nicht ganz sicher, ob ich mich wirklich darauf einlassen und zur Diebin werden sollte. Aber in einem hatte Jens recht: Den Verlust würde wahrscheinlich niemand bemerken. Frau Herrmann war schon ein bisschen dement und mit ihren 91 Jahren würde sie wohl auch nicht mehr ewig zu leben haben. Sie selbst trug den Schmuck nicht. Das Erbe würde an den Neffen fallen und dem würde es bestimmt nicht auffallen, wenn ein einziges Stück aus der reich gefüllten Schatulle fehlt.
Auffliegen würde der Diebstahl also vermutlich nicht. Aber es ging mir nicht nur darum, nicht erwischt zu werden. Bisher hatte ich ein einwandfreies Leben geführt. Ich hatte noch nicht einmal einen Strafzettel für Falschparken bekommen. Immer war ich ehrlich und anständig gewesen. Schon allein der Gedanke an das, was ich vielleicht vorhaben könnte, machte mir ein schlechtes Gewissen, aber gleichzeitig zog ich in Erwägung, es zu tun. Gewissen, Verstand und meine Liebe zu Jens kämpften miteinander.
*
Und? Weißt du nun, wo die Alte ihre Klunker versteckt?!« Ich ärgerte mich über seine Ausdrucksweise und über den Ton. So kannte ich Jens bisher nicht.
»Ja«, sagte ich und bereute im selben Augenblick meine Ehrlichkeit. Denn ab diesem Moment bearbeitete mich Jens ununterbrochen. »Wenn du mich liebst, bringst du mir den Schmuck.«
»Du weißt doch, dass ich dich liebe, aber ich will nicht zur Diebin werden.« Ich versuchte verzweifelt, mich dagegen zu wehren, aber er ließ nicht locker. Immer wieder hielt er mir die teure Therapie vor, durch die er doch wieder geheilt werden könnte.
Nach einigen Tagen hatte er mich dann so weit. Er brachte zwei Argumente vor, die ich nicht einfach so wegschieben konnte.
Zum einen drohte er, mich zu verlassen, wenn ich ihm nicht helfen würde, an den Schmuck zu kommen.
Zum anderen versprach er mir hoch und heilig, den Schmuck ins Pfand-
leihhaus zu bringen, von dem Erlös Therapiestunden zu bezahlen, und sobald er die wertvollen Stücke wieder auslösen könnte, würde er das tun. Ich könnte den Schmuck dann wieder unbemerkt in die Schatulle zurücklegen. Es wäre also gar kein Diebstahl. Wir würden uns den Schmuck ja quasi nur leihen.
Warum ich mich breitschlagen ließ, kann ich nicht genau erklären. Ich kann es mir bis heute auch nicht verzeihen, aber es nützt ja nichts, ich habe es getan. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Als ich die Gelegenheit dazu hatte, griff ich zu. Instinktiv wählte ich die Halskette, die mir Frau Herrmann gezeigt hatte. Sie hatte bestimmt einen relativ hohen Wert.
Jens nahm mich in den Arm und drückte mich ganz fest, als ich ihm die Kette übergab.
»Jetzt wird alles gut«, versprach er mir. »Morgen versetze ich das Ding, gehe dann gleich zu meinem Therapeuten und bezahle die offenen Rechnungen der letzten Stunden und dann gehe ich zum Dienst. Ich habe Nachmittagsdienst.«
»Du hast doch Frühdienst«, entgegnete ich verwundert.
»Nein, Carmen hat vorhin angerufen, ich musste tauschen. Naja, passt ja jetzt.« Wieder war da sein Lächeln, seine strahlenden Augen, sein fester Griff bei seiner Umarmung. Das war das letzte Mal, dass ich ihn spürte. Noch am selben Abend verließ er mich.
Er machte mir vor, mit einem Freund noch was trinken zu wollen. Ich solle nicht auf ihn warten und schon schlafen gehen. Als ich mitten in der Nacht aufwachte, war er immer noch nicht da. Auch am nächsten Morgen nicht. Er kam nicht wieder.
Seinen Dienst trat er nicht an. Ein Tausch war nicht vorgesehen, er hatte mich angelogen und hätte zum Frühdienst kommen müssen. Die Kollegen und vor allem meine Chefin fragten mich, was los wäre. Ich log erst etwas zusammen, von der Großmutter, die plötzlich krank geworden war. Aber als ich nach einigen Tagen immer noch nichts von ihm gehört hatte und er auch auf dem Handy nicht erreichbar war, musste ich den Tatsachen ins Auge schauen: Er war weg.
In der Firma musste ich zugeben, dass er mich verlassen hatte. Warum er allerdings auch nicht zur Arbeit kam, dafür hatte ich keine offizielle Erklärung parat.
Ich traute mich nicht, im Pfanleih-haus nachzufragen, ob die Kette dort lagerte. Insgeheim glaubte ich sowieso, die Antwort zu wissen.
*
Immer wenn ich bei Frau Herrmann war, konnte ich ihr kaum in die Augen schauen. Mein schlechtes Gewissen war übermächtig. Es hatte sich außerdem auf meine Gesundheit ausgewirkt. Ich litt unter Schlafstörungen, Verdauungsproblemen und Hautausschlag.
Gleichzeitig hatte ich ständig Angst, dass ihr der Verlust der Kette auffiel. Ich war ja die Einzige, die vom Versteck der Schatulle wusste, also wäre der Verdacht auch als erstes gleich auf mich gefallen – zu Recht!
Als ich nach einem Jahr durch meine Chefin erfuhr, dass Frau Herrmann gestorben ist, war ich fast erleichtert. Ich hoffte, die Sache für mich abschließen zu können. Mein schlechtes Gewissen war aber immer noch da. Damit würde ich wohl mein restliches Leben verbringen müssen, aber das geschah mir auch recht so.
Kurz nach der Beerdigung kam dann der Schock. Der Neffe der Verstorbenen kündigte telefonisch seinen Besuch in der Sozialstation an. Alle Kollegen und vor allem meine Chefin, gingen davon aus, dass sich der Neffe für die jahrelange Pflege und Betreuung seiner Tante bedanken wollte. Es war nicht ungewöhnlich, dass Angehörige eine Spende zu Gunsten der Station machten. Nur ich ahnte, dass er aus einem anderen Grund kam.
So war es dann auch.
Er wollte mit meiner Chefin unter vier Augen sprechen. Danach holte mich Carmen in ihr Büro und stellte mir die Frage, die ich befürchtet hatte.
»Der Angehörige behauptet, es fehlt ein wertvolles Schmuckstück. Weißt du etwas davon?««
»Nein«, log ich. »Warum sollte ich was davon wissen?«
»Weil du diejenige von uns bist, die bei Frau Herrmann war, und der Neffe behauptet, du hättest die Schatulle vor ca. einem Jahr in der Hand gehabt.«
Ich gab nichts zu und hoffte, die Sache wäre damit erledigt. Aber der Neffe ging zur Polizei und zeigte mich an.
Ich wurde mehrmals verhört und verzettelte mich in Widersprüche. Schließlich brach ich in Tränen aus, aber zugegeben hatte ich immer noch nichts. Die Polizei hatte erst einmal mit den Ermittlungsarbeiten zu tun, denn ich brachte bei meinen Aussagen Jens ins Spiel. Schließlich ist er mein damaliger Lebenspartner und Kollege gewesen. Auch er war hin und wieder bei Frau Herrmann tätig gewesen und hätte deshalb ebenfalls Zugriff auf den Schmuck gehabt.
Sein rätselhaftes Verschwinden deutete außerdem darauf hin, dass er etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Nun war er der Hauptverdächtige. Ich wurde vorerst auf freien Fuß gesetzt. Carmen stellte mich vom Dienst frei, bis alles geklärt wäre.
Die Polizei konnte Jens tatsächlich ausfindig machen. Seine Aussage belastete mich zu hundert Prozent. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis ich verhaftet wurde.
Das Urteil fiel dann noch recht mild aus. Ein Psychologe bescheinigte mir eine psychische Abhängigkeit von Jens. Man glaubte mir, dass ich fest vorhatte, die Kette aus dem Leihhaus wieder auszulösen. Und weil ich bisher ein unbescholtenes Leben geführt hatte, wurde ich lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt. Allerdings verlor ich meinen Job. Momentan beziehe ich Arbeitslosengeld. Es ist schwer, eine neue Anstellung zu finden.
Eigentlich wird ständig Personal in der Altenpflege gesucht. Aber in meinem Beruf ist es ganz unmöglich für mich geworden. Da steht mein Zeugnis gegen. Ich verstehe auch, dass mich keiner in der Branche nimmt. Momentan habe ich eine Bewerbung bei einer Reinigungsfirma als Putzfrau laufen.
Was aber noch schwerer wiegt, ist der Verlust meiner Freunde. Fast mein gesamter Freundeskreis bestand aus Kollegen. Damit war es vorbei. Sie waren fassungslos über meine Tat.
Auch meine Eltern waren entsetzt, als sie von der Sache erfuhren. Sie wollen erst einmal nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich hoffe sehr, dass sich das wieder ändert und sie mir verzeihen. Sonst hätte ich neben meinem Freundeskreis auch meine Familie verloren.
Ich bereue meine Schuld aus vollem Herzen. Jede Woche gehe ich zum Friedhof und lege Blumen auf das Grab von Frau Herrmann. Ich bitte sie leise um Verzeihung, aber mein Gewissen wiegt immer noch unglaublich schwer.
Ich hoffe sehr, dass ich wieder ein unbeschwertes Leben führen kann, aber noch bin ich damit beschäftigt, mit der Schuld fertigzuwerden, die ich auf mich geladen habe. Eines ist mir klar: Ich werde nie mehr stehlen! Weder für mich noch für irgendjemand anderes. Ich werde ein unbescholtenes Leben führen, denn ich möchte niemals mehr einem anderen Menschen Schaden zufügen!
Beim nächsten Mann, den ich treffe, werde ich sehr vorsichtig sein, auf wen ich mich da einlasse. So blauäugig und naiv will ich nie wieder sein!
Ende
Dunkle Vergangenheit »Was damals wirklich geschah ...«
Roman von Heike L. (44)
Heike L. (44):
Meine Eltern flohen vor
vielen Jahren mit mir über das ehemalige Jugoslawien aus der DDR in den Westen. An diese Zeit habe ich nur sehr vage Erinnerungen. Meine Eltern berührten dieses Thema nur sehr ungern. Ich ahnte, dass sich um unsere Flucht ein Geheimnis rankte. Und ich sollte recht behalten …
Freut ihr euch denn gar nicht?«, fragte ich meine Eltern damals, als die Grenzen gefallen waren. Ich war seinerzeit mitten in der Ausbildung zur Friseurin und hatte an der ganzen Entwicklung regen Anteil genommen, denn wir stammten aus der damaligen DDR.
»Ja, ja«, sagte Papa eher abweisend. Er war eigentlich Ingenieur, hatte aber im Westen nie wieder Anschluss in seinem Beruf finden können und arbeitete seit Jahren als Schichtleiter in einer Metallwarenfabrik. Mama hatte eine Stelle als Verkäuferin bei einem Discounter. Unser Leben verlief in ruhigen Bahnen.
»Damit hätte ich nie gerechnet, dass es einmal so kommt. Nicht wahr, Ina?« Er sah zu meiner Mutter und nahm ihre Hand.
»Niemand hätte damit gerechnet«, sagte sie irgendwie tonlos. Mir kamen
beide so unendlich traurig vor. So richtig schien sie diese sensationelle Nachricht nicht zu begeistern.
»Jetzt könnt ihr ja vielleicht wieder mal rüberfahren nach Thüringen ...«
»Was sollen wir dort?«, blockte Papa gleich mürrisch ab. »Wir haben dort nichts mehr verloren. Es ist keiner mehr da von denen.«