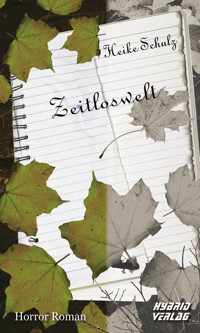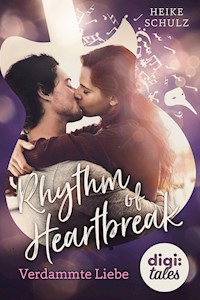9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Gewissenhaft geht Veit seiner Ausbildung zum Schreiner nach, züchtet voller Hingabe Kaninchen und kann die fantasievollsten Kunstwerke aus einem Stück Holz schnitzen. Zumindest unter der Woche. Samstags ist Veit ein anderer. Dann wird er zum Schläger und trifft sich mit seinen Kameraden des 'Injury Time Cologne' jenseits des Fußballplatzes, um sich mit gegnerischen Hooligans zu prügeln. 'Dritte Halbzeit' nennen die Jungs diese Zusammenkünfte, und so manche gegnerische Flagge, die die Stammkneipe des ITC schmückt, geht auf Veits Konto. Obwohl Veit stets darauf achtet, keine Außenstehenden mit in ihre Prügelorgien hineinzuziehen, lässt sich das nicht immer vermeiden. So auch an jenem Abend, als der ITC eine verfeindete Hooligangruppe aufmischt und ein unbeteiligter junger Mann zu Schaden kommt. Veit plagt das Gewissen, doch er verdrängt den Vorfall und widmet sich lieber Lara, der jungen Cellistin, die er auf der Heimfahrt in der S-Bahn kennenlernt. Dass er ein Hooligan ist, verschweigt er. Sie tauschen Telefonnummern aus, verabreden sich und schon wenig später entwickelt sich eine zarte Liebe. Eine Liebe, auf der ein Schatten liegt, denn Laras Sorgen gelten Laurien, ihrem 19-jährigen Bruder, der in der Nacht ihres Kennenlernens mit schweren Kopfverletzungen in der Altstadt aufgefunden wurde und seitdem im Koma liegt. Niemand weiß, woher seine Verletzungen stammen und ob er je wieder aufwachen wird. Zunächst sieht Veit keinen Zusammenhang zwischen Lauriens Koma und dem Zwischenfall bei der Prügelei, doch als die Ärzte massive Schläge auf den Kopf als Ursache für Lauriens Zustand ausmachen, fürchtet er, dass womöglich der ITC und somit auch er selbst dafür verantwortlich sein könnten. Er gerät in einen immer größer werdenden Gewissenskonflikt: Kann er Lara die Wahrheit sagen, ohne sie zu verlieren? Und wie weit würden seine Kameraden gehen, wenn er den Schwur bricht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Ähnliche
Heike Schulz
Anpfiff dritte Halbzeit
Jugendroman
Für meine Brüder Frank und Dirk.
Die Besten.
Kapitel 1
Ein zweibeiniger Cellokoffer
Ich weiß nicht, woran meine Eltern gedacht haben, als sie vor siebzehn Jahren einen Namen für ihren Sohn suchten. Vielleicht haben sie auch einfach nur blind in ein Vornamenbuch getippt, aber ihre Wahl hätte nicht treffender sein können. Veit. So heiße ich, und das bin ich auch. Ein Fighter, schon von der ersten Sekunde an.
»Dä Jung soh us wie en affjetrocken Kning.« Wie ein abgezogenes Kaninchen. Der Spruch hängt mir schon mein Leben lang nach. Ich weiß, dass meine Oma es nicht böse meint, aber es nervt tierisch, wenn sie das auf jeder Familienfeier vom Stapel lässt. Kaum zwei Kilo schwer und viel zu früh kam ich auf die Welt. Das kauft mir keiner ab, der mich heute sieht. Gut, mit eins fünfundsiebzig bin ich noch immer kein Riese, aber dafür echt eine Kante. Wie Wayne Rooney, der Stürmer von Manchester United. Der ist cool und geht immer dahin, wo es wehtut. Kompromisslos, aber ehrlich, genau wie ich. Nicht dass ich selber Fußball spiele. Für mich hat es nie in eine Mannschaft gereicht. Klar, ein bisschen kicken auf dem Bolzplatz mit den Jungs, aber im Verein? Bloß nicht. Ich gucke mir die Spiele lieber an. SC Germania Köln 09, das ist mein Verein. Der hält sich zwar nur mit Mühe in der zweiten Liga, aber das ist egal. Viel wichtiger ist sowieso, was in der dritten Halbzeit stattfindet. Dann gibt es ordentlich Beulerei. Meine Jungs vom Injury Time Cologne und ich sind die Macht im Sektor. Keine andere Hooligangruppe zieht so viele gegnerische Fahnen und Banner wie wir. Konrad sagt zwar immer, dass ich derjenige bin, dem der ITC die meisten Trophäen zu verdanken hat, aber das spielt keine Rolle. Klar macht es mich stolz, wenn unser Anführer mich besonders lobt, aber es ist mir auch ein bisschen peinlich. Es ist doch egal, wer die Fahne zieht. Wir alle sind Brüder, einer für alle, alle für einen, und am Ende zählt doch nur das Ansehen des ITC.
Dass es auch so bleibt, dafür haben wir vorhin wieder gesorgt. Die Zecken vom VfL Braunschweig dachten echt, sie könnten uns den Hintern versohlen, aber denen haben wir es gezeigt. Rund ums Stadion hatten die Bullen alles im Griff, da ging nichts. Sogar mit Pferden waren sie da, aber auf dem Weg zum Bahnhof haben wir die Braunschweiger zuerst auseinandergezogen und sie uns dann in der Altstadt gekrallt. Die dachten wohl, sie könnten sich hinter den Jungs vom blau-weißen Trachtenverein verstecken und eine dicke Lippe riskieren. Zu unserer Freude hat es dann aber ordentlich geknallt. Wie die Hasen sind sie gerannt, es hat ihnen jedoch nichts genützt, schließlich hatten wir sie eingekesselt.
Konrad ist echt ein super Stratege. Wie ein General hatte er die Aktion geplant und per Handy dirigiert. Kaum einer ist uns entkommen. Wir haben ordentlich gelbe Scheine verteilt, und als die Bullen endlich geschnallt hatten, was läuft, waren wir auch schon wieder weg. Drei Kutten und vier Fahnen haben wir geerntet, alles in allem eine super Aktion, wenn da nicht dieser Typ gewesen wäre.
Keine Ahnung, wo der so plötzlich herkam, der sah aus, als hätte er sich verlaufen, und ehe ich es richtig mitbekommen hatte, lag er schon am Boden. Sah übel aus, blutete aus den Ohren und bekam nichts mehr mit.
»Kollateralschaden« nennt Konrad es, wenn ein Unbeteiligter mit hineingezogen wird, und zuckt mit den Achseln. Passiert halt, lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber mich wurmt das. Es pisst mich sogar richtig an. Der Junge sah harmlos aus. Zuerst guckte er sich nur erstaunt um, dann sah ich, wie die Angst nach ihm griff. Ich habe das schon tausend Mal gesehen. Es ist auch beeindruckend, wenn da plötzlich eine rot-weiße Wand von allen Seiten auf dich zurennt, »ITC – jetzt tut’s weh!« aus zig Kehlen durch die Gassen hallt, das Getrampel unserer Stiefel wie Donnergrollen über dich hereinbricht und du nicht weißt, wo du hinsollst. Dann brauchst du schon ein paar mächtig haarige Eier, um dagegenzuhalten.
Aber der Junge wusste gar nicht, wie ihm geschah. Der hob die Arme wie ein Pfaffe, der die Gemeinde segnen will, und bekam gleich eins auf die Zwölf. Ich wollte mich zu ihm durchschlagen und gucken, ob ich ihm helfen kann. Konrad musste dieselbe Idee gehabt haben, denn er war vor mir da und bückte sich zu ihm hinunter. Als aber jemand »Die Bullen kommen!« rief, sind wir nur noch gerannt.
Bestimmt eine halbe Stunde lang bin ich kreuz und quer durch die Innenstadt gewetzt, bis ich sie abgeschüttelt hatte. Auch als ich endlich in der S-Bahn saß und meinen Schädel gegen das kalte Glas legte, trommelte mein Herz noch wie wild. Ich fühlte mich großartig und musste grinsen, aber das lag nicht nur an dem Adrenalin, sondern auch an dem schwarzen Ungetüm, das hinter mir in den Waggon stieg. Es sah aus wie ein überdimensionierter Gitarrenkasten auf zwei sonnengebräunten Beinen, die in einem Paar ausgefranster Jeans steckten, und quetschte sich an den Sitzreihen vorbei. Dabei rempelte das Ungeheuer gegen ein paar Schienbeine, keuchte Entschuldigungen, blieb an einer Haltestange hängen und krachte der Länge nach in den Mittelgang. Darauf landete bäuchlings ein Mädchen von vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahren.
»Bleib ruhig sitzen und glotz noch ein bisschen. Ich schaff das schon!« Die Augen, mit denen es mich unter einem Vorhang dunkelbrauner Haare anfunkelte, erinnerten mich an zwei glänzende Schokodrops.
Ertappt sah ich mich um. Offenbar war ich der Einzige, der den Blick nicht von ihr hatte losreißen können. Die paar Nachtschwärmer, die das Abteil besetzten, hatten sich bereits wieder müde der Dunkelheit zugewandt, die an den Fenstern vorbeiglitt.
Ich spürte, wie mir die Röte bis unter mein Basecap kroch. Hastig sprang ich auf die Füße und zog das Mädchen an den Handgelenken hoch. Zumindest versuchte ich es. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, was nun geschah, womöglich machte die Bahn einen Ruck, jedenfalls verlor ich bei der ganzen Aktion das Gleichgewicht und landete neben ihr auf dem Kasten.
»Machst du das immer so?«, zischte sie und schaute demonstrativ auf meine linke Hand. Die ruhte wie selbstverständlich auf einer ihrer Brüste. Scheiße, wie peinlich! Schnell zog ich die Hand weg und klemmte sie mir unter die Achsel.
»Tut mir leid, äh, echt jetzt, das war keine Absicht.«
Ich wagte kaum, sie anzusehen. Stattdessen bereitete ich mich auf eine Ohrfeige vor und kniff die Augen zusammen, aber der brennende Schmerz auf meiner Backe blieb aus.
Stattdessen murmelte sie etwas, was wie »Vollspacko«klang, und rappelte sich auf. Irgendwie schaffte auch ich es wieder auf den Sitz und tat cool. Dabei bemühte ich mich, das Gefühl ihrer Brust loszuwerden, das sich wie ein Stempel in meine Handfläche gedrückt hatte. Leicht war das nicht, besonders deshalb, weil sie mir genau gegenübersaß und mich unentwegt anstarrte. Dann fing sie auch noch an zu kichern. »So schlimm?«
Widerwillig wandte ich mich ihr zu. »Was?«
Sie deutete auf meine Hand und grinste. »War es so schlimm?«
Ich folgte ihrem Blick und bemerkte, dass ich die ganze Zeit meine Hände geknetet hatte. Hastig wollte ich sie in die Taschen meines Hoodies schieben, doch sie beugte sich vor und hielt mich am Ellbogen fest.
»Zeig mal.«
Ich habe kräftige Hände. Schwielig von der Arbeit in der Tischlerei und egal, wie sehr ich sie schrubbe, immer hängt mir irgendwo etwas Dreck unter den Nägeln. Meistens Harz oder Holzöl, mit dem ich meine fertigen Stücke poliere. Ich bin ein guter Tischler, sagt mein Meister, und obwohl ich meine Lehre noch nicht abgeschlossen habe, bin ich jetzt schon besser als die Gesellen. Sie nehmen sich einfach nicht genug Zeit, das Holz zu spüren. Es spricht mit einem, wenn man nur genau hinhört. Es sagt, wie man den Beitel ansetzen muss, wenn man seine Seele freilegen will. Die anderen meinen, ich spinne, Holz hätte keine Seele. Aber was wissen die schon? Ich jedenfalls spüre sie ganz genau.
Bisher hatte ich mir nie Gedanken über meine Hände gemacht, aber hier, unter den Blicken des Mädchens, schämte ich mich ein wenig. Widerwillig hielt ich sie ihr hin.
»Nein, andersrum.« Sie drehte meine Handflächen nach unten. »Du hast dir wehgetan. Tut mir leid, ist das gerade eben passiert?« Sie deutete auf die aufgeplatzten Knöchel meiner Rechten.
»Ist nicht so schlimm.« Ich befreite mich aus ihrem Griff und beeilte mich, meine Hände in die Hoodietaschen zu stopfen. Sie sollte keine Fäuste ansehen, die vor nicht einmal einer Stunde die Reihen der Braunschweiger gelichtet hatten.
»Ich bin übrigens Lara.« Sie hielt mir wie zur Begrüßung die Hand hin, doch als ich nicht zugriff, machte sie eine Geste, die »Was soll’s?« sagte.
»Veit«, murmelte ich und deutete mit einem Kopfnicken auf den schwarzen Koffer, dem wir unsere Bekanntschaft zu verdanken hatten. »Was ist das eigentlich?«
»Das?« Sie strich zärtlich über das Leder, das an den Kanten teilweise schon durchgescheuert war. Das Furnier schimmerte durch. »Das ist George.« Sie kicherte, als sie meinen verständnislosen Blick sah. »George ist mein Cello. Und du? Bist wohl Fußballfan, was, Veit?« Neugierig musterte sie meinen Hoodie mit dem Vereinswappen des SC Germania. »Heimspiel?«
Ich räusperte mich und zupfte am Schirm meines Caps. »Kann man so sagen«, antwortete ich ausweichend und versuchte, das Gespräch in unverfänglichere Bahnen zu lenken. »Spielst du in einer Band oder so was?«
»Oder so was. Genau. Ich spiele im Orchester der Musikschule Köln. Schon mal was von uns gehört? Wir geben regelmäßig Konzerte.«
Ich schüttelte wortlos den Kopf.
»Macht nichts«, sagte sie schulterzuckend. »Heute haben wir im Palladium gespielt.«
»Und, macht das Spaß?« Ich stellte mir eine Horde alter Leute vor, die wie Pinguine gekleidet stocksteif dasaßen und mit ernsten Gesichtern schwerer Orchestermusik mit viel Tamtam lauschten.
Sie schaute mich verblüfft an. »Ja klar! Die Leute sind richtig mitgegangen. Doof nur, dass ich George jetzt mit der Bahn nach Hause bringen muss. Eigentlich sollte mein Bruder Laurien mich abholen, aber so, wie es aussieht, hat er es mal wieder verpeilt. Normalerweise fahre ich mit meinem Roller, aber der ist kaputt. Vergaserschaden.«
Ich schnaufte belustigt. »Sagt die Cellistin.«
Ihr Blick bohrte sich in meinen. »Sagt die Cellistin. Es liegt an der Hauptdüse. Der Ersatzteilhändler hat mir die falsche geschickt. Ich habe extra gesagt, ich bräuchte eine Sechs-Millimeter-Düse, aber er hat eine mit vier Millimetern geschickt. Da hole ich mir doch einen Kolbenklemmer. Nun kann ich das Ding erst nächste Woche wieder zusammenschrauben.«
Jetzt war ich baff. »Du reparierst das selbst?«
Ein Grinsen breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Hättest du mir wohl nicht zugetraut, oder?«
»Nein, ehrlich gesagt nicht.«
Etwas Herausforderndes blitzte in ihren Augen auf. »Und warum? Weil ich Musikerin bin? Oder ein Mädchen?«
Ich zwang mich, ihrem Blick standzuhalten. »Nein, nicht deswegen. Weil ich dachte, du hättest mit deiner Musik so viel zu tun, dass dir dafür keine Zeit bleibt. Man muss doch sicher Tag und Nacht üben, um in einem Orchester spielen zu dürfen. Wann soll man dann noch Zeit haben, einen Vergaser zu reparieren?«
Sie öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, überlegte es sich anscheinend jedoch anders und lächelte entschuldigend. »Scheint, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Tut mir leid.«
»Kein Ding. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Dinge, die du mir nicht zutrauen würdest.«
Ihre Augenbrauen schnellten nach oben. »Was zum Beispiel?«
Ich tat, als müsste ich überlegen. »Ähm, nein. Das verrate ich dir nicht.«
Während wir redeten, fuhr ich nicht nur an meiner Station vorbei, sondern auch noch an drei weiteren, bis sie schließlich auf die Leuchtanzeige der Bahn schaute.
»Die nächste muss ich aussteigen«, erklärte sie seufzend, und ich spürte einen leichten Stich.
Sie umklammerte George wie einen schlafenden Liebhaber und stemmte ihn in die Höhe. Als die Bahn langsamer wurde, schwankte sie ein wenig, fiel diesmal aber nicht hin. Stattdessen sah ich ihr hinterher, wie sie sich in Richtung der Türen bewegte. Verzweifelt suchte ich in meinem Schädel nach einem Weg, sie dazu zu bringen, sich noch mal zu mir umzudrehen. Nur noch ein Lächeln, hätte ich ihr am liebsten hinterhergerufen, denn jeden Augenblick würde sie aus meinem Leben verschwinden. Es gab einen weiteren Ruck, die Räder quietschten und die Bahn kam zum Stehen. Zischend öffneten sich die Türen, da stellte sie plötzlich den Cellokasten ab und rannte zu mir.
»Schnell, dein Arm!«
Ehe ich es recht kapierte, hatte sie meinen Ärmel hochgeschoben und mir mit einem Labello eine Zahlenreihe auf den Unterarm gemalt.
»Damit ich herausfinden kann, was dir nicht zuzutrauen ist«, rief sie über die Schulter, bevor sie George wieder anhob und sich aus der Bahn schob.
Muss wohl ein Labello mit Kirsche oder so gewesen sein, jedenfalls duftete ihre Handynummer fruchtig und schimmerte rosa auf meiner Haut. Durchs Fenster sah ich, wie sie in die Nacht hinausstolperte, und hatte plötzlich eine Idee. Ich schaffte es gerade noch raus, bevor sich die Türen hinter mir schlossen und die Bahn abfuhr.
Nein, ich habe sie nicht gefragt, ob ich sie begleiten dürfte. Wie hätte das denn ausgesehen? Ein Kerl wie ich, der ein hübsches Mädchen, das er eben erst in der S-Bahn kennengelernt hat, um diese Uhrzeit nach Hause bringen will. Solche Geschichten stehen jeden Tag in der Zeitung, zusammen mit einem Phantombild unter der Überschrift »Verdächtiger gesucht«.
Mit meinem Angebot hätte ich ihr sicher Angst gemacht. Das war das Letzte, was ich im Sinn hatte. Aber ich bin ihr hinterhergegangen und habe so lange aufgepasst, bis sie sicher in ihrer Haustür verschwunden war. Dann schrieb ich ihr eine SMS, in der ich ihr eine gute Nacht wünschte, und fuhr nach Hause.
Kapitel 2
In einer Tupperdose
Ich bin nicht wirklich der Aufreißertyp. Eigentlich bin ich, was Mädchen betrifft, gar kein Typ. Nicht, dass ich nicht an Mädchen interessiert wäre, das schon, aber mit einer Freundin hat es bisher nicht geklappt.
Wenn ich mal eine nett fand, war sie entweder schon mit einem anderen zusammen oder sie hat mich nur als guten Kumpel gesehen. Für Mädchen scheine ich als Mann nicht besonders interessant zu sein, aber bei Lara hatte ich das Gefühl, dass es anders war. Warum sonst hätte sie mir ihre Handynummer geben sollen?
Die folgenden zwei Nächte grübelte ich darüber nach, ob ich es wagen sollte, sie anzurufen, bis ich es schließlich nicht mehr aushielt. Alleine in meinem Zimmer probierte ich ein paar der Sprüche aus, die bei meinen Brüdern vom ITC immer gut funktioniert hatten, aber keiner davon hörte sich aus meinem Mund richtig an. Das war ich einfach nicht. Ich überlegte, ob ich vielleicht nur eine SMS schreiben sollte, dachte dann aber, dass es kein gutes Zeichen sei, wenn ich gleich zu Beginn zu feige zum Reden wäre. Also wählte ich ihre Nummer, lauschte mit pochendem Herzen, wie sich die Verbindung aufbaute, und erschrak beinahe, als sie abhob.
»Ja?«
Ich würgte den Kloß herunter, der sich in meinem Hals quergestellt hatte. »Ähm, ja. Hallo Lara. Hier ist Veit. Der Typ von neulich, aus der S-Bahn«, setzte ich hinzu.
»Ja klar, weiß ich doch«, antwortete sie. »Du hast mir am selben Abend eine Gute-Nacht-SMS geschrieben. Deine Handynummer steht in meinem Speicher.«
»Echt?« Natürlich, die SMS. Die hatte ich fast vergessen.
»Ja, echt!« Sie lachte kurz auf. »Das war total süß von dir.«
»Echt?« Ich klatschte mir gegen die Stirn. Echt? Echt? Ich klang ja wie ein demenzkranker Papagei. Sie musste mich für völlig meschugge halten. »Warum ich anrufe«, versuchte ich, das Gespräch wieder auf die Spur zu bringen. »Ich fand, das war die beste S-Bahn-Fahrt, die ich je hatte. Also mit dir und George und überhaupt.« Verdammt, was faselte ich denn da? Der Schweiß lief mir in Strömen den Rücken hinunter. »Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnten wir das noch mal machen?«
»Du meinst, miteinander S-Bahn fahren?«
»Ja. Ich meine, nein. Gern auch was anderes diesmal.« Ich räusperte mich und holte tief Luft. Jetzt war eh alles egal. »Ich dachte, ich lade dich zu einem Eis ein. Falls du Eis magst. Wir könnten auch was anderes essen, ähm …«
»Eis essen klingt super«, unterbrach sie mich.
»Echt jetzt?« Ich biss die Zähne zusammen.
»Echt.« Ich hörte an ihrer Stimme, dass sie schmunzelte.
*
Wir trafen uns noch am selben Tag um fünf Uhr bei Zampoli neben dem alten Kino. Wir setzten uns an einen Zweiertisch, etwas abseits im Schatten eines Sonnenschirms, und bestellten zwei Amarenabecher. Während ich mich gleich auf meinen stürzte, stocherte sie in ihrem nur mit dem Löffel herum. Dabei schwappte etwas Sahne über den Rand und lief außen am Glas herunter. Sie schien es nicht zu bemerken.
»Hast du deinen Roller inzwischen repariert?«
Sie schaute, als hätte ich sie aus einem tiefen Gedanken gerissen. »Wie?«
»Dein Roller. Der Vergaser«, half ich ihr auf die Sprünge. »Hast du ihn inzwischen repariert?«
»Oh. Nein. Hab ich nicht.« Sie fuhr mit dem Finger die Sahnespur nach und betrachtete nachdenklich ihre Fingerkuppe.
Ich rutschte nervös auf meinem Stuhl hin und her. In der Bahn war sie viel gesprächiger gewesen, heute wirkte sie hingegen, als hätte sie ihre Zunge verschluckt. Ich zermarterte mir das Hirn, was ich ihr erzählen könnte, aber mein Leben war nicht gerade mit Sensationen gepflastert.
»Magst du eigentlich Kaninchen?« Etwas Besseres fiel mir nicht ein.
»Meinst du, zum Essen?« Endlich schaute sie zumindest halbwegs interessiert auf.
»Quatsch, nicht zum Essen.« Ich schob mir einen Löffel Eiscreme in den Mund und beeilte mich zu schlucken. »Zum Anschauen.«
»Ich habe noch nicht drüber nachgedacht.« Sie leckte ihren Finger ab. »Wieso?«
»Weil ich Kaninchen züchte.«
Sie gluckste. »Du züchtest Kaninchen?«
»Du reparierst Motorroller? Ja klar, warum nicht? Marburger Fehn, um genau zu sein. Das ist eine kleine, hellblaue Kaninchenrasse.«
»Es gibt blaue Kaninchen?« Jetzt schien sie mehr als nur halbwegs interessiert.
»Das nennt man nur so. Eigentlich ist es mehr ein Hellgrau mit bräunlichem Schleier, aber in der Züchtersprache heißt es hellblau. Ursprünglich wurden sie für den Pelzhandel gezüchtet, um ein billiges Imitat des sibirischen Eichhörnchens zu bekommen.«
»Bah, wie fies!«, entfuhr es ihr.
»Ja, finde ich auch«, stimmte ich ihr zu. »Mir würde es nie und nimmer einfallen, meinen Fehn das Fell über die Ohren zu ziehen. Sie sind mein Ein und Alles. Ich habe einen ganz jungen Wurf aus fünf Tieren, dazu drei Häsinnen, einen kastrierten und einen nicht kastrierten Rammler.«
»Noch mal, bah, wie fies!«
Ich überlegte kurz, wie sie ihre Bemerkung meinte, dann fiel bei mir der Groschen. »Glaub mir, es ist besser so. Sonst hätten die Mädels keine ruhige Minute mehr.«
»Kann ich mir vorstellen.« Sie zwinkerte mir zu, worauf ich ganz verlegen wurde. »Wie kommst du darauf, ausgerechnet Kaninchen zu züchten?«
Ich suchte nach den richtigen Worten. »Schwer zu sagen«, antwortete ich schließlich. »Vermutlich, weil sie so klein und weich sind. Im Gegensatz zu mir. Was ist mit dir? Weshalb Cello?«
»Als ich klein war, dachten meine Eltern, ich wäre ein bisschen sonderbar.« Sie lächelte schüchtern und machte mit ihrem Finger eine kreisende Bewegung an ihrer Schläfe. »Weil ich nicht mit den anderen Kindern spielen wollte und stattdessen im Kindergarten alles auseinanderfummelte, was mir in die Hände kam. Ich baute die LEGO-Gebilde der anderen Kinder ab, drehte Seifenspender auf und einmal löste ich mit einer Kinderschere die Schrauben an der Klinke der Klotür.« Sie grinste bei der Erinnerung. »Ich weiß noch, dass es mächtig Ärger gegeben hatte, weil eine der Erzieherinnen fast eine Stunde in der Toilette eingesperrt war, nachdem sie beim Versuch, die Tür zu öffnen, plötzlich die Klinke in der Hand hielt. Ich wusste gar nicht, was los war. Alle waren sauer auf mich, und da bin einfach abgehauen.«
Ich fiel in ihr Lachen mit ein und stellte mir vor, wie die kleine Lara, eine Bastelschere in der einen, einen Satz Schrauben in der anderen Hand, staunend den Tumult beobachtete, den sie, ohne es zu ahnen, verursacht hatte.
»Warum hast du das gemacht?«
»Ich wollte einfach wissen, wie die Dinge funktionieren, warum sie so sind, wie sie sind«, erklärte sie schulterzuckend. »Das will ich auch heute noch. Jedenfalls dachten meine Eltern, dass es für mich unbedingt an der Zeit wäre, zu lernen, mit anderen zurechtzukommen. In einem Ratgeber hatten sie von musikalischer Früherziehung gelesen. In einem Kinderorchester zu spielen, meinen Platz als Teil eines Ganzen einzunehmen und Regeln einzuhalten, das war der pädagogische Hintergedanke.«
»Aber du hast ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht«, setzte ich die Geschichte fort.
Sie leckte genüsslich die Schlagsahne von ihrem Löffel. »Kann man so sagen. Ich wurde nämlich so gut, dass ich schon bald bei den älteren Kindern mitmachen durfte. Von wegen, Kontakt mit Gleichaltrigen. All diese Kindergartenkiddies waren mir irgendwie zu, na ja, kindergartenmäßig. Als ich mir dann ein Instrument aussuchen durfte, stürzte ich mich gleich auf das Cello.«
»Warum ausgerechnet das?« Bei der Erinnerung, wie sie George durch die Bahn geschleppt hatte, konnte ich mir kein Instrument vorstellen, das weniger zu ihr passte.
»Hast du dir das Cello mal angehört?« Sie schaute mich verwundert an, worauf ich mir ziemlich dumm vorkam. Nein, ich wusste echt nicht, wie ein Cello klang.
Beschämt schüttelte ich den Kopf.
»Dann müssen wir das unbedingt demnächst mal nachholen.« Sie nickte entschlossen. »Wenn du es einmal gehört hast, wirst du mich verstehen. Cello klingt wie …«, ihr Blick ging suchend in die Ferne. »Es klingt wie der Gesang uralter Bäume. Verstehst du mich?«
Ich nickte. »Als ob das Holz dir seine Geheimnisse zuflüstert.«
Ihre Augen leuchteten. »Ja, genau so«, hauchte sie, griff über den Tisch und fasste meine Hand. Wie von selbst verschränkten sich unsere Finger. »Du bist ein besonderer Kerl, Veit. Weißt du das?« Ihr Blick versank in meinem.
»Ich bin nur ich«, widersprach ich und schaute weg.
»Das ist es ja«, antwortete sie. »Neulich in der S-Bahn, seien wir mal ehrlich, da hätte ich normalerweise Angst vor dir haben müssen. Ein fremder Typ, groß und breit, der mir auch noch versehentlich an die Oberweite fasst. Da hätten eigentlich alle Alarmsirenen bei mir angehen müssen, und die funktionieren normalerweise sehr zuverlässig. Ich wunderte mich, warum es bei dir anders war, und wollte es herausfinden. Jetzt weiß ich es. Du hast ein aufrichtiges Herz.«
*
Unser nächstes Date hatten wir schon einen Tag darauf. Wir gingen an den Rheinauen spazieren, setzten uns auf eine Bank und redeten. Je besser ich sie kennenlernte, umso klarer wurde mir, dass sie etwas bedrückte. Was es war, wollte sie nicht sagen, auch wenn es manchmal danach aussah, als wäre sie kurz davor. Abends saßen wir gemütlich am Rheinufer, als ihr Handy klingelte. Der Anruf dauerte nur kurz, und nachdem sie aufgelegt hatte, war sie weiß wie Sägemehl und verabschiedete sich hastig von mir. Ich wollte sie begleiten, doch sie achtete nicht weiter auf mich und rannte davon. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihr verdutzt und ein bisschen besorgt hinterherzuschauen. Mir wurde schlagartig bewusst, dass es etwas Schlimmes sein musste, was an ihr nagte.
Den ganzen nächsten Vormittag schlich ich wie ein Wolf um mein Handy herum und wartete auf ihren Anruf. Es machte mich total nervös und um ein Haar hätte ich die Gehrung für eine Leiste falsch gesägt. Mein Meister machte darüber eine spöttische Bemerkung. Ich wusste ja, dass er es nicht ernst meinte, aber Mick grinste hinter seinem Rücken schadenfroh. Ich zeigte ihm heimlich den Stinkefinger. Der Idiot war doch nur froh, dass ausnahmsweise mal jemand anderes als er Mist baute.
Trotzdem schaltete ich mein Handy aus, um mich besser auf meine Arbeit konzentrieren zu können. Erst in der Mittagspause schaute ich wieder drauf und endlich erschien Laras Name im Nachrichteneingang. Ich schob den Rest meines Wurstbrots in den Mund und öffnete die SMS.
»Na, Post von deiner Süßen?«, witzelte Mick und tunkte ein Stück Brot in seine Suppe. Als ob der nicht genau wusste, dass ich keine Freundin hatte. Die Gesellen vom Nebentisch feixten, und ich spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg.
»Deine Süße hat fünf Finger und ’nen ziemlich festen Griff, oder, Mick?«, rief Benno zurück.
Sofort fiel Mick das Grinsen aus dem Gesicht und er widmete sich wieder der dampfenden Suppe in seinem Henkelmann.
»Mach dir nichts draus, Junge«, raunte Benno und klopfte mir auf die Schulter.
Den knurrigen Altgesellen kann ich von allen Kollegen am besten leiden. Er hat schon viele Lehrlinge kommen und gehen sehen, und Mick ist, wie er immer so schön sagt, zum Tischler geeignet wie ein Igel zum Poabputzen.
»Und?« Er stützte seine Ellbogen auf die zerschrammte Wachstischdecke und nickte kauend in Richtung meines Handys. »Willste nicht lesen?«
Ich schaute auf den Text, der nur aus zwei knappen Sätzen bestand.
»Schlechte Nachrichten?« Benno musste gemerkt haben, dass sich meine Mundwinkel beim Lesen in Richtung Fußboden bewegt hatten.
»Bin gleich zurück«, murmelte ich, trank meinen Rest Kaffee aus und ging raus in den Innenhof. Zum Glück hatten die Raucher ihre Zigarettenpause schon beendet, sodass ich in Ruhe telefonieren konnte. Nach dem dritten Klingeln ging sie ran.
»Hi, hier ist Veit«, begann ich und spürte, wie mir das Herz in die Hose rutschte. »Geht es dir gut?« Ich verzog das Gesicht. Was für eine bescheuerte Frage! Hatte ihre SMS nicht Was Schlimmes passiert. Ruf später an gelautet?
»Äh, oh, hi Veit.«
Siedend heiß schoss mir ein Gedanke in den Kopf. Meinte sie mit ihrem zweiten Satz überhaupt, dass ich sie anrufen sollte, oder bezog sich das auf sie selbst? Was war ich doch für ein Idiot!
»Tut mir leid«, stammelte ich. »Ich wollte dich nicht belästigen. Entschuldige.« Ich war schon drauf und dran, aufzulegen, da hörte ich, wie sie meinen Namen sagte. Sofort hob ich das Handy wieder ans Ohr. »Ja?«
»Mir geht es beschissen.« Ihre Stimme klang, als müsste sie gegen aufsteigende Tränen ankämpfen. Eine Gänsehaut kroch mir den Nacken herauf.
»Was ist passiert?« Ich presste das Handy fest gegen mein Ohr. Atemlos wartete ich darauf, dass sie weitersprechen würde.
»Mein Bruder liegt im Krankenhaus. Er sieht schlecht aus.«
Meine Gedanken schossen zu unserer ersten Begegnung in der Bahn zurück. Sie hatte einen Bruder erwähnt. Einen älteren Bruder, der sie eigentlich mit dem Auto abholen sollte. Wie hieß er noch gleich? Lars? Nein, Laurien.
»Was ist passiert?«
»Das wissen wir noch nicht. Vielleicht ein Unfall. Man hat ihn vor ein paar Tagen in der Innenstadt aufgegriffen. Da taumelte er orientierungslos herum. Vielleicht ist er gestürzt. Er konnte sich an nichts erinnern.« Sie zog die Nase hoch. »Die Ärzte mussten ihn gestern in ein künstliches Koma versetzen, und nun liegt er in der Neurochirurgie.«
Ich hörte hinter mir die Betriebsglocke bimmeln und fluchte in Gedanken vor mich hin. Konnte die Mittagspause nicht wenigstens fünf Minuten länger dauern? Ich kam mir total hilflos vor.
»Kann ich irgendwas für dich tun?«
»Meine Eltern sind bei Laurien geblieben, aber meine Schwester und mich haben sie nach Hause geschickt. Lioba ist zu ihrer Freundin gegangen, und ich starre hier nur die Wände an.« Inzwischen hörte ich sie weinen.
Bennos Kopf erschien im Türspalt. Mit einer stummen Geste forderte er mich auf, hereinzukommen. Ich hob die Hand und nickte. Gleich.
»Soll ich nachher vorbeikommen?« Der Satz war raus, bevor ich richtig drüber nachdenken konnte.
Ihre Antwort war ein zustimmendes Wimmern, das mir ins Herz schnitt.
»Um vier habe ich Feierabend. Danach komme ich direkt zu dir.«
Erst nachdem wir aufgelegt hatten, fiel mir auf, dass sie mir gar nicht die Adresse genannt hatte.
*
Die zweistöckige Fassade aus weißem Klinker lag zurückgesetzt im Halbschatten einiger Kiefern. So beeindruckend hatte ich es bei Weitem nicht in Erinnerung, aber da war es ja auch dunkel gewesen. Bestimmt hatten Laras Eltern ordentlich Asche. Plötzlich wurde ich mir meiner schmutzigen Arbeitskleidung bewusst. Hätte ich doch lieber vorher nach Hause fahren und mich umziehen sollen? Beklommen drückte ich die Klinke des Gartentörchens hinunter. Ein breiter Weg mit Altstadtpflaster führte aufs Grundstück, an einem Rosenbeet teilte er sich. Ein Pfad zweigte nach rechts zu einem Garagentor ab, der andere reichte bis an eine Stufe aus schwarzem Granit. Vor der Stufe schaute ich skeptisch auf meine Arbeitsschuhe, an denen Sägemehl klebte, und fragte mich, ob ich sie bereits draußen ausziehen sollte.
Ich bückte mich und löste die Schnürsenkel, betete, dass meine Socken keine Löcher hatten, da hörte ich, wie jemand die Haustür öffnete. Laras vom Weinen geschwollenes Gesicht erschien im Türspalt.
»Können wir nicht irgendwo hingehen?«, fragte sie zur Begrüßung. »Ich halte es hier drinnen nicht aus.«
Ich sah auf und betrachtete die Gestalt, die da vor die Tür trat. Die Arme um sich geschlungen, wirkte es, als wolle sie sich an sich selbst festhalten.
»Klar, gehen wir zu mir«, antwortete ich und band meineSchuhe wieder zu.
Während der Fahrt mit der S-Bahn sprachen wir wenig. Lara schien mit ihren Gedanken weit weg zu sein und starrte die meiste Zeit aus dem Fenster. Sie tat mir leid, wie sie so verloren dasaß und krampfhaft eine Packung Tempos knetete. Die Taschentücher waren schon ziemlich zerfleddert, aber sie bemerkte es nicht. Immer weiter und weiter quetschte sie die Dinger, wrang sie und zupfte kleine Fetzen ab. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte, darum streckte ich meine Hand aus und legte sie einfach auf ihre. Sah schon merkwürdig aus, meine große, schwielige Pratze auf ihren perfekt manikürten Händen. Im ersten Moment dachte ich, sie würde sie abschütteln, doch dann schob sie ihre Finger zwischen meine und seufzte.
Sie ließ mich auch nicht los, als wir zwei Stationen später ausstiegen und den restlichen Weg den kleinen Berg hinauf in mein Viertel gingen. In den Sechzigern hatten hier die Angestellten der Bahn gewohnt – die einfachen Arbeiter unten, die Feineren oben auf dem Sanellahügel. Damals konnten sich nur die Besserverdiener leisten, Sanella aufs Brot zu schmieren, darum nannte man die Anhöhe so. Heute ist der Sanellahügel allerdings nichts Besonderes mehr. Inzwischen hat man die unteren Mehrfamilienhäuser saniert und schicke Eigentumswohnungen daraus gemacht. Die Einfamilienhäuser weiter oben sehen dagegen noch fast genauso aus wie damals. Rote Backsteinfassaden, Haustüren mit Riffelglas und Rosenstöcke in den Vorgärten. Unser Haus ist das letzte auf der linken Seite, bevor die Straße einen Knick macht und zum Schulzentrum hin abfällt. Mein Vater hatte es damals günstig gekauft, als die Bahn die Häuser nicht mehr halten wollte, und nachdem mein Opa gestorben war, ist meine Oma zu uns gezogen. Es ist ein bisschen eng, aber es ist okay.
Ich schloss die Haustür auf und zog Lara herein. Ein leichter Kohlgeruch schlug mir entgegen.
»Oma, ich bin zu Hause!«, rief ich über das Gedudel von WDR 4 hinweg und schlüpfte aus meinen dreckigen Arbeitsschuhen. Lochfreie Socken, na immerhin. »Lass sie ruhig an, wir sind nicht so pingelig«, sagte ich zu Lara, die Anstalten machte, ebenfalls ihre Chucks auszuziehen.
Etwas verlegen folgte sie mir in die Küche, wo meine Oma am Herd stand und mit einem Pfannenheber und zwei flachen Töpfen hantierte. Wie immer trug sie eine ihrer geblümten Kittelschürzen und summte zu irgendeinem Schlager.
»Hi Oma!«
Sie zuckte zusammen, als hätte sie mich nicht kommen hören. »Jung, mach mich doch nit esu verschreck!«
Ich drückte ihr einen Kuss auf die Wange und drehte das Radio leiser. »Oma, das ist Lara. Sie ist eine Freundin und bleibt heute ein bisschen hier.«
Da erst bemerkte Oma unseren Gast, wischte sich die Hände an der Schürze ab und stemmte sie in die Hüften. Prüfend musterte sie Lara und zwinkerte. »Dat wurde aber auch Zick, dat der Jung mal mit einem Mädchen ankütt.«
»Oma! Sie ist nur eine Freundin!« Ich spürte, wie meine Ohren zu glühen anfingen. Am liebsten hätte ich Lara gleich nach oben in mein Zimmer bugsiert. Sie aber lächelte zum ersten Mal, seit ich sie abgeholt hatte, und reichte Oma die Hand. »Lara Wegmann. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Ganz meinerseits«, wechselte Oma endlich in das, was sie für Hochdeutsch hielt. »Essen ist fertig, aber erst Hände waschen.«
Da war Oma unerbittlich. Als wir aus dem Bad zurückkamen, standen schon drei dampfende Portionen Kohlrouladen mit Kartoffeln auf dem Tisch. Eins meiner Lieblingsessen, aber bei Lara war ich da nicht so sicher. Mädchen wie sie aßen doch sicher nur gedünstetes Gemüse, Putenfleisch und so was, aber anscheinend hatte ich sie falsch eingeschätzt. Mit geübtem Griff zog sie die Holzspieße aus dem Kohl und begann, mit Appetit zu essen. Erst als Oma ihr eine weitere Portion auftun wollte, strich sie die Segel. Nach dem Essen wollte Lara beim Abwasch helfen, doch Oma scheuchte uns mit einer ungeduldigen Handbewegung weg, also gingen wir die Treppe hinauf in mein Zimmer.
»Ich springe schnell unter die Dusche, willst du dich nicht so lange setzen?« Ich räumte ein paar Shirts von der Lehne meines Schreibtischstuhls und drehte ihn ihr hin, doch sie blieb mitten im Raum stehen und betrachtete die Holzfiguren in dem Regal.
Vorsichtig hob sie einen geschnitzten Löwenkopf heraus und fuhr die Konturen seines aufgerissenen Mauls nach. »Der ist hübsch.« Sie drehte ihn herum und entdeckte das eingravierte VE. »Oh, den hast du gemacht?«
»Mein erster Versuch mit Opas Werkzeug, da war ich dreizehn«, murmelte ich und nahm frische Wäsche aus dem Schrank. »Sieh dich ruhig um, ich bin gleich wieder da.«
Als ich aus dem Bad kam, stand sie noch immer vor meinen Schnitzereien. Diesmal hielt sie allerdings ihr Handy in der Hand und betrachtete regungslos das Display.
»Gibt’s was Neues?« Ich überlegte, ob ich ihr die Hand auf die Schulter legen oder irgendetwas Tröstendes sagen sollte, traute mich aber nicht.