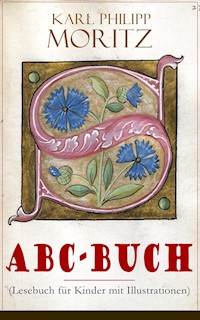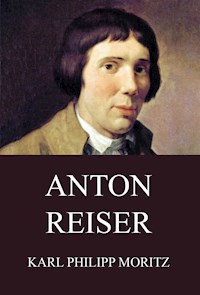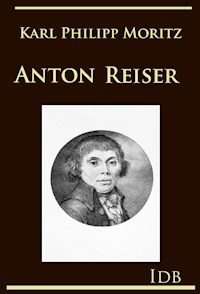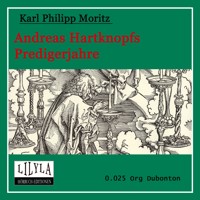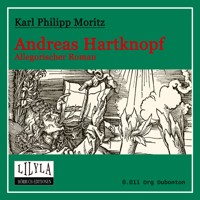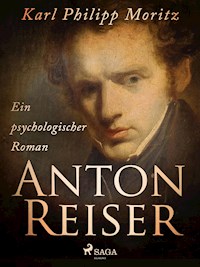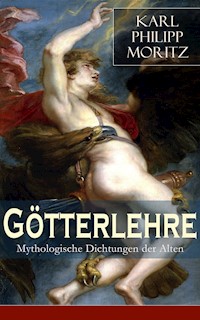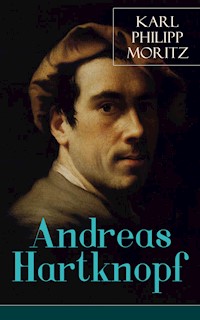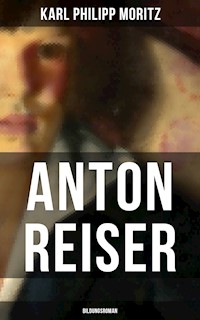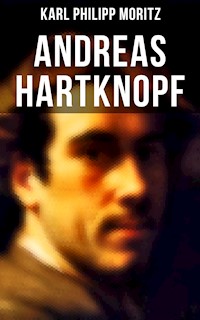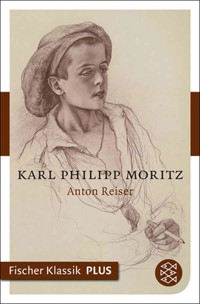
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Wie soll man als Jugendlicher wissen, wer man ist und was man selbst vom Leben will, wenn einem dauernd wohlmeinende Erwachsene dazwischenfunken? Was vor allem haben die Gegenbilder und Versprechen, die man in den Medien findet, mit der Welt und einem selbst zu tun? Gibt es überhaupt so etwas wie ein wahres Ich – jenseits aller Einflüsse und Zitate? Karl Philipp Moritz hat in seinem berühmten »psychologischen Roman« schon vor über zweihundert Jahren genau das infrage gestellt, was heute mehr denn je überall angepriesen und verkauft wird: das Authentische und Individuelle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Karl Philipp Moritz
Anton Reiser
Ein psychologischer Roman
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Erster Teil
Dieser psychologische Roman könnte auch allenfalls eine Biographie genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils aus dem wirklichen Leben genommen sind. – Wer den Lauf der menschlichen Dinge kennt, und weiß, wie dasjenige oft im Fortgange des Lebens sehr wichtig werden kann, was anfänglich klein und unbedeutend schien, der wird sich an die anscheinende Geringfügigkeit mancher Umstände, die hier erzählt werden, nicht stoßen. Auch wird man in einem Buche, welches vorzüglich die innere Geschichte des Menschen schildern soll, keine große Mannigfaltigkeit der Charaktere erwarten: denn es soll die vorstellende Kraft nicht verteilen, sondern sie zusammendrängen, und den Blick der Seele in sich selber schärfen. – Freilich ist dies nun keine so leichte Sache, dass gerade jeder Versuch darin glücken muss – aber wenigstens wird doch vorzüglich in pädagogischer Rücksicht, das Bestreben nie ganz unnütz sein, die Aufmerksamkeit des Menschen mehr auf den Menschen selbst zu heften, und ihm sein individuelles Dasein wichtiger zu machen.
In P., einem Orte, der wegen seines Gesundbrunnens berühmt ist, lebte noch im Jahre 1756 ein Edelmann auf seinem Gute, der das Haupt einer Sekte in Deutschland war, die unter dem Namen der Quietisten oder Separatisten bekannt ist, und deren Lehren vorzüglich in den Schriften der Mad. Guion, einer bekannten Schwärmerin, enthalten sind, die zu Fenelons Zeiten, mit dem sie auch Umgang hatte, in Frankreich lebte.
Der Hr. v. F., so hieß dieser Edelmann, wohnte hier von allen übrigen Einwohnern des Orts, und ihrer Religion, Sitten, und Gebräuchen, ebenso abgesondert, wie sein Haus von den ihrigen durch eine hohe Mauer geschieden war, die es von allen Seiten umgab.
Dies Haus nun machte für sich eine kleine Republik aus, worin gewiss eine ganz andre Verfassung, als rund umher im ganzen Lande herrschte. Das ganze Hauswesen bis auf den geringsten Dienstboten bestand aus lauter solchen Personen, deren Bestreben nur dahin ging, oder zu gehen schien, in ihr Nichts (wie es die Mad. Guion nennt) wieder einzugehen, alle Leidenschaften zu ertöten, und alle Eigenheit auszurotten.
Alle diese Personen mussten sich täglich einmal in einem großen Zimmer des Hauses zu einer Art von Gottesdienst versammlen, den der Herr v. F. selbst eingerichtet hatte, und welcher darin bestand, dass sie sich alle um einen Tisch setzten, und mit zugeschlossnen Augen, den Kopf auf den Tisch gelegt, eine halbe Stunde warteten, ob sie etwa die Stimme Gottes oder das innre Wort, in sich vernehmen würden. Wer dann etwas vernahm, der machte es den übrigen bekannt.
Der Herr v. F. bestimmte auch die Lektüre seiner Leute, und wer von den Knechten oder Mägden eine müßige Viertelstunde hatte, den sahe man nicht anders, als mit einer von der Mad. Guion Schriften, vom innern Gebet, oder dergleichen, in der Hand, in einer nachdenkenden Stellung sitzen und lesen.
Alles, bis auf die kleinsten häuslichen Beschäftigungen, hatte in diesem Hause ein ernstes, strenges, und feierliches Ansehn. In allen Mienen glaubte man Ertötung und Verleugnung, und in allen Handlungen Ausgehen aus sich selbst und Eingehen ins Nichts zu lesen.
Der Herr v. F. hatte sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin nicht wieder verheiratet, sondern lebte mit seiner Schwester, der Fr. v. P., in dieser Eingezogenheit, um sich dem großen Geschäfte, die Lehren der Mad. Guion auszubreiten, ganz und ungestört widmen zu können.
Ein Verwalter, namens H., und eine Haushälterin mit ihrer Tochter, machten gleichsam den mittlern Stand des Hauses aus, und dann folgte das niedrige Gesinde. – Diese Leute schlossen sich wirklich fest aneinander, und alles hatte eine unbegrenzte Ehrfurcht gegen den Hrn. v. F., der wirklich einen unsträflichen Lebenswandel führte, obgleich die Einwohner des Orts sich mit den ärgerlichsten Geschichten von ihm trugen.
Er stand jede Nacht dreimal zu bestimmten Stunden auf, um zu beten, und bei Tage brachte er seine meiste Zeit damit zu, dass er die Schriften der Mad. Guion, deren eine große Anzahl von Bänden ist, aus dem Französischen übersetzte, die er denn auf seine Kosten drucken ließ, und sie umsonst unter seine Anhänger austeilte.
Die Lehren, welche in diesen Schriften enthalten sind, betreffen größtenteils jenes schon erwähnte völlige Ausgehen aus sich selbst, und Eingehen in ein seliges Nichts, jene gänzliche Ertötung aller sogenannten Eigenheit oder Eigenliebe, und eine völlig uninteressierte Liebe zu Gott, worin sich auch kein Fünkchen Selbstliebe mehr mischen darf, wenn sie rein sein soll, woraus denn am Ende eine vollkommne, selige Ruhe entsteht, die das höchste Ziel aller dieser Bestrebungen ist.
Weil nun die Mad. Guion sich fast ihr ganzes Leben hindurch, mit nichts als mit Bücherschreiben beschäftigt hat, so sind ihrer Schriften eine so erstaunliche Menge, dass selbst Martin Luther schwerlich mehr geschrieben haben kann. Unter andern macht allein eine mystische Erklärung der ganzen Bibel wohl an zwanzig Bände aus.
Diese Mad. Guion musste viel Verfolgung leiden, und wurde endlich, weil man ihre Lehrsätze für gefährlich hielt, in die Bastille gesetzt, wo sie nach einer zehnjährigen Gefangenschaft starb. Als man nach ihrem Tode ihren Kopf öffnete, fand man ihr Gehirn fast wie ausgetrocknet. Sie wird übrigens noch jetzt von ihren Anhängern, als eine Heilige der ersten Größe, beinahe göttlich verehrt, und ihre Aussprüche werden den Aussprüchen der Bibel gleich geschätzt; weil man annimmt, dass sie durch gänzliche Ertötung aller Eigenheit so gewiss mit Gott sei vereinigt worden, dass alle ihre Gedanken auch notwendig göttliche Gedanken werden mussten.
Der Herr v. F. hatte die Schriften der Mad. Guion auf seinen Reisen in Frankreich kennen gelernt, und die trockne, metaphysische Schwärmerei, welche darin herrscht, hatte für seine Gemütsbeschaffenheit so viel Anziehendes, dass er sich ihr mit eben dem Eifer ergab, womit er sich wahrscheinlich, unter andern Umständen, dem höchsten Stoizismus würde ergeben haben, womit die Lehren der Mad. Guion, in Ansehung der gänzlichen Ertötung aller Begierden usw. oft eine auffallende Ähnlichkeit haben.
Er wurde nun auch von seinen Anhängern ebenfalls wie ein Heiliger verehrt, und ihm wirklich zugetrauet, dass er, beim ersten Anblick, das Innerste der Seele eines Menschen durchschauen könne.
Zu seinem Hause geschahen Wallfahrten von allen Seiten, und unter denen, die jährlich, wenigstens einmal, dieses Haus besuchten, war auch Antons Vater.
Dieser, ohne eigentliche Erziehung aufgewachsen, hatte seine erste Frau sehr früh geheiratet, immer ein ziemlich wildes herumirrendes Leben geführt, wohl zuweilen einige fromme Rührungen gehabt, aber nicht viel darauf geachtet. Bis er nach dem Tode seiner ersten Frau plötzlich in sich geht, auf einmal tiefsinnig, und wie man sagt, ein ganz andrer Mensch wird, und bei seinem Aufenthalt in P. zufälligerweise erstlich den Verwalter des Hrn. v. F. und nachher durch diesen den Hrn. v. F. selber kennen lernte.
Dieser gibt ihm denn nach und nach die Guionschen Schriften zu lesen, er findet Geschmack daran, und wird bald ein erklärter Anhänger des Hrn. v. F.
Demohngeachtet fiel es ihm ein, wieder zu heiraten, und er machte mit Antons Mutter Bekanntschaft, welche bald in die Heirat willigte, das sie nie würde getan haben, hätte sie die Hölle von Elend vorausgesehen, die ihr im Ehestande drohete. Sie versprach sich von ihrem Manne noch mehr Liebe und Achtung, als sie vorher bei ihren Anverwandten genossen hatte, aber wie entsetzlich fand sie sich betrogen.
So sehr die Lehre der Mad. Guion von der gänzlichen Ertötung und Vernichtung aller, auch der sanften und zärtlichen Leidenschaften, mit der harten und unempfindlichen Seele ihres Mannes übereinstimmten, so wenig war es ihr möglich, sich jemals mit diesen Ideen zu verständigen, wogegen sich ihr Herz auflehnte.
Dies war der erste Keim zu aller nachherigen ehelichen Zwietracht.
Ihr Mann fing an, ihre Einsichten zu verachten, weil sie die hohen Geheimnisse nicht fassen wollte, die die Madam Guion lehrte.
Diese Verachtung erstreckte sich nachher auch auf ihre übrigen Einsichten, und jemehr sie dies empfand, je stärker musste notwendig die eheliche Liebe sich vermindern, und das wechselseitige Missvergnügen aneinander mit jedem Tage zunehmen.
Antons Mutter hatte eine starke Belesenheit in der Bibel, und eine ziemlich deutliche Erkenntnis von ihrem Religionssystem, sie wusste z.E. sehr erbaulich davon zu reden, dass der Glaube ohne Werke tot sei, usw.
In der Bibel las sie wirklich zu ganzen Stunden mit innigem Vergnügen, aber sobald ihr Mann es versuchte, ihr aus den Guion’schen Schriften vorzulesen, so empfand sie eine Art von
Bangigkeit, die vermutlich aus der Vorstellung entstand, sie werde dadurch in dem rechten Glauben irregemacht werden.
Sie suchte sich alsdann auf alle Weise loszumachen. – Hiezu kam nun noch, dass sie vieles von der Kälte und dem lieblosen Wesen ihres Mannes auf Rechnung der Guion’schen Lehre schrieb, die sie nun in ihrem Herzen immermehr zu verwünschen anfing, und bei dem völligen Ausbruch der ehelichen Zwietracht sie laut verwünschte.
So wurde der häusliche Friede und die Ruhe und Wohlfahrt einer Familie Jahre lang durch diese unglücklichen Bücher gestört, die wahrscheinlich einer so wenig, wie der andere verstehen mochte.
Unter diesen Umständen wurde Anton geboren, und von ihm kann man mit Wahrheit sagen, dass er von der Wiege an unterdrückt ward.
Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm, und sein aufdämmernder Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen des unauflöslich geknüpften Ehebandes.
Ob er gleich Vater und Mutter hatte, so war er doch in seiner frühesten Jugend schon von Vater und Mutter verlassen, denn er wusste nicht, an wen er sich anschließen, an wen er sich halten sollte, da sich beide hassten, und ihm doch einer so nahe wie der andre war.
In seiner frühesten Jugend hat er nie die Liebkosungen zärtlicher Eltern geschmeckt, nie nach einer kleinen Mühe ihr belohnendes Lächeln.
Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so trat er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen.
Diese ersten Eindrücke sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden, und haben sie oft zu einem Sammelplatze schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen konnte.
Da sein Vater im siebenjährigen Kriege mit zu Felde war, zog seine Mutter zwei Jahre lang mit ihm auf ein kleines Dorf.
Hier hatte er ziemliche Freiheit und einige Entschädigung für die Leiden seiner Kindheit.
Die Vorstellungen von den ersten Wiesen, die er sahe, von dem Kornfelde, das sich einen sanften Hügel hinanerstreckte, und oben mit grünem Gebüsch umkränzt war, von dem blauen Berge, und den einzelnen Gebüschen und Bäumen, die am Fuß desselben auf das grüne Gras ihren Schatten warfen, und immer dichter und dichter wurden, je höher man hinaufstieg, mischen sich noch immer unter seine angenehmsten Gedanken, und machen gleichsam die Grundlage aller der täuschenden Bilder aus, die oft seine Fantasie sich vormalt.
Aber wie bald waren diese beiden glücklichen Jahre entflohen!
Es ward Friede, und Antons Mutter zog mit ihm in die Stadt zu ihrem Manne.
Die lange Trennung von ihm verursachte ein kurzes Blendwerk ehelicher Eintracht, aber bald folgte auf die betrügliche Windstille ein desto schrecklicherer Sturm.
Antons Herz zerfloss in Wehmut, wenn er einem von seinen Eltern Unrecht geben sollte, und doch schien es ihm sehr oft, als wenn sein Vater, den er bloß fürchtete, mehr Recht habe, als seine Mutter, die er liebte.
So schwankte seine junge Seele beständig zwischen Hass und Liebe, zwischen Furcht und Zutrauen, zu seinen Eltern hin und her.
Da er noch nicht acht Jahr alt war, gebar seine Mutter einen zweiten Sohn, auf den nun vollends die wenigen Überreste väterlicher und mütterlicher Liebe fielen, so dass er nun fast ganz vernachlässiget wurde, und sich, sooft man von ihm sprach, mit einer Art von Geringschätzung und Verachtung nennen hörte, die ihm durch die Seele ging.
Woher mochte wohl dies sehnliche Verlangen nach einer liebreichen Behandlung bei ihm entstehen, da er doch derselben nie gewohnt gewesen war, und also kaum einige Begriffe davon haben konnte?
Am Ende freilich ward dies Gefühl ziemlich bei ihm abgestumpft; es war ihm beinahe, als müsse er beständig gescholten sein, und ein freundlicher Blick, den er einmal erhielt, war ihm ganz etwas Sonderbares, das nicht recht zu seinen übrigen Vorstellungen passen wollte.
Er fühlte auf das innigste das Bedürfnis der Freundschaft von seinesgleichen: und oft, wenn er einen Knaben von seinem Alter sahe, hing seine ganze Seele an ihm, und er hätte alles drum gegeben, sein Freund zu werden; allein das niederschlagende Gefühl der Verachtung, die er von seinen Eltern erlitten, und die Scham, wegen seiner armseligen, schmutzigen, und zerrissnen Kleidung hielten ihn zurück, dass er es nicht wagte, einen glücklichen Knaben anzureden.
So ging er fast immer traurig und einsam umher, weil die meisten Knaben in der Nachbarschaft ordentlicher, reinlicher, und besser, wie er, gekleidet waren, und nicht mit ihm umgehen wollten, und die es nicht waren, mit denen mochte er wieder, wegen ihrer Liederlichkeit, und auch vielleicht aus einem gewissen Stolz, keinen Umgang haben.
So hatte er keinen, zu dem er sich gesellen konnte, keinen Gespielen seiner Kindheit, keinen Freund unter Großen noch Kleinen.
Im achten Jahre fing denn doch sein Vater an, ihn selber etwas lesen zu lehren, und kaufte ihm zu dem Ende zwei kleine Bücher, wovon das eine eine Anweisung zum Buchstabieren, und das andre eine Abhandlung gegen das Buchstabieren enthielt.
In dem ersten musste Anton größtenteils schwere biblische Namen, als: Nebukadnezar, Abednego, usw., bei denen er auch keinen Schatten einer Vorstellung haben konnte, buchstabieren. Dies ging daher etwas langsam.
Allein sobald er merkte, dass wirklich vernünftige Ideen durch die zusammengesetzten Buchstaben ausgedrückt waren, so wurde seine Begierde, lesen zu lernen, von Tage zu Tage stärker.
Sein Vater hatte ihm kaum einige Stunden Anweisung gegeben, und er lernte es nun, zur Verwunderung aller seiner Angehörigen, in wenig Wochen von selber.
Mit innigem Vergnügen erinnert er sich noch jetzt an die lebhafte Freude, die er damals genoss, als er zuerst einige Zeilen, bei denen er sich etwas denken konnte, durch vieles Buchstabieren, mit Mühe herausbrachte.
Nun aber konnte er nicht begreifen, wie es möglich sei, dass andre Leute so geschwind lesen konnten, wie sie sprachen; er verzweifelte damals gänzlich an der Möglichkeit, es je so weit zu bringen.
Um desto größer war nun seine Verwunderung und Freude, da er auch dies nach einigen Wochen konnte.
Auch schien ihn dieses bei seinen Eltern, noch mehr aber bei seinen Anverwandten in einige Achtung zu setzen, welches von ihm zwar nicht unbemerkt blieb, aber doch nie die eigentliche Ursach ward, die ihn zum Fleiß anspornete.
Seine Begierde zu lesen, war nun unersättlich. Zum Glücke standen in dem Buchstabierbuche, außer den biblischen Sprüchen, auch einige Erzählungen von frommen Kindern, die mehr wie hundertmal von ihm durchgelesen wurden, ob sie gleich nicht viel Anziehendes hatten.
Die eine handelte von einem sechsjährigen Knaben, der zur Zeit der Verfolgung die christliche Religion nicht verleugnen wollte, sondern sich lieber auf das entsetzlichste peinigen, und nebst seiner Mutter, als ein Märtyrer für die Religion sein Leben ließ; die andre von einem bösen Buben, der sich im zwanzigsten Jahre seines Lebens bekehrte, und bald darauf starb.
Nun kam auch das andre kleine Buch an die Reihe, worin die Abhandlung gegen das Buchstabieren stand, und er zu seiner großen Verwunderung las, dass es schädlich, ja seelenverderblich sei, die Kinder durch Buchstabieren lesen zu lehren.
In diesem Buche fand er auch eine Anweisung für Lehrer, die Kinder lesen zu lehren, und eine Abhandlung über die Hervorbringung der einzelnen Laute durch die Sprachwerkzeuge: so trocken ihm dieses schien, so las er es doch aus Mangel an etwas Besserm, mit der größten Standhaftigkeit, nach der Reihe durch.
Durch das Lesen war ihm nun auf einmal eine neue Welt eröffnet, in deren Genuss er sich für alle das Unangenehme in seiner wirklichen Welt einigermaßen entschädigen konnte. Wenn nun rund um ihn her nichts als Lärmen und Schelten und häusliche Zwietracht herrschte, oder er sich vergeblich nach einem Gespielen umsah, so eilte er hin zu seinem Buche.
So ward er schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine unnatürliche idealische Welt verdrängt, wo sein Geist für tausend Freuden des Lebens verstimmt wurde, die andre mit voller Seele genießen können.
Schon im achten Jahre bekam er eine Art von auszehrender Krankheit. Man gab ihn völlig auf, und er hörte beständig von sich, wie von einem, der schon wie ein Toter beobachtet wird, reden. Dies war ihm immer lächerlich, oder vielmehr war ihm das Sterben selbst, wie er sich damals vorstellte, mehr etwas Lächerliches, als etwas Ernsthaftes. Seine Base, der er doch etwas lieber, wie seinen Eltern zu sein schien, ging endlich mit ihm zu einem Arzt, und eine Kur von einigen Monaten stellte ihn wieder her.
Kaum war er einige Wochen gesund, als ihn gerade bei einem Spaziergange mit seinen Eltern auf das Feld, der ihm sehr etwas Seltnes, und eben daher desto reizender war, der linke Fuß an zu schmerzen fing. Dies war nach überstandner Krankheit sein erster und sollte auf lange Zeit sein letzter Spaziergang sein.
Am dritten Tage war die Geschwulst und Entzündung am Fuße schon so gefährlich geworden, dass man am vierten zur Amputation schreiten wollte. Antons Mutter saß und weinte, und sein Vater gab ihm zwei Pfennige. Dies waren die ersten Äußerungen des Mitleids gegen ihn, deren er sich von seinen Eltern erinnert, und die wegen der Seltenheit einen desto stärkern Eindruck auf ihn machten.
An dem Tage vor der beschlossnen Amputation kam ein mitleidiger Schuster zu Antons Mutter, und brachte ihr eine Salbe, durch deren Gebrauch sich die Geschwulst und Entzündung im Fuße, während wenigen Stunden legte. Zum Fußabnehmen kam es nun nicht, aber der Schaden dauerte demohngeachtet vier Jahre lang, ehe er geheilt werden konnte, in welcher Zeit unser Anton wiederum unter oft unsäglichen Schmerzen alle Freuden der Kindheit entbehren musste.
Bei diesem Schaden konnte er zuweilen ein ganzes Vierteljahr nicht aus dem Hause gehen, nachdem er eine Weile zuheilte, und immer wieder aufbrach.
Oft musste er ganze Nächte hindurch wimmern und klagen, und die abscheulichsten Schmerzen fast alle Tage beim Verbinden erdulden. Dies entfernte ihn natürlicherweise noch mehr aus der Welt und von dem Umgange mit seinesgleichen, und fesselte ihn immer mehr an das Lesen und an die Bücher. Am häufigsten las er, wenn er seinen jüngern Bruder wiegte, und wann es ihm damals an einem Buche fehlte, so war es, als wenn es ihm jetzt an einem Freunde fehlt: denn das Buch musste ihm Freund, und Tröster, und alles sein.
Im neunten Jahre las er alles, was Geschichte in der Bibel ist, vom Anfange bis zu Ende durch; und wenn einer von den Hauptpersonen, als Moses, Samuel, oder David, gestorben war, so konnte er sich Tage lang darüber betrüben, und es war ihm dabei zu Mute, als sei ihm ein Freund abgestorben, so lieb wurden ihm immer die Personen, die viel in der Welt getan, und sich einen Namen gemacht hatten.
So war Joab sein Held, und es schmerzte ihn, sooft er schlecht von ihm denken musste. Insbesondre haben ihn oft die Züge der Großmut in Davids Geschichte, wenn er seines ärgsten Feindes schonte, da er ihn doch in seiner Gewalt hatte, bis zu Tränen gerührt.
Nun fiel ihm das Leben der Altväter in die Hände, welches sein Vater sehr hochschätzte, und diese Altväter bei jeder Gelegenheit als Autoritäten anführte. So fingen sich gemeiniglich seine moralischen Reden an: Madam Guion spricht, oder der heilige Makarius oder Antonius sagt usw.
Die Altväter, so abgeschmackt und abenteuerlich oft ihre Geschichte sein mochte, waren für Anton die würdigsten Muster zur Nachahmung, und er kannte eine Zeit lang keinen höhern Wunsch, als seinem großen Namensgenossen, dem heiligen Antonius, ähnlich zu werden, und wie dieser Vater und Mutter zu verlassen und in eine Wüste zu fliehen, die er nicht weit vom Tore zu finden hoffte, und wohin er einmal wirklich eine Reise antrat, indem er sich über hundert Schritte weit von der Wohnung seiner Eltern entfernte, und vielleicht noch weiter gegangen wäre, wenn die Schmerzen an seinem Fuße ihn nicht genötiget hätten, wieder zurückzukehren. Auch fing er wirklich zuweilen an, sich mit Nadeln zu pricken, und sonst zu peinigen, um dadurch den heiligen Altvätern einigermaßen ähnlich zu werden, da es ihm doch ohnedem an Schmerzen nicht fehlte.
Während dieser Lektüre ward ihm ein kleines Buch geschenkt, dessen eigentlichen Titel er sich nicht erinnert, das aber von einer frühen Gottesfurcht handelte, und Anweisung gab, wie man schon vom sechsten bis zum vierzehnten Jahre in der Frömmigkeit wachsen könne. Die Abhandlungen in diesem Büchelchen hießen also: für Kinder von sechs Jahren, für Kinder von sieben Jahren usw. Anton las also den Abschnitt für Kinder von neun Jahren, und fand, dass es noch Zeit sei, ein frommer Mensch zu werden, dass er aber schon drei Jahre versäumt habe.
Dies erschütterte seine ganze Seele, und er fasste einen so festen Vorsatz sich zu bekehren, wie ihn wohl selten Erwachsene fassen mögen. Von der Stunde an befolgte er alles, was von Gebet, Gehorsam, Geduld, Ordnung usw. in dem Buche stand, auf das pünktlichste, und machte sich nun beinahe jeden zu schnellen Schritt zur Sünde. Wie weit, dachte er, werde ich nun nicht schon in fünf Jahren sein, wenn ich hierbei bleibe. Denn in dem kleinen Buche war das Fortrücken in der Frömmigkeit gleichsam zu einer Sache des Ehrgeizes gemacht, wie man etwa sich freuet, aus einer Klasse in die andere immer höher gestiegen zu sein.
Wenn er, wie natürlich, sich zuweilen vergaß, und einmal, wenn er Linderung an seinem Fuße fühlte, umher sprang oder lief, so fühlte er darüber die heftigsten Gewissensbisse, und es war ihm immer, als sei er nun schon einige Stufen wieder zurückgekommen.
Dieses kleine Buch hatte lange einen starken Einfluss auf seine Handlungen und Gesinnungen: denn was er las, das suchte er auch gleich auszuüben. Daher las er auf jeden Tag in der Woche sehr gewissenhaft den Abend- und Morgensegen, weil im Katechismus stand, man müsse ihn lesen; auch vergaß er nicht, das Kreuz dabei zu machen, und das walte zu sagen, wie es im Katechismus befohlen war.
Sonst sahe er nicht viel von Frömmigkeit, ob er gleich immer viel davon reden hörte, und seine Mutter ihn alle Abend einsegnete, und niemals vergaß, ehe er einschlief, das Zeichen des Kreuzes über ihn zu machen.
Der Herr v. F. hatte unter andern die geistlichen Lieder der Madam Guion ins Deutsche übersetzt, und Antons Vater, der musikalisch war, passte ihnen Melodien an, die größtenteils einen raschen, fröhlichen Gang hatten.
Wenn es sich nun fügte, dass er etwa einmal nach einer langen Trennung wieder zu Hause kam, so ließ sich denn doch die Ehegattin überreden, einige dieser Lieder mitzusingen, wozu er die Zitter spielte. Dies geschahe gemeiniglich kurz nach der ersten Freude des Wiedersehens und diese Stunden mochten wohl noch die glücklichsten in ihrem Ehestande sein.
Anton war dann am frohesten, und stimmte oft, so gut er konnte, in diese Lieder ein, die ein Zeichen der so seltnen wechselseitigen Harmonie und Übereinstimmung bei seinen Eltern waren.
Diese Lieder gab ihm nun sein Vater, da er ihn für reif genug zu dieser Lektüre hielt, in die Hände, und ließ sie ihn zum Teil auswendig lernen.
Wirklich hatten diese Gesänge, ohngeachtet der steifen Übersetzung, immer noch so viel Seelenschmelzendes, eine so unnachahmliche Zärtlichkeit im Ausdrucke, solch ein sanftes Helldunkel in der Darstellung, und soviel unwiderstehlich Anziehendes für eine weiche Seele, dass der Eindruck, den sie auf Antons Herz machten, bei ihm unauslöschlich geblieben ist.
Oft tröstete er sich in einsamen Stunden, wo er sich von aller Welt verlassen glaubte, durch ein solches Lied vom seligen Ausgehen aus sich selber, und der süßen Vernichtung vor dem Urquelle des Daseins.
So gewährten ihm schon damals seine kindischen Vorstellungen oft eine Art von himmlischer Beruhigung.
Einmal waren seine Eltern bei dem Wirt des Hauses, wo sie wohnten, des Abends zu einem kleinen Familienfeste gebeten. Anton musste es aus dem Fenster mit ansehen, wie die Kinder der Nachbarn schön geputzt zu diesem Feste kamen, indes er allein auf der Stube zurückbleiben musste, weil seine Eltern sich seines schlechten Aufzuges schämten. Es wurde Abend, und ihn fing an zu hungern; und nicht einmal ein Stückchen Brot hatten ihm seine Eltern zurückgelassen.
Indes er oben einsam saß und weinte, schallte das fröhliche Getümmel von unten zu ihm herauf. – Verlassen von allem, fühlte er erst eine Art von bitterer Verachtung gegen sich selbst, die sich aber plötzlich in eine unaussprechliche Wehmut verwandelte, da er zufälligerweise die Lieder der Madam Guion aufschlug, und eins fand, das gerade auf seinen Zustand zu passen schien. – Eine solche Vernichtung, wie er in diesem Augenblick fühlte, musste nach dem Liede der Mad. Guion vorhergehen, um sich in dem Abgrunde der ewigen Liebe, wie ein Tropfen im Ozean, zu verlieren. – – Allein, da nun der Hunger anfing, ihm unausstehlich zu werden, so wollten auch die Tröstungen der Madam Guion nichts mehr helfen, und er wagte es, hinunter zu gehen, wo seine Eltern in großer Gesellschaft schmauseten, öffnete ein klein wenig die Türe, und bat seine Mutter um den Schlüssel zum Speiseschranke, und um die Erlaubnis, sich ein wenig Brot nehmen zu dürfen, weil ihn sehr hungere.
Dies erweckte erst das Gelächter und nachher das Mitleid der Gesellschaft, nebst einigem Unwillen gegen seine Eltern.
Er ward mit an den Tisch gezogen, und ihm von dem Besten vorgelegt, welches ihm denn freilich eine ganz andre Art von Freude, als vorher die Guion’schen Trostlieder, gewährte.
Allein auch jene schwermutsvolle tränenreiche Freude behielt immer etwas Anziehendes für ihn, und er überließ sich ihr, indem er die Guion’schen Lieder las, sooft ihm ein Wunsch fehlgeschlagen war, oder ihm etwas Trauriges bevorstand, als wenn er z.B. vorher wusste, dass sein Fuß verbunden, und die Wunde mit Höllenstein bestrichen werden sollte.
Das zweite Buch, was ihn sein Vater nebst den Guion’schen Liedern lesen ließ, war eine Anweisung zum. innern Gebet von eben dieser Verfasserin.
Hierin ward gezeigt, wie man nach und nach dahin kommen könne, sich im eigentlichen Verstande mit Gott zu unterreden, und seine Stimme im Herzen, oder das eigentliche innre Wort, deutlich zu vernehmen; indem man sich nämlich zuerst so viel wie möglich von den Sinnen loszumachen, und sich mit sich selbst und seinen eignen Gedanken zu beschäftigen suchte, oder meditieren lernte, welches aber auch erst aufhören, und man sich selbst sogar erst vergessen müsse, ehe man fähig sei, die Stimme Gottes in sich zu vernehmen.
Dies ward von Anton mit dem größten Eifer befolgt, weil er wirklich begierig war, so etwas Wunderbares, als die Stimme Gottes, in sich zu hören.
Er saß daher halbe Stunden lang mit verschlossnen Augen, um sich von der Sinnlichkeit abzuziehen. Sein Vater tat dieses zum größten Leidwesen seiner Mutter ebenfalls. Auf Anton aber achtete sie nicht, weil sie ihn zu keiner Absicht fähig hielt, die er dabei haben könne.
Anton kam bald so weit, dass er glaubte, von den Sinnen ziemlich abgezogen zu sein, und nun fing er an, sich wirklich mit Gott zu unterreden, mit dem er bald auf einem ziemlich vertraulichen Fuß umging.
Den ganzen Tag über, bei seinen einsamen Spaziergängen, bei seinen Arbeiten, und sogar bei seinem Spiele sprach er mit Gott, zwar immer mit einer Art von Liebe und Zutrauen, aber doch so, wie man ohngefähr mit einem seinesgleichen spricht, mit dem man eben nicht viel Umstände macht, und ihm war es denn wirklich immer, als ob Gott dieses oder jenes antwortete.
Freilich ging es nicht so ab, dass es nicht zuweilen einige Unzufriedenheit sollte gesetzt haben, wenn etwa ein unschuldiges Spielwerk, oder sonst ein Wunsch vereitelt ward. Dann hieß es oft: aber mir auch diese Kleinigkeit nicht einmal zu gewähren! oder: das hättest du doch wohl können geschehen lassen, wenn’s irgend möglich gewesen wäre! und so nahm es sich denn Anton nicht übel, zuweilen ein wenig mit Gott nach seiner Art böse zu tun; denn obgleich davon nichts in der Madame Guion Schriften stand, so glaubte er doch, es gehöre mit zum vertraulichen Umgange.
Alle diese Veränderungen gingen mit ihm vom neunten bis zum zehnten Jahre vor. Während dieser Zeit nahm ihn auch sein Vater, wegen des Schadens am Fuße, mit nach dem Gesundbrunnen in P. Wie freute er sich nun, den Hrn. v. F. persönlich kennen zu lernen, von dem sein Vater beständig mit solcher Ehrfurcht, wie von einem übermenschlichen Wesen geredet hatte, und wie freute er sich, dort von seinen großen Fortschritten in der innern Gottseligkeit Rechenschaft ablegen zu können: seine Einbildungskraft malte ihm dort eine Art von Tempel, worin er auch als Priester eingeweiht, und als ein solcher zur Verwunderung aller, die ihn kannten, zurückkehren würde.
Er machte nun mit seinem Vater die erste Reise, und während derselben war dieser auch etwas gütiger gegen ihn, und gab sich mehr mit ihm ab, als zu Hause. Anton sahe hier die Natur in unaussprechlicher Schönheit. Die Berge rund umher in der Ferne und in der Nähe und die lieblichen Täler entzückten seine Seele, und schmolzen sie in Wehmut, die teils aus der Erwartung der großen Dinge entstand, die hier mit ihm vorgehen sollten.
Der erste Gang mit seinem Vater war in das Haus des Hrn. v. F., wo dieser den Verwalter, Hrn. H., zuerst sprach, ihn umarmte und küsste, und auf das freundschaftlichste von ihm bewillkommt wurde.
Ohngeachtet der großen Schmerzen, die Anton durch die Reise an seinem Fuße empfand, war er doch beim Eintritt in das Haus des Hrn. v. F. vor Freuden außer sich. Anton blieb diesen Tag in der Stube des Hrn. H., mit dem er künftig alle Abend speisen musste. Übrigens bekümmerte man sich doch im Hause lange nicht so viel um ihn, wie er erwartet hatte.
Seine Übungen im innern Gebet setzte er nun sehr fleißig fort; allein es konnte denn freilich nicht fehlen, dass sie nicht zuweilen eine sehr kindische Wendung nehmen mussten. Hinter dem Hause, wo sein Vater in P. logierte, war ein großer Baumgarten: hier fand er zufälligerweise einen Schiebkarrn, und machte sich das Vergnügen, damit im ganzen Garten herumzuschieben.
Um dies nun aber zu rechtfertigen, weil er anfing, es für Sünde zu halten, bildete er sich eine ganz sonderbare Grille. Er hatte nämlich in den Guion’schen Schriften und anderwärts viel von dem Jesulein gelesen, von welchem gesagt wurde, dass es allenthalben sei, und man beständig, und an allen Orten mit ihm umgehen könne.
Das Diminutivum machte, dass er sich einen Knaben, noch etwas kleiner wie er, darunter vorstellte, und da er nun mit Gott selber schon so vertraut umging, warum nicht noch vielmehr mit diesem seinem Sohne, dem er zutraute, dass er sich nicht weigern werde, mit ihm zu spielen, und also auch nichts dawider haben werde, wenn er ihn ein wenig auf den Schiebkarrn herum fahren wollte.
Nun schätzte er es sich aber doch für ein sehr großes Glück, eine so hohe Person auf den Schiebkarrn herum fahren zu können, und ihr dadurch ein Vergnügen zu machen; und da diese Person nun ein Geschöpf seiner Einbildungskraft war, so machte er auch mit ihr, was er wollte, und ließ sie oft kürzer, oft länger an dem Fahren Gefallen finden, sagte auch wohl zuweilen mit der größten Ehrerbietigkeit, wenn er vom Fahren müde war: so gern ich wollte, ist es mir doch jetzt unmöglich, dich noch länger zu fahren.
So sahe er dies am Ende für eine Art von Gottesdienst an, und hielt es nun für keine Sünde mehr, wenn er sich auch halbe Tage mit dem Schiebkarrn beschäftigte.
Nun aber bekam er selbst mit Bewilligung des Hrn. v. F. ein Buch in die Hand, das ihn wieder in eine ganz andre und neue Welt führte. Es war die Acerra philologica. Hier las er nun die Geschichte von Troja, vom Ulysses, von der Circe, vom Tartarus und Elysium, und war sehr bald mit allen Göttern und Göttinnen des Heidentums bekannt. Bald darauf gab man ihm auch den Telemach, ebenfalls mit Bewilligung des Hrn. v. F. zu lesen, vielleicht weil der Verfasser desselben, Hr. v. Fenelon, mit der Madam Guion Umgang hatte.
Die Acerra philologica war ihm zur Lektüre des Telemach eine schöne Vorbereitung gewesen, weil er dadurch mit der Götterlehre ziemlich bekannt geworden war, und sich schon für die meisten Helden interessierte, die er im Telemach wieder fand.
Diese Bücher wurden verschiedne Male nacheinander mit der größten Begierde und mit wahrem Entzücken von ihm durchgelesen, insbesondere der Telemach, worin er zum ersten Male die Reize einer schönen zusammenhängenden Erzählung schmeckte.
Die Stelle, welche ihn im ganzen Telemach am lebhaftesten gerührt hat, war die rührende Anrede des alten Mentors an den jungen Telemach, als dieser auf der Insel Cypern die Tugend mit dem Laster zu vertauschen im Begriff war, und ihm nun sein getreuer lange von ihm für verloren gehaltener Mentor plötzlich wieder erschien, dessen traurender Anblick ihn bis in das Innerste seiner Seele erschütterte.
Dies hatte nun freilich für Antons Seele weit mehr Anziehendes, als die biblische Geschichte, und alles, was er vorher in dem Leben der Altväter, oder in den Guion’schen Schriften gelesen hatte; und da ihm nie eigentlich gesagt worden war, dass jenes wahr, und dieses falsch sei, so fand er sich gar nicht ungeneigt, die heidnische Göttergeschichte mit allem, was da hineinschlug, wirklich zu glauben.
Ebensowenig konnte er aber auch, was in der Bibel stand, verwerfen; um so vielmehr, da dies die ersten Eindrücke auf seine Seele gewesen waren. Er suchte also, welches ihm allein übrig blieb, die verschiedenen Systeme, so gut er konnte, in seinem Kopfe zu vereinigen, und auf die Weise die Bibel mit dem Telemach, das Leben der Altväter mit der Acerra philologica, und die heidnische Welt mit der christlichen zusammenzuschmelzen.
Die erste Person in der Gottheit und Jupiter, Calypso und die Madam Guion, der Himmel und Elysium, die Hölle und der Tartarus, Pluto und der Teufel, machten bei ihm die sonderbarste Ideenkombination, die wohl je in einem menschlichen Gehirn mag existiert haben.
Dies machte einen so starken Eindruck auf sein Gemüt, dass er noch lange nachher eine gewisse Ehrfurcht gegen die heidnischen Gottheiten behalten hat.
Von dem Hause, wo Antons Vater logierte, bis nach dem Gesundbrunnen und der Allee dabei, war ein ziemlich weiter Weg. Anton schleppte sich demohngeachtet mit seinem schmerzenden Fuße, das Buch unterm Arm, hinaus, und setzte sich auf eine Bank in der Allee, wo er im Lesen nach und nach seinen Schmerz vergaß, und bald nicht nur auf der Bank in P., sondern auf irgend einer Insel mit hohen Schlössern und Türmen, oder mitten im wilden Kriegsgetümmel sich befand.
Mit einer Art von wehmütiger Freude las er nun, wenn Helden fielen, es schmerzte ihn zwar, aber doch deuchte ihm, sie mussten fallen.
Dies mochte auch wohl einen großen Einfluss auf seine kindischen Spiele haben. Ein Fleck voll hochgewachsener Nesseln oder Disteln waren ihm so viele feindliche Köpfe, unter denen er manchmal grausam wütete, und sie mit seinem Stabe einen nach dem andern herunter hieb.
Wenn er auf der Wiese ging, so machte er eine Scheidung, und ließ in seinen Gedanken zwei Heere gelber oder weißer Blumen gegeneinander anrücken. Den größten unter ihnen gab er Namen von seinen Helden, und eine benannte er auch wohl von sich selber. Dann stellte er eine Art von blindem Fatum vor, und mit zugemachten Augen hieb er mit seinem Stabe, wohin er traf.
Wenn er dann seine Augen wieder öffnete, so sah er die schreckliche Zerstörung, hier lag ein Held und dort einer auf den Boden hingestreckt, und oft erblickte er mit einer sonderbaren wehmütigen und doch angenehmen Empfindung sich selbst unter den Gefallenen.
Er betrauerte dann eine Weile seine Helden, und verließ das fürchterliche Schlachtfeld. Zu Hause, nicht weit von der Wohnung seiner Eltern, war ein Kirchhof, auf welchem er eine ganze Generation von Blumen und Pflanzen mit eisernem Szepter beherrschte, und keinen Tag hingehen ließ, wo er nicht mit ihnen eine Art von Musterung hielt.
Als er von P. wieder nach Hause gereist war, schnitzte er sich alle Helden aus dem Telemach von Papier, bemalte sie nach den Kupferstichen mit Helm und Panzer, und ließ sie einige Tage lang in Schlachtordnung stehen, bis er endlich ihr Schicksal entschied, und mit grausamen Messerhieben unter ihnen wütete, diesem den Helm, jenem den Schädel zerspaltete, und rund um sich her nichts als Tod und Verderben sahe.
So liefen alle seine Spiele auch mit Kirsch- und Pflaumkernen auf Verderben und Zerstörung hinaus. Auch über diese musste ein blindes Schicksal walten, indem er zwei verschiedne Arten als Heere gegeneinander anrücken, und nun mit zugemachten Augen den eisernen Hammer auf sie herabfallen ließ, und wen es traf, den trafs.
Wenn er Fliegen mit der Klappe tot schlug, so tat er dieses mit einer Art von Feierlichkeit, indem er einer jeden mit einem Stücke Messing, das er in der Hand hatte, vorher die Totenglocke läutete. Das allergrößte Vergnügen machte es ihm, wenn er eine aus kleinen papiernen Häusern erbauete Stadt verbrennen, und dann nachher mit feierlichem Ernst und Wehmut den zurückgebliebenen Aschenhaufen betrachten konnte.
Ja als in der Stadt, wo seine Eltern wohnten, einmal wirklich in der Nacht ein Haus abbrannte, so empfand er bei allem Schreck eine Art von geheimem Wunsche, dass das Feuer nicht sobald gelöscht werden möchte.
Dieser Wunsch hatte nichts weniger als Schadenfreude zum Grunde, sondern entstand aus einer dunklen Ahndung von großen Veränderungen, Auswanderungen und Revolutionen, wo alle Dinge eine ganz andre Gestalt bekommen, und die bisherige Einförmigkeit aufhören würde.
Selbst der Gedanke an seine eigne Zerstörung war ihm nicht nur angenehm, sondern verursachte ihm sogar eine Art von wollüstiger Empfindung, wenn er oft des Abends, ehe er einschlief, sich die Auflösung und das Auseinanderfallen seines Körpers lebhaft dachte.
Antons dreimonatlicher Aufenthalt in P. war ihm in vieler Rücksicht sehr vorteilhaft, weil er fast immer sich selbst überlassen war, und das Glück hatte, diese kurze Zeit wieder von seinen Eltern entfernt zu sein, indem seine Mutter zu Hause geblieben war, und sein Vater andre Geschäfte in P. hatte, und sich nicht viel um ihn bekümmerte; doch aber sich hier, wenn er ihn zuweilen sahe, weit gütiger, als zu Hause, gegen ihn betrug.
Auch logierte mit Antons Vater in demselben Hause ein Engländer, der gut deutsch sprach, und sich mit Anton mehr abgab, wie irgend einer vor ihm getan hatte, indem er anfing, ihn durch bloßes Sprechen Englisch zu lehren, und sich über seine Progressen freute. Er unterredete sich mit ihm, ging mit ihm spazieren, und konnte am Ende fast gar nicht mehr ohne ihn sein.
Dies war der erste Freund, den Anton auf Erden fand: mit Wehmut nahm er von ihm Abschied. Der Engländer drückte ihm bei seiner Abreise ein silbern Schaustück in die Hand, das sollte er ihm zum Andenken aufbewahren, bis er einmal nach England käme, wo ihm sein Haus offen stände: nach funfzehn Jahren kam Anton wirklich nach England, und hatte noch sein Schaustück bei sich, aber der erste Freund seiner Jugend war tot.
Anton sollte einmal diesen Engländer gegen einen Fremden, der ihn besuchen wollte, verleugnen, und sagen, er sei nicht zu Hause. Man konnte ihn auf keine Weise dazu bringen, weil er keine Lüge begehen wollte.
Dies wurde ihm damals sehr hoch angerechnet, und war just einer der Fälle, wo er tugendhafter scheinen wollte, als er wirklich war, denn er hatte sich sonst eben aus einer Notlüge nicht so sehr viel gemacht; aber seinen wahren innern Kampf, wo er oft seine unschuldigsten Wünsche einem eingebildeten Missfallen des göttlichen Wesens aufopferte, bemerkte niemand.
Indes war ihm das liebreiche Betragen, dass man in P. gegen ihn bewies, sehr aufmunternd, und erhob seinen niedergedrückten Geist ein wenig. Wegen seiner Schmerzen am Fuße bezeugte man ihm Mitleid, im v. F.schen Hause begegnete man ihm leutselig, und der Hr. v. F. küsste ihn auf die Stirne, sooft er ihm auf der Straße begegnete. Dergleichen Begegnungen waren ihm ganz etwas Ungewohntes und Rührendes, das seine Stirne wieder freier, sein Auge offner, und seine Seele heitrer machte.
Er fing nun auch an, sich auf die Poesie zu legen, und besang, was er sah und hörte. Er hatte zwei Stiefbrüder, die beide in P. das Schneiderhandwerk lernten, und deren Meister ebenfalls Anhänger der Lehre des Hrn. v. F. waren. Von diesen nahm er in Versen, die er selbst gemacht und auswendig gelernt hatte, sehr rührend Abschied, so wie auch von dem v. F.schen Hause.
Freilich kehrte er nun nicht so wieder von P. zu Hause, wie er erwartet hatte, aber doch war er in dieser kurzen Zeit ein ganz andrer Mensch geworden, und seine Ideenwelt um ein Großes bereichert.
Allein zu Hause wurden durch die erneuerte Zwietracht seiner Eltern, wozu vermutlich die Ankunft seiner beiden Stiefbrüder vieles beitrug, und durch das unaufhörliche Schelten und Toben seiner Mutter, die guten Eindrücke, die er in P. und besonders in dem v. F.schen Hause erhalten hatte, bald wieder ausgelöscht, und er befand sich aufs Neue in seiner vorigen gehässigen Lage, wodurch seine Seele ebenfalls finster und menschenfeindlich gemacht wurde.
Da Antons beide Stiefbrüder bald abreiseten, um ihre Wanderschaft anzutreten, so war auch der häusliche Friede eine Zeit lang wieder hergestellt, und Antons Vater las nun zuweilen selber, anstatt aus der Madam Guion Schriften, etwas aus dem Telemach vor, oder erzählte ein Stück aus der ältern oder neuern Geschichte, worin er wirklich ziemlich bewandert war, denn neben seiner Musik, worin er es im Praktischen weit gebracht hatte, machte er beständig aus dem Lesen nützlicher Bücher ein eignes Studium, bis endlich die Guion’schen Schriften alles übrige verdrängten.
Er redete daher auch eine Art von Büchersprache, und Anton erinnert sich noch sehr genau, wie er im siebenten oder achten Jahre oft sehr aufmerksam zuhörte, wann sein Vater sprach, und sich wunderte, dass er von allen den Wörtern, die sich auf heit, und keit, und ung endigten, keine Silbe verstand, da er doch sonst, was gesprochen wurde, verstehen konnte.
Auch war Antons Vater außer dem Hause ein sehr umgänglicher Mann, und konnte sich mit allerlei Leuten über allerlei Materien angenehm unterhalten. Vielleicht wäre auch alles im Ehestande besser gegangen, wenn Antons Mutter nicht das Unglück gehabt hätte, sich oft für beleidigt, und gern für beleidigt zu halten, auch wo sie es wirklich nicht war, um nur Ursach zu haben, sich zu kränken und zu betrüben, und ein gewisses Mitleid mit sich selber zu empfinden, worin sie eine Art von Vergnügen fand.
Leider scheint sie diese Krankheit auf ihren Sohn fortgeerbt zu haben, der jetzt noch oft vergeblich damit zu kämpfen hat.
Schon als Kind, wenn alle etwas bekamen, und ihm sein Anteil hingelegt wurde, ohne dabei zu sagen, es sei der seinige, so ließ er ihn lieber liegen, ob er gleich wusste, dass er für ihn bestimmt war, um nur die Süßigkeit des Unrechtleidens zu empfinden, und sagen zu können, alle andren haben etwas, und ich nichts bekommen! Da er eingebildetes Unrecht schon so stark empfand, um so viel stärker musste er das wirkliche empfinden. Und gewiss ist wohl bei niemanden die Empfindung des Unrechts stärker, als bei Kindern, und niemandem kann auch leichter Unrecht geschehen; ein Satz, den alle Pädagogen täglich und stündlich beherzigen sollten.
Oft konnte Anton stundenlang nachdenken, und Gründe gegen Gründe auf das genaueste abwägen, ob eine Züchtigung von seinem Vater recht oder unrecht sei?
Jetzt genoss er in seinem eilften Jahre zum ersten Mal das unaussprechliche Vergnügen verbotner Lektüre.
Sein Vater war ein abgesagter Feind von allen Romanen, und drohete ein solches Buch sogleich mit Feuer zu verbrennen, wenn er es in seinem Hause fände. Demohngeachtet bekam Anton durch seine Base die schöne Banise, die Tausendundeine Nacht, und die Insel Felsenburg in die Hände, die er nun heimlich und verstohlen, obgleich mit Bewusstsein seiner Mutter, in der Kammer las, und gleichsam mit unersättlicher Begierde verschlang.
Dies waren einige der süßesten Stunden in seinem Leben. Sooft seine Mutter hereintrat, drohete sie ihm bloß mit der Ankunft seines Vaters, ohne ihm selber das Lesen in diesen Büchern zu verbieten, worin sie ehemals ein ebenso entzückendes Vergnügen gefunden hatte.
Die Erzählung von der Insel Felsenburg tat auf Anton eine sehr starke Wirkung, denn nun gingen eine Zeit lang seine Ideen auf nichts Geringers, als einmal eine große Rolle in der Welt zu spielen, und erst einen kleinen, denn immer größern Zirkel von Menschen um sich her zu ziehen, von welchen er der Mittelpunkt wäre: dies erstreckte sich immer weiter, und seine ausschweifende Einbildungskraft ließ ihn endlich sogar Tiere, Pflanzen, und leblose Kreaturen, kurz alles, was ihn umgab, mit in die Sphäre seines Daseins hineinziehen, und alles musste sich um ihn, als den einzigen Mittelpunkt, umher bewegen, bis ihm schwindelte.
Dieses Spiel seiner Einbildungskraft machte ihm damals oft wonnevollre Stunden, als er je nachher wieder genossen hat.
So machte seine Einbildungskraft die meisten Leiden und Freuden seiner Kindheit. Wie oft, wenn er an einem trüben Tage bis zum Überdruss und Ekel in der Stube eingesperrt war, und etwa ein Sonnenstrahl durch eine Fensterscheibe fiel, erwachten auf einmal in ihm Vorstellungen vom Paradiese, von Elysium, oder von der Insel der Kalypso, die ihn ganze Stunden lang entzückten.
Aber von seinem zweiten und dritten Jahre an erinnert er sich auch der höllischen Qualen, die ihm die Märchen seiner Mutter und seiner Base im Wachen und im Schlafe machten: wenn er bald im Traume lauter Bekannte um sich her sahe, die ihn plötzlich mit scheußlich verwandelten Gesichtern anbleckten, bald eine hohe düstre Stiege hinaufstieg, und eine grauenvolle Gestalt ihm die Rückkehr verwehrte, oder gar der Teufel bald wie ein fleckichtes Huhn, bald wie ein schwarzes Tuch an der Wand ihm erschien.
Als seine Mutter noch mit ihm auf dem Dorfe wohnte, jagte ihm jede alte Frau Furcht und Entsetzen ein, so viel hörte er beständig von Hexen und Zaubereien; und wenn der Wind oft mit sonderbaren Getön durch die Hütte pfiff, so nannte seine Mutter dies im allegorischen Sinn den handlosen Mann, ohne weiter etwas dabei zu denken.
Allein sie würde es nicht getan haben, hätte sie gewusst, wie manche grauenvolle Stunde und wie manche schlaflose Nacht dieser handlose Mann ihrem Sohne noch lange nachher gemacht hat.
Insbesondre waren immer die letzten vier Wochen vor Weihnachten für Anton ein Fegefeuer, wogegen er gerne den mit Wachslichtern besteckten und mit übersilberten Äpfeln und Nüssen behängten Tannenbaum entbehrt hätte.
Da ging kein Tag hin, wo sich nicht ein sonderbares Getöse wie von Glocken, oder ein Scharren vor der Türe, oder eine dumpfe Stimme hätte hören lassen, die den sogenannten Ruprecht oder Vorgänger des heiligen Christs anzeigte, den Anton denn im ganzen Ernst für einen Geist oder ein übermenschliches Wesen hielt, und so ging auch diese ganze Zeit über keine Nacht hin, wo er nicht mit Schrecken und Angstschweiß vor der Stirne aus dem Schlaf erwachte.
Dies währte bis in sein achtes Jahr, wo erst sein Glaube an die Wirklichkeit des Ruprechts sowohl als des heiligen Christs an zu wanken fing.
So teilte ihm seine Mutter auch eine kindische Furcht vor dem Gewitter mit. Seine einzige Zuflucht war alsdann, dass er, so fest er konnte, die Hände zusammen faltete, und sie nicht wieder auseinander ließ, bis das Gewitter vorüber war; dies, nebst dem über sich geschlagenen Kreuze, war auch seine Zuflucht, und gleichsam eine feste Stütze, sooft er alleine schlief, weil er dann glaubte, es könne ihm weder Teufel noch Gespenster etwas anhaben.
Seine Mutter hatte einen sonderbaren Ausdruck, dass einem, der vor einem Gespenste fliehen will, die Fersen lang werden; dies fühlte er im eigentlichen Verstande, sooft er im Dunkeln etwas Gespensterähnliches zu sehen glaubte. Auch pflegte sie von einem Sterbenden zu sagen, dass ihm der Tod schon auf der Zunge sitze; dies nahm Anton ebenfalls im eigentlichen Verstande, und als der Mann seiner Base starb, stand er neben dem Bette, und sahe ihm sehr scharf in den Mund, um den Tod auf der Zunge desselben, etwa, wie eine kleine schwarze Gestalt, zu entdecken.
Die erste Vorstellung über seinen kindischen Gesichtskreis hinaus bekam er ohngefähr im fünften Jahre, als seine Mutter noch mit ihm in dem Dorfe wohnte, und eines Abends mit einer alten Nachbarin, ihm und seinen Stiefbrüdern allein in der Stube saß.
Das Gespräch fiel auf Antons kleine Schwester, die vor kurzem in ihrem zweiten Jahre gestorben war, und worüber seine Mutter beinahe ein Jahr lang untröstlich blieb.
Wo wohl jetzt Julchen sein mag? sagte sie nach einer langen Pause, und schwieg wieder. Anton blickte nach dem Fenster hin, wo durch die düstre Nacht kein Lichtstrahl schimmerte, und fühlte zum ersten Male die wunderbare Einschränkung, die seine damalige Existenz von der gegenwärtigen beinahe so verschieden machte, wie das Dasein vom Nichtsein.
Wo mag jetzt wohl Julchen sein? dachte er seiner Mutter nach, und Nähe und Ferne, Enge und Weite, Gegenwart und Zukunft blitzte durch seine Seele. Seine Empfindung dabei malt kein Federzug; tausendmal ist sie wieder in seiner Seele, aber nie mit der ersten Stärke, erwacht.
Wie groß ist die Seligkeit der Einschränkung, die wir doch aus allen Kräften zu fliehen suchen! Sie ist wie ein kleines glückliches Eiland in einem stürmischen Meere: wohl dem, der in ihrem Schoße sicher schlummern kann, ihn weckt keine Gefahr, ihm drohen keine Stürme. Aber wehe dem, der von unglücklicher Neugier getrieben, sich über dies dämmernde Gebirge hinauswagt, das wohltätig seinen Horizont umschränkt.
Er wird auf einer wilden stürmischen See von Unruh und Zweifel hin und her getrieben, sucht unbekannte Gegenden in grauer Ferne, und sein kleines Eiland, auf dem er so sicher wohnte, hat alle seine Reize für ihn verloren.
Eine von Antons seligsten Erinnerungen aus den frühesten Jahren seiner Kindheit ist, als seine Mutter ihn in ihren Mantel eingehüllt, durch Sturm und Regen trug. Auf dem kleinen Dorfe war die Welt ihm schön, aber hinter dem blauen Berge, nach welchem er immer sehnsuchtsvoll blickte, warteten schon die Leiden auf ihn, die die Jahre seiner Kindheit vergällen sollten.
Da ich einmal in meiner Geschichte zurückgegangen bin, um Antons erste Empfindungen und Vorstellungen von der Welt nachzuholen, so muss ich hier noch zwei seiner frühesten Erinnerungen anführen, die seine Empfindung des Unrechts betreffen.
Er ist sich deutlich bewusst, wie er im zweiten Jahre, da seine Mutter noch nicht mit ihm auf dem Dorfe wohnte, von seinem Hause nach dem gegenüberstehenden, über die Straße hin und wieder lief, und einem wohlgekleideten Manne in den Weg rannte, gegen den er heftig mit den Händen ausschlug, weil er sich selbst und andre zu überreden suchte, dass ihm Unrecht geschehen sei, ob er gleich innerlich fühlte, dass er der beleidigende Teil war.
Diese Erinnerung ist wegen ihrer Seltenheit und Deutlichkeit merkwürdig; auch ist sie echt, weil der Umstand an sich zu geringfügig war, als dass ihm nachher jemand davon hätte erzählen sollen.
Die zweite Erinnerung ist aus dem vierten Jahre, wo seine Mutter ihn wegen einer wirklichen Unart schalt; indem er sich nun gerade auszog, fügte es sich, dass eines seiner Kleidungsstücke mit einigem Geräusch auf den Stuhl fiel: seine Mutter glaubte, er habe es aus Trotz hingeworfen, und züchtigte ihn hart.
Dies war das erste wirkliche Unrecht, was er tief empfand, und was ihm nie aus dem Sinne gekommen ist; seit der Zeit hielt er auch seine Mutter für ungerecht, und bei jeder neuen Züchtigung fiel ihm dieser Umstand ein.
Ich habe schon erwähnt, wie ihm der Tod in seiner Kindheit vorgekommen sei. Dies dauerte bis in sein zehntes Jahr, als einmal eine Nachbarin seine Eltern besuchte, und erzählte, wie ihr Vetter, der ein Bergmann war, von der Leiter hinunter in die Grube gefallen sei, und sich den Kopf zerschmettert habe.
Anton hörte aufmerksam zu, und bei dieser Kopfzerschmetterung dachte er sich auf einmal ein gänzliches Aufhören von Denken und Empfinden, und eine Art von Vernichtung und Ermangelung seiner selbst, die ihn mit Grauen und Entsetzen erfüllte, sooft er wieder lebhaft daran dachte. Seit der Zeit hatte er auch eine starke Furcht vor dem Tode, die ihm manche traurige Stunde machte.
Noch muss ich etwas von seinen ersten Vorstellungen, die er sich ebenfalls ohngefähr im zehnten Jahre von Gott und der Welt machte, sagen.
Wenn oft der Himmel umwölkt und der Horizont kleiner war, fühlte er eine Art von Bangigkeit, dass die ganze Welt wiederum mit ebenso einer Decke umschlossen sei, wie die Stube, worin er wohnte, und wenn er dann mit seinen Gedanken über diese gewölbte Decke hinausging, so kam ihm diese Welt an sich viel zu klein vor, und es deuchte ihm, als müsse sie wiederum in einer andern eingeschlossen sein, und das immer so fort.
Eben so ging es ihm mit seiner Vorstellung von Gott, wenn er sich denselben, als das höchste Wesen, denken wollte.
Er saß einmal in der Dämmerung an einem trüben Abend allein vor seiner Haustüre, und dachte hierüber nach, indem er oft gen Himmel blickte, und dann wieder die Erde ansahe, und bemerkte, wie sie selbst gegen den trüben Himmel so schwarz und dunkel war.
Über dem Himmel dachte er sich Gott, aber jeder, auch der höchste Gott, den sich seine Gedanken schufen, war ihm zu klein, und musste immer wieder noch einen höhern über sich haben, gegen den er ganz verschwand, und das so ins Unendliche fort.
Doch hatte er hierüber nie etwas gelesen noch gehört. Was am sonderbarsten war, so geriet er durch sein beständiges Nachdenken und in sich gekehrt sein sogar auf den Egoismus, der ihn beinahe hätte verrückt machen können.
Weil nämlich seine Träume größtenteils sehr lebhaft waren, und beinahe an die Wirklichkeit zu grenzen schienen; so fiel es ihm ein, dass er auch wohl am hellen Tage träume, und die Leute um ihn her, nebst allem, was er sahe, Geschöpfe seiner Einbildungskraft sein könnten.
Dies war ihm ein erschrecklicher Gedanke, und er fürchtete sich vor sich selber, sooft er ihm einfiel, auch suchte er sich dann wirklich durch Zerstreuung von diesen Gedanken los zu machen.
Nach dieser Ausschweifung wollen wir der Zeitfolge gemäß in Antons Geschichte wieder fortfahren, den wir eilf Jahre alt bei der Lektüre der schönen Banise und der Insel Felsenburg verlassen haben. Er bekam nun auch Fenelons Totengespräche, nebst dessen Erzählungen zu lesen, und sein Schreibmeister fing an, ihn eigne Briefe und Ausarbeitungen machen zu lassen.
Dies war für Anton eine noch nie empfundene Freude. Er fing nun an, seine Lektüre zu nutzen, und hie und da Nachahmungen von dem Gelesenen anzubringen, wodurch er sich den Beifall und die Achtung seines Lehrers erwarb.
Sein Vater musizierte mit in einem Konzert, wo Ramlers Tod Jesu aufgeführt wurde, und brachte einen gedruckten Text davon mit zu Hause. Dieser hatte für Anton soviel Anziehendes und übertraf alles Poetische, was er bisher gelesen hatte, so weit, dass er ihn so oft und mit solchem Entzücken las, bis er ihn beinahe auswendig wusste.
Durch diese einzige so oft wiederholte zufällige Lektüre bekam sein Geschmack in der Poesie eine gewisse Bildung und Festigkeit, die er seit der Zeit nicht wieder verloren hat; so wie in der Prose durch den Telemach; denn er fühlte bei der schönen Banise, und Insel Felsenburg, ohngeachtet des Vergnügens, das er darin fand, doch sehr lebhaft das Abstechende und Unedlere in der Schreibart.
Von poetischer Prose fiel ihm Carl v. Mosers Daniel in der Löwengrube in die Hände, den er verschiedne Male durchlas, und woraus auch sein Vater zuweilen vorzulesen pflegte.
Die Brunnenzeit kam wieder heran, und Antons Vater beschloss, ihn wieder mit nach P. zu nehmen, allein diesmal sollte Anton nicht so viel Freude als im vorigen Jahre dort genießen, denn seine Mutter reiste mit.
Ihr unaufhörliches Verbieten von Kleinigkeiten und beständiges Schelten und Strafen zu unrechter Zeit, verleidete ihm alle edlern Empfindungen, die er hier vor einem Jahre gehabt hatte; sein Gefühl für Lob und Beifall ward dadurch so sehr unterdrückt, dass er zuletzt, beinahe seiner Natur zuwider eine Art von Vergnügen darin fand, sich mit den schmutzigsten Gassenbuben abzugeben, und mit ihnen gemeine Sache zu machen, bloß weil er verzweifelte, sich je die Liebe und Achtung in P. wieder zu erwerben, die er durch seine Mutter einmal verloren hatte, welche nicht nur gegen seinen Vater, sooft er zu Hause kam, sondern auch gegen ganz fremde Leute, beständig von nichts, als von seiner schlechten Aufführung sprach, wodurch dieselbe denn wirklich anfing, schlecht zu werden und sein Herz sich zu verschlimmern schien.
Er kam auch nun seltner in das v. F.sche Haus, und die Zeit seines diesmaligen Aufenthalts in P. strich für ihn höchst unangenehm und traurig vorüber, so dass er sich oft noch mit Wehmut an die Freuden des vorigen Jahres zurückerinnerte, ob er gleich diesmal nicht so viel Schmerzen an seinem Fuß auszustehn hatte, der nun, nachdem der schadhafte Knochen herausgenommen war, wieder an zu heilen fing.
Bald nach der Zurückkunft seiner Eltern in H… trat Anton in sein zwölftes Jahr, worin ihm wiederum sehr viele Veränderungen bevorstanden: denn noch in diesem Jahre sollte er von seinen Eltern getrennt werden. Fürs Erste stand ihm eine große Freude bevor.
Antons Vater ließ ihn auf Zureden einiger Bekannten in der öffentlichen Stadtschule eine lateinische Privatstunde besuchen, damit er wenigstens auf alle Fälle, wie es hieß, einen Kasum sollte setzen lernen. In die übrigen Stunden der öffentlichen Schule aber, worin Religionsunterricht die Hauptsache war, wollte ihn sein Vater, zum größten Leidwesen seiner Mutter und Anverwandten, schlechterdings nicht schicken.
Nun war doch einer von Antons eifrigsten Wünschen, einmal in eine öffentliche Stadtschule gehen zu dürfen, zum Teil erfüllt.
Beim ersten Eintritt waren ihm schon die dicken Mauern, dunklen gewölbten Gemächer, hundertjährigen Bänke, und vom Wurm durchlöcherten Katheder, nichts wie Heiligtümer, die seine Seele mit Ehrfurcht erfüllten.
Der Konrektor, ein kleines muntres Männchen, flößte ihm, ohngeachtet seiner nicht sehr gravitätischen Miene, dennoch durch seinen schwarzen Rock und Stutzperücke einen tiefen Respekt ein.
Dieser Mann ging auch auf einem ziemlich freundschaftlichen Fuß mit seinen Schülern um: gewöhnlich nannte er zwar einen jeden ihr, aber die vier öbersten, welche er auch im Scherz Veteraner hieß, wurden vorzugsweise er genannt.
Ob er dabei gleich sehr strenge war, hat doch Anton niemals einen Vorwurf noch weniger einen Schlag von ihm bekommen: er glaubte daher auch in der Schule immer mehr Gerechtigkeit, als bei seinen Eltern zu finden.
Er musste nun anfangen, den Donat auswendig zu lernen, allein freilich hatte er einen wunderbaren Akzent, der sich bald zeigte, da er gleich in der zweiten Stunde sein Mensa auswendig hersagen musste, und indem er Singulariter und Pluraliter sagte, immer den Ton auf die vorletzte Silbe legte, weil er sich beim Auswendiglernen dieses Pensums, wegen der Ähnlichkeit dieser Wörter mit Amoriter, Jebusiter, usw., fest einbildete, die Singulariter wären ein besonderes Volk, das Mensa, und die Pluraliter ein andres Volk, das Mensae gesagt hätte.
Wie oft mögen ähnliche Missverständnisse veranlasst werden, wenn der Lehrer sich mit den ersten Worten des Lehrlings begnügen lässt, ohne in den Begriff desselben einzudringen!
Nun ging es an das Auswendiglernen. Das ›amo, amem, amas, ames‹, ward bald nach dem Takte hergebetet, und in den ersten sechs Wochen wusste er schon sein ›oportet‹ auf den Fingern herzusagen; dabei wurden täglich Vokabeln auswendig gelernt, und weil ihm niemals eine fehlte, so schwang er sich in kurzer Zeit von einer Stufe zur andern empor und rückte immer näher an die Veteraner heran.
Welch eine glückliche Lage, welch eine herrliche Laufbahn für Anton, der nun zum ersten Male in seinem Leben einen Pfad des Ruhms vor sich eröffnet sahe, was er so lange vergeblich gewünscht hatte.
Auch zu Hause brachte er diese kurze Zeit ziemlich vergnügt zu, indem er alle Morgen, während dass seine Eltern Kaffee tranken, ihnen aus dem Thomas von Kempis von der Nachfolge Christi vorlesen musste, welches er sehr gern tat.
Es ward alsdann darüber gesprochen, und er durfte auch zuweilen sein Wort dazu geben. Übrigens genoss er das Glück, nicht viel zu Hause zu sein, weil er noch die Stunden seines alten Schreibmeisters zu gleicher Zeit besuchte, den er, ohngeachtet mancher Kopfstöße, die er von ihm bekommen hatte, so aufrichtig liebte, dass er alles für ihn aufgeopfert hätte.
Denn dieser Mann unterhielt sich mit ihm und seinen Mitschülern oft in freundschaftlichen und nützlichen Gesprächen, und weil er sonst von Natur ein ziemlich harter Mann zu sein schien, so hatte seine Freundlichkeit und Güte desto mehr Rührendes, das ihm die Herzen gewann.
So war nun Anton einmal auf einige Wochen in einer doppelten Lage glücklich: aber wie bald wurde diese Glückseligkeit zerstört! Damit er sich seines Glücks nicht überheben sollte, waren ihm fürs Erste schon starke Demütigungen zubereitet.
Denn ob er nun gleich in Gesellschaft gesitteter Kinder unterrichtet ward, so ließ ihn doch seine Mutter die Dienste der niedrigsten Magd verrichten.
Er musste Wasser tragen, Butter und Käse aus den Kramläden holen, und wie ein Weib mit dem Korbe im Arm auf den Markt gehen, um Esswaren einzukaufen.
Wie innig es ihn kränken musste, wenn alsdann einer seiner glücklichern Mitschüler hämischlächelnd vor ihm vorbeiging, darf ich nicht erst sagen.
Doch dies verschmerzte er noch gerne gegen das Glück, in eine lateinische Schule gehen zu dürfen, wo er nach zwei Monaten so weit gestiegen war, dass er nun an den Beschäftigungen des öbersten Tisches, oder der sogenannten vier Veteraner, mit teilnehmen konnte.