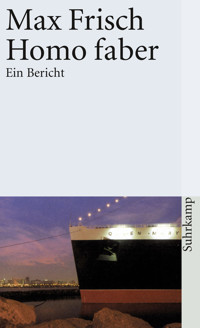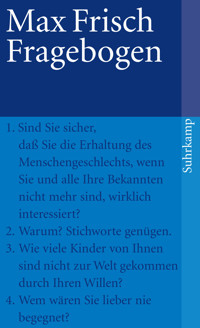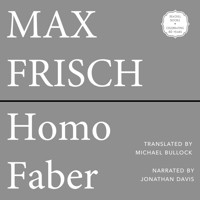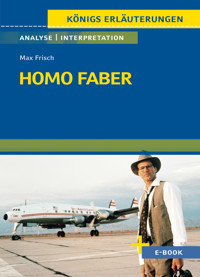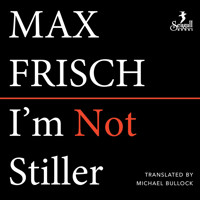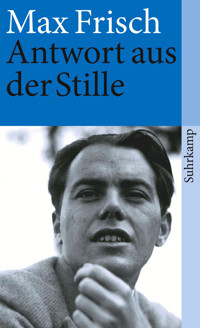
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Warum leben wir nicht, wo wir doch wissen, daß wir nur ein einziges Mal da sind, nur ein einziges und unwiederholbares Mal, auf dieser unsagbar herrlichen Welt!« Balz Leuthold wollte nie »gewöhnlich« sein, doch Außergewöhnliches hat er kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag nicht vorzuweisen. Nun will er am Berg erzwingen, was ihm in Kunst und Literatur nicht gelang: die heroische Tat, die endlich sein »Dasein« in ein echtes »Leben« verwandelt. Mehr als siebzig Jahre nach Erscheinen ist diese frühe Erzählung von Max Frisch jetzt wieder zugänglich. Drängend und ungeschliffen noch begegnet bereits hier die Frage nach der biographischen Identität, die sein gesamtes Schaffen prägen sollte: Was macht ein erfülltes Leben aus? »Finden wir heraus, warum Frisch diese höchst ungewöhnliche und äußerst dichte, meisterhafte Erzählung verbannt hat, welche Züge seiner Figur ihm peinlich waren? Die Antwort kommt in diesem Buch tatsächlich aus der Stille; jeder Leser wird durch seine eigenen Lektüre eine für sich zutreffende finden. Diese Lektüre schafft man in wenigen, besonders lohnenden Stunden.« Andreas Müller, Darmstädter Echo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Balz Leuthold wollte nie »gewöhnlich« sein, doch Außergewöhnliches hat er kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag nicht vorzuweisen. Nun will er am Berg erzwingen, was ihm in Kunst und Literatur nicht gelang: die heroische Tat, die endlich sein »Dasein« in ein echtes »Leben« verwandelt.
Mehr als siebzig Jahre nach Erscheinen ist diese frühe Erzählung von Max Frisch jetzt wieder zugänglich. Drängend und ungeschliffen noch begegnet bereits hier die Frage nach der biographischen Identität, die sein gesamtes Schaffen prägen sollte: Was macht ein erfülltes Leben aus?
Max Frisch, am 15. Mai 1911 in Zürich geboren, starb dort am 4. April 1991. Sein Werk, vielfach ausgezeichnet, erscheint im Suhrkamp Verlag.
Max Frisch
Antwort aus der Stille
Eine Erzählung aus den Bergen
Mit einem Nachwort vonPeter von Matt
Suhrkamp
Antwort aus der Stille. Eine Erzählung aus den Bergen erschien erstmals 1937 in der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart/Berlin
Umschlagfoto: Hans Staub, Porträt Max Frisch, 1933,
© Fotostiftung Schweiz / VG Bild-Kunst, Bonn 2010
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73875-7
www.suhrkamp.de
Es ist ein Tag, wie er zum Wandern kaum schöner sein kann, ein blauer und nicht allzu warmer Tag. Wie weiße Watte hängen die Wolken über dem Tal, ganz still, und in den Wiesen zirpen die Grillen. Noch ist es Sommer; nur daß das Licht, das über den Feldern flimmert, schon eine goldene Milde hat, und es genügt ein einzelnes Blatt, das einmal am Wege liegt und braune Ränder hat, und man denkt an den Herbst, obgleich noch alles grün ist, obgleich die bunten Schmetterlinge flattern und das reifende Korn noch an den Hängen steht.
Schon seit Stunden hat sich der Wandrer kaum eine Rast gegönnt; er hat sein Hemd ausgezogen und trägt den Rucksack auf den bloßen Schultern, die braun sind und glänzen. Es ist ein schwerer Rucksack, beladen mit Seil und Steigeisen, mit Schlafsack und Zelt; auch die Mauerhaken fehlen nicht, und wer immer ihm begegnen würde, erriete es auf den ersten Blick, daß er offenbar Großes vorhat, dieser Wandrer mit dem strammen Schritt und dem Pickel in der schwingenden Hand . . .
Aber es begegnet ihm ja niemand.
Es ist ein stilles und einsames Bergtal, manchmal hört man wieder den Bach, der in den Schluchten tost, oder es geht an den hohen Felsen vorbei, wo das Wasser in stäubenden und silbernen Schleiern niederfällt.
Das ist alles noch wie damals, wie vor dreizehn Jahren; damals ging er mit seinem älteren Bruder, der ihm mancherlei zeigte und erklärte, zum Beispiel, wie ein solches Tal entstünde, wie sich die alten Gletscher langsam eine breite Mulde ausgeschliffen hätten, gleichsam wie ein Hobel, und an den Felsen zeigte er die Gletscherschliffe, die es bezeugen konnten, und wenn man in die Weite blickte, erkannte man auch die Terrassen eines alten und höheren Talbodens. Und dann erst, sagte sein erwachsener Bruder, sei der Bach gekommen, der sich die schmalen Schluchten sägte, in vielen Jahrtausenden natürlich.
Daran erinnert sich der einsame Wandrer nun, als er diese Felsen wiedersieht. Damals war er ja noch ein Bub, und man hatte noch das jugendliche Gefühl, daß man ein unabsehbares und fast endloses Leben besitze, und vielleicht war es das erstemal, hier an dieser Stelle, daß er sich wie eine Eintagsfliege vorkam –
Damals vor dreizehn Jahren.
Einmal kommt ein holpernder und ächzender Karren des Weges, und man muß zur Seite treten, solange der Staub aufwirbelt und in weißen Fahnen über die Wiesen sinkt.
Auch an den kleinen Brunnen, der später am Wegrand steht, erinnert sich der einsame Wandrer noch; das muntere Plätschern ist nicht älter geworden, und auch diesmal trinkt er von dem eiskalten Wasser, das manchmal einfach ausbleibt, dann gluckst und sprudelt es wieder um so toller. Köstlich erfrischt es die Stirne, die er unter die Röhre hält; auch die braunen Arme taucht er nochmals in den vermoosten Holztrog, bevor er wieder seinen Pickel ergreift, und bald sind die schwarzen Tropfen auf seinen Schuhen abermals verstaubt und verschwunden.
Vielleicht weiß er selber nicht, warum er sich keine Rast gönnt, trotzdem er eigentlich Zeit genug hat. Oft blickt er nur auf seine wandernden Schuhe und schaut nicht, was links und rechts ist, wie ein Mensch, der eben ein starkes Ziel hat oder jedenfalls meint, daß er eines habe, und der nun einzig und allein noch an dieses Ziel denkt . . .
Immer einsamer wird dann der Weg. Kaum daß sich noch einmal eine Hütte zeigt. In den Feldern summt der Mittag, und später, wenn es am wärmsten ist, hört man dann und wann ein dumpfes Rollen, das irgendwo über dem Tale verhallt, ein Steinschlag in den Bergen, wie immer um diese Stunde.
Auch das ist noch wie damals.
Oder vielleicht denkt der einsame Wandrer auch zurück; es ist ein langes Tal, und dreizehn Jahre sind eine lange Zeit, und immer weiter wandert er in seine Erinnerung hinein. Manches läßt ihn lächeln, ganz schwach, sei es aus Scham oder aus heimlichem Neid: bei dieser hölzernen Brücke war es, wo er seinem erwachsenen Bruder, der damals gerade verlobt war, so jugendlich offen und unverfroren erklärte, heiraten sei gewöhnlich, und er würde niemals heiraten, der Siebzehnjährige; denn er wäre kein gewöhnlicher Mensch, sagte er, sondern ein Künstler oder ein Erfinder oder so. Es war das erstemal, daß er dies einem Menschen anvertraute, damals bei dieser hölzernen Brücke, und sein erwachsener Bruder fragte nur, welche Art von Künstler er denn wäre, was er denn schaffte? Und das war natürlich eine Frage, die den Jungen damals sehr verletzte, da er sie nicht beantworten konnte; denn er hatte ja noch nichts geschaffen. Man fühlte nur, daß man kein Mensch wie alle andern war, wie sein erwachsener Bruder zum Beispiel, der verlobt war und den er darum als Inbegriff des gewöhnlichen Menschen verachtete . . .
Auch durch Wald geht es manchmal, wo eine moosige Kühle herrscht und wo es nach Schwämmen riecht oder nach Harz. Graugrün hängen die Flechten an den Ästen, wie uralte Bärte, die sich im Winde leise bewegen, und zwischenhinaus blickt man immer wieder über das verblauende Tal.
Sein Bruder hat später geheiratet und ist nach Afrika ausgewandert, wo er eine Farm hat und viele Kinder, und er, der Jüngere, hat unterdessen weitergehofft und weitergeplant, während ihm die Jugend zwischen den Fingern zerrann. Aus dem Erfinden ist natürlich nichts geworden, trotz der vielen Tage, die er auf dem Estrich verbrachte, und dann versuchte er es auch als Schauspieler, dann mit dem Pinsel, dann mit der Geige. Und einmal kam auch der Tag, wo man einfach aus der Schule weglief, weil man vielleicht ein großer Entdecker wäre; aber er entdeckte damals nur, daß sein Geld nicht lange reichte und daß auch das ein Irrtum war, und man war oft verzweifelt, wie es sich für außergewöhnliche Menschen gehört; aber sein Leben hat er sich nie genommen. Noch konnte man ja sagen: Du bist erst zwanzig, und noch war alles möglich, und wie war man stolz darauf, daß noch alles möglich war! Später hieß es, fünfundzwanzig Jahre wären ja noch kein Alter, und man las gerne von Menschen, die mit fünfundzwanzig Jahren noch nichts geleistet hatten, was ungewöhnlich war, und denen es die Umwelt auch nicht zutraute, daß sie diese oder jene Werke gleichsam in der Tasche trugen. Zwar wußte man noch immer nicht, welcher Art diese kommenden Werke sein sollten; indessen trug man Hüte und Krawatten, wie sie keinem gewöhnlichen Bürger einfallen konnten, und wenn auch manchmal die Angst kam, daß man lächerlich wäre oder vielleicht sogar verrückt, lächerlicher und dümmer und schlechter und wertloser als alle Menschen dieser Erde, so war es wohl ein schmerzlicher Gedanke, aber noch kein trostloser; denn noch war ja die Süße darin, daß man mindestens auf diese Weise ein besonderer Mensch sei, vielleicht ein Verbrecher, und erst als man auch im Schlechten nichts leistete, was andere nicht ebenso konnten, wuchs eine neue und trostlosere Angst, daß es vielleicht überhaupt ausbleiben könnte. Einfach ausbleiben. Eine Hast kam seither in alles Beginnen, eine Ungeduld und ein fieberhafter Ehrgeiz, der ja selten fruchtbar ist. Man kann es in der Tat nicht glauben, daß soviel Sehnsucht, soviel jugendliche Zuversicht, soviel Gefühl und soviel stolze Worte einfach nichts sind, fruchtlos und gewöhnlich. Einmal muß es sich erfüllen, daran glaubt er noch immer, auch wenn er langsam älter und in seinem Reden verhaltener geworden ist. Eine Gnade läßt sich ja nicht zwingen, das hat man langsam eingesehen, und man lernt Geduld, auch wenn es ihm mitunter schwerfällt. Zumal unter Menschen, die ihn nur nach seiner Gegenwart werten, nicht nach seiner Zukunft. Aber man schweigt und wartet, und während man wartet, tut man, was eben die gewöhnlichen Menschen tun; man lächelt natürlich im geheimen, denn man weiß, daß man nur so tut und daß man nicht gewöhnlich ist, man weiß, daß man eigentlich wartet, nur wartet auf das Besondere, auf den Aufbruch, auf die Gnade, auf die Erfüllung, auf den Sinn . . .
Unterdessen ist das Tal immer enger und steiler geworden; es gibt nur noch einen Saumpfad, und zwischen den rostroten Föhren, die am steilen Hange stehen, schimmert auch schon der bläuliche Gletscher, dessen breite und zerrissene Zunge in die Tiefe hängt, und immer dünner wird dann das Tosen des Baches, je höher man steigt.
Aber wer einsam wandert, denkt eben immer wieder an allerlei; es ist, als begleite ihn ein Siebzehnjähriger, der ihn fragt, und als schulde man ihm Rechenschaft, als müsse man sich erzählen, daß man alle Schulen bestanden hat, sogar sehr gut, und daß man demnächst selber Lehrer sein wird, daß man eine gute Stelle hat, daß man Doktor ist und Leutnant und verlobt . . .
Als er einmal auf einem Felsen sitzt, den offenen Rucksack zwischen den Füßen, hält er eine ganze Weile seinen trockenen Becher in der Hand, als habe er seinen Durst vergessen; es ist neben einem gischtenden und schäumenden Wasser, das über den Weg stürzt, und er blickt in das dunstige Tal zurück, wo schon die Schatten steigen.
Das also ist mein Leben, denkt er immer wieder und findet, daß es kein Leben sei, sondern nur ein Dasein.
Später hält er seinen Becher unter einen Wasserstrahl, so, daß es aufspritzt, und leert ihn zweimal, und dann verfolgt er einen Raubvogel, der über den Felsen kreist, lautlos und in großen Schleifen, fast ohne Flügelschlag. Der Himmel wird übrigens schon blasser, schon abendlicher, und über den geschnittenen Matten, die steil ins Tal hängen, ist ein feuchter und hauchdünner Schleier, kaum sichtbar, aber man spürt, wie wieder ein Jahr vergeht . . .
Einmal, als er seinen Rucksack wieder auf die Schultern geschwungen hat und weitersteigt, begegnet ihm auch ein Bergler, der gerade den steilen Weg herabkommt und ein Lasttier am Strick führt, einen Maulesel, der ein wankendes Räf auf dem mageren Rücken trägt und stets am äußersten Rand des Pfades geht, wie es ihre Art ist; und der Staub, den die Hufe aufwirbeln, weht noch lange über den Abgrund hinaus und leuchtet in der abendlichen Sonne wie ein glühender Rauch.
Dann gönnt sich der einsame Wandrer keine Rast mehr, bis er an jenen Vorsprung kommt, wo das hölzerne Kreuz steht und man plötzlich den großen Ausblick hat, einen Ausblick über das ganze Tal und an den Berg, dessen Bild ihm schon immer vorschwebte: aber einfach ungeheuer ist dieser Klotz, wie er nun wirklich dasteht, und alles Erinnern ist übertroffen. Seine Spitze ragt über ziehenden Wolken. Man sieht, wie der Grat zerklüftet ist, und die Felsen, die oft als senkrechte Wände dastehen, erscheinen gerade wie glühende Kohlen. Indessen wechselt das mit jedem Augenblick, und bald ist es nur noch ein Verglimmen. Später ist es überhaupt erloschen, und der ganze Berg steht wie eine finstere Schlacke da, und die Wolken, die weiterziehen, sind wie graue und weggeblasene Asche.
Aber noch immer hält der Wandrer, der vor dem hölzernen Kreuz sitzt, seinen Feldstecher vor den Augen und schaut nach dem Nordgrat, den noch nie ein Mensch bezwungen hat . . .
Sein Herz pocht.
Es ist nur gut, daß niemand weiß, was er vorhat; man würde ihm sagen, es sei Wahnsinn oder Selbstmord, und man würde ihm nichts sagen, was er nicht selber weiß.
Als er seinen Feldstecher endlich wieder versorgt, dunkelt es schon; aber von diesem Kreuz ist es nur noch eine Stunde zum Dörflein, dessen feines und verlorenes Gebimmel man eben hört, und zum Gasthaus, wo er die Nacht verbringen will, vielleicht auch noch zwei oder drei Tage . . .
Denn auch das weiß er, daß sein Wagnis eine ernste Arbeit und Geduld verlangt. Er wird sich nochmals in den Felsen üben, damit er auf den Erfolg hoffen kann, ohne den er nicht heimkehren wird. Es ist sein letzter Versuch, wozu er aufgebrochen ist, und niemand wird ihn daran hindern, nicht durch Bitten und nicht durch Warnen. Einmal muß man sein jugendliches Hoffen einlösen, wenn es nicht lächerlich werden soll, einlösen durch die männliche Tat, und es wird sich ja zeigen, ob es ein leerer Größenwahn war oder nicht, woran man so viele Jahre lang glaubte. Einmal muß man es wagen, die Tat oder der Tod, denn ein Leben, wie es sich anläßt, kann und will er nicht ertragen, das hat er sich geschworen, dieses Leben eines Durchschnittsmenschen – nie und nimmer!
Auch das Gasthaus ist noch wie vor dreizehn Jahren; die Zimmer sind aus rohem Holz, die Fensterrahmen verwittert, und draußen, wenn man die Läden aufstößt, fällt der Kalkputz in ganzen Fetzen ab. Und auf der Wiesenterrasse, die drunten vor dem Hause ist, sieht man die Gäste, die sich nach dem Abendessen ergehen; man blickt über die grauen Schindeldächer des kleinen Dorfes, über das verdunkelnde Tal und in die Berge, die nun wie bleiches und sprödes Porzellan sind.
Das ist alles noch wie damals.
Auch daß der Bergführer, der unterdessen einen Bart bekommen hat, wieder an seinem runden Holztisch sitzt, wie er es jeden Abend tut, zusammen mit dem alten kleinen Postmann, der gerne einen Rotwein trinkt, während er seinen Maulesel an einen Baum gebunden hat, und manchmal gibt es sich, daß auch noch Jäger da sind, die Murmeltiere haben, oder es hängt sogar einmal eine Gemse am hölzernen Geländer; dann kommen die weißen Damen und streicheln das tote Fell, während die Herren ihre Zigarre aus dem Mund nehmen, den Schuß suchen oder wissen wollen, wo und wie das schöne Tier erlegt worden sei.
So sind die Abende da droben.
Später geht man wieder hinein, weil es draußen kalt wird; man blättert vielleicht im Gästebuch, aber der neue Gast hat sich noch nicht eingetragen, und man nennt ihn einfach den Sonderling, sei es, weil er in seinem Bergkleid an den Tisch kam, oder sei es, weil er nach dem Essen sofort verschwunden ist und sich den ganzen Abend nicht mehr zeigt.
Man macht wieder das Spiel mit dem Becher und den Mäusen, das die junge Dänin eingeführt hat, und das Vergnügen ist wieder grenzenlos; sie hat ein Lachen, diese junge Fremde, daß alle mitlachen müssen, die zugegen sind, auch die älteren Herren, die nur zuschauen, und einmal kracht sogar ein Stuhl, als sich jemand vor Lachen nach hinten wirft, ein neuer Stuhl wird geholt, und das Spiel geht weiter . . .
Unterdessen liegt der neue Gast, den sie also einen Sonderling nennen, bereits im Bett und wartet auf den Schlaf.
Man möchte ihn um vier Uhr wecken und seinen Lunch bereitlegen, hat er noch gesagt, drunten beim Hausdiener, und auch sein Rucksack steht schon auf dem Stuhl, fix und fertig, damit er in der Frühe keine Zeit verliere.
Wie gut ist das Leben, denkt er, wenn man müde ist und weiß, wozu man am andern Morgen erwachen wird. Man weiß es ja so selten, und immer dieses Aufstehen in ein leeres und unfruchtbares Dasein hinaus, manchmal meint man wohl, man ertrage es nicht länger. Aber man kann ja sehr verzweifelt sein, man kann sich über den Tisch werfen, und manchmal möchte man sogar seinen Kopf nehmen und ihn einfach gegen eine Wand rennen, damit alles zerspritze, was man denkt – am Ende aber, irgendwann, kommt immer ein Schlaf, der stärker ist als alles, stärker als unser Denken und Verzweifeln, und der alle Not einfach aufschiebt und das Denken löscht, bevor es tödlich wird. Und dabei weiß man so genau, daß er ja nichts löst, dieser Schlaf, daß er uns nur zu neuem Verzweifeln stärken will, und daß man am andern Morgen nie weiter ist und dennoch wieder aufstehen muß, ins Weglose hinaus, ohne Glauben und ohne Ziel, ohne Sinn, ohne alles, ohne Berufung, und bloß damit man älter werde, immer noch leerer und ratloser . . .
Aber nun soll es ja anders werden, nun weiß er ja, wozu man ihn am andern Morgen wecken wird, und er muß sich nicht grauen vor dem Erwachen, nun hat er ja ein Ziel, woran er denken kann, woran er glauben will, wofür er aufstehen muß!
Indessen findet er lange keinen Schlaf, und dann schlägt es zwölf Uhr, drunten im Dorf, als er noch immer wach liegt –