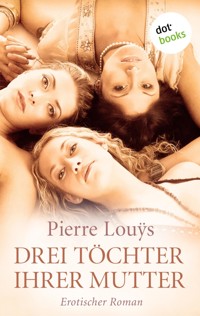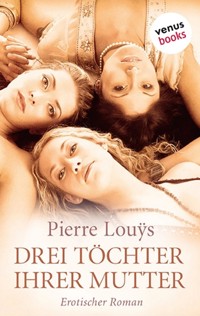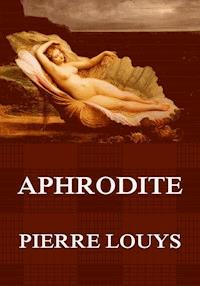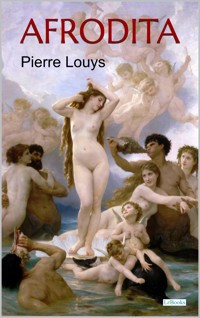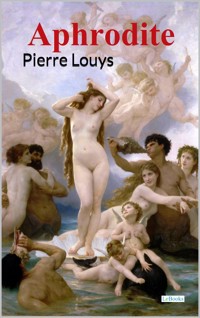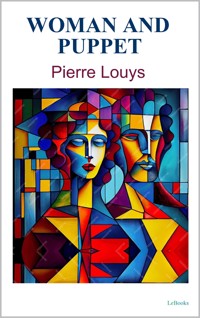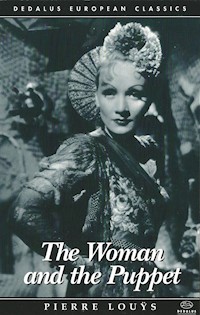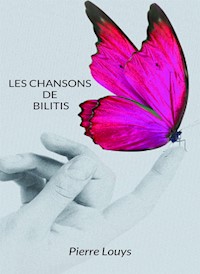Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Aphrodite" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Dieser blühende Wald am Ufer des Meeres, diese tiefen Bäche, diese Seeen und dunkle Wiesen waren in der Wüste mehr als zwei Jahrhunderte vorher durch den ersten Ptolemäer geschaffen worden. Seit jener Zeit waren die auf seinen Befehl gepflanzten Sycomoren riesengroß geworden; unter dem Einflusse der befruchtenden Gewässer waren aus den Rasenplätzen Wiesen geworden, die Wasserbecken hatten sich zu Teichen erweitert; die Natur hatte aus einem Park eine ganze Landschaft gemacht."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aphrodite
Inhaltsverzeichnis
Selbst die Ruinen der Griechenwelt lehren uns, wie in unserer modernen Welt das Leben uns erträglich gemacht werden könnte.
Richard Wagner.
Der gelehrte Prodicos von Kéos, welcher um das Ende des V. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung blühte, ist der Autor der berühmten Lehrfabel »Herkules auf dem Scheidewege zwischen der Tugend und der Wollust«, welche der heilige Basilius den christlichen Betrachtungen empfahl. Wir wissen, daß Herkules die Tugend wählte, was ihm gestattete, eine gewisse Anzahl großer Verbrechen gegen die Hirschkühe, die Amazonen, die goldenen Äpfel und die Riesen zu begehen.
Hätte Prodicos sich damit begnügt, dann hätte er wohl nur eine Fabel von einem ziemlich leichten Symbolismus geschrieben; allein er war ein gutmüthiger Philosoph und seine Sammlung von Erzählungen »Die Horen«, in drei Abschnitte eingetheilt, stellte die moralischen Wahrheiten unter den verschiedenen Formen dar, welche sie je nach den drei Lebensaltern annehmen. Den kleinen Kindern stellte er die sittenstrenge Wahl des Herkules als Beispiel hin; den jungen Leuten erzählte er die wollüstige Wahl des Paris; den reifen Männern sagte er – wie ich mir vorstellen kann – ungefähr Folgendes:
– Als Ulysses eines Tages am Fuße des delphischen Gebirges jagte, traf er auf seinem Wege zwei Jungfrauen, die sich an der Hand hielten. Die Eine hatte Veilchenhaare, durchsichtige Augen und Lippen von einem ernsten Ausdruck; sie sagte ihm: »Ich bin Arètê«. Die Andere hatte schwache Augenlider, schmale Hände und zarte Brüstchen. Sie sagte: »Ich bin Triphê«. Und Beide fügten hinzu: »Wähle zwischen uns«. Doch der schlaue Ulysses antwortete klug und weise: »Wie könnte ich wählen? Ihr seid unzertrennlich. Die Augen, welche die Eine ohne die Andere von Euch gesehen, haben nur einen hohlen Schatten gesehen. Gleichwie die wahre Tugend sich der ewigen Freuden nicht beraubt, welche die Wollust ihr bietet, würde auch die Weichlichkeit ohne eine gewisse Seelengröße wenig taugen. Ich werde Euch beiden folgen. Zeiget mir den Weg«. Kaum hatte er geendet, als die beiden Erscheinungen ineinanderflossen. Ulysses erkannte, daß er mit der großen Göttin Aphrodite gesprochen. Die Frau, welche den ersten Platz in dem vorliegenden Roman einnimmt, ist eine Courtisane des Alterthums. Zur Beruhigung des Lesers will ich sogleich hinzufügen: sie wird sich nicht bekehren.
Sie wird weder von einem Mönch, nach von einem Propheten, noch von einem Gott geliebt werden. In der Litteratur unserer Tage ist sie eine Originalität.
Sie wird sich als Buhlerin zeigen mit dem Freimuth, dem Eifer und auch mit dem Stolze jedes menschlichen Wesens, welches einen Beruf hat und in der Gesellschaft einen frei gewählten Platz einnimmt. Sie wird den Ehrgeiz haben, sich bis zum höchsten Punkte erheben zu wollen. Sie wird gar nicht auf den Gedanken kommen, daß ihr Leben einer Entschuldigung oder einer Verheimlichung bedürfe. Dies soll erklärt werden.
Die modernen Schriftsteller, die sich an ein Publikum gewendet haben, welches weniger voreingenommen ist als die jungen Mädchen und die jungen Normalschüler, haben sich bis zum heutigen Tage einer mühseligen List bedient, deren Heuchelei mir mißfällt. Sie sagen: »Ich habe die Wollust so geschildert wie sie ist, um die Tugend umso höher zu stellen.« Ich verschmähe es rundweg, an der Spitze eines Romans, dessen Handlung sich in Alexandrien abspielt, mich eines solchen Anachronismus zu bedienen.
Die Liebe mit allen ihren Folgen war für die Griechen das tugendhafteste Gefühl, am fruchtbarsten an großen Thaten. Sie verbanden mit ihr niemals jene Ideen von Unzüchtigkeit und Unbescheidenheit, welche die jüdische Überlieferung mit der christlichen Lehre unter uns gebracht hat. Herodot (I, 10) sagt uns ganz einfach: »Bei einigen barbarischen Völkern ist es eine Schande nackt zu erscheinen.« Wenn die Griechen oder die Lateiner einen Mann beschimpfen wollten, welcher mit Freudendirnen Umgang hatte, nannten sie ihn »Maechus«, was Ehebrecher heißt. Wenn ein Mann und eine Frau, die durch kein anderes Band mit einander verknüpft waren, sich vereinigten, – und selbst wenn es öffentlich geschah und ohne Rücksicht auf ihre Jugend – so ließ man sie ungestört, als Leute, die ja Niemandem schadeten.
Wie man sieht, darf das Leben der Alten nicht nach jenen moralischen Ideen beurtheilt werden, die uns heutzutage aus Genf übermittelt werden.
Ich habe dieses Buch mit jener Einfachheit geschrieben, mit welcher ein Athener ähnliche Begebenheiten erzählt haben würde. Ich wünsche, daß man es in dem nämlichen Geiste lese.
Wollte man die alten Griechen nach den heute angenommenen Ideen beurtheilen, dann dürfte man keine einzige genaue Übersetzung ihrer größten Schriftsteller einem Schüler in die Hände geben. Wenn Herr Mounet-Sully seine Oedipus-Rolle ohne Streichungen spielen sollte, würde die Polizei die Aufführung untersagen. Hätte Herr Leconte de Lisle seine Theokrit-Übersetzung nicht vorsichtigerweise gesäubert, sie wäre am Tage des Erscheinens mit Beschlag belegt worden. Man hält Aristophanes für eine Ausnahme, allein wir besitzen bedeutende Bruchstücke von 1440 Komödien, geschrieben von 132 anderen griechischen Dichtern, deren einige, wie z. B. Alexis, Philetairos, Strattis, Euboulos, Cratinos uns wunderbare Verse hinterlassen haben, und noch hat Niemand es gewagt, diese ebenso herrliche wie unzüchtige Sammlung zu übersetzen.
Um die griechischen Sitten zu vertheidigen, zitirt man immer einige Philosophen, welche die geschlechtlichen Freuden tadelten. Allein, das heißt die Dinge verwirren. Diese wenigen Philosophen verpönten alle sinnlichen Ausschreitungen im Allgemeinen und machten keinen Unterschied zwischen den Ausschweifungen des Bettes und jenen der Tafel. Einer, der heute in einem Pariser Restaurant straflos ein Diner zu sechs Louis für sich allein bestellt, würde von ihnen ebenso strafbar befunden worden sein, wie ein Anderer, der auf offener Straße ein allzu intimes Rendezvous geben und für diese Handlung durch die in Geltung stehenden Gesetze zu einem Jahr Gefängniß verurtheilt werden würde. Übrigens wurden diese sittenstrengen Philosophen in der alten Welt als kranke und gefährliche Narren betrachtet, auf allen Schaubühnen verhöhnt, in den Straßen geprügelt; die Tyrannen zogen sie als Spaßmacher an ihren Hof, die Bürger verbannten sie, wenn sie sie nicht der Todesstrafe werth erachteten.
Es ist demnach eine bewußte und willkürliche Täuschung, wenn die modernen Erzieher, von der Renaissance angefangen bis auf den heutigen Tag, vorgeben, aus der antiken Moral die Eingebungen für ihre engbrüstigen Tugenden zu schöpfen. Wenn diese Moral groß war und in der That verdient, als Vorbild genommen und befolgt zu werden, so ist es deshalb, weil keine andere es besser verstanden hat, Recht und Unrecht nach dem Kriterium der Schönheit zu unterscheiden und das Recht zu verkünden, welches der Mensch besitzt, sein Glück innerhalb jener Schranken zu suchen, welche das gleiche Recht seiner Nebenmenschen ihm setzt und zu erklären, daß es unter dem Himmel nichts Heiligeres gibt als die physische Liebe und nichts Schöneres, als der menschliche Körper.
Das war die Moral jenes Volkes, welches die Akropolis erbaut hat; und wenn ich hinzufüge, daß diese Moral diejenige aller großen Geister geblieben, so wird dies nur ein Gemeinplatz sein, so sehr ist es erwiesen, daß die überlegenen Geister von Künstlern, Schriftstellern, Heerführern und Staatsmännern die erhabene Duldsamkeit dieser Moral niemals unerlaubt gefunden haben. Aristoteles beginnt sein Leben damit, daß er sein väterliches Erbtheil mit Buhlerinen vergeudet; Sapho gibt einem eigenen Laster den Namen; Caesar ist der »kahle Ehebrecher«; – Racine ist den Theaterdamen nicht abhold und Napoleon übt nichts weniger als die Enthaltsamkeit. Die Romane Mirabeau's, die griechischen Verse Chénier's, die Korrespondenz Diderot's und die Schriften Montesquieu's kommen an Kühnheit dem Werke eines Catullus gleich. Und Buffon, dieser sittenstrengste und frömmste aller französischen Autoren – durch welche Maxime hat er die Liebes-Intriguen angerathen? »Liebe! Warum bist du das Glück aller Wesen und das Unglück des Menschen? – Weil von dieser Leidenschaft die physische Seite allein gut ist, die moralische aber nichts taugt.«
— — — — —
Woher kommt das? und wie ist es zu erklären, daß trotz dem Umsturz der Ideen des Alterthums die große Sinnlichkeit der Griechen gleichsam ein Strahl auf den erleuchtetesten Stirnen geblieben ist?
Weil die Sinnlichkeit die mysteriöse aber nothwendige und schöpferische Bedingung der geistigen Entwicklung ist. Jene, welche die Forderungen des Fleisches nicht bis an ihre Grenze empfunden haben, sei es um sie zu lieben, sei es um ihnen zu fluchen, sind schon dadurch unfähig, die Forderungen des Geistes in ihrer vollen Ausdehnung zu begreifen. Gleichwie die Schönheit der Seele das ganze Antlitz erhellt, so vermag die Männlichkeit des Körpers allein das Gehirn zu befruchten; der schmählichste Schimpf, welchen Delacroix Männern zufügen konnte und welchen er thatsächlich den Verhöhnern eines Rubens und den Verleumdern eines Ingres zurief, war das furchtbare Wort: »Eunuchen!«
Ja noch mehr: es scheint, daß das Genie der Völker, wie dasjenige der Individuen, vor Allem sinnlich ist. Alle Städte, welche die Welt beherrscht haben, Babylon, Alexandrien, Athen, Rom, Venedig, Paris waren vermöge eines allgemeinen Gesetzes je ausschweifender desto mächtiger, gleichsam als wäre ihre Zügellosigkeit zu ihrem Glanze nothwendig gewesen. Jene Städte, wo der Gesetzgeber eine künstliche, engbrüstige und unfruchtbare Tugend einzuführen sich bemühte, sahen sich vom ersten Tage angefangen zu vollständigem Tode verurteilt. So war es mit Sparta, welches inmitten des wunderbarsten Aufschwunges des menschlichen Geistes, zwischen Corinth und Alexandrien, zwischen Syrakus und Milet uns keinen Dichter, keinen Maler, keinen Philosophen, keinen Geschichtsschreiber, keinen Gelehrten zurückgelassen, kaum den volksthümlichen Ruhm eines sonderbaren Helden, der sich mit dreihundert Männern in einem Gebirgspaß tödten ließ, ohne auch nur den Erfolg des Sieges für sich zu haben. Und darum können wir noch nach zweitausend Jahren die Nichtigkeit der spartanischen Tugend ermessend, nach der Ermahnung Renan's »den Boden verfluchen, wo diese Beherrscherin düsterer Irrthümer gestanden, und sie beschimpfen, weil sie nicht mehr ist.«
— — — — —
Werden wir jemals die Tage von Ephesus und Kyrene wiederkehren sehen? Ach, die moderne Welt geht in einer Überschwemmung des Häßlichen unter. Die Zivilisationen ziehen sich nach dem Norden zurück, in Nebel, Frost und Koth. Welche Nacht! Ein schwarz gekleidetes Volk treibt sich in den schmutzigen Straßen herum. Woran denkt es? Man weiß es nicht mehr. Aber unsere fünfundzwanzig Jahre frösteln in der Verbannung unter Greisen.
So möge denn wenigstens Jenen, die stets bedauern werden jene entzückte Jugend der Erde, die wir das antike Leben nennen, nicht gekannt zu haben, so möge ihnen wenigstens gestattet werden, kraft einer fruchtbaren Illusion jene Zeit von Neuem zu durchleben, wo die menschliche Nacktheit – die vollkommenste Form, die uns zu kennen und zu fassen gegönnt ist, da wir sie nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen glauben – sich unter den Zügen einer geheiligten Buhlerin enthüllen durfte, in Gegenwart von zwanzigtausend Pilgern, welche die Gestade von Eleusis bedeckten; jene Zeit, wo die sinnlichste Liebe, die göttliche Liebe, aus der wir geboren werden, ohne Schmutz, ohne Schande, ohne Sünde war; es möge ihnen gestattet sein, achtzehn barbarische, heuchlerische und häßliche Jahrhunderte zu vergessen, vom Sumpfe zur Quelle, zur ursprünglichen Schönheit zurückzukehren, den großen Tempel beim Klange der bezauberten Flöten wieder zu erbauen und den Heiligthümern des wahren Glaubens mit Begeisterung ihre Herzen zu weihen, die für immer der unsterblichen Aphrodite gehören.
Pierre Louÿs.
Erstes Buch
I. Chrysis
Der Länge nach auf der Brust dahingestreckt, mit vorgebeugten Ellenbogen und gespreizten Beinen, die Wange auf die Hand stützend, lag sie da und stach mit einer langen goldenen Nadel kleine, regelmäßig gestellte Löcher in ein Kopfkissen aus grüner Leinwand.
Seitdem sie – zwei Stunden nach des Tages Mitte – erwacht war, ganz erschöpft von dem allzu langen Schlafen, war sie allein auf dem zerwühlten Bette liegen geblieben, nur auf einer Seite durch die reiche Fülle ihrer Haare bedeckt.
Dieses Haar war glänzend und tief, weich wie das Fell eines Raubthiers, länger als Vogelschwingen, geschmeidig, unzählbar, belebt, voll Wärme. Es bedeckte den halben Rücken, breitete sich unter dem nackten Bauche aus und glänzte wieder bei den Knieen in schweren, rundlichen Locken. Das junge Weib war eingehüllt in dieses kostbare Vließ, dessen goldener Glanz fast metallisch war, weßhalb sie von den Hetären Alexandriens den Namen Chrysis (die Goldige) erhalten hatte.
Es waren nicht die glatten Haare der Syrierinen des Hofes, noch die gefärbten Haare der Asiatinen, noch auch die braunen und schwarzen Haare der Töchter Aegyptens. Es waren diejenigen einer arischen Rasse, der Galiläerinen, die jenseits der Sandwüste wohnten.
Chrysis. Sie liebte diesen Namen. Junge Leute, welche sie besuchten, nannten sie Chryse, wie Aphrodite, in den Versen, welche sie, früh morgens, mit Rosen umkränzt, an ihre Thür schrieben. Sie glaubte nicht an Aphrodite, aber sie sah sich gern mit der Göttin verglichen, und ging manchmal in den Tempel, um ihr, wie einer Freundin, Wohlgerüche und blaue Schleier zu schenken.
Sie war an den Ufern des Sees Genezareth geboren, im Lande der Sonne und des Schattens, wo der Oleander duftete. Ihre Mutter ging des Abends auf die Straße von Jeruschalaim und wartete auf die Reisenden und Kaufleute und gab sich ihnen auf dem Grase hin, inmitten der nächtlich-stillen Landschaft. Sie war eine in Galilaea wohlgelittene Frau. Die Priester wandten sich nicht ab von ihrer Pforte, denn sie war mildthätig und fromm; sie bezahlte stets die Opferlämmer und die Gnade des Herrn ruhte auf ihrem Hause. Als sie aber schwanger ward und ihre Schwangerschaft Aergerniß erregte (weil sie keinen Gatten hatte), sagte ein Mann, der im Rufe eines Wahrsagers stand, daß sie eine Tochter gebären würde, welche dereinst »den Reichthum und den Glauben eines Volkes« um ihren Hals tragen werde. Sie verstand nicht recht wie dies geschehen könnte, aber sie nannte ihr Kind Sarah, was hebräisch Fürstin heißt. Und dies brachte die Lästerzungen zum Schweigen.
Chrysis war dies stets verborgen geblieben, da der Wahrsager ihre Mutter gewarnt hatte, wie gefährlich es sei den Leuten die Prophezeiungen zu enthüllen, welche sich auf sie bezogen. Sie wußte nichts von ihrer Zukunft, weßhalb sie oft daran dachte. An ihre Kindheit erinnerte sie sich wenig und sie sprach auch nicht gern davon. Die einzige klare Empfindung, die sie davon behalten hatte, war die Furcht und die Langeweile, welche ihr Tag für Tag die ängstliche Beaufsichtigung ihrer Mutter verursachte. Es war ihr keine Freiheit gegönnt, und wenn die Stunde gekommen war, auf die Straße hinaus zu gehen, sperrte ihre Mutter sie für lange Stunden allein in ihre Kammer. Sie erinnerte sich auch des runden Fensters, von wo aus sie die Gewässer des Sees, die blauenden Felder, den durchsichtigen Himmel mit der klaren Luft des Landes Galilaea sah. Das Haus war von rosigem Flachs und von Tamarisken umgeben. Da und dort reckten Kapernstauden ihre grünen Köpfchen aus dem verschwimmenden Nebel der Wiesen empor. Die kleinen Mädchen badeten in einem klaren Bache und suchten rothe Muscheln unter blühenden Lorbeersträuchern; und Blumen blühten auf dem Wasser, Blumen auf den Wiesen und große Lilien auf den Bergen.
Sie war zwölf Jahre alt, als sie ihrer Mutter davonlief, um einer Schaar junger Reiter zu folgen, welche nach Tyrus zogen, um dort Elfenbein zu verkaufen. Bei einer Zisterne war sie ihnen begegnet. Sie schmückten langgeschwänzte Pferde mit farbigen Troddeln. Chrysis erinnerte sich wohl, wie sie, bleich vor Freude, von den Reitern auf ihren Rossen entführt wurde, wie sie sich dann ein zweites Mal in der Nacht aufhielten, eine Nacht, die so hell war, daß man keinen einzigen Stern sehen konnte.
Auch der Einzug in Tyrus war ihr im Gedächtniß geblieben: sie ritt voran auf dem Korbe eines Lastpferdes, sich mit den Fäusten an der Mähne festhaltend. Stolz ließ sie ihre nackten Beine hängen, um den Frauen der Stadt zu zeigen, daß ihre Waden mit Blut befleckt waren. Doch am selben Abend ging es weiter nach Aegypten und Chrysis folgte den Elfenbeinhändlern bis zum Markte Alexandriens.
Und dort hatten sie das Mädchen, zwei Monate später, in einem weißen Säulenhäuschen zurückgelassen, mit ihrem ehernen Spiegel, Teppichen und neuen Kissen, bedient von einer schönen indischen Sklavin, welche es verstand Hetären zu kämmen. Andere Männer waren am Tage ihres Abzuges gekommen und wieder andere am nächsten Tage.
Da sie im äußersten Osten der Stadt wohnte, wo die jungen Griechen des Brouchion-Stadttheiles zu erscheinen verschmähten, kannte sie lange, ebenso wie ihre Mutter, nur Reisende und Kaufleute. Ihre vorübergehenden Liebhaber sah sie niemals wieder. Sie verstand es, ihnen zu gefallen und sie schnell wieder zu verlassen, bevor sie anfing sie zu lieben. Und doch hatte sie unendliche Leidenschaften entflammt. Man hatte Führer von Karavanen gesehen, welche zu Spottpreisen ihre Waaren verschleuderten, um sich dort aufzuhalten wo sie weilte und in wenigen Nächten ihr Hab und Gut zu vergeuden. Mit dem Vermögen dieser Männer hatte sie sich Schmuck, Bettkissen, seltene Wohlgerüche, blumengestickte Gewänder und vier Sklavinen gekauft.
Sie hatte allmälig viele fremde Sprachen erlernt und sie kannte Märchen aus allen Ländern. Assyrer hatten ihr von der Liebe zwischen Duzi und Ischtar erzählt. Phoenizier von derjenigen zwischen Aschthoreth und Adoni. Griechische Mädchen aus den Inseln hatten ihr die Legende von Iphis erzählt und sie in sonderbaren Liebkosungen unterwiesen, Liebkosungen, welche sie zuerst verwundert und dann in solchem Maße bezaubert hatten, daß sie dieselben nicht mehr einen ganzen Tag hindurch entbehren konnte. Sie kannte auch die Liebesweise Atalantés und wie, nach ihrem Beispiele noch jungfräuliche Flötenspielerinen die stärksten Männer schwächen konnten. Endlich hatte ihre indische Sklavin ihr geduldig, während sieben Jahre, die verwickelte und wollüstige Kunst der Courtisanen von Palibothra, bis in die letzten Einzelheiten gelehrt.
Denn die Liebe ist eine Kunst wie die Musik. Sie verursacht Gemüthsbewegungen gleicher Art, ebenso zart und vibrirend, manchmal vielleicht sogar intensiver; und Chrysis, die alle Rhythmen und alle Feinheiten derselben kannte, hielt sich mit Recht für eine größere Künstlerin als Plango selbst, welche doch Tonkünstlerin des Tempels war.
Sieben Jahre hindurch lebte sie so, ohne ein glücklicheres oder vergnügteres Dasein zu träumen, als das ihrige. Kurze Zeit jedoch vor ihrem zwanzigsten Jahre, als aus dem jungen Mädchen ein Weib wurde und sie unter ihren Brüsten die erste dünne Falte der nahen Reife sah, bekam sie mit einem Male ehrgeizige Pläne.
Und eines Morgens, als sie, zwei Stunden nach des Tages Mitte erwachte, ganz erschöpft von dem allzu langen Schlafe, legte sie sich auf die Brust, quer über das Bett, spreizte die Beine, stützte die Wange auf die Hand und stach, mit einer goldenen Nadel, kleine, regelmäßig gestellte Löcher in ein Kopfkissen aus grüner Leinwand.
Sie war tief in ihre Gedanken versunken.
Zuerst stach sie vier kleine Punkte, welche ein Viereck bildeten, und einen Punkt in der Mitte. Dann vier weitere Punkte, um ein größeres Viereck zu zeichnen. Dann versuchte sie einen Kreis auszuführen. Aber es war ein bischen schwierig. Nun stach sie die Punkte aufs Geradewohl und begann zu rufen:
»Djala! Djala!«
Djala war ihre indische Sklavin, welche Djalantaschtschandratschapala hieß, was »Beweglich-wie-das-Bild-des-Mondes-auf-dem-Wasser« bedeutet. Chrysis war zu träge, um den Namen ganz auszusprechen.
Die Sklavin trat ein und blieb bei der Thür stehen, ohne sie ganz zu schließen.
– Djala, wer ist gestern gekommen?
– Weißt Du es denn nicht?
– Nein, ich habe ihn nicht angeschaut. War er schön? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit geschlafen; ich war so müde. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Um wie viel Uhr ist er weggegangen? Früh am Morgen?
– Bei Sonnenaufgang, er hat gesagt...
– Was hat er zurückgelassen? Ist es viel? Nein, sage es mir nicht. Es ist mir gleichgültig. Was hat er gesagt? Und seitdem er fort, ist Niemand gekommen? Wird er wiederkehren? Gib mir meine Armspangen!
Die Sklavin brachte ein Kästchen, aber Chrysis warf keinen Blick darauf. Die Arme so hoch als nur möglich emporhebend sagte sie:
– Ach Djala! Ach, Djala! ... Ich verlange nach außerordentlichen Abenteuern.
– Alles ist außerordentlich oder Nichts, sagte Djala. Die Tage gleichen einander.
– Ach nein. Früher war es nicht so. In allen Ländern der Welt sind die Götter zur Erde herabgestiegen und haben sterbliche Weiber geliebt. Ach, auf welchen Betten muß man sie erwarten, in welchen Wäldern muß man sie suchen. Jene, die etwas mehr als Männer sind? Welche Gebete muß man hersagen, damit sie nahen, Diejenigen, die mich etwas lehren oder Alles vergessen lassen würden? Und wenn die Götter nicht mehr herniedersteigen wollen, wenn sie todt oder zu alt sind, Djala, werde ich auch sterben, ohne einen Mann gesehen zu haben, der tragische Erlebnisse in mein Dasein bringen würde?
Sie drehte sich um und legte sich auf den Rücken, wobei sie verzweifelt die Hände rang.
– Wenn Jemand mich anbetete, würde es mir eine so große Freude machen, ihn leiden zu lassen, bis er stürbe. Diejenigen, welche zu mir kommen, sind es nicht werth beweint zu werden. Und dann ist es ja auch meine Schuld: ich selbst rufe sie, wie könnten sie mich lieben?
– Welches Armband legst Du heute an?
– Alle. Aber laß mich. Ich brauche Niemanden. Bleibe auf der Schwelle des Hauses, und wenn Jemand kommt, sage ihm, ich sei mit meinem Geliebten, einem schwarzen Sklaven, den ich bezahle ... Geh!
– Willst Du nicht ausgehen?
– Doch. Ich werde allein ausgehen. Ich werde mich allein ankleiden. Ich werde nicht nach Hause kommen. Geh! geh!
Sie ließ ein Bein auf den Teppich gleiten und streckte sich, bis sie aufgerichtet war. Djala war leise hinausgegangen.
Sie ging sehr langsam durch das Zimmer, die Hände auf dem Nacken gefaltet, ganz von der Wollust durchdrungen ihre nackten Füße auf die kalten Steinplatten zu setzen, wo der Schweiß erstarrte. Dann stieg sie in ihr Bad.
Für sie war es ein Genuß, ihren Körper durch das Wasser hindurch zu betrachten. Wie eine große Muschelschale, die offen auf einem Felsen klebt, kam sie sich vor. Ihre Haut wurde glatt und vollkommen; die Linien ihrer Beine dehnten sich in einem blauen Lichte aus; ihre ganze Gestalt war biegsamer; sie erkannte ihre Hände nicht wieder. Die Leichtigkeit ihres Körpers war so groß, daß sie sich auf zwei Fingern in die Höhe heben konnte. So hielt sie sich eine Weile auf dem Wasser, um dann leicht auf den Marmor zurückzufallen, wobei das Wasser ihr Kinn berührte. Mit dem neckischen Kitzel eines Kusses drang das Wasser in ihre Ohren.
Zur Badezeit begann bei Chrysis die Selbstanbetung. Alle Theile ihres Körpers wurden, einer nach dem anderen, der Gegenstand einer zarten Bewunderung oder einer Liebkosung. Mit ihren Haaren und ihren Brüsten gab sie sich tausend reizenden Spielen hin. Manchmal gewährte sie sogar ihren beständigen Begierden eine wirksamere Dienstfertigkeit und keine Ruhestätte schien ihr für die berechnete Langsamkeit dieser delicaten Befriedigung besser geeignet.
Der Tag neigte sich zu Ende; Chrysis richtete sich in ihrem Becken empor, stieg aus dem Wasser und schritt der Thüre zu. Die Spuren ihrer Schritte glänzten auf den Fliesen. Schwankend, gleichsam erschöpft, öffnete sie die Thür, und blieb da stehen, den Arm nach der Klinke ausgestreckt; dann, als Djala sie gesehen, trat sie bis zu ihrem Bette zurück und sagte zu ihrer Sklavin:
– Trockne mich ab!
Die Malabareserin nahm einen großen Schwamm zur Hand und führte ihn durch Chrysis feines Goldhaar, das ganz vom Wasser getränkt war, welches nach hinten abtropfte. Sie trocknete die Haare, streute sie auseinander, bewegte sie langsam und weich; dann tauchte sie den Schwamm in einen Oelkrug, bestrich damit ihre Herrin bis zum Halse und rieb sie endlich mit einem groben Stoffe, der ihre geschmeidige Haut röthete.
Chrysis versenkte sich fröstelnd in die Kühle eines Marmorsitzes und murmelte:
– Kämme mich.
Im horizontal einfallenden Abendlichte glänzte das noch feuchte und schwere Haar wie ein von der Sonne beleuchteter Regenguß. Die Sklavin ergriff es mit vollen Händen und rang es aus. Sie drehte es um sich selbst, als sei es eine dicke Metallschlange, die von Goldnadeln wie von Pfeilen durchstochen war. Dann wand sie grüne Bändchen dreimal gekreuzt um das Haar, um dessen Glanz durch die Seide noch zu erhöhen. Chrysis hielt einen blanken Metallspiegel in einiger Entfernung vor sich hin. Zerstreut betrachtete sie die dunkeln Hände der Sklavin, wie sie sich in der Ueppigkeit der Haare bewegten, hie und da die Büsche abrundend, die ungeberdigen Locken verbergend, das Haar in Formen modellierend, wie man eine Thonmasse bearbeitet. Als Alles vollendet war, kniete Djala vor ihrer Herrin hin und rasierte ihren schwellenden Schamberg glatt, damit das Mädchen in den Augen ihrer Geliebten die volle Reinheit und Glätte einer Statue habe.
Chrysis wurde ernster und sagte mit leiser Stimme:
– Schminke mich.
Eine kleine Büchse aus rosarothem Holze, welche von der Insel Discorides kam, enthielt Schminken in allen Farben. Mit einem Pinsel aus Kameelhaar nahm die Sklavin ein wenig von einer schwarzen Masse und bestrich damit die schönen, lang gebogenen Augenwimpern, um die blaue Farbe der Augen hervorzuheben. Durch zwei feste Striche bekamen diese Augen eine längere und weichere Gestalt; ein bläuliches Pulver verdunkelte die Augenlider; zwei zinoberrothe Flecken verschärften die Winkel, wo sich die Thränen zuerst zeigen. Um die Schminke festzuhalten, mußten Gesicht und Brust mit einer frischen Wachssalbe bestrichen werden; mit dem weichen Flaum einer Feder, welchen sie in Bleiweiß tauchte, malte Djala weiße Striche die Arme entlang und auf dem Halse; mit einem in Carmin getauchten Pinsel wurden der Mund und die Spitzen der Brüste roth gefärbt; ihre Finger, welche auf den Wangen eine leichte Wolke rothen Pulvers verbreitet hatten, markierten auf den Seiten die drei tiefen Falten der Taille und am Hintertheile zwei bewegliche Grübchen; endlich färbte sie mit einem geschminktem Lederballen die Ellbogen und die zehn Fingernägel. Die Toilette war beendet.
Dann lächelte Chrysis und sagte zur Indierin:
– Singe mir etwas.
Zurückgebeugt saß sie in ihrem Marmorsessel. Ihre Nadeln standen wie Goldstrahlen hinter ihrem Kopfe. Ihre Hände waren an die Brust gedrückt und breiteten zwischen den Schultern das rothe Halsband ihrer bemalten Nägel aus; ihre weißen Füße standen eng nebeneinander auf der Steinplatte.
Djala, die an der Wand zusammengekauert saß, erinnerte sich an die Liebesgesänge Indiens:
– Chrysis ...
Sie sang mit eintöniger Stimme.
– Chrysis, Deine Haare sind wie ein Bienenschwarm, der an einem Baume hängt. Der Südwind durchdringt sie mit dem Thau der Liebeskämpfe und mit dem feuchten Wohlgeruch der Nachtblumen.
Das Mädchen antwortete mit noch milderer und langsamerer Stimme:
– Meine Haare sind wie ein unendlicher Fluß in der Ebene, wo die flammende Abendsonne dahinfließt.
Sie sangen abwechselnd, die Eine nach der Andern.
*
– Deine Augen sind wie die blauen Wasserlilien ohne Stengel, unbeweglich auf den Teichen.
– Meine Augen sind im Schatten meiner Augenwimpern, wie tiefe Seen unter dunklen Zweigen.
*
– Deine Lippen sind zwei zarte Blumen, auf welche das Blut einer Hirschkuh gefallen ist.
– Meine Lippen sind die Ränder einer brennenden Wunde.
*
– Deine Zunge ist der blutige Dolch, der deinen Mund gespaltet hat.
– Meine Zunge ist mit Edelsteinen besetzt. Vom Widerscheine meiner Lippen ist sie roth.
*
– Deine Arme sind gerundet wie zwei Elfenbeinzähne und deine Achselhöhlen wie zwei Mündchen.
– Meine Arme sind langgestreckt, wie zwei Lilienstengel, woran meine Finger schimmern, gleich fünf Blumenblättern.
*
– Deine Schenkel sind die Rüssel zweier weißen Elephanten und sie tragen Füße gleich zwei rothen Blumen.
– Meine Füße sind zwei Seerosenblätter auf dem Wasser, meine Schenkel sind zwei geschwellte Seerosenknospen.
*
– Deine Brüste sind zwei silberne Schilder, deren Spitzen in Blut getaucht wurden.
– Meine Brüste sind der Mond und der Widerschein des Mondes im Wasser.
*
– Dein Nabel ist ein tiefer Brunnen in einer Wüste voll rosigen Sandes, und dein Unterleib ein junges Zicklein im Schoße der Mutter.
– Mein Nabel ist eine runde Perle auf einer umgestürzten Schale und mein Schoß ist die helle Sichel Phöbes, die durch den Wald schimmert.
*
Es entstand eine Stille. – Die Sklavin hob die Hände empor und verbeugte sich.
Die Hetäre fuhr fort:
»SIE ist wie eine Purpurblume, voll Honig und Wohlgerüche.
»Sie ist wie die Hydra des Meeres, lebendig und weich, offen des Nachts.
»Sie ist die feuchte Grotte, die stets warme Lagerstätte, das Obdach, wo der Mann ausruht auf seinem Gang zum Tode.«
Die niedergebeugte Sklavin murmelte ganz leise:
»Sie ist furchtbar. Es ist das Gesicht der Medusa.«
— — — — —
Chrysis setzte ihren Fuß auf den Nacken der Sklavin und sagte zitternd:
»Djala...«
— — — — —
Nach und nach war die Nacht herangebrochen; aber der Mond war so hell, daß sich das Gemach mit blauem Lichte füllte.
Chrysis saß nackt da und betrachtete ihren Leib, wo die Lichtreflexe unbeweglich standen und die Schatten tiefschwarz herabfielen.
Plötzlich stand sie auf:
»Djala, an was denken wir? Es ist Nacht und ich bin noch nicht ausgegangen. Ich werde auf dem Heptastadion1 nur noch schlafende Matrosen finden. Sage mir, Djala, bin ich schön?
»Sage mir Djala, bin ich diese Nacht schöner als je? Ich bin die schönste aller Frauen Alexandriens, Du weißt es? Nicht wahr, er wird mir folgen wie ein Hund, derjenige, der jetzt vor dem schiefen Blick meiner Augen vorbei gehen wird? Nicht wahr, ich werde aus ihm machen können, was mir gefällt, einen Sklaven, wenn dies meine Laune ist? und ich kann von dem ersten Besten den ergebensten Gehorsam erwarten? Kleide mich an, Djala.«
Um ihre Arme wanden sich zwei Silberschlangen. An ihre Füße wurden Sandalen geheftet, welche um ihre braunen Beine mit gekreuzten Lederriemen gebunden waren. Sie schnallte um ihren Bauch einen Jungferngürtel, welcher von der Höhe der Hüfte, der hohlen Linie der Leisten entlang, herunterfiel; in ihre Ohren heftete sie runde Reife, an ihre Finger steckte sie Ringe und Siegel; um ihren Hals legte sie drei Halsketten von goldenen Phallos2, welche in Paphos durch Hierodulen ziselirt worden waren.
Sie betrachtete sich einige Zeit, wie sie so nackt da stand, inmitten ihres Schmuckes; dann zog sie aus einem Koffer – wo es zusammengefaltet lag – ein großes Stück durchsichtiger gelber Leinwand, sie drehte es herum und wickelte sich hinein, daß es bis zum Boden reichte. Diagonale Falten durchfurchten den kleinen Theil ihres Körpers, den man durch das leichte Gewebe hindurch sah; einer ihrer Ellenbogen trat unter der eng anhaftenden Tunika hervor, und der andere Arm, den sie nackt gelassen hatte, hielt die lange Schleppe in die Höhe, damit sie nicht im Staub geschleift werde.
Sie nahm ihren Federfächer zur Hand und trat nachläßig hinaus.
Auf der Thürschwelle stehend, die Hand an die weiße Wand gelehnt, sah Djala allein der sich entfernenden Hetäre nach.
Langsam schritt diese vorwärts, den Häusern entlang, in der öden Straße, die das Mondlicht beleuchtete. Ein kleiner, beweglicher Schatten zitterte hinter ihren Schritten.
1. Auf dem sieben Stadien langen Kai.
2. Männliches Zeugungsglied
II. Am Strande Alexandriens
Am Strande Alexandriens stand ein Mädchen und sang. Neben ihr saßen zwei Flötenspielerinen auf der weißen Brüstung.
I.
Die Satyren haben in den Wäldern Die leichte Spur der Orcaden verfolgt. Sie haben den Bergnymphen nachgejagt Ihre dunkeln Augen erschreckt, Ihre lang flatternden Haare ergriffen, Ihre Jungfrauenbrüste im Laufe gefaßt, Ihre warmen Körper zurückgelehnt, Auf den feuchten Rasen hingestreckt, Und die schönen Körper, die schönen halbgöttlichen Körper Streckten und reckten sich im Schmerze. Eure Lippen, ihr Frauen, preisen Eros In leidvoll süßem Verlangen.
*
Die Flötenspielerinen wiederholten:
»Eros!« – Eros!«
und ihre Klagen schluchzten im doppelten Schilfrohr.
II.
Kybele hat durch die Ebene Attys, schön wie Apoll verfolgt. Eros hatte sie in's Herz getroffen, und für ihn, O weh! aber nicht für sie. Um geliebt zu werden, grausamer Gott, böser Eros, Ist nur der Haß, was Du anräthst... Durch die Wiesen und die weiten, fernen Felder Hat Kybele dem Attys nachgejagt, Und weil sie den liebte, der sie verschmäht', Hat sie in seine Adern den mächt'gen Hauch, Den kalten, den Hauch des Todes geblasen. Oh schmerzhaft-süßes Verlangen!
*
»Eros! – Eros!«
Den Flöten entstiegen schrille Töne.
III.
Der Satyr hat bis zum Flusse Syrinx, die Tochter der Quelle verfolgt. Der bleiche Eros, der den Geschmack der Thränen liebt, Küßt sie im Fluge, Wange gegen Wange: