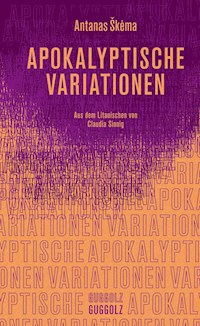
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Guggolz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Antanas Škėma (1910–1961) arbeitete sein ganzes Leben daran, das von ihm Durchlebte in Literatur zu verwandeln. Sein einziger Roman, "Das weiße Leintuch", gibt Zeugnis von seinem New Yorker Exil. Daneben sind aus allen Phasen seines Lebens literarische Stücke überliefert: Erzählungen, Skizzen, Szenen und Verdichtungen. Es sind in Blickwinkel und literarischer Gestaltung einzigartige Schlüsselszenen der Weltgeschichte: die Kindheit während des Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs in der russischen und ukrainischen Provinz, Schulzeit und Studium, frühe literarische Versuche im unabhängigen Zwischenkriegslitauen sowie unter sowjetischer und deutscher Besatzung, die dramatische Flucht vor den Sowjets, das Leben als displaced person in Thüringen und Bayern und als Neuankömmling in Chicago und New York. All das spiegelt sich in facettenreichen Prosastücken. "Apokalyptische Variationen" umspielt die Verheerungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts und den Riss, der die Existenzen durchzieht. Schreibend vergewissert sich Škėma seiner Biografie und versucht Sinn und Bedeutung in ihren Splittern aufzuspüren. Wir können lesend nachvollziehen, wie sich die Aussichtslosigkeit in seine Sprache einschreibt, wie diese immer mehr zerspringt, sich auflöst – und wie aus der sprachlichen Entgrenzung eine ganz neue Form entsteht. Claudia Sinnig greift in ihrer Übersetzung die Vielfalt von Škėmas Erzählstilen auf, schürft tief im Sprachmaterial, lotet Trauer und Dunkelheit aus und geht auch der Hoffnung und dem Vorwärtsstreben auf den Grund. Erlösung findet sich vielleicht nicht in Škėmas Leben, aber in seiner Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antanas Škėma
APOKALYPTISCHEVARIATIONEN
Aus dem Litauischenund mit einem Nachwortvon Claudia Sinnig
INHALT
ANGST
FORT
SCHWELBRÄNDE UND FUNKEN
DIE STILLE DER NACHT
DER EGOIST
DER KALENDER
DIE BIRKE UND DER MENSCH
IN DEN BERGEN
GEFANGEN
DAS KLEID
IM KRANKENHAUS
DAS LÄCHELN
HINTER DER MEMEL
DIE HEILIGE INGA
SONNENTAGE
DER GLÄSERNE MENSCH
DAS KARUSSELL
IŠA-AK
MURKSA
DIE VERDAMPFTE APRIKOSE
DER WEG ZUR STRASSE
SALTO MORTALE
ROMANTISCHES FINALE
ÜBER DIE EISENBAHN
DER WAGGON DES ZAREN
ALTER POSTWEG 16
APOKALYPTISCHE VARIATIONEN
CELESTA
HOLOFERNES
SCHRITTE UND STUFEN
HEIMWEH
DER SPAZIERGANG
ŽIIILVINAS
FREITAG
DIE FEUERWEHR KOMMT
IM ANFANG WAREN ZWEI
DIE BEGLEITER
DER GESANG
DAS MEER
DIE MADONNA
ANTANAS ŠKĖMA WIRD 40
ANHANG
EDITORISCHE NOTIZ
ANMERKUNGEN
NACHWORT DER ÜBERSETZERIN
ANGST
Zum ersten Mal bin ich ihm in einem Kaunaser Café begegnet, das ich an einem kalten, regnerischen Herbstabend aufsuchte. Die kleinen Tische waren alle besetzt. Da entdeckte ich in einer Ecke ein Tischchen, an dem ein einzelner Mann saß. Ich ging hin und fragte: »Darf ich?« Tiefe melancholische Augen sahen mich an … »Bitte.« Ich setzte mich. Bestellte eine Tasse Kaffee. Mein Blick schweifte durch den vollen Raum, blieb eine Weile bei den Musikern auf der Bühne und schließlich an meinem Tischnachbarn hängen. Ein Mann von dreißig bis fünfunddreißig Jahren. Ebenmäßiges Gesicht mit scharfen Zügen, klassisch gerade Nase, schöne hohe Stirn mit tiefen Falten, nach hinten gekämmtes schwarzes Haar, aber seine Augen … Ich habe das Glück, viele schöne, ja sogar wunderbare Augen von Frauen gesehen zu haben, doch solche Männeraugen begegneten mir zum ersten Mal. Sie sahen ganz dunkel aus in dem trüben elektrischen Licht, obwohl sie es in Wirklichkeit vermutlich nicht waren. Ihr Blick drang gleichsam durch die Menschen in dem Café, durch das nichtssagende Bild an der Wand und auch durch die Wand hindurch. Es hatte den Anschein, als würden seine Augen sehen, was hinter der Wand vorging. Sie verströmten eine ruhige und zugleich bittere Niedergeschlagenheit. Da ich mir die Augen des Unbekannten genauer ansehen wollte, bat ich ihn um Streichhölzer für meine Papirossa. Sein an die Wand des Cafés gehefteter Blick glitt ab, er schien zu verlöschen und blieb dann an mir hängen. Jetzt sahen mich andere farblose, aber noch genauso traurige Augen an. »Verzeihen Sie, ich habe nicht gehört, was Sie gesagt haben.« Ich wiederholte meine Bitte. Er holte ohne Eile aus seiner Tasche Streichhölzer hervor, entzündete eines und gab mir Feuer. Ich bedankte mich. »Bitte«, klang es traurig. Und dann richtete sich sein Blick wieder auf die Wand des Cafés. Plötzlich, als sei ihm etwas eingefallen, schärften sich seine Gesichtszüge, auf seiner Stirn erschienen neue Falten und seine Pupillen erweiterten sich. Seine Haltung, die bis dahin ruhig, wie erstarrt, gewesen war, veränderte sich. Sein ganzer Körper spannte sich nervös an und geriet krampfartig in Bewegung. Er sprang von seinem Platz auf, rannte fast zur Theke, warf einige Münzen hin und verschwand durch die Tür des Cafés. ›Seltsamer Typ‹, dachte ich und konnte den ganzen Abend sein eindrückliches Gesicht mit den trübsinnigen Augen nicht vergessen.
Zum zweiten Mal sah ich ihn in einem Kino. Die Vorstellung hatte bereits begonnen, es war dunkel im Saal. Ich hatte mich auf den ersten besten Platz gesetzt. Als das Licht anging, schaute ich mich in dem vollen Zuschauerraum um. Da entdeckte ich links von mir im Profil sein bekanntes Gesicht. ›Das ist dieser Typ aus dem Café‹, dachte ich. Sein Blick war, wie im Café, auf gar nichts gerichtet, sondern verlor sich irgendwo in der Tiefe des Saals. Plötzlich schien er zu spüren, dass ich ihn anstarrte, er wandte sich träge zu mir um, und sein melancholischer und ein bisschen spöttischer Blick begegnete meinem. Fast unmerklich bewegten sich seine Mundwinkel. ›Wahrscheinlich hat er mich erkannt‹, dachte ich und war – ich weiß selbst nicht, warum – erfreut. Das Licht verlosch wieder, es begann der nächste Akt. Der Film war langweilig. Ein abgedroschener amerikanischer Western. Ich schaute zu ihm hinüber. Obwohl es ziemlich dunkel war, konnte ich die Konturen seiner ausgeprägten Gesichtszüge erkennen. Mitten im Film begann er, sich im Zuschauerraum umzusehen, er zuckte ähnlich wie beim letzten Mal zusammen, setzte sich mit einer schnellen Handbewegung den Hut auf und verließ gebeugt den Saal. In mir erwachte die Neugier. Ich erhob mich von meinem Platz und ging hinaus auf die glitzernde Freiheitsallee. Er lief quer über die Straße. Langsam, in einiger Entfernung, folgte ich ihm. Nachdem wir die Freiheitsallee überquert hatten, bogen wir in die Gediminasstraße ein. Er bewegte sich mit großen Schritten voran und wankte dabei leicht. Plötzlich blieb er, wie vom Blitz getroffen, stehen. Auf der Straße waren fast keine Leute. Sofort verbarg ich mich im Schatten eines Hauseingangs. Er stand etwa zwanzig Schritte von mir entfernt, und ich konnte deutlich sein bleiches Gesicht mit diesem seltsamen Ausdruck sehen, den ich im Café bemerkt hatte. Mit weit aufgerissenen Augen schaute er sich auf der Straße um. Ein Autobus kam mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Er gab ihm kein Zeichen anzuhalten, stürzte direkt auf ihn zu und sprang auf. Kurz darauf verschwand der Bus in einer Abbiegung. Ich ging zurück zur Freiheitsallee. Lange habe ich mir den Kopf über diese beiden Begegnungen zerbrochen und das Gesicht dieses seltsamen Unbekannten mit den traurigen, ein bisschen ironischen Augen nicht vergessen können.
Einige Monate vergingen. Es war ein schöner Frühlingsabend. Die Uhr am Militärmuseum schlug acht. Das Dong, Dong, Dong, Dong … hing feierlich in der Luft. Ein Invaliden-Orchester spielte einen traurigen Walzer, die Melodie ging unter die Haut. Dong, tönte es zum letzten Mal und verging in der linden Abendluft. Die Akkorde der Musik wurden eindringlicher und strenger. Hier und da spazierten Pärchen umher, glücklich mit sich und diesem Abend. Es wurde dunkel. Ich erhob mich von meiner Bank und ging zum Ausgang des Museumsgartens. Auf der gegenüberliegenden Seite der Donelaitisstraße lief wankend ein Mann. ›Wahrscheinlich ein Betrunkener‹, dachte ich. Da fiel das Licht der elektrischen Straßenlaterne auf sein Gesicht. Er war es! Doch wie sehr er sich verändert hatte! Seine ausgeprägten Gesichtszüge waren ganz kantig geworden. Er sah aus, als hätte er eine schwere Krankheit durchgemacht. Sein Haar war nicht mehr sorgfältig nach hinten gekämmt, sondern hing wirr herunter. Seine eingesunkenen Augen blickten nicht mehr traurig und ein wenig spöttisch drein wie damals. Sie waren durch ihre Dunkelheit und ihren Ausdruck furchterregend. Ihr Blick irrte unstet und suchend umher. Der Mann stützte sich schwerfällig auf das Geländer an einem Schaufenster. Sein offener Mund schnappte gierig nach Luft. Ich weiß nicht, welches Gefühl mich trieb, über die Straße zu rennen, ihn am Arm zu packen und zu fragen: »Ist Ihnen nicht gut?« Er sah mich mit einem schweren, nachdenklichen Blick an. »Ach, Sie sind es«, sagte er ohne jedes Erstaunen. »Ja, ich fühle mich ein bisschen schwach.« Ich schaute mich um. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen Bänke für Spaziergänger. »Gehen wir dort hinüber, dort können wir uns setzen. Halten Sie sich an mir fest, ich werde Ihnen helfen.« Ich nahm ihn am Arm, führte ihn über die Straße und setzte ihn auf die Bank. »Danke«, sagte er und senkte den Kopf. Ich schwieg und überlegte, was ich sagen könnte. Plötzlich hob er den Kopf, starrte mich mit seinen großen Augen an, die jetzt seltsam funkelten, und begann hastig und unablässig mit gesenkter Stimme zu sprechen.
»Vermutlich werden Sie mich nicht verstehen und sich über das wundern, was Sie jetzt hören. Aber das ist mir egal. Ich kann es nicht länger ertragen. Ich kann mit dieser Benommenheit nicht leben. Angst, Angst und noch mal Angst. Sonst nichts.« Seine Pupillen wurden noch weiter. In ihnen stand Schrecken. »Hören Sie! Damals, in dem Café und im Kino, habe ich gesehen, dass Sie mich mit Mitgefühl betrachten. Die anderen Menschen sind so kalt, so egoistisch. Vielleicht sind Sie ja imstande, mich zu verstehen. Ich quäle mich schon seit zwei Jahren so. Früher war ich nicht anders als alle Menschen. Doch dann begann mich diese Angst zu verfolgen. Warum, das weiß ich nicht. Mir scheint, ich habe nichts Besonderes erlebt. Aber ich fühle, dass die Angst mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Sie taucht plötzlich auf, wenn ich sie überhaupt nicht erwarte. Ganz gleich, ob ich allein oder in Gesellschaft bin. Ich laufe vor ihr davon, dorthin, wo viele Menschen sind und Lärm. Anfangs ging es mir dann besser. Inzwischen findet sie mich aber auch dort. Ich fühle, wie sie sich mir nähert, ihre unbezwingbare Macht … Der Schrecken hat in meiner Seele die Oberhand gewonnen. Menschen, Häuser – alles verschwindet in einem Dunst. Und er wird immer größer, der Schrecken. Meine ganze Seele zittert vor dieser unverständlichen Angst. Ich laufe davon – ich weiß selbst nicht wohin. Ich kann ihr nicht entfliehen. Ich habe verschiedene Ärzte aufgesucht. ›Ihre Nerven sind geschwächt. Sie müssen sich erholen, ans Meer fahren …‹, sagen sie meistens. Aber ich weiß, dass ich diese Angst selbst am stillsten Ort der Welt nicht abschütteln könnte.« Er stöhnte. Er tat mir leid. »Beruhigen Sie sich, ich habe etwas Ähnliches erlebt«, sagte ich, weil ich ihn beschwichtigen wollte. »Ja? Dann werden Sie mich verstehen! Wissen Sie, ich kann niemals ruhig einschlafen. Wenn ich mich ins Bett lege, fühle ich, dass sie mich belauert. Ich verkrieche mich unter der Decke und habe Angst, ins Dunkel meines Zimmers zu schauen. Mir kommt es so vor, als würde ich, wenn ich in die Tiefe des Zimmers blickte, etwas unvorstellbar Schreckliches zu Gesicht bekommen. Es vergehen eine, zwei, drei Stunden, und ich liege da mit der Angst im Herzen, bis ich endlich einschlafe. Und so geht es jede Nacht. Jeden Tag. Wird das jemals aufhören?!« Er sprang von der Bank auf, packte mich an den Schultern und sah mir mit stechendem Blick in die Augen. Ich stand auf. Etwa zwei Sekunden lang schauten wir einander an. Dann ließ er mich los, murmelte irgendetwas in sich hinein und verschwand in der Abenddämmerung.
Ich habe ihn nie wieder gesehen.
[1929]
FORT
Heimweh ist eine chronische Krankheit. Thüringens blaue Wälder können sie nicht heilen. In Friedenszeiten würdest du vielleicht zwischen den hochstämmigen Kiefern umherwandern, sacht die rötlichen Felsbrocken berühren und mit weiten Lungen die Luft, die wunderbare Luft des atmenden Waldes einsaugen. Und dann würdest du dich im Moos ausstrecken, und aus den kleinen Gräsern würden auf einmal gewaltige märchenhafte Dschungel wachsen, in denen es keine Wege gibt, wo eine üppige, kämpfende Pflanzenwelt wächst, die Kiefernzapfen seltsam gemaserte Felsen sind und die Ameisen längst ausgestorbene, vorsintflutliche Tiere. Und wenn es ein bisschen ungemütlich, wenn es gar zu unfreundlich würde, würdest du aufspringen, auf einen rötlichen Fels klettern, und unten, dir zu Füßen, würden Thüringens Wälder flimmern in der diesigen Luft, als lägen sie hinter großen, klaren Ozeanen. In Friedenszeiten vielleicht … Aber jetzt … Ach, Heimweh – chronische Krankheit! Finster, so finster die hochstämmigen Kiefern, und die Tannen werfen kalte Schatten auf die Erde, und die steinigen Abhänge sind unüberwindliche Hürden: Und wenn du dir die Fäuste wundschlägst an den Steinen, und wenn du noch so sehr schreist, das Echo wird dir den vielfachen Schrei in den Mund stopfen und … – du wirst dich nicht durchschlagen, wirst dich nicht durchzwängen, du wirst nicht zurückkehren. Dann wird dir, wie Wasser einem Verdurstenden in der Sahara eine Fata Morgana erscheinen.
Vilnius … Türme … Türme und Kreuze. Kreuze wie warnende Zeigefinger. »Hier ist unsere Stadt. Sie gehört uns, den Türmen und Kreuzen. Rührt sie nicht an!« Die engen Gassen dort und die alten Häuserblocks, geheimnisvoll wie kleine Städtchen, sind in eine einzigartige Atmosphäre des Gestern gehüllt.
Für euch ist es das Gestern, für uns sind es unwiederbringlich verlorene Jahrhunderte. Irgendwo, in den größeren Straßen, versuchen Automobile, Radioapparate und die dreiste gehaltlose Sprache des heutigen Menschen, die Gegenwart auszurufen. Hier aber können Schreihälse und Hohlköpfe nicht hinein. Hier sind die Türme und Kreuze, hier sind die Schriftrollen auf den Reliefs, hier sind die mächtigen, kühnen, stummen Häupter der Großen mit ihren toten gemeißelten Augen – körperlose Häupter, die unter grünen Kupferdächern hängen, hier sind die muskulösen Nackten, ihre vom Regen rissigen Rücken beladen mit Steingebirgen, hier sind die vergessenen Heiligen in den dunklen, nicht mehr besuchten Kirchen, die Heiligen mit den drohenden, unerbittlichen Gesichtern, in deren tiefen Falten dieselben unauslöschlichen Worte eingeschrieben sind: »Der Tag des Zorns wird kommen. Er wird kommen. Wir wissen es. Wir warten. Dies irae, der einzige, der wichtigste Tag in deinem Leben!« Hier ist viel Elend von einst. Deshalb kommen Schreihälse und Hohlköpfe schwerlich hierher.
In den Ausläufern der labyrinthischen Gassen, in den Höfen mit mehreren Ausgängen durch gedrungene Torbögen und zwischen den von kapriziösen Architekten gebauten Häusern war es so leicht, so unausweichlich, sich mutwillig zu verirren und stundenlang herumzuwandern. Herumzuwandern und zu lauschen. Zu lauschen und versuchen zu verstehen. Vielleicht verschenkt ja dieser gebeugte Riese mit dem rissigen, bröckelnden Rücken ein vergessenes Geheimnis, vielleicht wird sich in jenen barocken Girlanden aus Blumen und Blättern eine Prophezeiung erfüllen, vielleicht wirst du in der kalten, trüben, in ihrer ewigen Stille furchterregenden Kirche nach langem Warten endlich sehen, wie der schreckliche Heilige vom Sockel steigt und mit schweren, steinernen Schritten das Gewölbe erschüttert wie der Komtur im Don Giovanni, und dir gleich einen zentnerschweren Schmetterling auf die Schultern legen und ein Wort aussprechen, ein bedrückendes Wort, das die schwarzen Gewölbe erbeben und die verrostete Orgel Töne der Vergeltung posaunen lässt. So leicht, so unvermeidlich war es, sich im alten Vilnius zu verirren.
3. Juli 1944. Die Stadt war zeitig erwacht. Die Türme und Kreuze ruderten noch schlank und ruhig in den ersten Sonnenstrahlen, aber zu ihren Füßen eilten schon die Menschen, mit Bündeln und Koffern beladen, waren Straße und Gehweg nicht mehr zu unterscheiden.
»Raus aus der Stadt, fort, nur fort …« – der einzige, drängende, treibende Gedanke in ihren Augen. Und die blitzenden Automobile, die gestern noch langsam und feierlich wie Eroberer durch die Straßen geglitten waren, zogen heute früh in scharfen Kurven davon.
»Raus, fort aus der Stadt …«
Bekannte begegneten sich und sprangen auseinander. Eilig, nicht stehenbleiben, die Zeit ist kostbar. Der Gruß rutschte tonlos oder kehlig heraus, fremd. »Gut …« – mehr nicht. Schon standen die altertümlichen Häuser fremd da, mit eingeschlagenen Fenstern. Schon ließen sich die Schriftrollen auf den Reliefs nicht mehr entziffern, und die Sphinx-Köpfe der Großen – mochte man noch so flehen – würden die gespitzten steinernen Lippen nicht öffnen. Aber wer konnte das wissen? Vielleicht waren sie so furchtbar gefasst, weil der Tod bevorstand. Vielleicht wussten sie es schon. Vielleicht würde bald eine Fliegerbombe oder ein Artilleriegeschoss ihr jahrhundertealtes Leben zerschmettern. Splitter würden auf den Gehsteigen verstreut, und mit gekreuzten Armen würden langsam, schwer und endgültig die unerbittlichen Heiligen aus ihren staubigen Nischen stürzen. Aber wer weiß, ob die in ihre tiefen Falten eingeschriebenen unauslöschlichen Worte verschwinden würden: »Der Tag des Zorns wird kommen. Er wird kommen! Wir wissen es. Dies irae, die einzige, die wichtigste Stunde deines Lebens!«
Die Luft, die Augen der Menschen, das nervöse Zucken ihrer Körper, die brummenden Automobile – alles war beherrscht von einem einzigen Wort:
Pa-nik!
Wir waren am Bahnhof. Durchgeschwitzt, atemlos. Wir sanken mit unseren Bündeln und Koffern auf die Eingangstreppe. Ein paar Schauspieler. Später fand sich ein Chirurg mit einigen Universitätsprofessoren ein. Um uns herum, in der bereits drückenden Sonne, keuchten Hunderte Niedergesunkener. Hunderte aufgesperrter Münder schnappten nach der staubigen Luft. Einige schienen zu lächeln. Lächelnde Zähne. Gesichter gequälter Tiere, die Augen unruhig, suchend. Wann werden wir auf den Bahnsteig gelassen? Wann in den Zug? Hunderte Menschen, hinter ihren Klamotten verbarrikadiert, verpackt in verschiedenfarbigen Bündeln und Koffern. Und du gehst vorüber – und mancher Blick wird dich zwingen wegzusehen, und dann wird er sich dir in Nacken und Rücken bohren.
»Hier sind meine vier Sachen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist alles, Gott sei Dank! Nicht das, das ist meins! Vier Sachen, hörst du! Eins, zwei …«
Ein Halbwüchsiger verkauft Zigaretten. Viermal so teuer wie gestern. Wir kauften Zigaretten, rauchten, bis uns schlecht wurde. Wir versuchten zu essen, nur ein bisschen, ein Stück Brot, ein Stück Speck. Es ging nicht runter. Plötzlich verbreitete sich Gelächter auf dem Platz. Siebzehnjähriges Gelächter. Ein junges Mädchen lachte aus voller Kehle. Ein Tuch um den Kopf, ein halbleeres Aktentäschchen in der Hand, ein Leberfleck auf der linken Wange. Sind die beiden jungen Männer, ihre Begleiter, so witzig? Oder genügt allein ihre Jugend, dass sich das Gelächter auf dem ganzen Platz ausbreitet? Die Leute, die sich auf die Bündel fallengelassen hatten, wandten wie auf Kommando die Köpfe, aber nur kurz. Das Gelächter war verletzend. Jetzt?! Nur kurz hatten sich die Köpfe umgewandt, und der noch ungeborene Trost verlosch wie ein Strohfeuer. Eine Sache, die wirklicher war …
»Das sind meine, hörst du! Drei, vier …«
Ein Bekannter kam. Der Bekannte hatte es gesehen. In der Chopinstraße. Am Molkereigeschäft und weiter, wie ausgestreut, fünf männliche Leichen. In eleganter Kleidung. Es hatte einen Wortwechsel gegeben und ein kurzes Feuergefecht. Die, die geschossen hatten, trugen deutsche Uniformen und hatten Maschinenpistolen. Die Pistolen der eleganten Leichen waren keine automatischen, sie schossen langsamer. Die Leichen waren stumm, wie üblich, und die Menschen konnten nur rätseln:
»Partisanen? Banditen?«
Ein Mann, an einen kleinen Eisenzaun gelehnt, sagte laut:
»Die Anarchie fängt an. Es wird noch schlimmer.«
Die Augen ringsum warteten. Was wird schlimmer? Die Augen erwarteten konkrete Kleinigkeiten. Was, wen und wie? Aber der Mann wusste es selbst nicht. Wusste nicht, was er den wartenden Augen noch sagen sollte, und schämte sich. Er wühlte in einem abgewetzten Rucksack. Doch die Nachricht verbreitete sich schnell, sie wurde gierig aufgenommen.
»In der Stadt herrscht Anarchie. Auf den Straßen liegen Tote. Es wurde aus den Fenstern geschossen. Die Partisanen wüten. Am Abend gibt es noch mehr Leichen. Es gibt keine Ordnung. Anarchie.«
Die Menschen sind nicht mehr niedergesunken. Wellen schweißüberströmter Gesichter und verschiedenfarbiger Bündel. Eine Welle sickert ins Innere des Bahnhofs, an den schmalen Türen, hinter denen die Dampfloks, die Waggons und die Felder sind. Aber an den engen Türen stehen breitschultrige Gendarmen mit eisernen Schildern auf der Brust und verwehren den Einlass. Trotzdem werden die Wellen kleiner. Sie sickern durch die Umzäunungen. Einer klettert über den Zaun. Einer geht außen herum. Auch durch die engen Türen kommen sie unbemerkt. Der Chirurg hat eine Flasche mit Spiritus und spricht gut Deutsch. Der Chirurg wagt es, mit dem eisernen Schild zu verhandeln. Das Schild schreit etwas von Ordnung, gibt aber schnell nach, und die Freiheit, hindurchgehen zu dürfen, wird eilig gegen die Flasche mit der klaren Flüssigkeit eingetauscht.
Wir saßen auf dem Bahnsteig. Es kam kein Zug. Wieder rauchten wir bis uns schlecht war, tranken warmes, graues Wasser, warteten. Die Stunden schleppten sich träge dahin. Lange, lange bewegen sich die Zeiger der Uhr vom Elektrizitätswerk nicht, bis sie plötzlich springen und sich wieder beruhigen. Fünf Minuten vergingen. Die Anspannung ließ nach. Zuerst gähnten die Menschen auf den Bündeln ein langes, erstarrtes Gähnen. Ein Gähnen wie die Reglosigkeit des Uhrzeigers. Dann schlummerten viele ein. Die anderen schwiegen. Einzelne Worte platzten heraus, blieben ohne Antwort. Sie unterstrichen die schläfrige Mittagsstille. Es war, als würde der Zug aus dem bedrohlichen Osten niemals kommen. Als würden die auf ihren Bündeln Zusammengesunkenen nie mehr aufwachen. Sie würden schlafen, eingeschnürt in die Mittagsstille wie Mumien. Und die Sonne würde hier stehenbleiben, über diesem grauen Häuschen mit den weißen Fensterläden. Und der Uhrzeiger würde auf zwanzig nach zwei zeigen, nur noch auf zwanzig nach zwei. Und dieser vierjährige Junge da zwirbelt ständig die Schnur seines Rucksacks, immer rechts herum, rechts herum …
Die Mittagsstille – ein Albtraum, der nicht weicht. Und …
Die Bündel …
Die weißen Fensterläden …
Der Uhrzeiger …
Die Schnur, immer rechts herum, rechts … – ich schlummerte.
Doch dann kam der Zug. Um fünf Uhr nachmittags. Ein Militärzug. Der Bahnsteig ruckte. Ein fernes Grollen zerstreute den Schlummer. Schwere, gerötete Lider rissen auf, und wieder übermannte der quälende, bohrende Gedanke den Bahnhof.
»Raus aus der Stadt, fort, nur fort …«
Über den Bahnsteig ergoss sich ein Trupp von Blitzmädeln. Ach, wo ist das schwungvolle Stolzieren auf den Straßen von Vilnius geblieben? Noch vor kurzem waren die Töchter des auserwählten Volkes auf den Gehwegen spaziert. Uns Parias haben sie nicht gesehen, man musste höflich zur Seite springen, die graue Kleidung ging geradeaus. Ein menschliches Hindernis hatte sich zu verziehen, die graue Kleidung glitt wie ein Panzer. Nur geradeaus. Jetzt waren uns die Blitzmädel so ähnlich. Sie schleppten Bündel wie wir, ihre Kleidung war zerknittert. Auch ihre Achseln waren genauso schweißgetränkt wie unsere, und in ihren Augen der gemeinsame quälende, bohrende Gedanke.
»Fort, nur fort …«
Am Ende des Zugs zwei Waggons für zivile Deutsche! Wir stürzten hin. Vielleicht irgendwie, irgendwo in einem Eckchen, wir brauchen nicht viel Platz, wir machen uns ganz klein, winzig! Man ließ uns nicht. Der Bahnhofskommandant erklärte betont ruhig:
»Kein Grund zur Beunruhigung. In zwei Tagen wird es Sonderzüge für die Bevölkerung geben. Das ist ein Militärzug, der ist verboten. Gehen Sie nach Hause und essen Sie in Ruhe zu Abend. Schneiden Sie sich eine Scheibe Speck und streichen Sie die Butter dick aufs Brot.«
Das Gesicht des Offiziers war intelligent. Sauber, hohe Stirn, blitzende Brille. Die letzten Sätze rochen nach Ironie. Und kaum spürbarer Panik. Da tauchte zufällig im Wortwechsel ein gemeinsamer Bekannter des Bahnhofskommandanten und eines der Professoren auf. Ein Bekannter, den beide verehrten. Und der Offizier stieg vom Podest.
»Steigen Sie ein, wo Platz ist.«
Wir waren ein paar Dutzend Erwählter. Wir stürzten zu den vollgestopften Waggons. Plötzlich hatten wir einander vergessen. Die einen drängten sich ins Innere, andere landeten im Gepäckwagen. Der Schaffner pfiff. Ich allein stand auf der Erde. Für mich war kein Platz mehr. Einige Jugendliche hatten sich auf die Puffer geschwungen und an die schmalen Brettchen zwischen den Waggons gehängt.
O wie schnell ich an das Dach kam, mit welch zirkushafter Behändigkeit ich meine Koffer festschnürte! Ich hing fast in der Luft, meine Beine baumelten über den Puffern, meine Hände krallten sich in das Dach. Endlich war ich ein Erwählter. Der Zug ruckte an. Ich fuhr. Die auf den Bündeln zurückgebliebenen Leute schauten böse, neidisch. Aber sie verschwanden sofort. Sie und der Bahnsteig, und Vilnius.
An jenem Abend wurde die Stadt bombardiert. Und danach – jeden Tag. Und keine Züge für die Einwohner mehr. Die Menschen flohen so wie wir oder erbettelten sich Plätze auf den Lastwagen [Zeile fehlt im Original] ihre Klamotten auf dem Rücken.
Damit zwischen Unbekannten Sympathie aufkommt, bedarf es eines gemeinsamen Bekannten. Unbedingt. Sonst kann es einem schlecht ergehen.
Jawohl, Herr Bahnhofskommandant!
[1945]
SCHWELBRÄNDE UND FUNKEN
DIE STILLE DER NACHT
Du öffnest die Augen, vielleicht weil sich dein Herz zusammenschnürt. Plötzlich erwacht, allein, in einer hellen Nacht, sagst du, wieder und wieder: »Wie still es ist …«
Warum bist du aufgewacht? Tiefe Ruhe erfüllt dein Zimmer, und auf deinen Armen liegt der Abglanz der Sterne. Die Sterne stehen hoch am Himmel, ihre himmlischen, suchenden Strahlen bringen Seligkeit. Aber als sie deine ohnmächtigen Arme fanden, bist du erschauert. Der winzige Muskel an deinem linken Augenlid zuckt jetzt noch. Warum? Die Sterne stehen so hoch am Himmel, und das Licht des Himmels ist so segensreich.
Weißt du es nicht? Dann schlaf wieder ein und öffne nachts die Augen nicht, wenn die Gardinen reglos an den Fenstern hängen wie die Gewänder von Statuen. Schlafe, bis der Tag heraufzieht. Am Tag wird die scharfe Sonne die Erde peitschen, in grellen Farben werden die Pflanzen und die Dinge schreien, und die Menschen werden schimpfen und lachen.
Beruhige dich, ruh dich aus, ich stehe dir bei, ich bin die Stille der Nacht. Es gelingt dir nicht? Deine Augen sind tief wie Brunnen in den Bergen, dein Blick dringt durch den Gardinenspalt, du horchst bis es schmerzt, und es kommt dir so vor, als würdest du hören. Du hast recht. Jetzt leben jene, die Er bestattet hat, und Sein Thron ist über den Sternen. Sie sind ruhlos, auch nach dem Tod.
Sie sind verflucht und wissen selbst nicht warum. Wenn du nicht schläfst, dann hör zu, achte nicht auf diesen winzigen Muskel an deinem linken Augenlid, der so hartnäckig zuckt.
Psst … Hörst du? Dort, vor dem Fenster, geht ein toter Soldat. Seine weit aufgerissenen Augen sind blind, ein Flammenwerfer hat sie ausgebrannt. Er geht mit lautlosen Schritten, dieser arme Blinde, und er sucht sein Zuhause. Täusch ihn nicht, beweg dich nicht, sonst könnte der Soldat meinen, dass die Wellen der Gardinen von schlanken kleinen Händen geteilt werden. Bleib liegen. Er weiß ja nicht, der arme Blinde, er weiß nicht, dass der Krieg sein Zuhause verweht hat. Er tastet sich mit den Händen voran, jetzt befühlt er eine Kletterrose, die an der Hauswand blüht. Die Rose ist weich, wie die Haare seines Kindes. Weißt du, warum der Soldat sein Zuhause sucht? Er möchte die Haare des Kinds betasten und sie langsam streicheln, so langsam wie diese Kletterrose hier. Der arme Blinde … poch, poch … und wieder poch, poch …
Ich frage dich, ich, die Stille der Nacht, hörst du dieses schwache Klopfen an einer Mauerwand? Fern von hier kriecht ein kleines Kind umher, das Kind des Soldaten, es wurde in einem Bunker verschüttet, es sucht nach seiner Mutter. Das Kind zittert, ihm ist kalt, es wurde ja nur im Hemdchen hinausgetragen, es bittet um den warmen Körper seiner Mutter. Poch, poch … die ganze Nacht hindurch, zu mehr ist es nicht imstande, dieses dumme Kindchen in dem schmutzigen Hemdchen. Weißt du, dass die beiden sich niemals mehr begegnen werden? Der Fluch wird aufgezeichnet für die Ewigkeit, und Er, der diesen Fluch ausspricht, ist groß und mächtig.
Pssst … Wo siehst du hin? Ah, du schaust durch den Gardinenspalt zu dem fahlen Stern. Ja, du würdest ihn gern vom Himmel holen und an die Brust drücken. Du glaubst, der fahle Stern könnte deine verblassende Hoffnung erwärmen und sie würde kühn und unsterblich brennen wie ein Feuer auf einem Berggipfel. Weißt du, dass denselben Stern ein Mensch gesehen hat, als er verhungerte? Einer von denen, die aufgelesen wurden wie Holzscheite. Weißt du, wie er sich danach gesehnt hat, dieses traurige silberne Licht nicht sehen zu müssen, aber er konnte sich nicht mehr bewegen, er hat auf dem Rücken gelegen, dieser gequälte Mensch, und gierig auf seinen Tod gewartet. Er wurde ruhig und seufzte froh, als kurz vor dem Tod bunte Kreise das weiße Silber erstickten. Doch Er, der den Fluch ausspricht, Er ist erbarmungslos. Unweit von deinem Zuhause ist ein Friedhof. Dort ist einer von denen verscharrt, die wie Holzscheite aufgelesen wurden. Und jetzt liegt er dort auf dem Rücken, und das weiße Licht des Sterns dringt unnachgiebig durch die Erde und brennt in seinen Augenhöhlen. Denn Er, der den Fluch ausspricht, Er mag die Qual.
Warum leuchten deine Augen auf? Ah, im Haus der Nachbarin ist ein fröhliches Licht angegangen. Ein angenehmes, alltägliches. Und dir ist leichter. Jetzt vertreibst du mich, die Stille der Nacht, jetzt machst du mir Vorwürfe, jetzt verstreust du Worte. Du sagst, dieses Land sei so wunderbar ruhig, es sei kaum berührt vom Krieg, die Menschen hier hätten das Lächeln nicht vergessen und würden Blumen pflanzen. Du sagst: Sie seien oft sanft wie schnurrende Katzen. Ja, im Haus deiner Nachbarin ist das Licht angegangen. An und wieder aus. Dort sind zwei Liebende vereint. Jetzt liebkosen sie einander, leidenschaftlich und glücklich. Du kennst sie, deine Nachbarin, sie grüßt dich jeden Morgen mit Gottes Namen. Ich sehe, du freust dich und erinnerst dich an das alte, eingepaukte Sprichwort – die Liebe ist stärker als der Tod. Aber siehst du denn den Mann nicht, der sich an die Mauer drückt? Es ist der Ehemann deiner Nachbarin, er beobachtet die Verliebten. Du meinst, er sieht ruhig zu, die Hände in die Taschen gesteckt. Weißt du, dass er nicht imstande wäre, sie so leidenschaftlich zu liebkosen wie der Neue?
Ich flüstere dir zu, ich – die Stille der Nacht: Der Mann deiner Nachbarin hat keine Hände mehr. Sie wurden ihm abgeschnitten, im Winter, im hohen Norden, weißt du, dass es dort im Winter furchtbar kalt ist? Dann ist er gestorben, wie viele Häftlinge, und seine unstillbare Sehnsucht hat ihn hierher geführt. Du meinst, er würde seelenruhig zusehen, die Hände in den Taschen? Ich sage dir, ich, die Stille der Nacht, was dieser ruhige Mann sich wünscht. Er wünscht, er hätte wenigstens eine Hand, denn auch die Leblosen vergießen schmerzliche Tränen, und er kann sie sich nicht abwischen. Doch Er, der den Fluch ausspricht, verzieht nur die Mundwinkel zu einem Lächeln.
Pssst … Beweg dich nicht. Besser nicht. Er ist groß und böse.
Richte deinen Blick auf diese Mauer. Du schaust nach Nordosten. Dort, im Nordosten, wachsen Kiefern und Fichten, Birken und Weiden. Dort riecht es nach Harz und nach Moos, dort würdest du gern herumtollen, wie früher, und fröhlich krakeelen. Dort ist ein Wald in deinem Land. Dort steht eine hohe, eine sehr hohe Fichte, sie ist so schlank wie ein siebzehnjähriges Mädchen, und unter der Fichte tollt dein Bruder herum. Ein Fremder hat ihn erschossen. Er tollt herum, bis er erstarrt und neben ihm eine Frau kniet, die sich aus Verzweiflung die Lippen zerbissen hat. Über ihr Kinn laufen kleine Rinnsale von Blut, sie erreichen die Delle in ihrem Kinn, und das Blut tropft auf den Gestorbenen. Du weißt, die Frau sagt immer und immer wieder dasselbe:
»Wir sind vergessen, wir sind vergessen, wir sind vergessen.«
Ihre Gedanken werden verworren, Wahnsinn ergreift sie.
Doch Er, der den Fluch ausspricht, verzieht nur die Mundwinkel zu einem Lächeln. Er sitzt oben, hoch oben, höher als die weißen Sterne, und Seine Augenhöhlen sind finster. Niemand hat je Seine Augen gesehen. Er sitzt da mit verschränkten Armen, unbarmherzig und höhnisch, und Er gestattet es nicht, für immer zu sterben.
Pssst … Beweg dich nicht. Ich weiß, du möchtest aus dem Bett springen, du möchtest Ihm drohen und laut schreien, dass Er es hört, dass Er sich regt, dort oben, über den weißen Sternen, dass Er erklärt:
Warum ist das so?
Du musst wissen, dass Er, der diesen Fluch ausspricht, ängstlich ist. Er wird mit dir nicht offen kämpfen. Er wird es dir vergelten, ohne das Geheimnis zu lüften. Er wird dich dazu bringen, deinen Menschenbruder zu vernichten, und dieser wird lachen an deinem Leichnam.
Pssst … Hör genau hin. Ich werde leise flüstern, ich – die Stille der Nacht. Ich sage dir:
Warum ist es so?
Weil … Er sich fürchtet vor dir, weil du nicht aus Ihm geboren bist, weil du ein Mensch bist und weil du in dir den Funken eines einst bezwungenen Gottes trägst. Erinnerst du dich an die alten Legenden, die heiligen Schriften? Dort gibt es immer zwei Namen. Dort gibt es immer zwei, die miteinander ringen. Osiris und Seth, Ahura Mazda und Ahriman, Gott und Satan. Erinnerst du dich an das Märchen vom Paradies, das Märchen vom Goldenen Zeitalter? Das ist sehr lange her, und Er, der den Fluch ausspricht, hat gesiegt. Und dieser zweite – Er lächelt zufrieden, sitzt über den weißen Sternen, erbarmungslos und höhnisch, und Er straft die Menschen, denn sie tragen einen Funken des besiegten Gottes in sich.
Doch … vielleicht, eines Tages … Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht – ich, die Stille der Nacht, aber wenn diese Funken den Himmel entzünden, dann geht Sein Thron über den weißen Sternen vielleicht in Flammen auf. Und vielleicht ersteht dann der Gott des Lichts wieder auf.
Pssst … Er könnte es hören. Beweg dich nicht. Schlaf besser wieder ein. Und öffne in einer hellen Nacht die Augen nicht, wenn dein Herz beklommen ist. Möge es still sein, mögen die Gardinen vor dem Fenster reglos herabhängen wie die Gewänder einer Statue.
DER EGOIST
Aus den Erzählungen eines Freunds
Sieh mal, diesem Herrn Professor bin ich einige Male in Vilnius begegnet. Zu jener Zeit fanden wir uns öfter bei einem jungen Chirurgen zusammen, einem Liebhaber von Wissenschaft und Literatur. Der Professor ist meines Wissens Litauendeutscher. Und seine Ernennung zum Professor hatte unter den Deutschen stattgefunden. Aber das Wesentliche besteht darin, dass er für mich ein Symbol ist. Ein Symbol für die heutige Denkweise, die diese egoistischen, unmenschlichen Verhältnisse hervorgebracht hat. Ich werde versuchen, mir meine letzte Begegnung mit ihm in dieser fantastischen Stadt in Erinnerung zu rufen.
Nun denn, der längliche Innenhof der Universität. Hinter der lauten Piliesstraße – die plötzliche Stille, eingezwängt in ein Rechteck aus zweigeschossigen Häusern. Das holprige, von Studentenfüßen ausgetretene Pflaster. Von Studenten, die dicke Mützen trugen, sich lange, gelockte Haare wachsen ließen, zahllose Weinfässer leerten und Tausende Worte verloren mit geröteten Gesichtern und glühenden romantischen Augen. Der Nebel aus erhabenen Worten und Träumen vermischte sich mit dem Dunst des Weins und berauschte die leidenschaftlichen Köpfe der Studenten.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit … Ein großes, mütterliches Vaterland …
Friede den Unterdrückten, Krieg den Ausbeutern …
Die hitzigen studentischen Köpfe vergammelten, die seidigen Locken verkamen, und der Nebel aus erhabenen Worten und Träumen zerstreute sich mit dem Weindunst.
Nun denn, dieser Hof im Rechteck der zweigeschossigen Häuser. Und die Stille. Und die verschlungenen orangenen Kaskaden von Kletterpflanzen, die mit dem einfachen Gras in den Ritzen der Pflastersteine verwachsen waren. Und diese niedrige Tür, bei der man den Kopf einziehen musste, und endlich ein geräumiges Zimmer, mittlerweile weiß gestrichen, mit einer Decke wie in einem Kloster. An den Wänden hingen Grafiken von Vilnius, der Besitzer der Wohnung, der junge Chirurg, mochte Grafik. In einer Ecke ein kleines Büffet. Auf dem Tisch eine Flasche Schnaps. (Oh, eine große Seltenheit im deutsch besetzten Vilnius!) Den Schnaps stellte ein Bekannter des Chirurgen her, der im Universitätslabor arbeitete. Was blieb ihm anderes übrig in dem leeren Labor? Studenten gab es keine mehr. Sie fanden den Militärdienst und den Kampf für das Neue Europa wenig verlockend. Diejenigen, die nicht Neo-Europäer werden mochten, zogen scharenweise in die sich zusehends bevölkernden litauischen Wälder. Der Laborant hatte in dem verwaisten Labor gesessen und gähnend die leeren, verstaubten Retorten, Kolben und Fläschchen angestarrt, bis ihn eines Morgens die in einer leeren Retorte spielenden Sonnenstrahlen an gelben Honigschnaps erinnerten und … in seinem Gehirn eine geniale Idee aufkeimte. Aus verschiedenen Resten (mit reichlich »O« und »H« und anderen Buchstaben der organischen Chemie) machte sich der Laborant daran, Alkohol herzustellen. Und bald glätteten sich die Falten der Langeweile auf seiner Stirn, und die Kolben, Retorten und Fläschchen blitzten wieder sorgfältig geputzt. Und der Laborant empfing wieder selbstgewiss seinen Monatslohn, sein Gewissen war beruhigt, das Labor war in Betrieb.
An jenem Abend war es ein besonderer Schnaps. Der Laborant hatte eine mit Äther angereicherte Flasche geschickt, und diese überraschende Veredelung veranlasste uns zu einem Moment der Besinnung. Wir waren zu viert. Der Chirurg und Hausherr, der Chemieprofessor, mein Kollege, so wie ich Lehrer für Literatur, und ich. Wie ein Götzenbild stand in der Mitte des Tischs die Flasche, und aller Augen starrten unverwandt auf das Wasser des Lebens. Ja, wir hatten es wahrlich nötig, dieses Wasser des Lebens. Unsere Lebensgeister waren stark geschwächt. Die Jagd nach Lebensmitteln und Tabak – und sonst fast nichts. Natürlich, wir verrichteten unsere berufliche Arbeit. Der Chirurg öffnete und untersuchte menschliche Körper, mein Kollege und ich – menschliche Seelen, doch es mangelte uns an Selbstgewissheit, in uns herrschte ein Zwiespalt, und er breitete sich wie ein Krebsgeschwür aus. Es war eine Krankheit, es war Schizophrenie.
Ich unterrichtete zu jener Zeit die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. In Augenblicken der intensivsten schöpferischen Ergriffenheit, wenn ich die Gehirne von Menschen des vergangenen Jahrhunderts erkundete, wenn in meiner Vorstellung ferne und doch nahe Männer mit hohen Stirnen und buschigen Schnauzbärten und Frauen mit geschnürten Taillen und kämpferisch aufgerichteten Brüsten weinten und zürnten, liebten und scherzten, wenn Ibsens oder Hauptmanns Helden an Subtilitäten starben, die die Menschheit nicht so bald wieder erreichen würde, unterbrach oft ein scharfer, perfider kleiner Hintergedanke plötzlich mein lebhaftes Schattenspiel.
›Du musst zum Abteilungsleiter gehen, mein Lieber, damit er dir Brennholz gibt. Weißt du noch, was deine Frau gestern Abend und heute Morgen zu dir gesagt hat? Sie hat mehrmals betont: Wir haben kein Brennholz mehr. Das Brennholz ist aus, verstehst du, du Genie. Ich habe gerade das letzte Stückchen verbrannt. Heute Morgen habe ich ein paar Scheite aus dem Schuppen von unserem Nachbarn genommen, aber so kann es nicht weitergehen, weil der Nachbar es bemerken könnte. Heute muss Brennholz beschafft werden.‹
Und wie auf ein Plakat druckte der kleine Hintergedanke deutlich sichtbare, nüchterne, rationale Sätze aus:
›Deine Frau hat gesagt, es ist kein Brennholz mehr im Haus. Du musst zum Abteilungsleiter gehen. Du musst sympathisch lächeln und ihn mit schuldbewusstem Gesichtsausdruck um Brennholz bitten. Es geht nicht an, dass deine Frau im Nachbarschuppen stiehlt. Der Nachbar könnte es bemerken.‹
Der letzte Satz war wenigstens erheiternd. Es war nicht wichtig, dass sie überhaupt Brennholz stahl, sondern dass es der Nachbar bemerken konnte. Und da fiel das Kartenhaus von Ibsens und Hauptmanns edler Psychologie in sich zusammen. Mein Kopf wurde leer. Wie vereinzelte Flugzeuge flogen in ihm die Trümmer von Sätzen umher …
… er lächelte, aber sie erkannte an seinem Lächeln ihre Niederlage nicht …
… wenn der Abteilungsleiter uns zwei Kubikmeter geben würde, wäre es nicht schlecht …
… ihre Ohnmacht löste bei ihm innere Freude aus …
… es gibt Brennholz aus Kiefer, Fichte, Pappel …
Und einmal, mitten in einer Unterrichtsstunde, da sickerte plötzlich still, aber aufdringlich, sehr aufdringlich, in der Klasse die Nachricht durch:
»Eine Lieferung Fleisch. Sie wird gerade verteilt. Die Ersten bekommen die besten Stücke. Eine Lieferung Fleisch, sie wird gerade verteilt.«
Nein, er, der Lehrer, war kein Betrüger, wenn er die Maske des neunzehnten Jahrhunderts trug.
Aber der Hunger nach Fleisch war ja sichtbar – in den funkelnden Blicken, und er war echt – in den Mundwinkeln.
Ja, wir waren gespalten. Der Steinzeitmensch drang grob in unser präzises Bewusstsein ein. Wir waren zu spät geboren, wir waren nicht mehr imstande zu fallen mit dem ins Chaos fallenden zwanzigsten Jahrhundert. Das neunzehnte Jahrhundert war bereits sehr weit entfernt, die Fallgeschwindigkeit war enorm, wie der Fall eines Steins in den Abgrund, und wir wollten uns mit erhobenen Armen an irgendetwas festhalten, was uns zurückversetzt in die luftigen Gefilde der edlen Psychologie. Deshalb dürsteten wir so sehr nach dem Wasser des Lebens. Deshalb starrten unsere Augen unverwandt diese Schnapsflasche an, die wie ein Götzenbild in der Mitte auf dem Tisch stand.
Die Stille wurde von der scharfen Stimme des Professors gebrochen. Er war ein noch junger Mann und Professor der Chemie. Ein erst vor kurzem berufener. Ein kräftiger, schwarzhaariger Mann, dessen kantiges Gesicht durch die Erforschung von Formeln und Flüssigkeiten intellektuelle Züge bekommen hatte.
»Fangen wir an.«
Der Geruch von echtem Bohnenkaffee breitete sich aus. Oh, das war ein besonderes Fest. Dankbare Blicke streichelten das kleine, erschöpfte, bereits verkahlende Köpfchen des Hausherrn und Chirurgen. Er tat so, als würde er die stummen Komplimente nicht bemerken. Seine etwas zu große Brille verbarg komfortabel die wohlige Verlegenheit. Wir fingen an. Die letzten Sonnenstrahlen fielen in das Rechteck des Hofs, sie glitten über die Kletterpflanzen, färbten sie grell rot und schmolzen zwischen den Steinen. Nur ein einziger, der behändeste, schlüpfte in unser Zimmer. Schlüpfte herein und breitete sich auf dem Boden aus, erschöpft und verblasst.
Der Schnaps wärmte. Der Schnaps hüllte unsere gereizten Hirne in weiches Behagen ein. Das Deckengewölbe sah jetzt leicht und gerundet aus. Und die ein wenig zu roten Kletterpflanzen dort, vor dem Fenster, versprachen ein seltenes, nicht alltägliches Abenteuer. Es könnte doch einmal im Leben etwas Außergewöhnliches geschehen, oder nicht? Vielleicht würde es plötzlich läuten und nach längerem angespanntem Warten mit beschleunigtem Herzschlag jemand hereinkommen und eine so gute, so rührende Neuigkeit überbringen, dass man den Wunsch nach einem festen Handschlag verspürt, nach völliger Hingabe mit einem freundschaftlichen Blick, vielleicht würde es einer von uns sogar wagen, seinen Nachbarn zu küssen. Ja, unsere Hirne funkelten schon, unsere menschliche Stimmung hätte Wörter erzeugen können, die wir, da wir alltäglich waren, sonst nicht auszusprechen wagten.
Ich sah die große Brille des Chirurgen funkeln, sein Blick wollte durch sie hindurchbrechen, das wäre für mich jetzt der Blick gewesen, den ich am meisten gebraucht hätte. Nun ja, und da legte er seine Hand auf die meine, und das verband uns sofort, unsere Gedanken waren im Begriff zu verschmelzen, und ich konnte deutlich erkennen, wie sich seine Lippenmuskeln anspannten, der Chirurg wollte etwas sagen …
»Ich bin ein Egoist.«
Diese Überraschung kam völlig unvermittelt. Drei Männer zuckten zusammen. Und einer bewegte sich nicht. Er starrte mit aufgerissenen Augen vor sich hin. Die Falten an seiner Nase wurden schwarz, und seine markanten Gesichtsknochen waren noch deutlicher sichtbar, als wären sie hervorgesprungen. Erst jetzt verstanden wir, dass es der Professor war, der diesen unerwarteten Satz ausgesprochen hatte. Erst jetzt erinnerte ich mich, dass er nicht ganz bei uns gewesen war, dass er sich die ganze Zeit an der Flasche zu schaffen gemacht hatte und an den Kaffeetassen und …
»Ich bin ein Egoist. Ich muss es sein.«
Seine Stimme zerriss endgültig die warme, gemütliche Blase, in der wir versunken waren. Die Zellen in unseren brennenden Hirnen spannten sich an. Die kleinen, engen Augen meines Kollegen. Sie waren verschwunden gewesen, im Nirwana. Jetzt bohrten sie sich wie zwei Nadeln in den Mund des Professors. Mein Kollege wagte es als erster:
»Warum?«
Der Professor blickte uns aufmerksam an. Unsere wie bei einem plötzlichen Angriff nach vorn gebeugten Körper amüsierten ihn. Aber er riss sich sofort zusammen und schenkte uns nach.
»Trinken wir zuerst.«
Wir tranken. Und beruhigten uns. Sein beherrschtes kleines Lächeln versetzte uns in den Alltag zurück. Die Gewölbedecke war nicht mehr gerundet und nicht mehr leicht. Und die Kletterpflanzen vor dem Fenster … Na und? Im Sommer gibt es viele rote Abende. Am nächsten Tag würde es wahrscheinlich windig. Und … es war wirklich komisch. Dieses Vilnius war romantisch. Diese Höfe, diese Häuser, umso mehr, wenn man etwas getrunken hatte … Ein ungutes Gefühl machte sich in uns breit. Wir schämten uns dafür, dass wir in unseren Herzen fest verschlossene Kostbarkeiten hatten hervorholen und einander schenken wollen. Ja, man sollte kühl denken, objektiv und logisch. Das grausame Leben, der Existenzkampf und so weiter.
»Es wäre interessant zu erfahren, warum der Herr Professor ein Egoist sein muss.«
Mein Kollege hatte diesen Satz mit ganz und gar höflicher Stimme gesprochen, sogar in einem zuvorkommenden Tonfall mit feinsten höchsten Nuancen. Der Professor lehnte sich bequem zurück. Er war ein Sieger und fühlte, dass seine Zuhörerschaft seine Gedanken gehorsam aufnehmen und sich einzuprägen versuchen würde. Wir waren jetzt vorbildliche Schüler mit gewaschenen Ohren und gekämmten Haaren.
»Erstens bin ich mir gewiss, dass ich am Leben bin. Ich möchte essen und schlafen, ich fühle Schmerz, Zufriedenheit und so weiter. Das ist für mich eine Tatsache. Weiter. Ich kommuniziere mit meiner Umgebung, sie beeinflusst mich. Auch das ist eine Tatsache. Diese beiden Tatsachen genügen mir.«
»Und wir?«
»Sie?«
Der Professor lächelte. Gute Zähne hatte der Professor. Gerade, regelmäßige, weiße. Wirklich egoistische.
»Sie … Sie sind Tatsachen unklarer Sorte. Tatsachen, die mit der Umgebung verknüpft sind. Ich würde sagen, vorübergehende. Sie existieren, solange ich mit Ihnen zu tun habe. Danach verschwinden Sie hinter den Grenzen der Umgebung. Sie sind einzelne Elemente der Umgebung, sonst nichts.«
»Aber auch wir fühlen Schmerz, Zufriedenheit, die Umgebung … Auch wir sind Tatsachen. Jeder von uns ist eine Tatsache für sich …«
Während ich diese verstreuten Sätze von mir gab, griffen meine Hände unbewusst nach der leeren Kaffeetasse und streckten sie zur Kanne aus. Meine Hände zitterten merklich. Der Professor nahm mir behutsam, wie einem Kind, die Tasse ab, goss laborantisch genau Kaffee hinein und stellte sie vor mich hin.
»Darüber brauchen wir nicht zu streiten. Sie für sich – gut möglich, aber für mich … Verzeihung. Wenn ich nach Hause komme, sind Sie nicht da. Sie sind aus der Umgebung hervorgetreten, Sie haben eine Zeit lang auf mich gewirkt, angenehm gewirkt …«
Er schenkte uns wieder ein Lächeln.
»… und dann sind Sie verschwunden. Sie sind nicht mehr da. Ich dagegen bin die ganze Zeit da, selbst im Schlaf. Und die Umgebung bleibt. Natürlich, sie ist beweglich, aber die Tatsache ist konstant, weil sie ständig da ist, diese Umgebung. Ich und sie. Diese beiden Tatsachen genügen mir. Und aus diesem Grund muss ich ein Egoist sein. Ich bin schließlich allein. Ich muss mich allein bewegen, untertauchen, an die Oberfläche zurückkehren, weiter schwimmen. Wenn ich stark bin, komme ich voran. Wie in einem dichten Wald. Äste versperren mir den Weg, knacks-knacks, und ich gehe weiter. Wenn man schwach ist, nun ja, dann mag man herumsitzen und jammern. Aber es gibt noch einen anderen Ausweg für die Schwachen. Einem Stärkeren folgen, natürlich nur, wenn es diesem recht ist. Na ja, man kann sich ja einschmeicheln. Sagen wir, einem Starken juckt der Rücken, dann kratzt ihn flink ein Schwacher – und geht ihm dann hinterher. Dem Starken ist der Schnürsenkel aufgegangen, ein Schwacher bindet ihn blitzartig zu – und geht ihm hinterher.«
Und wieder ein Lächeln. Und dann ein forschender Blick zur Zuhörerschaft. Ob der Clou gelungen ist.
»Man kann anderer Meinung sein, aber klar ist es. Und genau. Auf originelle Weise einfach.«
Mein Kollege attestiert dem Professor Weisheit. Mit einem Schluck trank ich meinen Kaffee aus. Der Schnaps war zu stark. Und meine verfluchten Hände … Ich konnte mein Gleichgewicht nicht wiederherstellen. Der Professor war ruhig. Betont ruhig. Der Schnaps zementierte seine Gehirntätigkeit. Seine grauen Augen verfolgten ganz bewusst meine unsicheren Handgriffe. Ich aber wollte mich aus dem Dunstkreis des Professors lösen, ich wollte in meine anfängliche Stimmung zurück, als die Gewölbedecke so leicht, so gerundet schien, als die allzu roten Kletterpflanzen vor dem Fenster ein seltenes, nicht alltägliches Abenteuer versprachen …
Der Hof vor dem Fenster hatte sich (so plötzlich?) in einen grauen Vorhang eingehüllt. Und die Farben und Konturen verschwanden. Alles war jetzt grau und vage. Graue, nicht alltägliche Abenteuer gibt es nicht. Graue, im Herzen verschlossene Kostbarkeiten auch nicht. Ach, diese ungestümen Studenten! Es waren vermutlich sonnige Tagen, wenn der Hof in klaren, frohen Farben erstrahlte, an denen sie unter lauten Rufen ihre dicken Mützen in die Luft geworfen haben.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit … Menschenliebe …
Und, und, und.
Der Chirurg, der in sich zusammengesunken neben mir saß, summte im Bass eine trübsinnige, endlose, vermutlich von ihm selbst erfundene Melodie. Warum im Bass? Es hatte etwas Groteskes, dieses kleine zusammengesunkene Wesen. Ich hatte den Wunsch, durch seine übergroße Brille hindurch die Blitze in seiner Seele zu beobachten …
Nein, jetzt wurde es bereits dunkel im Zimmer. Die Augen des Chirurgen gab es nicht mehr. Und sein erschöpfter, verkahlender kleiner Kopf erzeugte diese trübsinnige, endlose Melodie im Bass. Aa, aa, ooo, aa, aa, ooo … Irgendetwas ziepte an meinem Herzen, irgendetwas fehlte in meinen Hirnzellen. Mein Zorn brach aus dem Zellgewebe aus und löste sich mit Lichtgeschwindigkeit im Blut auf. Hunderte Wörter wollte ich diesem selbstgewissen Mann entgegenschleudern, der uns professorenhaft in diesen unterwürfigen Gehorsam eingesperrt hatte. Hunderte Wörter gegen eine Weltsicht, die Kriege, Hunger und Hass erzeugte. Schließlich waren solche vorübergehenden einzelnen Elemente der Umgebung unwichtig für seine Tatsachen für sich. Man konnte sie gegebenenfalls vernichten, einzeln oder en gros. Ganz gleich, ob mit langen dicken Rohren oder mit kurzen schlanken. Ganz gleich, ob durch Versetzung ins katholische, protestantische oder muslimische Paradies oder durch Fortsetzung der langen Agonie von Qualen und Schrecken. Ganz gleich … Nein. Nur nicht in diesem einschläfernden Grau. Aa, aa, ooo, aaa, ooo … Jetzt reicht es aber! Ich sprang plötzlich auf, der von mir verlassene Stuhl knarrte, und ich war mit einem Satz am Lichtschalter. Ich knipste ihn an. Weiches elektrisches Licht verbreitete sich von einer matten Kugel an der Decke. Schreibstubenlicht. Ich stand mit geballten Fäusten vor dem Professor, und mein Gesicht sah nicht besonders gemütlich aus, glaube ich.
»Ich bin sehr dankbar, dass Sie Licht gemacht haben. In der Flasche ist noch etwas übrig, in der Dunkelheit hätte ich beim Nachschenken die Gläser nicht mehr erkennen können.«
Und der Professor kümmerte sich laborantisch um mein Glas. Er hatte mich ganz einfach entwaffnet. Mit zwei banalen Sätzen, mehr nicht. Ich musste mich nur noch vorsichtig, um niemanden anzustoßen, wieder auf meinen Platz setzen und meine Rolle spielen … Dieses unvermeidliche Rollenspiel. Eines der wenigen Dinge, das uns die berühmte Evolution eingebracht hat. Wie oft ich auf der Flucht vor der Front und in Schutzräumen dieses Rollenspiel erlebt habe. Ich habe gesehen, wie unwillig, mit welch einer nervösen Angst, die sich nicht verbergen ließ, die deutschen Soldaten sich auf die Schlacht vorbereitet und vor uns eine Rolle gespielt haben. Schlecht und laienhaft, aber trotzdem haben sie die Rollen von mutigen Kriegern gespielt. Und einmal, als an unserem Schutzraum eine Bombe einschlug und das ganze Gebäude aus Stahlbeton wankte, als würde es von riesigen Händen gezogen, habe ich in den Augen eines vor mir stehenden Mannes die Todesangst gesehen, aber sein Mund hat gelächelt. Er hat die Rolle eines Mannes gespielt. Wenn es dieses Geschenk der berühmten Evolution nicht gäbe, dann hätte der Soldat vielleicht nicht auf diese wahnsinnige Tatsache für sich gehört und wäre nicht in den garantierten Tod gegangen, und der Besitzer dieses bedauernswerten Lächelns hätte vielleicht nicht in einer Tag und Nacht bombardierten Stadt herumgesessen. Es ist nicht männliche Selbstbeherrschung, dieses Rollenspiel, es ist unterwürfiger Gehorsam.
Ich versuchte noch einmal, mich aufzurichten und einen Streit anzufangen. Zugegeben, mit gespielter Höflichkeit, aber ich habe es versucht.
»Sie haben, Professor, einige von der Menschheit erschaffene Dinge vergessen. Den Humanismus, die Nächstenliebe, das Strahlen dieses kleinen, ewig schlagenden Gefäßes. Sie haben, Professor, das menschliche Herz vergessen.«
Der Professor brach in Gelächter aus. Seine großartigen glänzenden Zähne drangen durch seine fleischigen Lippen. Er lachte lautlos, wie in einem Stummfilm. Nicht verletzend, nein. Sondern als hätte ich einen komischen und sehr warmherzigen Witz erzählt. Dann ging er behutsam zwischen den anderen hindurch und setzte sich neben mich auf das Sofa. Seine große Hand, eine Hand, die man männlich nennt, drehte an einem losen Knopf meines Jackenärmels.
»Das ist das Mittel, mein Teurer, das Mittel. Der Starke hat sich ein Mittel ausgedacht, um den Schwachen abzulenken. Manchmal kann ja sogar eine Mücke schmerzhaft stechen. Und der Schwache spielt gern mit Abstraktionen. Was bleibt ihm denn auch anderes, als zu spielen. Und dann stellt er sich vor, dass er irgendeinen Wert hat, irgendeine Mission zu erfüllen hat. Er kratzt dem Starken den Rücken und denkt: ›Das tue ich aus Nächstenliebe. Zugleich stähle ich meinen Willen, ich erziehe mein inneres Ich.‹ Man wirft einem Kind einen Span hin, und die kindliche Fantasie erschafft sich daraus ein Schiff. Verzeihung.« Der Knopf meines Ärmels hatte sich gelöst. Der Professor steckte ihn mir in die Jackentasche und kehrte wieder zu dem Götzen – der Flasche – zurück:
»Trinken wir.«
Der Chirurg flüsterte mir schnell, sich verschluckend, ins Ohr:
»Ich habe vorgestern einen Menschen umgebracht. Es war eine um zwanzig Minuten verspätete Operation. Es war meine Schuld – ich hatte mich verspätet. Und ich hatte mich verspätet, weil meine Vermieterin das Mittagessen zu spät zubereitet hatte. Und die Vermieterin hatte sich mit dem Essen verspätet, weil die Verkäuferin das Geschäft später geöffnet hatte. Und auch die Verkäuferin war aus irgendeinem Grund zu spät gekommen. Was glaubst du, dieser Mensch, den ich umgebracht habe, war er einer von den Schwachen oder von den Starken?«
Endlich zeigte der Alkohol Wirkung. Alle redeten, und sie redeten über alles. Zerfetzte, paradoxe Sätze flogen umher. Die gerundete Gewölbedecke drehte sich im Dunst des Tabakqualms. Der Dunst sickerte in die Gehirne. Manchmal waren deutliche, scharfe Begriffe herauszuhören, aber ohne Anfang und Ende. Bruchstücke von Gedanken, von Meinungen, von Ereignissen verflochten sich, stießen aufeinander und prallten voneinander ab in diesem fahlen, einschläfernden Dunst. Jetzt war wirklich jeder von uns eine Tatsache für sich, jeder schrie irgendetwas Besonderes über sich heraus. Das Verdunkelungspapier in den Fenstern trennte uns von den vergangenen Jahrhunderten. Wir irrten umher in diesem abgesperrten Zimmer. Wir irrten umher in trunkener Hysterie, weil uns das alltägliche Chaos, die erschütternden Ereignisse und der Verfall unserer Persönlichkeiten quälten. Bis wir einschliefen. Ohnmächtig, schnarchend, mit offenen Mündern, zerknittert, abstoßend. Ja, dieses Wasser des Lebens war kein Wasser des Lebens. Es war ein schwer erhältlicher Betrug. Trotzdem werde ich diesen Abend nicht so bald vergessen.
Auch die Sätze des Professors, die mir noch so saftig im Ohr klingen, als hätte ich sie erst vor einigen Stunden gehört. Der Herr Professor hatte sich nichts Neues ausgedacht. Seine Weisheiten waren so alt wie die Steinzeit. Vielleicht, der Mode entsprechend, ein wenig pompöser hergerichtet. Und auch die Menschen waren wie in der Steinzeit. Nur – der Mode entsprechend pompöser hergerichtet.
DER KALENDER
Vilnius. Die Gediminasstraße. Ein großer, verwaister Platz (das rege Markttreiben von den Besatzungen hinweggefegt) und gegenüber – ein Palast. Nicht hässlich, sympathisch anzusehen. Hell gestrichen, harmonisch komponiert. Und still, als würde niemand in ihm leben, als stünde er leer. Trotzdem wird er von dem Passanten gemieden. Oder, wenn er vorübergeht, dann mit kleinen, schnellen Schritten. Vor nicht allzu langer Zeit, da hatte er hier einen kurzen Schrei gehört – oder gemeint zu hören (oh, die Doppelfenster sind fest montiert in den steinernen Mauern!), der plötzlich abbrach, und der Passant wusste nicht, ob der Schrei aus dem Keller des Palasts entwichen war oder ob der Lastwagen, der auf der Gediminasstraße anhielt, gekreischt hatte. Deshalb – so schnell wie möglich vorbeigehen … Diese schweren Eichentüren und diese breite Fahne mit diesem kabbalistischen Hakenkreuz … Ah … Der Passant atmet erleichtert auf, als der hell gestrichene Palast hinter ihm liegt. Vielleicht hatte er sich wirklich nur verhört? Vielleicht hatte der Lastwagen gekreischt? Nein, still, sehr still, als würde niemand in ihm leben, als stünde er leer, stand dieser Palast an der Gediminasstraße. Nur einmal …
Die erste Etage. Ein geräumiges Zimmer. Ein riesiges Fenster. Es ist hell. Ein glänzender Schreibtisch. Braun und poliert. Hinter dem Tisch sitzt ein Staatsanwalt von brauner Gestalt. Hinter ihm, an der Wand, hängt der braune und selbstzufriedene Führer. Vor dem Tisch steht ein junger Mann mit zerzaustem Haar. Sein Gesicht ist blass, die Muskeln angespannt. An den Mundwinkeln. An der Stirn. An den hohlen Wangen. Auf der Glasplatte des Tischs liegen litauische Untergrundzeitungen, ein Aschenbecher, eine Pistole. An der Wand gegenüber, mit der schwarzen Tür, hängt ein Kalender. 16. Februar 1944.
Der Staatsanwalt raucht. Stößt den Qualm aus. Dieser steigt dem Stehenden in die Nase, der ihn gierig einatmet und schweigt. Er ist entschlossen, nur ein einziges Wörtchen zu sagen: Nein. Der Staatsanwalt, der braune, möchte viele, viele wichtige Wörter hören. Durch wichtige Wörter würde der Braune aufsteigen, er würde dem selbstzufriedenen Führer näher kommen, vielleicht sogar einen Händedruck erhalten für den aufrichtigen Dienst. Dem Braunen passt die Stille nicht. Er zieht den Stuhl näher an den Tisch heran. Ächz … seufzt der Fußboden, und der junge Mann zuckt zusammen. Ja, seine Nerven sind nicht in Ordnung, eine Woche Verhör – das heißt schon was.
»Ich frage zum letzten Mal. Ich habe es satt. Was soll denn das Nein heißen. Zier dich nicht wie ein junges Mädchen, das von einem Mann bedrängt wird.«
Der Braune versucht zu scherzen. Wirklich, mit Fäusten auf den Tisch zu schlagen ist aufreibend. Ebenfalls zuzusehen, wie der mit gefesselten Händen am Türhaken hängende Mann mit den zerzausten Haaren von zwei schnaufenden Helfern mit Gummiknüppeln geschlagen wird. Manchmal, nach langen, verzweifelten Stunden, hilft ein warmherziges Wort, o ja, wie das hilft! Der Braune zieht sogar seine fleischigen Lippen auseinander, und es stellt sich so etwas wie ein sympathisches Lächeln ein. Das Einzige, das er noch hat und das er benutzt, um den Frauen zu gefallen. Na ja, dieses Mal muss er es diesem blassen Mann mit den zerzausten Haaren schenken. Wenn er dem ein Dutzend wichtige Wörter abringt … Oho, wer kann das wissen? Und der Braune wackelt mit dem Kopf.
»Setz dich. Reg dich nicht auf. Wir können auch freundlich reden. Rauch eine, konzentrier dich. Und dann denk ruhig nach.«
Das Wort wir klang so, als würde der große Braune, der an der Wand hängt, dem kleinen, hier sitzenden Braunen persönlich beipflichten. Der junge Mann ergreift gierig eine Zigarette. Oh, der Wunsch zu rauchen ist übermenschlich! Er nimmt einige Züge. Sein Herz pocht, die Beine werden weich, und der Kopf des vor ihm sitzenden Ermittlers verwandelt sich in eine riesige schwankende Kugel. Dies dauert ein paar Augenblicke. Er reißt sich schnell zusammen – dieser blasse Mann mit den angespannten Gesichtsmuskeln.
»Na also. Das ist ein gutes Beruhigungsmittel, oder nicht? Wir können Ihnen auch öfter welche geben. Das ist möglich, wenn Sie sich entsprechend verhalten …«
Der Braune steht auf, betrachtet eine Zeit lang aufmerksam den Rauchenden und geht, ohne den Blick abzuwenden, zum Fenster. Hier reckt es sich in die Höhe, das kleine, dickliche Männchen, und öffnet das Fenster. Ins Zimmer strömt kühle, erfrischende Luft. Der rauchende Mann weiß nicht einmal, was ihm besser schmeckt. Die Luft oder die Zigarette? Er nimmt den letzten Zug, drückt den Stummel im Aschenbecher aus und wendet sich mit dem ganzen Körper dem Fenster zu. Der Braune lächelt. Er schließt das Fenster. Lächelnd kehrt er zum Tisch zurück.
»Heute ist der Frühling zu spüren. Die Luft ist so erfrischend.«
Er schließt die Augen. Nicht ganz. Sie blitzen auf in schmalen Ritzen.
»Heute habe ich auf der Straße ein wunderbares Mädchen getroffen. Sie hat mich angelächelt.« Der Braune zieht die Wörter in die Länge, als wären sie so köstlich, dass er sie nicht aus dem Mund lassen möchte.
»Wir sind gut informiert. Wenn ich mich nicht irre, in Antakalnis … Ach, immer vergesse ich die Straßennamen … Aber hier ist das nicht so wichtig. Die kleine Straße beginnt diesseits der Peterskirche. Dort steht ein blaues eingeschossiges Häuschen. In diesem Häuschen wohnt … Ich glaube, das Mädchen, das in dem blauen Häuschen wohnt, ist noch schöner als das, das mir heute Morgen auf der Straße zugelächelt hat.«





























