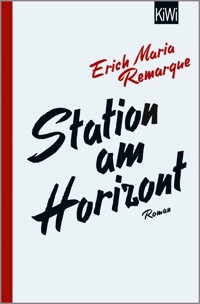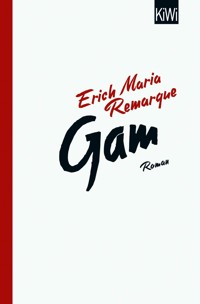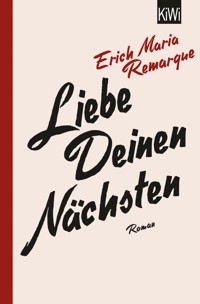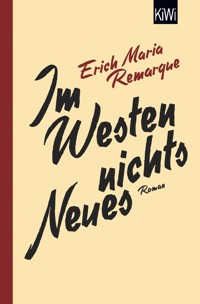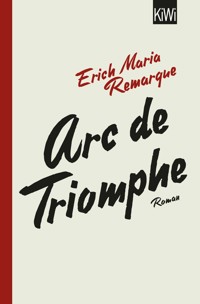
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Selbst dort, wo er zurückblickt, ist es die Gegenwart, die er anspricht.« Wilhelm von Sternburg über Erich Maria Remarque. »Arc de Triomphe« war Remarques zweiter Welterfolg nach »Im Westen nichts Neues«: Mit großer Leidenschaft erzählt Remarque die Geschichte des Arztes Ravic, der nach Paris emigriert und hier den Vorabend des Zweiten Weltkrieges erlebt. Aus Liebe zu zwei Frauen und dem Hass auf einen Gestapo-Agenten entwickelt sich das Drama eines Exilschicksals, in dessen Realität sich der Aufstand gegen den Terror einer ganzen Epoche spiegelt. »Eine Chronik und Liebesrhapsodie, wie die moderne Literatur nur wenige kennt« FAZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Erich Maria Remarque
Arc de Triomphe
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erich Maria Remarque
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland und lebte zunächst im Tessin/Schweiz. Seine Bücher Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selber wurde 1938 ausgebürgert. Ab 1939 lebte Remarque in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.
Der Herausgeber
Thomas F. Schneider, Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums an der Universität Osnabrück, veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert, zur Exilliteratur und zu Erich Maria Remarque.
Das Gesamtwerk von Erich Maria Remarque liegt im Verlag Kiepenheuer & Witsch vor: www.kiwi-verlag.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Arc de Triomphe« wurde Remarques zweiter Welterfolg nach »Im Westen nichts Neues«: Mit großer Leidenschaft erzählt Remarque die Geschichte des Arztes Ravic, der nach Paris emigriert und hier den Vorabend des Zweiten Weltkrieges erlebt. Aus Liebe zu zwei Frauen und dem Hass auf einen Gestapo-Agenten entwickelt sich das Drama eines Exilschicksals, in dessen Realität sich der Aufstand gegen den Terror einer ganzen Epoche spiegelt.
»Eine Chronik und Liebesrhapsodie, wie die moderne Literatur nur wenige kennt« FAZ
Inhaltsverzeichnis
Frontispiz
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
XXIII. Kapitel
XXIV. Kapitel
XXV. Kapitel
XXVI. Kapitel
XXVII. Kapitel
XXVIII. Kapitel
XXIX. Kapitel
XXX. Kapitel
XXXI. Kapitel
XXXII. Kapitel
XXXIII. Kapitel
Anhang
Der früheste Text Remarques
Noch vor der Veröffentlichung der deutschen Ausgabe
M. Feldmann
Werbeanzeige des Züricher Micha-Verlages ...
Für die französische Erstausgabe von Arc de Triomphe
Editorische Notiz
»Wer wirklich verloren ist, spricht nicht mehr«
Weiterführende Literatur
I
Die Frau kam schräg auf Ravic zu. Sie ging schnell, aber sonderbar taumelig. Ravic bemerkte sie erst, als sie fast neben ihm war. Er sah ein blasses Gesicht mit hochliegenden Wangenknochen und weit auseinanderstehenden Augen. Das Gesicht war starr und maskenhaft; es wirkte, als sei es eingestürzt, und die Augen hatten im Laternenlicht einen Ausdruck so gläserner Leere, daß er aufmerksam wurde. –
Die Frau streifte ihn beinahe, so dicht ging sie an ihm vorüber. Er streckte eine Hand aus und griff nach ihrem Arm. Im nächsten Augenblick schwankte sie und wäre gefallen, wenn er sie nicht gehalten hätte.
Er hielt ihren Arm fest. »Wo wollen Sie hin?« fragte er nach einer Weile.
Die Frau starrte ihn an. »Lassen Sie mich los«, flüsterte sie.
Ravic erwiderte nichts. Er hielt ihren Arm weiter fest.
»Lassen Sie mich los! Was soll das?« Die Frau bewegte kaum die Lippen.
Ravic hatte den Eindruck, daß sie ihn gar nicht sah. Sie blickte durch ihn hindurch, irgendwohin in die leere Nacht. Es war nur etwas, das sie aufhielt und gegen das sie sprach. »Lassen Sie mich los!«
Er hatte sofort gesehen, daß sie keine Hure war. Sie war auch nicht betrunken. Er hielt ihren Arm nicht mehr sehr fest. Sie hätte sich leicht losmachen können, wenn sie gewollt hätte; aber sie bemerkte es nicht. Ravic wartete eine Weile. »Wo wollen Sie wirklich hin, nachts, alleine, um diese Zeit in Paris?« sagte er dann noch einmal ruhig und ließ ihren Arm los.
Die Frau schwieg. Aber sie ging auch nicht weiter. Es war, als ob sie, einmal angehalten, nicht mehr weitergehen könne.
Ravic lehnte sich an das Geländer der Brücke. Er fühlte den feuchten, porösen Stein unter seinen Händen. »Dahin vielleicht?« Er deutete mit seinem Kopf rückwärts, hinunter, wo sich die Seine in grauem, verfließendem Glanz ruhelos gegen die Brückenschatten der Pont de l’Alma schob.
Die Frau antwortete nicht.
»Zu früh«, sagte Ravic. »Zu früh und viel zu kalt im November.«
Er zog ein Päckchen Zigaretten hervor und kramte in seinen Taschen nach Streichhölzern. Er fand, daß nur noch zwei in dem schmalen Karton waren, und beugte sich vorsichtig nieder, um die Flamme mit den Händen gegen den leichten Wind vom Fluß zu schützen.
»Geben Sie mir auch eine Zigarette«, sagte die Frau mit tonloser Stimme.
Ravic richtete sich auf und zeigte ihr das Päckchen. »Algerische. Schwarzer Tabak der Fremdenlegion. Wahrscheinlich zu stark für Sie. Ich habe keine andern bei mir.«
Die Frau schüttelte den Kopf und nahm eine Zigarette. Ravic hielt ihr das brennende Streichholz hin. Sie rauchte hastig, mit tiefen Zügen. Ravic warf das Streichholz über das Geländer. Es fiel wie eine kleine Sternschnuppe durch das Dunkel und erlosch erst, als es das Wasser erreichte.
Ein Taxi kam langsam über die Brücke gefahren. Der Chauffeur hielt an. Er blickte herüber und wartete einen Augenblick; dann gab er Gas und fuhr weiter die feuchte, schwarz glänzende Avenue George V hinauf.
Ravic fühlte plötzlich, daß er müde war. Er hatte den Tag über schwer gearbeitet und nicht schlafen können. Deshalb war er wieder fortgegangen, um zu trinken. Jetzt aber, auf einmal, fiel die Müdigkeit in der nassen Kühle der späten Nacht über seinen Kopf wie ein Sack.
Er sah die Frau an. Weshalb hatte er sie eigentlich angehalten? Es war etwas mit ihr los, das war klar. Aber was ging es ihn an? Er hatte schon viele Frauen gesehen, mit denen etwas los war, besonders nachts, besonders in Paris, und es war ihm jetzt egal, und er wollte nur noch ein paar Stunden schlafen.
»Gehen Sie nach Hause«, sagte er. »Was suchen Sie um diese Zeit noch auf der Straße? Sie können höchstens Unannehmlichkeiten haben.«
Er schlug seinen Mantelkragen hoch und wandte sich zum Gehen. Die Frau sah ihn an, als verstände sie ihn nicht. »Nach Hause?« wiederholte sie.
Ravic zuckte die Achseln. »Nach Hause, in Ihre Wohnung, ins Hotel, nennen Sie es, wie Sie wollen. Irgendwohin. Sie wollen doch nicht von der Polizei aufgegriffen werden?«
»Ins Hotel! Mein Gott!« sagte die Frau.
Ravic blieb stehen. Wieder einmal jemand, der nicht wußte, wohin er sollte, dachte er. Er hätte es voraussehen können. Es war immer dasselbe. Nachts wußten sie nicht, wohin sie sollten, und am nächsten Morgen waren sie verschwunden, ehe man erwachte. Dann wußten sie wohin. Die alte, billige Verzweiflung der Dunkelheit, die mit ihr kam und ging. Er warf seine Zigarette fort. Als ob er das nicht selbst bis zum Überdruß kannte!
»Kommen Sie, wir gehen irgendwo noch einen Schnaps trinken«, sagte er.
Es war das Einfachste. Er konnte dann zahlen und aufbrechen, und sie konnte sehen, was sie machte.
Die Frau machte eine unsichere Bewegung und stolperte. Ravic ergriff ihren Arm. »Müde?« fragte er.
»Ich weiß nicht. Ich glaube ja.«
»Zu müde, um schlafen zu können?«
Sie nickte.
»Das gibt es. Kommen Sie nur. Ich halte Sie schon.«
Sie gingen die Avenue Marceau hinauf. Ravic fühlte, wie die Frau sich auf ihn stützte. Sie stützte sich, als wäre sie im Fallen und müßte sich halten.
Sie überquerten die Avenue Pierre I de Serbie. Hinter der Kreuzung der Rue Chaillot öffnete sich die Straße, und fern, schwebend und dunkel, erschien vor dem regnerischen Himmel die Masse des Arc de Triomphe.
Ravic deutete auf einen schmalen, erhellten Eingang, der in ein Kellerloch führte. »Hier – da wird es schon noch etwas geben.«
Es war eine Chauffeurkneipe. Ein paar Taxichauffeure und ein paar Huren saßen darin. Die Chauffeure spielten Karten. Die Huren tranken Absinth. Sie musterten die Frau mit raschem Blick. Dann wandten sie sich gleichgültig ab. Die Ältere gähnte laut; die andere begann sich faul zu schminken. Im Hintergrund streute ein Pikkolo mit einem Gesicht wie eine verdrossene Ratte Sägespäne auf die Fliesen und fing an, den Flur auszufegen. Ravic setzte sich mit der Frau an einen Tisch neben dem Eingang. Es war bequemer; er konnte dann rascher weggehen. Er zog seinen Mantel nicht aus. »Was wollen Sie trinken?« fragte er.
»Ich weiß nicht. Irgendetwas.«
»Zwei Calvados«, sagte Ravic zu dem Kellner, der eine Weste trug und die Hemdsärmel aufgekrempelt hatte. »Und ein Paket Chesterfield-Zigaretten.«
»Haben wir nicht«, erklärte der Kellner. »Nur französische.«
»Gut. Dann ein Paket Laurens grün.«
»Grün haben wir auch nicht. Nur blau.«
Ravic betrachtete den Unterarm des Kellners, auf den eine nackte Frau tätowiert war, die über Wolken ging. Der Kellner folgte seinem Blick, ballte die Faust und ließ seine Armmuskeln springen. Die Frau wackelte unzüchtig mit dem Bauch.
»Also blau«, sagte Ravic.
Der Kellner grinste. »Vielleicht haben wir noch eine grün.« Er schlurfte davon.
Ravic sah ihm nach. »Rote Pantoffeln«, sagte er. »Und eine Bauchtänzerin! Er scheint in der türkischen Marine gedient zu haben.«
Die Frau legte ihre Hände auf den Tisch. Sie tat das, als wollte sie sie nie wieder hochnehmen. Die Hände waren gepflegt, aber das besagte nichts. Sie waren auch nicht sehr gepflegt. Ravic sah, daß der Nagel des rechten Mittelfingers abgebrochen und scheinbar abgerissen und nicht weggefeilt worden war. An einigen Stellen war der Lack abgesprungen.
Der Kellner brachte die Gläser und eine Schachtel Zigaretten.
»Laurens grün. Fand noch eine.«
»Das dachte ich mir. Waren Sie in der Marine?«
»Nein. Circus.«
»Noch besser.« Ravic reichte der Frau ein Glas hinüber. »Hier, trinken Sie das. Es ist das beste um diese Zeit. Oder wollen Sie Kaffee?«
»Nein.«
»Trinken Sie es auf einmal.«
Die Frau nickte und trank das Glas aus. Ravic betrachtete sie. Sie hatte ein ausgelöschtes Gesicht, fahl, fast ohne Ausdruck. Der Mund war voll, aber blaß, die Konturen schienen verwischt, und nur das Haar war sehr schön, von einem leuchtenden, natürlichen Blond. Sie trug eine Baskenmütze und unter dem Regenmantel ein blaues Schneiderkostüm. Das Kostüm war von einem guten Schneider gemacht, aber der grüne Stein des Ringes auf ihrer Hand war viel zu groß, um nicht falsch zu sein.
»Wollen Sie noch einen?« fragte Ravic.
Sie nickte.
Er winkte dem Kellner. »Noch zwei Calvados. Aber größere Gläser.«
»Größere Gläser? Auch mehr drin?«
»Ja.«
»Also zwei doppelte Calvados.«
»Erraten.«
Ravic beschloß, sein Glas rasch auszutrinken und dann aufzubrechen. Er langweilte sich und war sehr müde. Im allgemeinen war er geduldig mit Zwischenfällen; er hatte vierzig Jahre eines wechselvollen Lebens hinter sich. Aber er kannte Situationen wie diese hier schon zu sehr. Er lebte seit einigen Jahren in Paris und konnte nachts wenig schlafen; da sah man vieles unterwegs.
Der Kellner brachte die Gläser. Ravic nahm den scharf und aromatisch riechenden Apfelschnaps und stellte ihn behutsam vor die Frau. »Trinken Sie das noch. Es hilft nicht viel, aber es wärmt. Und was Sie auch haben – nehmen Sie es nicht zu wichtig. Es gibt wenig, das lange wichtig bleibt.«
Die Frau sah ihn an. Sie trank nicht.
»Es ist so«, sagte Ravic. »Besonders nachts. Die Nacht übertreibt.«
Die Frau sah ihn noch immer an. »Sie brauchen mich nicht zu trösten«, sagte sie dann.
»Umso besser.«
Ravic sah nach dem Kellner. Er hatte genug. Er kannte diesen Typ. Wahrscheinlich eine Russin, dachte er. Kaum saßen sie irgendwo, noch naß, da begannen sie schon, einem über den Mund zu fahren.
»Sind Sie Russin?« fragte er.
»Nein.«
Ravic zahlte und stand auf, um sich zu verabschieden. Im gleichen Augenblick stand die Frau ebenfalls auf. Sie tat es schweigend und selbstverständlich. Ravic sah sie unschlüssig an. Gut, dachte er dann, ich kann es auch draußen tun.
Es hatte angefangen zu regnen. Ravic blieb vor der Tür stehen.
»In welche Richtung gehen Sie?« Er war entschlossen, in die entgegengesetzte Richtung einzubiegen.
»Ich weiß nicht. Irgendwohin.«
»Wo wohnen Sie denn?«
Die Frau machte eine rasche Bewegung. »Dahin kann ich nicht! Nein! Das kann ich nicht! Nicht dahin!«
Ihre Augen waren plötzlich voll von einer wilden Angst. Gezankt, dachte Ravic. Irgendeinen Krach gehabt und auf die Straße gelaufen. Morgen mittag würde sie sich alles überlegt haben und zurückgehen.
»Kennen Sie nicht irgendjemand, zu dem Sie gehen können? Eine Bekannte? Sie können in der Kneipe telephonieren.«
»Nein. Niemand.«
»Aber Sie müssen doch irgendwohin. Haben Sie kein Geld für ein Zimmer?«
»Doch.«
»Dann gehen Sie in ein Hotel. Es gibt hier überall welche in den Seitenstraßen.«
Die Frau antwortete nicht.
»Irgendwohin müssen Sie doch«, sagte Ravic ungeduldig. »Sie können doch nicht im Regen auf der Straße bleiben.«
Die Frau zog ihren Regenmantel um sich. »Sie haben recht«, sagte sie, als fasse sie endlich einen Entschluß, »Sie haben ganz recht. Danke. Kümmern Sie sich nicht mehr um mich. Ich komme schon irgendwohin. Danke.« Sie nahm den Kragen des Mantels mit einer Hand zusammen. »Danke für alles.« Sie sah Ravic von unten herauf mit einem Blick voll Elend an und versuchte ein Lächeln, das ihr mißlang. Dann ging sie fort durch den nebligen Regen, ohne zu zögern, mit lautlosen Schritten.
Ravic stand einen Augenblick still. »Verdammt!« knurrte er überrascht und unschlüssig. Er wußte nicht, wie es kam und was es war, das trostlose Lächeln oder der Blick oder die leere Straße oder die Nacht – er wußte nur, daß er die Frau, die dort im Nebel plötzlich aussah wie ein verirrtes Kind, nicht allein gehen lassen würde.
Er folgte ihr. »Kommen Sie mit«, sagte er unfreundlich. »Etwas wird sich schon finden für Sie.«
Sie erreichten den Étoile. Der Platz lag im rieselnden Grau mächtig und unendlich vor ihnen. Der Nebel hatte sich verdichtet, und die Straßen, die rundum abzweigten, waren nicht mehr zu sehen. Nur noch der weite Platz war da mit den verstreuten, trüben Monden der Laternen und dem steinernen Bogen des Arc, der sich riesig im Nebel verlor, als stütze er den schwermütigen Himmel und schütze unter sich die einsame, bleiche Flamme auf dem Grab des Unbekannten Soldaten, das aussah wie das letzte Grab der Menschheit inmitten von Nacht und Verlassenheit.
Sie gingen quer über den ganzen Platz. Ravic ging rasch. Er war zu müde, um zu denken. Er hörte neben sich die tappenden, weichen Schritte der Frau, die ihm schweigend folgte, den Kopf gesenkt, die Hände in die Taschen ihres Mantels vergraben, eine kleine, fremde Flamme Leben – und plötzlich, in der späten Einsamkeit des Platzes, obschon er nichts von ihr wußte, erschien sie ihm einen Augenblick gerade deshalb seltsam zugehörig zu ihm. Sie war ihm fremd, so wie er sich selbst überall fremd fühlte, und das schien ihm auf eine sonderbare Weise näher als durch viele Worte und die abschleifende Gewohnheit der Zeit.
Ravic wohnte in einem kleinen Hotel in einer Seitenstraße der Avenue Wagram, hinter der Place des Ternes. Es war ein ziemlich baufälliger Kasten, an dem nur eines neu war: das Schild über dem Eingang mit der Inschrift: »Hôtel International«.
Er klingelte. »Habt ihr noch ein Zimmer frei?« fragte er den Burschen, der ihm öffnete.
Der Junge glotzte ihn verschlafen an. »Der Concierge ist nicht da«, stotterte er schließlich.
»Das sehe ich. Ich habe dich gefragt, ob noch ein Zimmer frei wäre.«
Der Bursche hob verzweifelt seine Schultern. Er sah, daß Ravic eine Frau bei sich hatte, aber er verstand nicht, wozu er noch ein zweites Zimmer wollte. Dazu brachte man Frauen seiner Erfahrung nach nicht mit. »Madame schläft. Sie wirft mich raus, wenn ich sie wecke«, sagte er und kratzte sich mit dem Fuß.
»Schön. Dann müssen wir selbst einmal nachsehen.«
Ravic gab dem Jungen ein Trinkgeld, nahm seinen Schlüssel und ging der Frau voran die Treppe hinauf. Bevor er sein Zimmer aufschloß, musterte er die Tür nebenan. Es standen keine Schuhe davor. Er klopfte zweimal. Niemand antwortete. Er versuchte vorsichtig den Drücker. Die Tür war verschlossen. »Gestern war die Bude leer«, murmelte er. »Wir wollen es einmal von der anderen Seite versuchen. Die Wirtin hat sie wahrscheinlich abgeschlossen, weil sie Angst hat, daß die Wanzen entkommen.«
Er schloß sein Zimmer auf. »Setzen Sie sich einen Augenblick.« Er zeigte auf ein rotes Roßhaarsofa. »Ich bin gleich zurück.«
Er öffnete eine Fenstertür, die auf einen schmalen Eisenbalkon führte, kletterte über ein Verbindungsgitter auf den Balkon daneben und versuchte die Tür. Sie war ebenfalls abgeschlossen. Resigniert kehrte er zurück. »Es hilft nichts. Ich kann Ihnen hier kein Zimmer verschaffen.«
Die Frau saß in der Ecke des Sofas. »Kann ich einen Augenblick hier sitzen bleiben?«
Ravic sah sie aufmerksam an. Ihr Gesicht war zerfallen vor Müdigkeit. Sie wirkte, als könne sie kaum noch aufstehen. »Sie können hier bleiben«, sagte er.
»Nur einen Augenblick –«
»Sie können hier schlafen. Das ist das einfachste.«
Die Frau schien ihn nicht zu hören. Sie bewegte langsam, fast automatisch den Kopf. »Sie hätten mich auf der Straße lassen sollen. Jetzt – ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr.«
»Das glaube ich auch. Sie können hier bleiben und schlafen. Das ist das beste. Morgen werden wir dann weitersehen.«
Die Frau sah ihn an. »Ich will Sie nicht –«
»Mein Gott«, sagte Ravic. »Sie stören mich wirklich nicht. Es ist nicht das erste Mal, daß jemand hier über Nacht bleibt, weil er nicht weiß, wohin. Das ist hier ein Hotel, wo Réfugiés wohnen. Da kommt so etwas fast jeden Tag vor. Sie können das Bett nehmen. Ich werde auf dem Sofa schlafen. Ich bin das gewöhnt.«
»Nein, nein – ich kann hier sitzen bleiben. Wenn ich nur hier sitzen bleiben kann, das ist genug.«
»Gut, wie Sie wollen.«
Ravic zog seinen Mantel aus und hängte ihn auf. Dann nahm er eine Decke und ein Kissen von seinem Bett und schob einen Stuhl neben das Sofa. Er holte einen Frottémantel aus dem Badezimmer und hängte ihn über den Stuhl. »So«, sagte er, »das kann ich Ihnen geben. Wenn Sie wollen, können Sie auch ein Pyjama haben. Drüben in der Schublade sind welche. Ich werde mich nun nicht mehr um Sie kümmern. Sie können das Badezimmer jetzt haben. Ich habe hier noch zu tun.«
Die Frau schüttelte den Kopf.
Ravic blieb vor ihr stehen. »Den Mantel werden wir aber ausziehen«, sagte er. »Er ist naß genug. Und die Mütze geben Sie auch einmal her.«
Sie gab ihm beides. Er legte das Kissen in die Ecke des Sofas. »Das ist für den Kopf. Der Stuhl hier, damit Sie nicht fallen, wenn Sie schlafen.« Er schob ihn gegen das Sofa. »Und nun noch die Schuhe. Klatschnaß natürlich. Gut für Erkältungen.« Er streifte sie ihr von den Füßen, holte aus der Schublade ein paar kurze, wollene Strümpfe und zog sie ihr über. »So, jetzt geht es einigermaßen. In kritischen Zeiten soll man auf etwas Komfort sehen. Altes Soldatengesetz.«
»Danke«, sagte die Frau. »Danke.«
Ravic ging ins Badezimmer und drehte die Hähne auf. Das Wasser schoß in das Waschbecken. Er löste seine Krawatte und betrachtete sich abwesend im Spiegel. Prüfende Augen, die tief in den Schatten der Höhlen saßen; ein schmales Gesicht, todmüde, wenn die Augen nicht gewesen wären; Lippen, die zu weich waren für die Furchen, die von der Nase zum Mund heruntergerissen waren; – und über dem rechten Auge, zackig ins Haar verlaufend, die lange Narbe.
Das Telephon klirrte in seine Gedanken. »Verdammt.« Er hatte eine Sekunde alles vergessen gehabt. Es gab solche Augenblicke des Versinkens. Da war ja noch die Frau nebenan.
»Ich komme«, rief er.
»Erschreckt?« Er hob den Hörer ab. »Was? Ja. Gut – ja – natürlich, ja – es wird gehen – ja. Wo? Gut, ich komme sofort. Heißen Kaffee, starken Kaffee – ja –«
Er legte den Hörer sehr behutsam zurück und blieb ein paar Sekunden nachdenklich auf der Sofalehne sitzen. »Ich muß fort«, sagte er dann. »Eilig.«
Die Frau stand sofort auf. Sie schwankte etwas und stützte sich auf den Stuhl.
»Nein, nein –.« Ravic war einen Moment gerührt von dieser gehorsamen Bereitwilligkeit. »Sie können hier bleiben. Schlafen Sie. Ich muß weg für ein, zwei Stunden; ich weiß nicht, wie lange. Bleiben Sie nur hier.« Er zog seinen Mantel an. Flüchtig kam ihm ein Gedanke. Er vergaß ihn sofort. Die Frau würde nicht stehlen. Sie war nicht der Typ. Den kannte er zu gut. Es war auch nicht viel da zu stehlen.
Er war schon an der Tür, als die Frau fragte. »Kann ich mitgehen?«
»Nein, unmöglich. Bleiben Sie hier. Nehmen Sie, was Sie noch brauchen. Das Bett auch, wenn Sie wollen. Kognak steht drüben. Schlafen Sie –«
Er wandte sich um. »Lassen Sie das Licht brennen«, sagte die Frau plötzlich und schnell.
Ravic ließ die Klinke los. »Angst?« fragte er.
Sie nickte.
Er zeigte auf den Schlüssel. »Schließen Sie die Tür hinter mir ab. Ziehen Sie den Schlüssel heraus. Unten ist noch ein zweiter Schlüssel, mit dem ich hereinkommen kann.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht. Aber bitte, lassen Sie das Licht brennen.«
»Ach so!« Ravic sah sie prüfend an. »Ich wollte es sowieso nicht auslöschen. Lassen Sie es nur brennen. Ich kenne das. Habe auch mal solche Zeiten gehabt.«
An der Ecke der Rue des Acacias kam ihm ein Taxi entgegen. »Fahren Sie vierzehn Rue Lauriston. – Rasch!«
Der Chauffeur drehte um und bog in die Avenue Carnot ein. Als er die Avenue de la Grande Armée kreuzte, schoss von rechts ein kleiner Zweisitzer heran. Die beiden Wagen wären zusammengestoßen, wenn die Straße nicht naß und glatt gewesen wäre. So schleuderte der Zweisitzer beim Bremsen zur Mitte der Straße hinüber, gerade an dem Kühler der Droschke vorbei. Der leichte Wagen drehte sich wie ein Karussell. Es war ein kleiner Renault, in dem ein Mann saß, der eine Brille und einen schwarzen, steifen Hut trug. Bei jeder Drehung sah man einen Augenblick sein weißes, entrüstetes Gesicht. Dann fing sich der Wagen und hielt auf den Arc am Ende der Straße zu, wie auf das riesige Tor des Hades – ein kleines, grünes Insekt, aus dem eine blasse Faust in den Nachthimmel drohte.
Der Taxichauffeur drehte sich um. »Haben Sie so was schon mal gesehen?«
»Ja«, sagte Ravic.
»Aber mit so einem Hut. Was hat einer mit so einem Hut nachts so schnell zu fahren?«
»Er hatte recht. Er war auf der Hauptstraße. Wozu schimpfen Sie?«
»Natürlich hatte er recht. Darum schimpfe ich ja gerade.«
»Was würden Sie denn tun, wenn er unrecht hätte?«
»Dann würde ich auch schimpfen.«
»Sie scheinen sich das Leben bequem zu machen.«
»Ich würde anders schimpfen«, erklärte der Chauffeur und bog in die Avenue Foch ein. »Nicht so erstaunt, verstehen Sie?«
»Nein. Fahren Sie langsamer an den Kreuzungen.«
»Das wollte ich sowieso. Verdammte Schmiere auf der Straße. Aber weshalb fragen Sie mich eigentlich, wenn Sie nachher nichts hören wollen?«
»Weil ich müde bin«, erwiderte Ravic ungeduldig. »Weil es Nacht ist. Meinetwegen auch, weil wir Funken in einem unbekannten Wind sind. Fahren Sie zu.«
»Das ist etwas anderes.« Der Chauffeur tippte mit einer gewissen Hochachtung an seine Mütze. »Das verstehe ich.«
»Hören Sie«, sagte Ravic, dem ein Verdacht kam. »Sind Sie Russe?«
»Nein. Lese aber allerlei, wenn ich auf Kunden warte.«
Mit Russen habe ich heute kein Glück, dachte Ravic. Er lehnte den Kopf zurück. Kaffee, dachte er. Sehr heißen, schwarzen Kaffee. Hoffentlich haben sie genug. Meine Hände müssen verdammt ruhig sein. Wenn es nicht anders geht, muß Veber mir eine Spritze machen. Aber es wird gehen. Er drehte die Fenster herunter und atmete langsam und tief die feuchte Luft ein.
II
Der kleine Operationsraum war taghell erleuchtet. Er sah aus wie eine hygienische Metzgerei. Eimer mit blutgetränkter Watte standen herum, Verbände und Tupfer lagen zerstreut, und das Rot schrie festlich gegen das viele Weiß. Veber saß im Vorraum an einem lackierten Stahltisch und machte Notizen; eine Schwester kochte die Instrumente aus; das Wasser brodelte, das Licht schien zu zischen, und nur der Körper auf dem Tisch lag ganz für sich selbst da – ihn ging das alles nichts mehr an.
Ravic ließ die flüssige Seife über seine Hände rinnen und begann sich zu waschen. Er wusch sich mit ärgerlicher Verbissenheit, als wolle er sich die Haut herunterscheuern. »Scheiße!« murmelte er vor sich hin. »Verdammte, verfluchte Scheiße!«
Die Operationsschwester sah ihn angewidert an. Veber blickte auf. »Ruhig, Eugénie! Alle Chirurgen fluchen. Besonders, wenn etwas schiefgegangen ist. Sie sollten daran gewöhnt sein.«
Die Schwester warf eine Handvoll Instrumente in das kochende Wasser. »Professor Perrier fluchte nie«, erklärte sie beleidigt. »Und er rettete trotzdem viele Menschen.«
»Professor Perrier war ein Spezialist für Gehirnoperationen. Subtilste Feinmechanik, Eugénie. Wir schneiden in Bäuchen herum. Das ist etwas anderes.« Veber klappte seine Eintragungen zu und stand auf. »Sie haben gut gearbeitet, Ravic. Aber gegen Pfuscher kann man schließlich nichts machen.«
»Doch – manchmal kann man.« Ravic trocknete sich die Hände ab und zündete sich eine Zigarette an. Die Schwester öffnete in schweigender Mißbilligung ein Fenster. – »Bravo, Eugénie«, lobte Veber. »Immer nach der Vorschrift.«
»Ich habe Pflichten im Leben. Ich möchte nicht gerne in die Luft fliegen.«
»Das ist schön. Eugénie. Und beruhigend.«
»Manche haben eben keine. Und wollen keine haben.«
»Das geht auf Sie, Ravic!« Veber lachte. »Besser, wir verschwinden. Eugénie ist morgens sehr aggressiv. Hier ist sowieso nichts mehr zu tun.«
Ravic sah sich um. Er sah die Schwester mit den Pflichten an. Sie erwiderte furchtlos seinen Blick. Die Brille mit dem Nickelrand gab ihrem kahlen Gesicht etwas Unantastbares. Sie war ein Mensch wie er, aber sie war ihm fremder als ein Baum. »Entschuldigen Sie«, sagte er. »Sie haben recht.«
Auf dem weißen Tisch lag das, was vor ein paar Stunden noch Hoffnung, Atem, Schmerz und zitterndes Leben gewesen war. Jetzt war es nur noch ein sinnloser Kadaver – und der menschliche Automat, Schwester Eugénie genannt, der stolz darauf war, nie einen Fehltritt begangen zu haben, deckte es zu und karrte es fort. Sie sind die ewig Überlebenden, dachte Ravic, das Licht liebt sie nicht, diese Holzseelen, deshalb vergißt es sie und läßt sie lange leben.
»Auf Wiedersehen, Eugénie«, sagte Veber. »Schlafen Sie sich aus, heute.«
»Auf Wiedersehen, Doktor Veber. Danke Herr Doktor.«
»Auf Wiedersehen«, sagte Ravic. – »Entschuldigen Sie mein Fluchen.«
»Guten Morgen«, erwiderte Eugénie eisig.
Veber schmunzelte. »Ein Charakter aus Gußeisen.«
Es war grauer Morgen draußen. Die Müllabfuhrwagen ratterten durch die Straßen. Veber schlug seinen Kragen hoch. »Ekelhaftes Wetter! Soll ich Sie mitnehmen, Ravic?«
»Nein danke. Ich will gehen.«
»Bei dem Wetter? Ich kann Sie vorbeifahren. Es ist kaum ein Umweg.«
Ravic schüttelte den Kopf. »Danke, Veber.«
Veber sah ihn prüfend an. »Sonderbar, daß Sie sich immer noch aufregen, wenn Ihnen jemand unter dem Messer bleibt. Sie sind doch schon fünfzehn Jahre in der Kiste drin und kennen das.«
»Ja. Ich kenne das. Ich rege mich auch nicht auf.«
Veber stand breit und behäbig vor Ravic. Sein großes, rundes Gesicht leuchtete wie ein normannischer Apfel. Der schwarze, gestutzte Schnurrbart war naß vom Regen und glitzerte. Am Bordrande stand ein Buick und glitzerte ebenfalls. Darin würde Veber gleich behaglich nach Hause fahren – in ein rosafarbenes Puppenhaus in der Vorstadt, mit einer sauberen, blitzenden Frau darin und zwei sauberen, blitzenden Kindern, mit einem sauberen, blitzenden Dasein. Wie konnte man ihm etwas erklären von dieser atemlosen Spannung, wenn das Messer zum ersten Schnitt ansetzte, wenn die schmale, rote Spur Blutes dem leisen Druck folgte, wenn der Körper sich unter Nadeln und Klammern wie ein vielfacher Vorhang auseinanderfaltete, wenn Organe frei wurden, die nie Licht gesehen hatten, wenn man wie ein Jäger im Dschungel einer Fährte folgte und plötzlich in zerstörten Geweben, in Knollen, in Wucherungen, in Rissen ihm gegenüberstand, dem großen Raubtier Tod, – und den Kampf, in dem man nichts anderes brauchen konnte als eine dünne Klinge und eine Nadel und eine unendlich sichere Hand – wie sollte man ihm erklären, was es bedeutete, wenn dann durch all das blendende Weiß höchster Konzentration auf einmal ein dunkler Schatten in das Blut schlug, ein majestätischer Hohn, der das Messer stumpf zu machen schien, die Nadel brüchig und die Hand schwer, – und wenn dieses Unsichtbare, Rätselhafte, Pulsierende: Leben plötzlich fortebbte unter den machtlosen Händen, zerfiel, angezogen von einem geisterhaften, schwarzen Strudel, den man nicht erreichen und nicht bannen konnte, wenn aus einem Gesicht, das eben noch atmete und Ich war und einen Namen trug, eine namenlose, starre Maske wurde, – diese sinnlose, rebellische Ohnmacht – wie konnte man sie erklären – und was war daran zu erklären?
Ravic zündete sich eine neue Zigarette an. »Einundzwanzig Jahre war das alt«, sagte er.
Veber strich sich mit einem Taschentuch die blanken Tropfen vom Schnurrbart. »Sie haben großartig gearbeitet. Ich könnte das nicht. Daß Sie nicht retten konnten, was ein Pfuscher versaut hat, das ist etwas, was Sie nichts angeht. Wo kämen wir hin, wenn wir anders dächten?«
»Ja«, sagte Ravic. »Wo kämen wir hin?«
Veber steckte sein Taschentuch ein. »Nach allem, was Sie mitgemacht haben, müßten Sie doch verdammt abgehärtet sein.«
Ravic sah ihn mit einer Spur von Ironie an. »Abgehärtet ist man nie. Man kann sich nur an vieles gewöhnen.«
»Das meine ich.«
»Ja, und an manches nie. Aber das ist schwer herauszufinden. Nehmen wir an, es war der Kaffee. Vielleicht war es wirklich der Kaffee, der mich so wach gemacht hat. Und wir verwechseln das mit Aufregung.«
»Der Kaffee war gut, was?«
»Sehr.«
»Kaffeemachen verstehe ich. Ich hatte so eine Ahnung, daß Sie ihn brauchten, deshalb habe ich ihn selbst gemacht. War was anderes als die schwarze Brühe, die Eugénie gewöhnlich produziert, wie?«
»Nicht zu vergleichen. Im Kaffeemachen sind Sie ein Meister.«
Veber stieg in seinen Wagen. Er startete und beugte sich aus dem Fenster. »Soll ich Sie nicht doch rasch absetzen? Sie müssen verflucht müde sein.«
Wie ein Seehund, dachte Ravic abwesend. Er gleicht einem gesunden Seehund. Aber was soll das schon? Wozu fällt mir das ein? Wozu immer dieses Doppeldenken? »Ich bin nicht müde«, sagte er. »Der Kaffee hat mich aufgeweckt. Schlafen Sie gut, Veber.«
Veber lachte. Seine Zähne blitzten unter dem schwarzen Schnurrbart. »Ich gehe nicht mehr schlafen. Ich gehe in meinen Garten arbeiten. Tulpen und Narzissen setzen.«
Tulpen und Narzissen, dachte Ravic. In abgezirkelten Beeten mit sauberen Kieswegen dazwischen. Tulpen und Narzissen – der pfirsichfarbene und goldene Sturm des Frühlings. »Auf Wiedersehen, Veber«, sagte er. »Sie sorgen ja wohl für alles andere.«
»Natürlich. Ich rufe Sie abends noch an. Das Honorar wird niedrig sein, leider. Kaum nennenswert. Das Mädchen war arm und hatte anscheinend keine Verwandten. Wir werden das noch sehen.«
Ravic machte eine abwehrende Bewegung.
»Hundert Francs hat sie Eugénie übergeben. Scheint alles zu sein, was sie hatte. Das waren fünfundzwanzig für Sie.«
»Gut, gut«, sagte Ravic ungeduldig. »Auf Wiedersehen, Veber.«
»Auf Wiedersehen. Bis morgen früh um acht.«
Ravic ging langsam die Rue Lauriston entlang. Wenn es Sommer gewesen wäre, hätte er sich jetzt im Bois irgendwo auf eine Bank in die Morgensonne gesetzt und gedankenlos in das Wasser und auf den grünen Wald gestarrt, bis die Spannung nachgelassen hätte. Dann wäre er ins Hotel gefahren und hätte sich schlafen gelegt.
Er trat in ein Bistro an der Ecke der Rue Boissière. Ein paar Arbeiter und Lastwagenchauffeure standen an der Theke. Sie tranken heißen, schwarzen Kaffee und tunkten Brioches hinein. Ravic sah ihnen eine Weile zu. Da war sicheres, einfaches Leben, ein Dasein, mit Fäusten anzupacken, auszuarbeiten, Müdigkeit abends, Essen, eine Frau und schwerer, traumloser Schlaf.
»Einen Kirsch«, sagte er.
Eine schmale, billige Kette aus Golddoublé hatte das sterbende Mädchen um den rechten Fuß getragen – eine dieser Albernheiten, zu denen man nur fähig war, wenn man jung, sentimental und ohne Geschmack war. Eine Kette mit einer kleinen Platte und der Inschrift »Toujours Charles« um den Fuß geschmiedet, so daß man sie nicht abnehmen konnte; eine Kette, die eine Geschichte erzählte von Sonntagen in den Wäldern an der Seine, von Verliebtheit und dummer Jugend, von einem kleinen Juwelier irgendwo in Neuilly, von Nächten im September in einer Dachstube – und dann kam plötzlich das Ausbleiben, das Warten, die Angst – toujours Charles, der nichts mehr von sich hören ließ, die Freundin, die eine Adresse wußte, die Hebamme irgendwo, ein Wachstuchtisch, reißender Schmerz und Blut, Blut, ein verstörtes altes Weibergesicht, Arme, die einen rasch in ein Taxi drängten, um einen loszuwerden, Tage der Qual und des Verkrochenseins und schließlich der Transport, das Hospital, die letzten hundert Francs zerknüllt in der heißen, nassen Hand und das: zu spät.
Das Radio begann zu plärren. Einen Tango, zu dem eine nasale Stimme blödsinnige Verse sang. Ravic ertappte sich, wie er die Operation noch einmal durchging. Er kontrollierte jeden Handgriff. Ein paar Stunden vorher wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Veber hatte telefonieren lassen. Er war nicht im Hotel gewesen. So hatte das Mädchen sterben müssen, weil er am Pont de l’Alma herumstand. Veber konnte solche Operationen nicht selber machen. Der Irrsinn des Zufalls. Der Fuß mit der Goldkette, schlaff einwärts gedreht. »Komm in mein Boot, der Vollmond scheint«, quäkte der Quetschtenor im Falsett.
Ravic zahlte und ging. Draußen hielt er ein Taxi an. »Fahren Sie zum Osiris.«
Die »Osiris« war ein großes, bürgerliches Bordell mit einer riesigen Bar im ägyptischen Stil.
»Wir schließen gerade«, sagte der Portier. »Niemand mehr da.«
»Niemand?«
»Nur Madame Rolande. Die Damen sind alle fort.«
»Gut.«
Der Portier stampfte mißmutig mit seinen Galoschen auf das Pflaster. »Wollen Sie das Taxi nicht behalten? Sie kriegen später nicht so leicht eines mehr. Hier ist Schluß.«
»Das haben Sie mir bereits einmal gesagt. Ich werde schon noch ein Taxi bekommen.«
Ravic steckte dem Portier ein Paket Zigaretten in die Brusttasche und ging durch die schmale Tür an der Garderobe vorbei in den großen Raum. Die Bar war leer; sie wirkte wie üblich nach einem kleinbürgerlichen Symposion – Lachen von vergossenem Wein, ein paar umgeworfene Stühle, Zigarettenreste auf dem Boden und der Geruch nach Tabak, süßem Parfum und Haut.
»Rolande«, sagte Ravic.
Sie stand vor einem Tisch, auf dem ein Haufen rosa Seidenwäsche lag. »Ravic«, sagte sie ohne Erstaunen. »Spät. Was willst du? – ein Mädchen oder etwas zu trinken? Oder beides?«
»Wodka. Den polnischen.«
Rolande brachte die Flasche und ein Glas. »Schenk dir selbst ein. Ich muß noch die Wäsche sortieren und aufschreiben. Das Auto der Wäscherei kommt gleich. Wenn man nicht alles notiert, stiehlt die Bande wie eine Schar Elstern. Die Chauffeure, verstehst du? Als Geschenke für ihre Mädchen.«
Ravic nickte. »Laß die Musik spielen, Rolande. Laut.«
»Gut.«
Rolande schaltete den Kontakt ein. Die Musik donnerte mit Pauken und Schlagzeug durch den hohen, leeren Raum wie ein Sturm.
»Zu laut, Ravic?«
»Nein.«
Zu laut? Was war zu laut? Nur die Stille. Die Stille, in der man zersprang wie in einem luftleeren Raum.
»Fertig.« Rolande kam zu Ravic an den Tisch. Sie hatte eine feste Figur, ein klares Gesicht und ruhige, schwarze Augen. Das schwarze, puritanische Kleid, das sie trug, kennzeichnete sie als Aufseherin; es unterschied sie von den fast nackten Huren.
»Trink etwas mit mir, Rolande.«
»Gut.«
Ravic holte ein Glas von der Bar und schenkte ein. Rolande hielt die Flasche zurück, als das Glas halb voll war. »Genug! Ich trinke nicht mehr.«
»Halbleere Gläser sind scheußlich. Laß stehen, was du nicht trinkst.«
»Warum? Das wäre doch Verschwendung.«
Ravic blickte auf. Er sah das verläßliche, vernünftige Gesicht und lächelte. »Verschwendung! Die alte französische Angst. Wozu sparen? Mit dir wird auch nicht gespart.«
»Dies hier ist Geschäft. Das ist etwas anderes.«
Ravic lachte. »Laß uns ein Glas darauf trinken! Was wäre die Welt ohne die Moral des Geschäftes! Ein Haufen Verbrecher, Idealisten und Faulenzer.«
»Du brauchst ein Mädchen«, sagte Rolande. »Ich kann Kiki telephonieren. Sie ist sehr gut. Einundzwanzig Jahre alt.«
»So. Auch einundzwanzig Jahre alt. Das ist heute nichts für mich.« Ravic goß sein Glas wieder voll. »Woran denkst du eigentlich, Rolande, bevor du einschläfst?«
»Meistens an gar nichts. Ich bin zu müde.«
»Und wenn du nicht zu müde bist?«
»An Tours.«
»Warum?«
»Eine Tante von mir hat da ein Haus mit einem Laden drin. Ich habe zwei Hypotheken darauf gegeben. Wenn sie stirbt – sie ist sechsundsiebzig –, bekomme ich das Haus. Ich will dann aus dem Laden ein Café machen. Helle Wände mit Blumenmustern, eine Kapelle, drei Mann: Klavier, Geige, Cello; im Hintergrund eine Bar. Klein und gut. Das Haus liegt in einem guten Viertel. Ich glaube, daß ich es mit neuntausendfünfhundert Francs einrichten kann, mit den Vorhängen und Lampen sogar. Dann will ich noch fünftausend Francs in Reserve haben für die erste Zeit. Und natürlich die Mieten aus der ersten und zweiten Etage. Daran denke ich.«
»Bist du in Tours geboren?«
»Ja. Aber niemand weiß, wo ich seitdem war. Und wenn das Geschäft geht, wird auch niemand sich darum kümmern. Geld deckt alles zu.«
»Nicht alles. Aber vieles.«
Ravic fühlte die Schwere hinter den Augen, die die Stimme langsamer machte. »Ich glaube, ich habe genug«, sagte er und zog ein paar Scheine aus der Tasche. »Wirst du in Tours heiraten, Rolande?«
»Nicht gleich. Aber in ein paar Jahren. Ich habe einen Freund da.«
»Fährst du ab und zu hin?«
»Selten. Er schreibt mir manchmal. An eine andere Adresse natürlich. Er ist verheiratet, aber seine Frau ist im Hospital. Tuberkulose. Höchstens noch ein bis zwei Jahre, sagen die Ärzte. Dann ist er frei.«
Ravic stand auf. »Gott segne dich, Rolande. Du hast einen gesunden Menschenverstand.«
Sie lächelte ohne Misstrauen. Sie fand, daß er recht hatte. Ihr klares Gesicht war nicht eine Spur müde. Es war frisch, als sei sie gerade aufgestanden. Sie wußte, was sie wollte. Das Leben hatte keine Geheimnisse für sie.
Draußen war es heller Tag geworden. Es hatte aufgehört zu regnen. Die Pissoirs standen wie kleine Panzertürme an den Straßenecken. Der Portier war verschwunden, die Nacht fortgewischt, der Tag hatte begonnen, und Scharen eiliger Menschen drängten sich an den Eingängen der Untergrundbahnen – als wären es Erdlöcher, in die sie hineinstürzten, um sich einer finsteren Gottheit zu opfern.
Die Frau fuhr vom Sofa hoch. Sie schrie nicht – sie fuhr nur mit einem leichten, unterdrückten Laut auf, stützte sich auf die Ellbogen und erstarrte.
»Ruhig, ruhig«, sagte Ravic. »Ich bin es. Derselbe, der Sie vor ein paar Stunden hergebracht hat.«
Die Frau atmete wieder. Ravic sah sie nur undeutlich; die brennenden elektrischen Birnen mischten sich mit dem Morgen, der durch das Fenster kroch, zu einem gelblich bleichen, kranken Licht. »Ich glaube, wir können das jetzt ausmachen«, sagte er und drehte den Schalter um.
Er fühlte wieder die weichen Hämmer der Trunkenheit hinter der Stirn. »Wollen Sie Frühstück?« fragte er. Er hatte die Frau vergessen gehabt und dann geglaubt, als er seinen Schlüssel geholt hatte, sie sei schon gegangen. Er wäre sie gern losgeworden. Er hatte genug getrunken, die Kulissen seines Bewußtseins hatten sich verschoben, die klirrende Kette der Zeit war zersprungen, und stark und furchtlos umstanden ihn die Erinnerungen und die Träume. Er wollte allein sein.
»Wollen Sie Kaffee?« fragte er. »Es ist das einzige, was hier gut ist.«
Die Frau schüttelte den Kopf. Er sah sie genauer an. »Ist was los? War jemand hier?«
»Nein.«
»Aber irgendwas muß doch los sein. Sie starren mich ja an wie ein Gespenst.«
Die Frau bewegte die Lippen. »Der Geruch«, sagte sie dann.
»Geruch?« wiederholte Ravic verständnislos; »Wodka riecht doch nicht. Kirsch und Brandy auch nicht. Und Zigaretten rauchen Sie ja selbst. Was ist daran zu erschrecken?«
»Das meine ich nicht –«
»Was denn, Herrgott?«
»Es ist derselbe – derselbe Geruch –«
»Du lieber Himmel, es wird Äther sein«, sagte Ravic, dem es auf einmal einfiel. »Ist es Äther?«
Sie nickte.
»Sind Sie einmal operiert worden?«
»Nein – es ist –«
Ravic hörte nicht mehr zu. Er öffnete das Fenster. »Wird gleich vorbei sein. Rauchen Sie eine Zigarette inzwischen.«
Er ging ins Badezimmer und drehte die Hähne auf. Im Spiegel sah er sein Gesicht. Er hatte ein paar Stunden vorher schon einmal so gestanden. Inzwischen war ein Mensch gestorben. Es war nichts dabei. Jeden Augenblick starben Tausende von Menschen. Es gab Statistiken darüber. Es war nichts dabei. Aber für den einen, der starb, war es alles und wichtiger als die ganze Welt, die weiter kreiste.
Er setzte sich auf den Rand der Wanne und zog die Schuhe aus. Das blieb immer dasselbe. Die Dinge und ihr stummer Zwang. Die Trivialität, die schale Gewohnheit in all dem irrlichternden Vergleiten. Das blühende Ufer des Herzens an den Wassern der Liebe; – aber wer man auch war, Poet, Halbgott oder Idiot – alle paar Stunden wurde man aus seinen Himmeln geholt, um zu urinieren. Dem war nicht zu entgehen! Die Ironie der Natur. Der romantische Regenbogen über Drüsenreflexen und Verdauungsgequirl. Die Organe der Verzückung diabolisch gleichzeitig zur Ausscheidung organisiert. Ravic warf die Schuhe in eine Ecke. Verhaßte Gewohnheit des Ausziehens! Sogar dem war nicht zu entkommen. Nur wer allein lebte, begriff das. Irgendeine verdammte Ergebenheit, ein Aufgehen war darin. Er hatte oft schon in seinen Kleidern geschlafen, um ihr zu entgehen; aber es war nur ein Verschieben. Es war ihr nicht zu entkommen.
Er drehte die Dusche an. Das kühle Wasser strömte über seine Haut. Er atmete tief und trocknete sich ab. Der Trost der kleinen Dinge. Wasser, Atem, abendlicher Regen. Nur wer allein war, kannte auch sie. Dankbare Haut. Leichtes in den dunklen Kanälen hinschießendes Blut. Auf einer Wiese zu liegen. Birken. Weiße Sommerwolken. Der Himmel der Jugend. Wo waren die Abenteuer des Herzens geblieben? Erschlagen von den finsteren Abenteuern des Daseins.
Er ging in das Zimmer zurück. Die Frau hockte in der Ecke des Sofas, die Decke hoch um sich gezogen.
»Kalt?« fragte er.
Sie schüttelte den Kopf.
»Angst?«
Sie nickte.
»Vor mir?«
»Nein.«
»Vor draußen?«
»Ja.«
Ravic schloß das Fenster.
»Danke«, sagte sie.
Er sah auf den Nacken vor sich. Schultern. Etwas, das atmete. Ein bißchen fremdes Leben – aber Leben. Wärme. Kein erstarrender Körper. Was konnte man sich schon anders geben, als etwas Wärme? Und was war mehr?
Die Frau bewegte sich. Sie zitterte. Sie sah Ravic an. Er spürte, wie die Welle zurückebbte. Die tiefe Kühle ohne Schwere kam. Die Spannung war vorüber. Die Weite kam. Es war, als würde er von einer Nacht auf einem fremden Planeten zurückgenommen. Alles wurde plötzlich einfach, der Morgen, die Frau – es war nichts mehr zu denken.
»Komm«, sagte er.
Sie starrte ihn an.
»Komm«, sagte er ungeduldig.
III
Er wachte auf. Er hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Frau war angezogen und saß auf dem Sofa. Aber sie sah ihn nicht an; sie blickte aus dem Fenster. Er hatte erwartet, sie würde längst fort sein. Es war ihm unbequem, daß sie noch da war. Er konnte morgens keine Menschen um sich leiden.
Er überlegte, ob er versuchen sollte, weiterzuschlafen; aber es störte ihn, daß sie ihn beobachten konnte. Er beschloß, sie rasch loszuwerden. Wenn sie auf Geld wartete, war es sehr einfach. Es würde auch sonst einfach sein. Er richtete sich auf.
»Sind Sie schon lange auf?«
Die Frau erschrak und drehte sich um. »Ich konnte nicht mehr schlafen. Es tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe.«
»Sie haben mich nicht geweckt.«
Sie stand auf. »Ich wollte fortgehen. Ich weiß nicht, weshalb ich hier noch gesessen habe.«
»Warten Sie. Ich bin gleich fertig. Sie bekommen noch Ihr Frühstück. Den berühmten Kaffee des Hotels. So lange werden wir beide noch Zeit haben.«
Er stand auf und klingelte. Dann ging er ins Badezimmer. Er sah, daß die Frau es benutzt hatte; aber alles war wieder ordentlich gerichtet worden, sogar die gebrauchten Frottétücher. Während er sich die Zähne putzte, hörte er das Mädchen mit dem Frühstück kommen. Er beeilte sich.
»War es unangenehm?« fragte er, als er herauskam.
»Was?«
»Daß das Zimmermädchen Sie sah. Ich habe nicht daran gedacht.«
»Nein. Sie war auch nicht überrascht.« Die Frau blickte auf das Tablett. Es war für zwei Personen, ohne daß Ravic etwas gesagt hätte.
»Sicher nicht. Dafür sind wir in Paris. Hier ist Ihr Kaffee. Haben Sie Kopfschmerzen?«
»Nein.«
»Gut. Ich habe welche. Aber das ist in einer Stunde vorbei. Hier sind Brioches.«
»Ich kann nichts essen.«
»Doch, Sie können. Sie glauben bloß, Sie könnten nicht. Versuchen Sie es nur.«
Sie nahm ein Brioche. Dann legte sie es wieder hin. »Ich kann wirklich nicht.«
»Dann trinken Sie den Kaffee und rauchen Sie eine Zigarette. Das ist das Frühstück der Soldaten.«
»Ja.«
Ravic aß. »Sind Sie immer noch nicht hungrig?« fragte er nach einer Weile.
»Nein.«
Die Frau drückte ihre Zigarette aus. »Ich glaube –«, sagte sie und verstummte.
»Was glauben Sie?« fragte Ravic ohne Neugier.
»Ich sollte jetzt gehen.«
»Wissen Sie den Weg? Sie sind hier nahe der Avenue Wagram.«
»Nein.«
»Wo wohnen Sie?«
»Im Hotel Verdun.«
»Das ist wenige Minuten von hier. Ich kann es Ihnen zeigen, draußen. Ich werde Sie ohnehin am Portier vorbeibringen.«
»Ja – aber das ist es nicht –«
Sie schwieg wieder. Geld, dachte Ravic. Geld, wie immer. »Ich kann Ihnen leicht aushelfen, wenn Sie in Verlegenheit sind.« Er zog seine Brieftasche hervor.
»Lassen Sie das! Was soll das?« sagte die Frau schroff.
»Nichts.« Ravic steckte die Brieftasche wieder ein.
»Entschuldigen Sie –« Sie stand auf. »Sie waren – ich muß Ihnen danken – es wäre – die Nacht – ich hätte allein nicht gewußt –«
Ravic fiel ein, was geschehen war. Er hätte es lächerlich gefunden, wenn sie eine Angelegenheit daraus gemacht hätte – aber daß sie ihm dankte, hatte er nicht erwartet, und es war ihm viel unangenehmer.
»Ich hätte wirklich nicht gewußt«, sagte die Frau. Sie stand noch immer unschlüssig vor ihm. Weshalb geht sie nicht? dachte er.
»Aber jetzt wissen Sie –«, sagte er, um etwas zu sagen.
»Nein.« Sie sah ihn offen an. »Ich weiß es noch immer nicht. Ich weiß nur, daß ich etwas tun muß. Ich weiß, daß ich nicht weglaufen kann.«
»Das ist schon viel.« Ravic nahm seinen Mantel. »Ich werde Sie jetzt herunterbringen.«
»Das ist nicht nötig. Sagen Sie mir nur –« Sie zögerte und suchte nach Worten. »Vielleicht wissen Sie – was man tun muß – wenn –«
»Wenn?« fragte Ravic nach einer Weile.
»Wenn jemand gestorben ist«, stieß die Frau hervor und brach plötzlich zusammen. Sie weinte. Sie schluchzte nicht, sie weinte nur, fast ohne Laut.
Ravic wartete, bis sie ruhiger wurde. »Ist jemand gestorben?«
Sie nickte.
»Gestern abend?«
Sie nickte wieder.
»Haben Sie ihn getötet?«
Die Frau starrte ihn an. »Was? Was sagen Sie da?«
»Haben Sie es getan? Wenn Sie mich fragen, was Sie tun sollen, müssen Sie es mir sagen.«
»Er ist gestorben!« schrie die Frau. »Plötzlich –«
Sie verbarg ihr Gesicht.
»War er krank?« fragte Ravic.
»Ja –«
»Hatten Sie einen Arzt?«
»Ja – aber er wollte nicht ins Krankenhaus –«
»War der Arzt gestern da?«
»Nein. Vorher. Vor drei Tagen. Er hat ihn – er schimpfte auf den Arzt und wollte ihn nicht mehr haben.«
»Hatten Sie keinen anderen danach?«
»Wir wußten keinen. Wir sind erst drei Wochen hier. Diesen hatte der Kellner uns besorgt – und er wollte ihn nicht mehr – er sagte – er glaubte, er könne es allein besser –«
»Was hat er gehabt?«
»Ich weiß es nicht. Der Arzt sagte Lungenentzündung – aber er glaubte es nicht – er sagte, alle Ärzte seien Betrüger – und es war auch besser gestern. Dann plötzlich –«
»Warum haben Sie ihn nicht in ein Hospital gebracht?«
»Er wollte nicht – er sagte – er – ich würde ihn betrügen, wenn er fort wäre – er – Sie kennen ihn nicht – es war nichts zu machen.«
»Liegt er noch im Hotel?«
»Ja.«
»Haben Sie dem Hotelbesitzer gemeldet, was geschehen ist?«
»Nein. Als er plötzlich still war – und alles so still – und seine Augen – da habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin fortgelaufen.«
Ravic dachte an die Nacht. Er war einen Moment verlegen. Aber es war geschehen und es war egal, für ihn und für die Frau. Besonders die Frau. Es war alles egal für sie gewesen in dieser Nacht und nur das eine wichtig: daß sie sie überstand. Das Leben bestand aus mehr als aus sentimentalen Vergleichen. Die Nacht als Lavigne gehört hatte, daß seine Frau tot war, hatte er im Hurenhaus verbracht. Die Huren hatten ihn gerettet; mit Priestern wäre er nicht durchgekommen. Wer das verstand, verstand es. Erklärungen dafür gab es nicht. Aber es gab Verpflichtungen dadurch.
Er nahm seinen Mantel. »Kommen Sie! Ich werde mit Ihnen gehen. War es Ihr Mann?«
»Nein«, sagte die Frau.
Der Patron des Hotels Verdun war dick. Er hatte kein Haar mehr auf dem Schädel, dafür aber einen gefärbten schwarzen Schnurrbart und schwarze, dichte Augenbrauen. Er stand im Eingangsraum, hinter ihm ein Kellner, ein Zimmermädchen und eine Kassiererin ohne Busen. Es war kein Zweifel, daß er bereits alles wußte. Er tobte auch sofort los, als er die Frau hereinkommen sah. Sein Gesicht verfärbte sich, er fuchtelte mit den fetten, kleinen Händen und strudelte Wut, Entrüstung und, wie Ravic sah, Erleichterung hervor. Als er bei Polizei, Fremden, Verdacht und Gefängnis war, unterbrach Ravic ihn.
»Sind Sie Provençale?« fragte er ruhig.
Der Wirt stoppte. »Nein. Was soll das?« fragte er verblüfft.
»Nichts«, erwiderte Ravic. »Ich wollte Sie nur unterbrechen. Das geht am besten durch eine völlig sinnlose Frage. Sie würden sonst noch eine Stunde geredet haben.«
»Herr! Wer sind Sie! Was wollen Sie?«
»Das ist der erste vernünftige Satz, den Sie bisher gesagt haben.«
Der Wirt hatte sich gefaßt. »Wer sind Sie?« fragte er ruhiger, mit der Vorsicht, unter keinen Umständen einen einflußreichen Mann zu beleidigen.
»Der Arzt.«
Der Wirt sah keine Gefahr mehr. »Wir brauchen hier keinen Arzt mehr«, kollerte er aufs Neue los. »Hier brauchen wir die Polizei.«
Er starrte Ravic und die Frau an. Er erwartete Angst, Protest und Bitten.
»Ein guter Gedanke. Warum ist sie nicht schon hier? Sie wissen doch schon seit einigen Stunden, daß der Mann tot ist.«
Der Patron erwiderte nichts. Er starrte Ravic nur weiter wütend an.
»Ich will es Ihnen sagen.« Ravic trat einen Schritt näher. »Weil Sie kein Aufsehen wollen Ihrer Gäste wegen. Es gibt eine Menge Leute, die ausziehen, wenn sie so etwas hören. Aber die Polizei wird kommen, das ist das Gesetz. Es liegt nur an Ihnen, es unauffällig zu machen. Das war auch gar nicht Ihre Sorge. Sie hatten Angst, daß man Ihnen durchgegangen sei und Ihnen alles überlassen hätte. Das war unnötig. Außerdem hatten Sie Angst wegen Ihrer Rechnung. Sie wird bezahlt werden. Und jetzt möchte ich den Toten sehen. Ich werde dann für alles andere sorgen.«
Ravic ging an dem Wirt vorbei. »Welche Zimmernummer?« fragte er die Frau.
»Vierzehn.«
»Sie brauchen nicht mitzugehen. Ich kann das alleine machen.«
»Nein. Ich möchte nicht hierbleiben.«
»Es ist einfacher, wenn Sie nichts mehr sehen.«
»Nein. Ich will nicht hierbleiben.«
»Gut. Wie Sie wollen.«
Das Zimmer war niedrig und lag nach der Straße. An der Tür drängten sich ein paar Zimmermädchen, Hausknechte und Kellner. Ravic schob sie beiseite. Der Raum hatte zwei Betten; in dem an der Wand lag der Mann. Er lag gelb und steif da wie eine Figur aus Kirchenwachs, mit krausen, schwarzen Haaren in einem roten Seidenpyjama. Die Hände waren zusammengelegt. Neben ihm auf dem Nachttisch stand eine kleine, billige hölzerne Madonna, auf deren Gesicht Spuren von Lippenstift waren. Ravic nahm sie hoch; »made in Germany« stand auf dem Rücken eingedruckt. Ravic sah das Gesicht des Toten an; er hatte kein Lippenrouge auf den Lippen. Er sah auch nicht so aus. Die Augen waren halb offen; eines mehr als das andere – das gab dem Körper einen sehr gleichgültigen Ausdruck, als wäre er in einer ewigen Langeweile erstarrt.
Ravic beugte sich über ihn. Er musterte die Flaschen auf dem Tisch neben dem Bett und untersuchte den Körper. Keine Spur irgendeiner Gewalt. Er richtete sich auf. »Wie hieß der Arzt, der hier war?« fragte er die Frau. »Wissen Sie seinen Namen?«
»Nein.«
Er sah sie an. Sie war sehr blaß. »Setzen Sie sich einmal da herüber. Dort drüben auf den Stuhl in der Ecke. Und bleiben Sie dort sitzen. Ist der Kellner hier, der Ihnen den Arzt besorgt hat?«
Er blickte auf die Gesichter in der Tür. Auf allen lag der gleiche Ausdruck: Grauen und Gier. »François hat die Etage«, sagte die Scheuerfrau, die einen Besen wie einen Speer in der Hand hielt.
»Wo ist François?«
Ein Kellner drängte sich durch. »Wie hieß der Arzt, der hier war?«
»Bonnet. Charles Bonnet.«
»Haben Sie seine Telephonnummer?«
Der Kellner kramte sie hervor. »Passy 27 43.«
»Gut.« Ravic sah, daß das Gesicht des Wirtes auftauchte. »Wir wollen jetzt einmal die Tür schließen. Oder haben Sie ein Interesse daran, daß man auch noch von der Straße hereinkommt?«
»Nein! Raus! Alle raus! Was steht ihr überhaupt hier rum und stehlt die Zeit, die ich euch bezahle?«
Der Wirt trieb die Angestellten hinaus und schloß die Tür. Ravic nahm das Telephon ab. Er rief Veber an und sprach eine Weile mit ihm. Dann rief er die Passy-Nummer an. Bonnet war in seinem Sprechzimmer. Er bestätigte, was die Frau gesagt hatte. »Der Mann ist gestorben«, sagte Ravic. »Können Sie herüberkommen, den Totenschein ausstellen?«
»Der Mann hat mich herausgeworfen. In der beleidigendsten Weise.«
»Er wird Sie jetzt nicht mehr beleidigen.«
»Er hat mir mein Honorar nicht bezahlt. Dafür hat er mich einen habgierigen Kurpfuscher genannt.«
»Würden Sie kommen, damit man Ihnen die Rechnung bezahlt?«
»Ich kann jemand schicken.«
»Es ist besser, Sie kommen selbst. Sonst bekommen Sie Ihr Geld nie.«
»Gut«, sagte Bonnet nach einigem Zögern. »Aber ich unterschreibe nichts, ehe ich nicht bezahlt bin. Dreihundert Francs macht es.«
»Schön. Dreihundert Francs. Sie werden sie bekommen.«
Ravic hängte ab. »Tut mir leid, daß Sie das mit anhören mußten«, sagte er zu der Frau. »Es war nicht anders zu machen. Wir brauchen den Mann.«
Die Frau holte bereits einige Scheine hervor. »Es macht nichts«, erwiderte sie. »So etwas ist nichts Neues für mich. Hier ist das Geld.«
»Warten Sie noch damit. Er kommt gleich. Sie können es ihm dann geben.«
»Können Sie den Totenschein nicht selbst ausstellen?« fragte die Frau.
»Nein«, sagte Ravic. »Dafür brauchen wir einen französischen Arzt. Am einfachsten den, der ihn behandelt hat.«
Als Bonnet die Tür hinter sich schloß, wurde es plötzlich still. Viel stiller, als wenn nur ein einzelner Mensch das Zimmer verlassen hätte. Der Autolärm von der Straße bekam etwas Blechernes, als pralle er gegen eine Wand schwerer Luft, durch die er nur mühsam sickerte. Nach dem Hin und Her der Stunde vorher begann der Tote jetzt zum ersten Male da zu sein. Sein mächtiges Schweigen füllte den billigen Raum, und es war gleichgültig, ob er glänzend rote Seidenpyjamas trug – er herrschte, wie selbst ein toter Clown herrscht –, weil er sich nicht mehr bewegte. Was lebte, bewegte sich – und was sich bewegte, konnte Kraft haben und Grazie und Lächerlichkeit –, aber nicht die fremde Majestät dessen, das sich nie mehr bewegen, sondern nur noch zerfallen konnte. Das Vollendete allein hatte es – und der Mensch war nur im Tode vollendet – und nur für kurze Zeit.
»Sie waren nicht verheiratet?« fragte Ravic.
»Nein. Warum?«
»Das Gesetz. Die Hinterlassenschaft. Die Polizei wird eine Aufstellung darüber machen, was Ihnen und was ihm gehört. Was Ihnen gehört hat, behalten Sie. Was ihm gehört, wird von der Polizei festgehalten. Für Angehörige, die sich melden sollten. Hat er welche?«
»Nicht in Frankreich.«
»Sie haben mit ihm gelebt?«
Die Frau antwortete nicht.
»Lange?«
»Zwei Jahre.«
Ravic sah sich um. »Haben Sie keine Koffer?«
»Doch – sie waren hier – dort, drüben an der Wand. Gestern abend noch.«
»Aha, der Wirt.« Ravic öffnete die Tür. Die Putzfrau mit dem Besen prallte zurück. »Mutter«, sagte er. »Für Ihr Alter sind Sie zu neugierig. Rufen Sie den Wirt.«
Die Putzfrau wollte protestieren.
»Sie haben recht«, unterbrach Ravic. »In Ihrem Alter hat man nur noch die Neugier. Aber rufen Sie den Wirt.«
Die Alte muffelte etwas, schob den Besen vor sich her und entschwand.
»Es tut mir leid«, sagte Ravic. »Doch es hilft nichts. Es mag roh aussehen, aber wir müssen es besser jetzt gleich machen. Es ist einfacher, wenn Sie es im Augenblick vielleicht auch nicht verstehen.«
»Ich verstehe es«, sagte die Frau.
Ravic sah sie an. »Sie verstehen es?«
»Ja.«
Der Wirt kam herein, einen Zettel in der Hand. Er klopfte nicht an.
»Wo sind die Koffer?« fragte Ravic.
»Zuerst einmal die Rechnung. Hier. Erst wird die Rechnung bezahlt.«
»Zuerst einmal die Koffer. Niemand hat sich bis jetzt geweigert, die Rechnung zu bezahlen. Das Zimmer ist immer noch vermietet. Das nächstemal klopfen Sie an, wenn Sie hereinkommen. Geben Sie die Rechnung her und lassen Sie die Koffer bringen.«
Der Wirt starrte ihn wütend an. »Sie werden Ihr Geld bekommen«, sagte Ravic.
Der Patron zog ab. Er warf die Tür hinter sich zu.
»Ist Geld in den Koffern?« fragte Ravic die Frau.
»Ich – nein, ich glaube nicht.«
»Wissen Sie, wo es ist? In seinem Anzug? Oder war keins da?«
»Er hatte Geld in seiner Brieftasche.«
»Wo ist sie?«
»Unter –«, die Frau zögerte. »Unter seinem Kopfkissen hatte er sie meistens.«
Ravic stand auf. Er hob vorsichtig das Kopfkissen mit dem Kopf des Toten und holte darunter eine lederne, schwarze Brieftasche hervor. Er gab sie der Frau. »Nehmen Sie das Geld heraus und alles, was wichtig für Sie ist. Rasch. Es ist keine Zeit für Sentimentalität. Sie müssen leben. Zu was sonst ist es nütze? Soll es bei der Polizei verschimmeln?«
Er blickte eine Minute aus dem Fenster. Ein Lastwagenchauffeur beschimpfte auf der Straße einen Kutscher mit einem von zwei Pferden gezogenen Grünkramwagen. Er beschimpfte ihn mit der vollen Überlegenheit, die ein schwerer Motor verleiht. Ravic wandte sich um. »Fertig?«
»Ja.«
»Geben Sie mir die Brieftasche wieder zurück.«
Er schob sie unter das Kissen. Er fühlte, daß sie dünner war, als vorher. »Packen Sie die Sachen in Ihre Handtasche«, sagte er.
Sie tat es gehorsam. Ravic nahm die Rechnung und sah sie durch. »Haben Sie hier schon einmal eine Rechnung bezahlt?«
»Ich weiß es nicht. Ich glaube schon.«
»Dies ist eine Rechnung für zwei Wochen. Bezahlte –« Ravic zögerte einen Moment. Es schien ihm sonderbar, von dem Toten als Herrn Raczinsky zu sprechen. »Wurden die Rechnungen immer pünktlich bezahlt?«
»Ja, immer. Er sagte oft, daß – in seiner Lage es wichtig wäre, immer pünktlich da zu zahlen, wo man müßte.«
»Dieser Halunke von Wirt! Haben Sie eine Ahnung, wo die letzte Rechnung sein kann?«
Es klopfte. Ravic konnte sich nicht enthalten zu lächeln. Der Hausknecht brachte die Koffer herein. Der Wirt folgte ihm. »Sind das alle?« fragte Ravic die Frau.
»Ja.«
»Natürlich sind das alle«, grunzte der Wirt. »Was dachten Sie denn?«
Ravic nahm einen kleinen Koffer. »Haben Sie einen Schlüssel dazu? Nein? Wo können die Schlüssel sein?«
»Im Schrank. In seinem Anzug.«
Ravic öffnete den Schrank. Er war leer. »Nun?« fragte er den Wirt.
Der Wirt wandte sich an den Valet: »Nun?« fauchte er.
»Der Anzug ist draußen«, stotterte der Valet.
»Warum?«
»Zum Bürsten und Reinigen.«
»Das braucht er wohl nicht mehr«, sagte Ravic.
»Bring ihn sofort herein, verdammter Dieb«, schnauzte der Wirt.
Der Hausdiener gab ihm einen kuriosen, zwinkernden Blick und ging. Gleich darauf brachte er den Anzug herein. Ravic schüttelte das Jackett, dann die Hose. Es klirrte in der Hose. Ravic zögerte einen Moment. Sonderbar, in die Hosentasche eines toten Mannes zu greifen. Als wäre der Anzug mitgestorben. Und sonderbar, so zu denken. Ein Anzug war ein Anzug.
Er nahm die Schlüssel heraus und öffnete die Koffer. Obenauf lag eine Segeltuchmappe. »Ist es diese?« fragte er die Frau.
Sie nickte.
Ravic fand die Rechnung sofort. Sie war quittiert. Er zeigte sie dem Wirt. »Sie haben eine Woche zu viel gerechnet.«
»So?« schnappte der Patron zurück. »Und dann der Ärger? Die Schweinerei? Die Aufregung? Das ist wohl nichts, was? Daß ich meine Galle wieder fühle, das ist wohl inbegriffen, wie? Sie haben ja selbst gesagt, daß Gäste ausziehen werden! Der Schaden ist viel höher! Und das Bett? Das Zimmer, das ausgeschwefelt werden muß? Das Betttuch, das verdreckt ist?«
»Das Bettuch ist auf der Rechnung. Außerdem ein Diner für 25 Francs, das er gestern abend noch gegessen haben soll. Haben Sie etwas gegessen, gestern?« fragte er die Frau.
»Nein. Aber kann ich es nicht einfach bezahlen? Es ist – ich möchte es rasch erledigen.«
Rasch erledigen, dachte Ravic. Wir kennen das. Und dann – die Stille und der Tote. Die Keulenschläge des Schweigens. Besser so – wenn es auch scheußlich ist. Er nahm einen Bleistift vom Tisch und rechnete. Dann gab er die Rechnung an den Wirt zurück. »Einverstanden?«
Der Patron warf einen Blick auf die Endziffer. »Ich bin doch nicht verrückt!«
»Einverstanden?« fragte Ravic noch einmal.
»Wer sind Sie überhaupt? Was mischen Sie sich hier ein?«
»Ich bin der Bruder«, sagte Ravic. »Einverstanden?«
»Plus zehn Prozent Service und Steuer. Sonst nicht.«
»Gut.« Ravic fügte die Ziffer hinzu. »Sie haben zweihundertzweiundneunzig Francs zu zahlen«, sagte er zu der Frau.