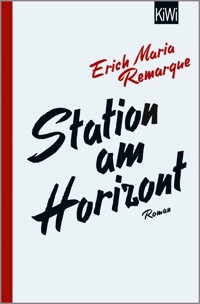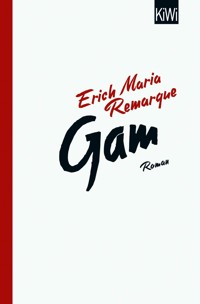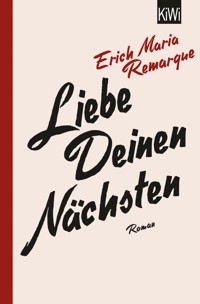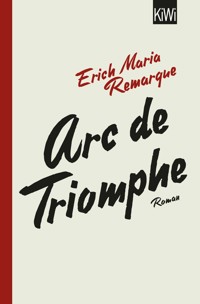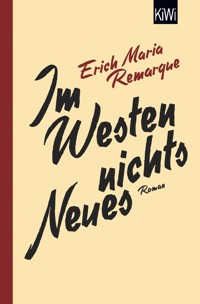12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es schien mir ... schon lange nicht mehr merkwürdig, einen anderen Namen zu haben und mit dem Pass eines Toten zu leben – im Gegenteil, eher passend.« Nach einer langen Flucht vor dem nationalsozialistischen Deutschland erreicht der regimekritische Journalist Robert Ross 1944 endlich das vermeintliche Paradies Amerika. Doch trotz der Liebe zu der schönen Russin Natascha bleibt er in der neuen Welt ein Fremder … Ein großer Roman über die Liebe zur Kunst, die Entfremdung im Exil und die Sehnsucht nach Heimat. Dieser nachgelassene Roman Remarques lag bislang nur in einer stark gekürzten und redaktionell entstellten Fassung vor. Nun erscheint er erstmals in der vollständig rekonstruierten Urfassung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 779
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Erich Maria Remarque
SCHATTEN IM PARADIES
(New York Intermezzo). Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erich Maria Remarque
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland und lebte zunächst im Tessin/Schweiz. Seine Bücher Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selber wurde 1938 ausgebürgert. Ab 1939 lebte Remarque in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.
Der Herausgeber
Thomas F. Schneider, Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums an der Universität Osnabrück, veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert, zur Exilliteratur und zu Erich Maria Remarque.
Das Gesamtwerk von Erich Maria Remarque liegt im Verlag Kiepenheuer & Witsch vor: www.kiwi-verlag.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nach einer langen Flucht vor dem nationalsozialistischen Deutschland erreicht der regimekritische Journalist Robert Ross 1944 endlich das vermeintliche Paradies Amerika. Doch trotz der Liebe zu der schönen Russin Natascha bleibt er in der neuen Welt ein Fremder … Ein großer Roman über die Liebe zur Kunst, die Entfremdung im Exil und die Sehnsucht nach Heimat. Dieser nachgelassene Roman Remarques lag bislang nur in einer stark gekürzten und redaktionell entstellten Fassung vor. Nun erscheint er erstmals in der vollständig rekonstruierten Urfassung.
Inhaltsverzeichnis
Frontispiz
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
XXIII. Kapitel
XXIV. Kapitel
XXV. Kapitel
XXVI. Kapitel
XXVII. Kapitel
XXVIII. Kapitel
XXIX. Kapitel
XXX. Kapitel
XXXI. Kapitel
XXXII. Kapitel
XXXIII. Kapitel
XXXIV. Kapitel
Anhang
Chronologie
Der Verleger von Remarques Hausverlag Kiepenheuer & Witsch …
Der Verlag Droemer Knaur beauftragte …
Anlässlich des Empfangs zur Übergabe des Typoskriptes …
Neben unzähligen Änderungen und Streichungen …
Editorische Notiz
»Nicht der Mörder, der Ermordete war schuldig«
Auftritt der Witwe
Das »Buch N.«
»Der letzte große Remarque«
Kunst ist Zivilisation
Weiterführende Literatur
I
Ich wohnte damals im fünfzehnten Stock eines Hauses in der 57. Straße in New York. In dieser Etage sollte sich vor vielen Jahren ein Puff befunden haben; jetzt war sie längst aufgeteilt in Ein- und Zweizimmerwohnungen. Über mir, auf dem Dach, befand sich noch eine Anzahl kleiner Penthaus-Apartments. Sie hatten Terrassen und waren sehr begehrt; aber sie waren fast alle in den Händen von Schwulen. Die Homos in New York wissen immer, wo die besten Unterkünfte zu finden sind. Man konnte sie leicht schon an ihren Hunden erkennen; um die Zeit, als ich dort lebte, waren es Zwergpudel. Auch da gab es Klassen und Unterschiede. Es war nicht gleichgültig, ob man einen weißen, grauen, schwarzen oder pfirsichfarbenen hatte; einige »kesse Väter« verstiegen sich sogar zu mächtigen Königspudeln, um ihre Männlichkeit zu betonen. Auch die Art, wie die Tiere getrimmt waren, spielte eine Rolle, – ob kraushaarig wie ein Malteser, langhaarig wie ein Kerry Blue-Terrier, oder mit Bäffchen und geschoren wie ein Zirkusvieh. Morgens früh und abends spät waren die Aufzüge voll von ihnen; dann wurden sie auf die Straße geführt zum Scheißen. Zu beiden Seiten der Fahrstraße sah man sie in den Abflußrinnen neben den Trottoirs hocken, von ihren stolzen Besitzern an der Leine gehalten, – in New York durften sie nicht frei herumlaufen und ihre Bedürfnisse auf den Gehsteigen erledigen. Sie wirkten dann wie eine Allee von Sphinxen, die über metaphysische Probleme grübelten. Kunitzky, der Besitzer des Zeitungskiosks an der Ecke, wurde jedesmal um diese Zeit sehr nervös. Pudel sind flink und wendig, und die Tucken ließen sie, wenn kein Polizist in der Nähe war, trotz der Vorschriften gern ein paar Minuten frei herumrennen; dabei glitten sie oft unter das Ausgabebord des Kiosks, wo Kunitzky, der drinnen war, sie nicht sehen konnte, und bepißten rasch die aufgehängten Umschläge der Magazine, die damit ruiniert waren. Besonders pfiffig war dabei der champagnerfarbene Pudel Renée der Tucke Jasper. Kunitzky hatte ihn schon öfter angezeigt, aber er mußte ihn in flagranti erwischen, wenn er Erfolg haben wollte. Renée war dafür zu schnell und er schien zu wissen, worum es ging. Jasper fütterte ihn dafür in der Bäckerei um die Ecke mit Apfelkuchen. Das Ganze war etwas mehr als ein harmloser Ulk. Kunitzky haßte Schwule und hatte eine Fülle von Bezeichnungen für sie, die er nicht für sich behielt, – außerdem hatte er Renée mit Hamburger Bouletten zu vergiften versucht. Beides traf Jasper ins Kerngehäuse.
Ich lebte in dieser Zeit in einem sonderbaren Zustand in Amerika, – so, als ob ich gleichzeitig zehn und fünfunddreißig Jahre alt sei. Ich war vor einigen Monaten mit einem Frachtdampfer aus Lissabon angekommen und konnte nur wenig Englisch, – das war, als wäre ich halb stumm und halb taub und von einem anderen Planeten hier ausgesetzt worden. Es war auch ein anderer Planet, denn in Europa herrschte Krieg.
Dazu kam, daß meine Papiere nicht in Ordnung waren. Ich hatte zwar, durch viele Wunder, ein gültiges amerikanisches Visum, mit dem ich angekommen war; aber mein Paß lautete auf einen anderen Namen als meinen. Die Immigrationsbehörden waren mißtrauisch geworden und hatten mich in Ellis Island festgesetzt. Nach sechs Wochen hatten sie mir dann eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Monate gegeben; in dieser Zeit sollte ich mir eine Einreisegenehmigung in ein anderes Land besorgen. Ich kannte das von Europa her. Ich hatte dort seit Jahren so existiert, – nicht von einem Monat, sondern von einem Tag zum andern. Als deutscher Emigrant war ich ohnehin seit 1933 offiziell tot, – jetzt für drei Monate nicht mehr auf der Flucht sein zu müssen, war bereits ein unfaßbarer Traum. Es schien mir auch schon lange nicht mehr merkwürdig, einen anderen Namen zu haben und mit dem Paß eines Toten zu leben, – im Gegenteil, eher passend. Ich hatte den Paß in Frankfurt geerbt; der Mann, der ihn mir am Tage, als er starb, geschenkt hatte, nannte sich nach ihm Ross. Ich hieß also ebenfalls Robert Ross. Meinen wirklichen Namen hatte ich fast vergessen. Man kann viel vergessen, wenn es ums nackte Leben geht.
In Ellis Island hatte ich einen Türken getroffen, der vor zehn Jahren schon einmal in Amerika gewesen war. Ich wußte nicht, weshalb man ihn jetzt nicht wieder einreisen ließ; ich fragte auch nicht danach. Ich hatte zu oft erlebt, daß man Leute auswies, einfach weil sie lebten. Der Türke gab mir die Adresse eines Russen, der in New York wohnte und dem sein Vater einmal auf der Flucht vor zwanzig Jahren in Konstantinopel geholfen hatte. Der Türke hatte ihn einmal besucht; er wußte aber nicht, ob der Russe noch lebte. Als ich freigelassen wurde, ging ich trotzdem sofort hin. Es war selbstverständlich, daß ich das tat; ich hatte seit Jahren so gelebt. Leute, die auf der Flucht waren, mußten durch Zufälle weiterleben, und je unwahrscheinlicher sie waren, desto normaler kamen sie einem vor. Es waren die Märchen von heute; sie waren nicht sehr erheiternd, aber sie gingen überraschenderweise oft besser aus, als man erwartete.
Der Russe lebte in einem kleinen, sehr heruntergekommenen Hotel in der Nähe vom Broadway. Er nannte sich Meukow und nahm mich sofort auf. Als alter Emigrant hatte er einen Blick für das, was mir fehlte: ein Unterkommen und Arbeit. Das Unterkommen war leicht gefunden; er hatte eine zweite Bettstelle, die er in seinem Zimmer unterbrachte. Zu arbeiten war mir mit einem Touristenvisum verboten, ich hätte dafür ein anderes haben müssen: ein Einreisevisum mit einer Quotanummer. Ich mußte also heimlich arbeiten. Ich kannte das aus Europa, und es störte mich nicht besonders; ich hatte auch noch etwas Geld.
»Haben Sie eine Ahnung, wovon Sie leben könnten?« fragte mich Meukow.
»Ich habe in Frankreich zuletzt als Schlepper für Händler mit zweifelhaften Bildern und falschen Antiquitäten gelebt.«
»Verstehen Sie etwas davon?«
»Nicht viel, aber einiges von den üblichen Praktiken.«
»Wo haben Sie es gelernt?«
»Ich war zwei Jahre im Museum in Brüssel.«
»Angestellt?« fragte Meukow überrascht.
»Versteckt«, antwortete ich.
»Vor den Deutschen?«
»Vor den Deutschen, die Belgien eingenommen hatten.«
»Zwei Jahre?« sagte Meukow. »Und man hat Sie nicht gefunden?«
»Mich nicht. Aber nach zwei Jahren den, der mich versteckt hat.«
Meukow sah mich an. »Sie sind entkommen?«
»Ja.«
»Haben Sie von dem anderen noch etwas gehört?«
»Das Übliche. Man hat ihn in ein Lager gebracht.«
»War er Deutscher?«
»Belgier. Direktor des Museums.«
Meukow nickte. »Wie konnten Sie so lange unentdeckt bleiben?« fragte er dann. »Kamen keine Besucher in das Museum?«
»Doch. Tagsüber war ich im Keller in einem Abstellraum eingeschlossen. Abends kam der Direktor, brachte mir Essen und ließ mich über Nacht heraus. Ich blieb im Museum; aber ich konnte aus dem Keller heraus. Licht durfte ich natürlich nicht machen.«
»Wußten andere Angestellte davon?«
»Nein. Der Abstellraum hatte keine Fenster. Ich mußte still sein, wenn jemand in den Keller kam. Am meisten Sorge hatte ich davor, zur falschen Zeit niesen zu müssen.«
»Hat man Sie so entdeckt?«
»Nein. Es war jemand aufgefallen, daß der Direktor so oft abends im Museum blieb, – oder noch einmal zurückging.«
»Ich verstehe«, sagte Meukow. »Konnten Sie lesen?«
»Nur nachts, im Sommer und wenn der Mond schien.«
»Aber Sie konnten nachts im Museum umhergehen und die Bilder ansehen?«
»Solange man sie sehen konnte.«
Meukow lächelte plötzlich. »Ich mußte auf der Flucht aus Rußland einmal sechs Tage an der finnischen Grenze unter dem Holzstapel eines Blockhauses liegen. Als ich herauskam, dachte ich, es wäre viel länger gewesen. Mindestens vierzehn Tage. Aber ich war jung damals; dann vergeht die Zeit ohnehin langsamer. Sind Sie hungrig?« fügte er ohne Übergang hinzu.
»Ja«, sagte ich erstaunt, »sehr sogar.«
»Das dachte ich. Man ist immer hungrig, wenn man freigelassen wird. Gehen wir zur Apotheke, essen.«
»Zur Apotheke?«
»Zu einem Drugstore. Das ist eine der Eigentümlichkeiten des Landes. Man kann dort Aspirin kaufen und essen.«
»Was haben Sie tagsüber im Museum getan«, fragte Meukow, »um nicht irrsinnig zu werden?«
Ich blickte die Reihe der Leute entlang, die eilig an der langen Theke aßen, Reklameschilder und Medizinflaschen vor sich. »Was essen wir hier?« fragte ich zurück.
»Ein Hamburger. Neben Wiener Würstchen die Hauptnahrung des Volkes. Steaks sind zu teuer für den einfachen Mann.«
»Ich wartete auf den Abend. Ich benutzte natürlich jedes Mittel, um nicht immerfort an die Gefahr zu denken, in der ich war. Das hätte mich rasch verrückt gemacht. Dafür aber hatte ich schon etwas Training; ich war ja bereits einige Jahre unterwegs, eines davon in Deutschland auf der Flucht. Ich schaltete jeden Gedanken aus, etwas falsch gemacht zu haben; Reue zerfrißt die Seele gründlicher als Salzsäure, – sie ist etwas für ruhige Zeiten. Ich repetierte alles Französisch, das ich konnte, und gab mir selbst unzählige Nachhilfestunden. Dann begann ich, nachts in den Galerien des Museums umherzustreichen und die Bilder zu betrachten und mir einzuprägen. Bald kannte ich alle. Dann fing ich an, sie mir im Dunkel des Tages in meinem Gelaß vorzustellen. Ich ging dabei systematisch vor, Bild auf Bild, nicht wahllos, und brauchte oft viele Tage für ein einzelnes Gemälde. Ich hatte zwischendurch Verzweiflungsanfälle, aber ich begann immer wieder. Hätte ich einfach die Bilder betrachtet, wäre die Verzweiflung viel häufiger gewesen. Dadurch, daß ich eine Art Gedächtnisübung daraus machte, gab ich mir eine Chance, mich zu verbessern. Ich rannte nicht mehr gegen eine Wand; ich ging eine Treppe hinauf. Verstehen Sie das?«
»Sie blieben in Bewegung«, sagte Meukow. »Und Sie hatten ein Ziel. Das schützte Sie.«
»Ich lebte einen Sommer lang mit Cézanne und einigen Degas. Es waren natürlich Phantasiebilder und Phantasie-Vergleiche. Aber es waren trotzdem Vergleiche, und dadurch wurden sie eine Herausforderung. Ich memorierte die Farben und die Kompositionen; dabei hatte ich die Farben nie am Tage gesehen. Es waren Mondschein-Cézannes und Nacht-Degas, die ich auf ihre Schattenwerte memorierte und verglich. In der Bibliothek fand ich später Kunstbücher; ich hockte mich unter die Fenstersimse und studierte sie. Es war eine Gespensterwelt; aber es war eine Welt.«
»War das Museum nicht bewacht?«
»Nur am Tage. Abends wurde es abgeschlossen. Das war mein Glück.«
»Und das Unglück des Mannes, der Ihnen Essen brachte.«
Ich blickte Meukow an. »Und das Unglück des Mannes, der mich versteckt hatte«, erwiderte ich ruhig. Ich sah, daß er es richtig gemeint hatte; er wollte mir keine Rüge erteilen. Er sprach über Tatsachen, weiter nichts.
»Sie können nicht anfangen, als illegaler Tellerwäscher Ihren Unterhalt zu verdienen«, sagte er. »Das ist romantischer Unfug, vorbei mit den Gewerkschaften. Wie lange können Sie leben, ohne verhungern zu müssen?«
»Was kostet diese Mahlzeit?«
»Eineinhalb Dollar. Alles ist seit dem Krieg teurer geworden.«
»Krieg?« sagte ich. »Hier ist doch kein Krieg!«
»Doch!« erwiderte Meukow. »Wieder einmal zu Ihrem Glück. Man braucht Leute. Es gibt keine Arbeitslosen mehr. Sie werden leichter etwas finden.«
»Ich muß in zwei Monaten hier wieder heraus.«
Meukow lachte und schloß seine kleinen Augen. »Amerika ist sehr groß. Und es ist Krieg. Wieder zu Ihrem Glück. Wo sind Sie geboren?«
»Nach meinem Paß in Wien. In Wirklichkeit in Hannover.«
»Man wird Sie weder nach dem einen noch nach dem andern ausweisen können. Aber Sie könnten in ein Internierungslager kommen.«
Ich hob die Schultern. »Ich war in einem in Frankreich.«
»Geflohen?«
»Eher eines Tages weggegangen. In der allgemeinen Konfusion der Niederlage.«
Meukow nickte. »Ich war auch in Frankreich. In der allgemeinen Konfusion eines Sieges, der nur theoretisch war. Neunzehnhundertachtzehn. Ich kam aus Rußland über Finnland und Deutschland. Auf der ersten Welle der kleinen Völkerwanderung.«
Ich blickte auf. Einen Augenblick war alles außer Zusammenhang; das, was ich vor mir sah, die Lichter, die Leute, Wesen, die sich bewegten und unverständliche Geräusche ausstießen, schwankende Eiscrèmereklamen. Ich und die unverständliche Folge von Geschehnissen, die sich mein Dasein nannte, – es kreiste nicht, aber es hatte eine Sekunde lang keinen Namen mehr, entsetzlich fremd und unbeteiligt starrte es herauf, wachsam, finster und gefährlich, sehr nahe und sehr entfernt, in allen Lauten gedämpft, als wäre ich unter Wasser.
Es schien ziemlich lange zu dauern, bis ich Meukow wieder verstand. »Wissen Sie, was das Schlimmste ist?« sagte ich, noch nicht ganz wieder zurück. »Einem unerbittlichen Feinde völlig hilflos ausgeliefert zu sein, – nicht einmal einem persönlichen Feind.«
Meukow wiegte den Kopf, als schliefe er ein. »Oder sich selbst«, sagte er langsam.
»Nein«, erwiderte ich etwas ungeduldig. Ich kannte diese Phrasen zu gut; sie stimmten nicht.
Meukow betrachtete mich amüsiert. »Sie waren noch nicht ganz unten«, erklärte er dann. »Glauben Sie nicht, daß wir jetzt etwas Wodka gebrauchen könnten?«
»Ich habe gelernt, dem Schnaps zu mißtrauen«, erklärte ich. »Er hat mich einige Male dazu gebracht, mir selbst zuviel zu vertrauen. Zweimal mit scheußlichen Resultaten; Gefängnisse mit Ungeziefer.«
»Spanien?«
»Nordafrika.«
»Versuchen wir es das dritte Mal. Die Gefängnisse hier sind sauber. Ich habe Wodka im Hotel. Hier bekommt man nichts.«
»Das nennen Sie Krieg?« sagte ich und starrte in die Lichtkaskaden von Broadway. »Das letzte Licht, das ich so in Europa gesehen habe, war in Portugal; und das war ein neutrales Land. Sonst war Europa dunkel wie ein Kohlenschacht. Das Licht verkroch sich hinter schwarze Vorhänge und in die Erde.«
Das viele Licht machte mich fast schwindlig und in einer schwebenden Weise betrunken. Ich begriff, daß die ersten Feuer so gewirkt haben mußten in den Anfängen des Ichbewußtseins. Das Licht veränderte das Gewicht des Körpers; es machte ihn leichter, als schwimme er in einem sanften, durchsichtigen, goldenen Öl. Mir schien, als könnte man nie sehr traurig sein in soviel Licht, in dem man schwebte und das einen durchdrang und durchleuchtete. Es war eine wunderbare Verschwendung, – die wunderbarste, die es gab: die gegen die Nacht der Zellen und die Starrheit des Todes, – es war Land, dem Kosmos abgerungen, der fliegenden Dunkelheit, übermütig, schrecklich, voll von Hybris und Jugend, Empörung und festlicher Rebellion gegen die Gesetze der Natur. Welch ein Krieg, dachte ich, der so geführt wird!
Ich konnte nicht genug bekommen! Ich starrte in die funkelnden Kinos und die Neonreklamen über den Dächern, in die Spielsäle mit den grell beleuchteten Automaten, in die Läden, die auch nachts noch offen waren und voll von elektrischem Licht, in die Restaurants mit ihren Kronleuchtern und den zahllosen Appliken aus Seide, Pergament und flüssigem Gold, – ich hatte zu lange bei Kerzen, Taschenlampen und dürftigem, abgeschirmtem und gefangenem rötlichen Licht gelebt, um nicht aus der Gewohnheit des Schauens herausgeworfen zu werden in ein leichtes Delirium durch dieses sorglose, verschwenderische Licht, das überall sprühte in Fontänen von gewichtslosem, buntem Wasser, hochgeschleudert zum schwarzen Himmel aus einer hellen Stadt mit den riesigen Bienenkörben der Wolkenkratzer, in denen der Lichtschaum wie Honig schimmerte.
»Zu dieser Stadt habe ich zwei Monate herübergestarrt«, sagte ich zu Meukow. »Jeden Tag und jede Nacht von Ellis Island aus.«
»Zu diesem Land«, erwiderte er.
»Zu dieser Stadt und zu diesem Land. Ist das nicht dasselbe?«
»Nein«, sagte Meukow.
»Wir saßen in Ellis Island wie in einer gestrandeten Arche. Weshalb hat man den Türken nicht hereingelassen?«
»Wahrscheinlich wegen Schmuggelverdacht. Er war schon einmal hier. Heroin. Man hat ihn später einmal vernommen, als man es herausgekriegt hat. Ich dachte, er würde nicht wieder kommen. Aber zehn Jahre ist eine lange Zeit; er hat wohl gelaubt, alles sei längst vergessen. Das mag so sein bei Morden, – nicht bei Heroin.«
Wir blieben vor der Auslage eines Restaurants stehen. Es war lange her, daß ich so viele Speisen zusammen gesehen hatte, und ich hätte geglaubt, daß dieser Überfluß der erste wäre, was den größten Eindruck auf mich machen würde. Aber es war das Licht, – nicht diese Sammlung von geschlachteten Tieren, Schinken, Hühnern und Torten.
»Sind Sie ein Romantiker?« fragte Meukow.
»Nicht sehr oft. Die Polizei faßt Romantiker leichter als andere.«
»Daran brauchen Sie doch für zwei Monate nicht zu denken.«
»Das ist wahr. Ich bin noch nicht daran gewöhnt.«
Wir gingen zum Hotel Meukows zurück, aber ich hielt es nicht lange da aus. Ich wollte nicht trinken, ich wollte auch nicht in dem verbrauchten Plüsch dort sitzen; und Meukows Zimmer war zu klein. Ich wollte noch einmal hinaus; man hatte mich lange genug eingesperrt. Selbst Ellis Island war ein komfortables, Gefängnis gewesen. Meukows Bemerkung saß mir noch im Kopf; ich hätte für die nächsten zwei Monate nichts von der Polizei zu fürchten. Das war eine unwahrscheinlich lange Zeit. »Wie lange kann ich noch weggehen?« fragte ich.
»Solange Sie wollen.«
»Wann gehen Sie schlafen?«
Meukow machte eine wegwischende Bewegung. »Nicht vor morgen früh. Ich habe jetzt zu tun. Wollen Sie eine Frau suchen? Das ist in New York nicht so einfach wie in Paris. Und etwas gefährlicher.«
»Nein. Ich will noch etwas herumlaufen.«
»Eine Frau finden Sie leichter hier im Hotel.«
»Ich brauche keine.«
»Man braucht immer eine.«
»Nicht heute.«
»Sie sind also doch ein Romantiker«, sagte Meukow. »Merken Sie sich die Nummer der Straße hier und den Namen des Hotels: Hotel Reuben. Man findet sich in New York leicht zurecht; fast alle Straßen haben hier Nummern, – wenige haben Namen.«
So wie ich, dachte ich, – eine Nummer mit irgendeinem Namen. Es war eine wohltuende Anonymität; ich hatte unter Namen genug Schwierigkeiten gehabt.
Ich ließ mich durch die anonyme Stadt treiben, deren heller Rauch zum Himmel stieg. Eine Feuersäule bei Nacht und eine Wolkensäule bei Tag, – war das nicht, wie Gott dem ersten Volk der Emigranten in der Wüste den Weg wies? Ich ging durch einen Regen von Worten, Lärm, Gelächter und Schreien, der blind auf meine Ohren schlug, – ich verstand nur den Lärm, nicht den Sinn, so wie ich das Licht verstand, aber schon nicht mehr immer, was es meinte. Ein jeder schien mir hier, nach den dunklen Jahren in Europa, ein Prometheus zu sein, – der schweißige Mann, der mir, von Elektrizität umwittert, aus einer Ladentür beschwörend einen Arm voll Socken und Handtücher zum Kaufen entgegenhielt, ebenso wie der Koch, der in einer großen Pfanne Pizza briet, von Funken umsprüht wie ein neapolitanischer Gott. Da ich sie nicht verstand, waren sie alle ihrer Handlungen in einem leicht symbolischen Sinne entkleidet. Sie wirkten für mich, als ständen sie auf einer Bühne; sie waren nicht nur Kellner, Köche, Anreißer und Verkäufer, sondern gleichzeitig Marionetten, die ein unverständliches Spiel miteinander spielten, von dem ich ausgeschlossen war und von dem ich nur die Umrisse wahrnahm. Ich war mitten unter ihnen und gehörte doch nicht dazu, war entfernt durch etwas Unsichtbares, nicht durch eine Glaswand und nicht durch eine Distanz, nicht durch Feindseligkeit und nicht durch Fremde, sondern durch etwas, was nur mich allein anging und nur aus mir kam. Dunkel begriff ich, daß es ein einmaliger Augenblick war, – daß er nie so wieder kommen würde, im Gegenteil, – es konnte gut sein, daß ich schon morgen den Kampf begonnen hatte mit Ducken und Feilschen und Verfälschen und der Traube aus Halblügen, aus der jeder Tag bestand, – aber heute nacht hielt mir die Stadt ihr unbeteiligtes Gesicht entgegen wie eine Monstranz: klar, in feinstem Filigran, noch ohne mich aufgenommen zu haben in ihre Mühlen, gleich zu gleich, als hielte die Minute den Atem an und die Balance der großen Waage im Dunkel sei einen Moment lang ausgeglichen, passiv und aktiv in einem, wie bei jenen mystischen Zäsuren, in denen das Leben plötzlich in sich selbst erschauert, und es unbestimmt ist und ganz einem selbst anheimgegeben, ob man abstürzen wird oder nicht.
Ich wußte plötzlich, daß jetzt, wo ich an dieser fremden Küste angelangt war, die Gefahr vorbei zu sein schien, sie erst wirklich begann. Nicht die äußere, – die von innen. Ich war so lange mit einfachem Überleben beschäftigt gewesen, daß darin gleichzeitig meine Protektion gelegen hatte. Es war primitives Überleben gewesen, wie das kurz vor der Panik beim Schiffsuntergang, mit keinem andern Ziel als dem zu überleben. Jetzt, schon von morgen an, sogar von dieser sonderbaren Stunde an, würde sich das Leben wieder fächerförmig vor mir ausbreiten, es würde wieder eine Zukunft haben, aber auch eine Vergangenheit, eine Vergangenheit, die mich leicht erschlagen konnte, wenn ich sie nicht vergaß oder sie bewältigen konnte. Ich wußte plötzlich, daß das Eis, das sich gebildet hatte, noch für lange Zeit zu dünn sein würde, um darauf zu gehen. Ich würde einbrechen. Ich mußte es vermeiden. Aber ich spürte auch, daß aus diesem anonymen Lärm aus Gier, herrlichem Licht, Schweiß und Gestank, der mich wie einen illegitimen Wanderer in einer geschäftigen Wüste anwehte, aus diesem Stummfilm mit nicht dazu passendem Tonband, mehr hervorbrach als nur eine überraschende Verzauberung durch Licht, Farbe, Nichtverstehen und der kindischen Sicherheit trügerischen Nichtverstehens: es war das Leben selbst, das sich aus der Abkapselung nußharter Notwendigkeit wieder öffnen wollte, zu Ruf und Frage, zu Blick und Einblick, mit dem weichen Morast der Erinnerung und der Verführung einer noch unfaßlichen, scheuen Hoffnung. Gab es das denn? Dachte ich und starrte auf eine von Chrom blitzende Reihe von Spielautomaten, die glänzenden Kassen glichen und vor denen intensive Gnomen hockten, – konnte das denn möglich sein? War nicht alles vertrocknet und abgestorben, und war vielleicht das Unmögliche möglich, trotzdem möglich, gab es eine Chance, das Überleben in Weiterleben und Leben zu verwandeln? Gab es das: noch einmal, von vorn, so wie die Sprache, die neue unbekannte, die vor mir lag, um gedeutet zu werden, gab es auch noch einmal das Leben, und war es nicht Verrat, war es kein Mord, doppelter Mord an geliebten Toten?
Ich drehte mich rasch um und ging zurück, verwirrt und tief aufgerührt, ich blickte nicht mehr umher, und ich war fast atemlos, als ich die kleine Leuchtschrift des Hotels vor mir sah, – nicht breit und waagrecht und siegreich wie andere, sondern schmal und trübe, gerade ein paar Buchstaben, nicht mehr.
Ich trat durch die Tür, die mit falschen Marmorleisten verunziert war, von denen zwei fehlten, und sah Meukow hinter der Theke in einem Schaukelstuhl dösen. Er öffnete die Augen, die für einen Augenblick liderlos wie die eines alten Papageien wirkten, dann wurden sie blau und hell. »Spielen Sie Schach?« sagte er und erhob sich.
»Wie jeder Emigrant.«
»Gut. Ich hole den Wodka.«
Er ging die Treppe hinauf. Ich sah mich um. Mir war schon, als wäre ich nach Hause gekommen. Wer nirgendwo zu Hause war, spürte das leicht.
II
In den nächsten Wochen verschob sich das Verhältnis meines doppelten Alters rasch. Von 10 zu 35 Jahren stand es nach zwei Wochen auf 12 zu 35. Weitere vierzehn Tage später hatte ich bereits die oberflächlichen Kenntnisse im Englischen eines Fünfzehnjährigen. Ich saß morgens mit einer Grammatik für einige Stunden im roten Plüsch des Hotels Reuben herum und suchte nachmittags jede sich bietende Gelegenheit zu englischer Konversation. Ich ging dabei ohne Scham und Scheu vor. Als ich merkte, daß ich nach zehn Tagen mit Meukow einen russischen Akzent bekam, wandte ich mich an Gäste und Angestellte des Hotels. Ich bekam nacheinander einen deutschen, jüdischen, französischen und zum Schluß, als ich ganz sicher bei den Aufwartefrauen und Stubenmädchen auf waschechte Amerikanerinnen gestoßen zu sein glaubte, einen schweren Brooklyn-Akzent.
»Du mußt ein Verhältnis mit einer jungen Amerikanerin anfangen«, sagte Meukow, mit dem ich mich inzwischen duzte.
»Aus Brooklyn?« fragte ich.
»Lieber aus Boston. Dort spricht man am besten.«
»Warum nicht mit einer Lehrerin aus Boston? Das wäre noch ökonomischer.«
»Dieses Hotel ist leider eine Karawanserei. Hier fliegen die Akzente umher wie Typhusbazillen; und du hast leider nur ein gutes Ohr für das Extreme, aber gar keines für das Normale. Emotion würde da vielleicht helfen.«
»Wladimir«, sagte ich. »Die Welt verändert sich mir ohnehin schon rapide genug. Alle paar Tage wird mein englisches Ich ein Jahr älter, zu meinem Bedauern entzaubert sich dabei auch seine Welt. Je mehr ich verstehe, desto mehr schwindet das Geheimnis. Noch ein paar Wochen und meine beiden Ichs halten sich die Waage. Das amerikanische ist dann ebenso ernüchtert wie das europäische. Laß mir deshalb Zeit! Auch mit den Akzenten. Ich möchte meine zweite Kindheit nicht zu schnell verlieren.«
»Das wirst du nicht. Vorläufig hast du erst den geistigen Horizont eines melancholischen Gemüsehändlers. Des Gemüsehändlers an der Ecke, Annibale Balbo. Du gebrauchst sogar schon seine italienischen Sprachbrocken; sie schwimmen wie Fleischstücke in deiner englischen Minestrone herum.«
»Gibt es auch normale, echte Amerikaner?«
»Natürlich. Aber New York ist der große Einfallshafen der Emigranten, – der irischen, italienischen, deutschen, jüdischen, armenischen, russischen und noch einem Dutzend anderer. Wie sagt man bei euch: Hier bist du Mensch, hier darfst du’s sein? Hier bist du Emigrant, hier darfst du’s sein. Dieses Land ist von Emigranten gegründet worden. Wirf also deine europäischen Minderwertigkeitskomplexe ab. Hier bist du wieder Mensch. Nicht mehr ein wundes Stück Fleisch, das an einem Paß klebt.«
Ich blickte vom Schachbrett auf. »Das ist wahr, Wladimir«, sagte ich langsam. »Wir wollen sehen, wie lange es dauert.«
»Glaubst du nicht, daß es dauert?«
»Wie könnte ich?«
»Was glaubst du eigentlich?«
»Daß alles immer schlimmer wird«, sagte ich.
Jemand hinkte in den Vorraum. Wir saßen im Halbdunkel, und ich konnte den Mann nur ungenau sehen; aber sein merkwürdiges Hinken, in einer Art von Dreivierteltakt, fiel mir auf und erinnerte mich vage an einen Bekannten. »Lachmann«, sagte ich halblaut.
Der Mann blieb stehen und blickte zu mir herüber. »Lachmann!« wiederholte ich.
»Ich heiße Merton«, sagte der Mann.
Ich knipste das Licht an, das trostlos gelb und blau aus einem bescheidenen Lüster des schlechtesten Jugendstils an der Decke tropfte. »Mein Gott, Robert«, sagte der Mann. »Du lebst? Ich dachte, du wärest längst tot!«
»Das dachte ich auch von dir! Ich habe dich an deinem Schritt wiedererkannt.«
»An meinem Trochäen-Gehinke?«
»An deinem Walzerschritt, Kurt. Kennst du Meukow?«
»Natürlich kenne ich ihn.«
»Wohnst du etwa hier?«
»Nein. Aber ich komme manchmal her.«
»Und du heißt jetzt Merton?«
»Ja. Und du?«
»Ross. Der Vorname stimmt noch.«
»So trifft man sich wieder«, sagte Lachmann mit einem dünnen Lächeln.
Wir schwiegen beide. Es war die alte Verlegenheitspause zwischen Emigranten. Man wußte nicht, wer tot war.
»Hast du noch etwas von Cohn gehört?« sagte ich dann.
Auch das war die alte Technik. Man fragte zuerst vorsichtig nach Leuten, die einem nicht sehr nahe gewesen waren. »Er ist in New York«, erwiderte Lachmann.
»Er auch? Wie ist er herübergekommen?«
»Wie sind wir alle herübergekommen? Durch hundert Zufälle. Keiner von uns war auf der Liste der Intelligenz, die von Amerika zur Rettung markiert wurde.«
Meukow drehte das Licht wieder ab und holte eine Flasche unter der Theke hervor. »Amerikanischer Wodka«, sagte er. »Ähnlich wie kalifornischer Bordeaux und Burgunder aus San Francisco. Oder Rheinwein aus Chile. Salut. Einer der Vorteile der Emigration ist, daß man so oft Abschied nehmen muß und dann ein Wiedersehen feiern kann. Gibt einem die Illusion eines langen Lebens.«
Weder Lachmann noch ich antworteten. Meukow kam von einer anderen Generation, – der von 1917. Was für uns noch brannte, war für ihn schon Erinnerung geworden. »Salut, Wladimir«, sagte ich schließlich. »Warum sind wir nicht alle als Jogis geboren worden?«
»Ich wäre schon zufrieden gewesen, nicht in Deutschland als Jude auf die Welt zu kommen«, erklärte Lachmann-Merton.
»Ihr seid die Vorhut der Weltbürger«, erwiderte Meukow ungerührt. »Benehmt euch zumindest wie Pioniere. Man wird euch einmal Denkmäler setzen.«
»Wann?« sagte Lachmann.
»Wo?« fragte ich. »In Rußland?«
»Auf dem Mond«, erklärte Meukow und ging zur Registriertheke, um einen Schlüssel herauszugeben.
»Ein Witzbold«, sagte Lachmann und sah hinter ihm her. »Arbeitest du für ihn?«
»Was?«
»Mädchen. Gelegentlich etwas Morphium und dergleichen. Wetten auch, glaube ich.«
»Bist du deswegen hier?«
»Nein. Ich bin verrückt nach einer Frau. Stell dir das vor, – sie ist fünfzig, aus Puerto Rico, katholisch und hat nur einen Fuß. Der andere ist ihr abgefahren worden. Sie hat ein Verhältnis mit einem Mexikaner. Der Mexikaner ist ein Pimp. Für fünf Dollar würde er sogar das Bett für uns machen. Aber sie will nicht. Absolut nicht. Sie glaubt, daß Gott aus einer Wolke zuschaue. Auch nachts. Ich habe ihr gesagt, Gott sei kurzsichtig; seit langem. Nichts zu machen. Aber sie nimmt Geld. Und verspricht. Und lacht dann. Und verspricht wieder. Was sagst du dazu? Bin ich deswegen nach Amerika gekommen? Es ist trostlos!«
Lachmann hatte einen Komplex, weil er hinkte. Nach seinen Erzählungen war er früher ein mächtiger Frauenjäger gewesen. Ein SS-Sturm, der davon gehört hatte, hatte ihn in Wilmersdorf in sein Sturmlokal geschleppt, um ihn zu kastrieren, war aber dabei von der Polizei – es war 1934 – gestört worden. Lachmann hatte nur ein paar Narben und ein viermal gebrochenes Bein davongetragen, das schlecht verheilt war. Seitdem hinkte er und bekam eine Vorliebe für Frauen mit leichten Körperfehlern. Alles war ihm gleich, solange sie dicke, harte Hintern hatten. In Frankreich hatte er seiner Jagdlust unter den schwierigsten Verhältnissen gefrönt. Er behauptete, einmal in Rouen eine Frau mit drei Brüsten, die dazu noch auf dem Rücken lagen, gekannt zu haben. Die Venus Anadyomene war für ihn dagegen eine traurige Mißbildung gewesen, da die Dame aus Rouen alles für seine Augen parat gehabt habe, ohne daß er sie umdrehen mußte. »Dazu steinhart!« sagte er schwärmerisch. »Heißer Marmor!« Die Polizei hatte ihn in Rouen zweimal erwischt: das erstemal war er in die Schweiz ausgewiesen worden. Noch in derselben Nacht hatte er die Grenze bei Annemasse wieder passiert und sich dann, wie ein Nachtpfauenauge-Schwärmer nach seinem Weibchen im Drahtkäfig über viele Kilometer hinweg, unbeirrt auf den Weg zurück nach Rouen gemacht, wo er der Polizei sofort wieder in die Arme lief. Vier Wochen Gefängnis und erneute Ausweisung. Lachmann wäre trotzdem zurückgekehrt, wenn die Deutschen nicht inzwischen Rouen besetzt gehabt hätten.
»Du hast dich aber nicht geändert, Kurt«, sagte ich.
»Man ändert sich nie. Man schwört es sich tausendmal. Man tut es sorgsam manchmal, wenn man am Boden liegt. Aber kaum kann man wieder schnaufen, vergißt man es.« Lachmann schnaufte selbst. »Ist das eigentlich heldenhaft oder idiotisch?«
Ich bemerkte, daß dicke Schweißtropfen auf seiner faltigen, grauen Stirn standen. »Heldenhaft«, sagte ich. »In unserer Situation soll man sich nur mit den besten Adjektiven schmücken. Wer seine Seele zu sehr erforscht, stößt ohnehin bald auf ein Sieb, das in die Abwässer dreckiger Kanäle führt.«
»Du bist auch derselbe geblieben.« Lachmann-Merton wischte den Schweiß mit einem zerknüllten Taschentuch fort. »Immer noch die Lust an populärer Philosophie, was?«
»Ich kann’s nicht lassen. Es beruhigt mich.«
Lachmann grinste unvermittelt. »Es gibt dir ein Gefühl billiger Überlegenheit, das ist es.«
»Überlegenheit kann gar nicht billig genug sein.«
Lachmann klappte den Mund zu. »Ich soll reden«, seufzte er dann und holte aus der Seitentasche seiner Jacke ein in Seidenpapier eingewickeltes Päckchen hervor. »Ein Rosenkranz«, sagte er. »Vom Papst persönlich geweiht. Echt Silber und Elfenbein. Glaubst du, das könnte sie weich machen?«
»Von welchem Papst?«
»Pius! Von wem sonst?«
»Benedikt XV. wäre besser gewesen.«
»Was?« Er sah mich irritiert an. »Der ist doch tot. Warum?«
»Er hätte mehr Überlegenheit gehabt. Tote haben mehr. Und nicht so billige.«
»Ach so! Auch ein Witzbold! Ich hatte das vergessen. Das letztemal, als ich dich –«
»Halt!« sagte ich.
»Was?«
»Halt, Kurt. Weiter nichts!«
»Na schön.« Lachmann zögerte einen Augenblick. Dann siegte sein Mitteilungsbedürfnis. Er wickelte ein hellblaues Seidenpapier aus. »Ein kleines Stück aus Gethsemane; von den Bäumen am Ölberg dort. Original, mit Stempel und schriftlicher Bestätigung. Wenn sie da nicht schmilzt, was?« Er starrte mich flehentlich an.
»Sicher. Hast du keine Flasche Jordanwasser?«
»Nein, habe ich nicht.«
»Füll eine ab.«
»Was?«
»Füll eine ab. Draußen ist ein Hahn. Tu etwas Staub hinein, damit es echter aussieht. Niemand kann es kontrollieren. Du hast schon beglaubigte Rosenkränze und Ölbaumzweige, – da darf Jordanwasser nicht fehlen.«
»Aber doch nicht in einer Wodkaflasche!«
»Warum nicht? Wasch das Etikett ab. Die Flasche sieht sehr orientalisch aus. Deine Puertoricanerin trinkt sicher keinen Wodka. Höchstens Rum.«
»Whisky. Da staunt man, was?«
»Nein.«
Lachmann dachte nach. »Man müßte die Flasche versiegeln; dann sähe sie echter aus. Hast du Siegellack?«
»Was sonst noch? Visa und Pässe? Woher soll ich Siegellack haben?«
»Man hat manchmal die sonderbarsten Sachen bei sich. Ich habe jahrelang eine Kaninchenpfote –«
»Vielleicht hat Meukow welchen.«
»Klar. Er versiegelt doch andauernd Päckchen. Daß ich nicht daran gedacht habe!«
Lachmann hinkte hinaus.
Ich lehnte mich zurück. Es war ganz dunkel geworden. Schatten und Gespenster stürzten durch die helle Tür nach draußen in den Abend. In dem Spiegel gegenüber hockte ein fahles Grau, das vergeblich zu etwas Silber werden wollte. Die Plüschsessel wirkten violett, sie schienen mir einen Augenblick, als wäre auf ihnen Blut eingetrocknet. Sehr viel Blut. Wo hatte ich das doch gesehen? Das Blut auf Leichen in einem kleinen, grauen Zimmer, hinter dessen Fenstern ein gewaltiger Sonnenuntergang leuchtete, das alles im Zimmer sonderbar farblos machte in einer Mischung aus Grau und Schwarz und diesem dunklen Rot und Violett, – alles, bis auf das Gesicht vor dem Fenster, das sich plötzlich abwandte und von der sterbenden Sonne voll getroffen wurde, eine Hälfte feurig überströmt, die andere im Schatten, und die Stimme, etwas sächsisch gefärbt, überraschend hoch und dünn, die sagte: Weitermachen! Die nächsten!
Ich drehte mich um und knipste das Licht an. Es hatte Jahre gedauert, bevor ich ohne Licht schlafen konnte; und wenn ich es mußte, war ich aus scheußlichen Träumen aufgeschreckt. Noch jetzt tat ich es ungern und ich schlief auch nicht gerne allein.
Ich stand auf und ging hinaus. Lachmann stand mit Meukow an der kleinen Theke am Eingang. »Es klappt«, sagte er triumphierend. »Schau es dir an! Wladimir hat eine russische Münze, damit siegeln wir den Korken zu. Kyrillische Schriftzeichen! Wenn das nicht aussieht, als hätten es die griechischen Väter in einem Kloster am Jordan abgefüllt!«
Ich sah den Siegellack auf den Korken tropfen, hellrot im Licht der Kerze, die auf dem Holz daneben stand. Was ist mit mir los? dachte ich. Es ist doch alles vorbei! Ich bin doch gerettet! Da draußen ist das Leben! Gerettet! Aber war ich gerettet? War ich wirklich entkommen? Auch den Schatten?
»Ich gehe noch etwas raus«, sagte ich, »habe den Kopf zu voll von Vokabeln! Muß ihn mir leer schütteln. Servus!«
Die Straße empfing mich mit dem tröstlichen Lärm des Abends. Ein paar Schritte vom Hotel entfernt waren zwei Autos miteinander verhakt, ein Taxi und ein Privatwagen. Der Taxichauffeur stand vor seinem Wagen und kratzte sich den Kopf. »Listen, Lady«, sagte er.
Er kam nicht weiter. »Sie Holzkopf!« sagte eine sehr mütterliche und freundlich aussehende ältere Frau leise aus ihrem Fenster heraus. »Schlafen Sie am hellen Tag? Lassen Sie sich Ihr Lehrgeld wiedergeben, Sie verkümmerter Hummer! Rast mit seiner Ruine in meinen neuen Chevrolet rein! Sie –«
»Listen, Lady, Sie haben –«
»Widersprechen Sie mir nicht, Sie Lügner! Jeder hat es gesehen! Sie sind schuld! Sie allein! Sie –«
»Aber meine Dame –«
»Seht ihr! Schon lügt er! Typisch! Sie –«
»Aber meine Dame –«
»Den Kotflügel hat er mir eingebeult, der Esel! Blind wie eine Fledermaus, wahrscheinlich schon betrun–«
»Aber meine Dame, Sie –«
»Reden Sie nicht! Versuchen Sie nicht –«
Das mütterliche und freundliche Gesicht veränderte sich kaum. Hätte ich die Szene vor vier Wochen beobachtet, so hätte ich geglaubt, es handle sich um ein harmloses Gespräch unter guten Bekannten; die Frau hob die Stimme nicht, sie sprach leise, kultiviert, fast nachdenklich, sie schien den Taxichauffeur kaum zu bemerken, – aber die Beschimpfungen ergossen sich über ihn wie ein sanfter Regen, unaufhörlich, murmelnd und nicht schlecht gezielt, soweit ich bei meiner beschränkten Sprachkenntnis beurteilen konnte.
»Aber Lady«, kam der Chauffeur endlich durch. »Sie sind ja auf der linken Seite! Ganz links!«
»Und? Was hat das damit zu tun, daß Sie nicht fahren können! Heißt das, daß Sie nicht aufpassen müssen? Fangen Sie nicht mit diesen sinnlosen Beschuldigungen an! Sehen Sie lieber an, was Sie angestellt haben! Den ganzen Kotflügel eingedrückt haben Sie mir!«
»Sie sind doch versichert«, sagte jemand von der Seite her. »Die Versicherung zahlt doch!«
»Und meine Tochter? Das ist der Wagen meiner Tochter!«
Ich ging weiter. Die mütterliche Frau war im Unrecht, das konnte jeder sehen. Plötzlich lösten sich die Wagen voneinander. Ein paar Chauffeure hatten sie angehoben und die Stoßstangen getrennt. Der Taxichauffeur holte einen Block Papier von seinem Wagen. Die Frau hielt inne, neigte leicht den Kopf, zwitscherte »Vielen Dank!« und fuhr rasch an.
»He, Lady«, rief der Taxichauffeur. »Ihre Nummer –«
Er kam zu spät. Der Chevrolet war bereits verschwunden. »Hat sich jemand die Nummer gemerkt?« fragte er, einen Bleistiftstummel in der Hand. »Jemand muß sich doch die Nummer gemerkt haben. Ich muß es sonst selbst bezahlen!«
Die Leute schüttelten die Köpfe und wichen zurück. Keiner wußte plötzlich etwas. Niemand wollte Zeuge sein. Nur keine Scherereien! Wer hatte schon Zeit, vor irgendeinem Gericht zu erscheinen? Das gab es also auch hier.
Meukow hatte seinen Dienst angetreten, als ich zurückkam. Er war alles mögliche zu gleicher Zeit; manchmal Tagesportier, manchmal Nachtportier und zwischendurch auch noch Vertreter für kleinere Aushilfsstellungen. Im Augenblick war er für eine Woche Nachtportier.
»Wo ist Lachmann?« fragte ich.
»Oben bei seiner Angebeteten.«
»Glaubst du, daß er heute Glück haben wird?«
»Nein. Sie wird ihn mit dem Mexikaner zum Essen nehmen. Er darf bezahlen. War er immer so?«
»Ja. Er hatte nur mehr Glück. Seine Vorliebe für Krüppel und Mißgestaltete hat er erst, seitdem er hinkt, behauptet er. Früher sei er normal gewesen. Vielleicht stimmt es, vielleicht hat er eine so zarte Seele, daß er sich vor schönen Frauen schämen würde. Wer weiß das! Wir haben gewisse Schablonenbegriffe, die wir übernehmen, ohne sie je zu kontrollieren. Zum Beispiel, daß eine empfindsame Seele sich nicht mit einem robusten Sex verträgt.«
Meukows Gesicht hatte plötzlich eine Menge Falten; wenn er vergnügt war, wurden seine Augen kleiner und seine Ohren größer und spitzer. »Es gibt schlimmere Kombinationen.«
»Ich weiß. Die von Himmler, der Angorakaninchen zärtlich liebt. Oder die vom Konzentrationslagerschlächter, der Chopin spielt. Laß uns heute nicht darüber reden, laß uns Schach spielen.«
»Oder die vom heimatlosen Russen, der Kellner oder Taxichauffeur ist und abends zur Balalaika mit Wodka sein elendes Leben verflucht.«
Ich lachte. »Sind die Russen der Emigration eigentlich oft erfolgreiche Geschäftsleute geworden?«
»Nein. Sie hatten es auch nicht gelernt. Eine Anzahl hat erfolgreich geheiratet, – die mit Titeln und andere, die vorgaben, welche zu haben. Einige sind Hotel-Manager geworden, nicht viele. Die meisten schlagen sich schlecht und recht durch und werden alt. Viele sind tot.«
»Das spricht eigentlich für die Russen.«
»Was? Daß sie gestorben sind?«
»Daß sie keine Geschäftsleute sind.«
Meukow stellte die Figuren auf. »Es ist gleichgültig«, sagte er. »Du glaubst nicht, wie gleichgültig vieles ist, wenn man alt wird.«
»Wie lange bist du schon hier?«
»Zwanzig Jahre.«
Ich sah einen Schatten durch die Tür kommen. Es war eine schmale, ziemlich große Frau mit einem kleinen Gesicht. Sie war blaß, hatte dunkelblonde Haare, die wirkten, als wären sie gefärbt, und graue Augen. Meukow stand auf. »Natascha Petrowna«, sagte er, »seit wann sind Sie zurück?«
»Seit zwei Wochen.«
Ich war aufgestanden. Die Frau war fast so groß wie ich. Sie trug ein enganliegendes Kostüm und schien sehr dünn zu sein. Sie hatte eine hastige Art zu sprechen, und die Stimme war etwas zu laut, als ob sie klirrte. »Einen Wodka«, sagte Meukow, »oder Whisky?«
»Einen Wodka. Aber nur einen Zentimeter. Ich muß weiter. Photographieren.«
»So spät noch?«
»Den ganzen Abend. Der Photograph ist nur abends frei. Kleider und Hüte. Kleine Hüte. Winzige.«
Ich sah erst jetzt, daß Natascha Petrowna selbst einen Hut trug; es war eher eine Kappe, ein schwarzes Nichts, das schief in ihrem Haar saß.
Meukow ging die Flasche holen. »Sie sind kein Amerikaner?« fragte das Mädchen.
»Nein. Deutscher.«
»Ich hasse die Deutschen!«
»Ich auch«, erwiderte ich.
Sie blickte mich überrascht an. »Ich meine das nicht persönlich.«
»Ich auch nicht.«
»Ich bin Französin. Sie müssen das verstehen. Der Krieg.«
»Ich verstehe es«, sagte ich gleichgültig. Es war nicht das erste Mal, daß ich für die Sünden des Regimes in Deutschland verantwortlich gemacht wurde. Mit der Zeit wurde man abgestumpft dagegen. Schließlich hatte ich dafür auch in einem Internierungslager in Frankreich gesessen; trotzdem haßte ich die Franzosen nicht. Aber es war überflüssig, das zu erklären. Wer so schlicht hassen oder lieben konnte, war um seine Primitivität zu beneiden.
Meukow kam mit der Flasche und drei sehr kleinen Gläsern, die er vollschenkte. »Nicht für mich«, sagte ich.
»Sind Sie beleidigt?« fragte das Mädchen.
»Nein. Ich möchte nur im Augenblick nichts trinken.«
Meukow schmunzelte. »Strasde«, sagte er und hob sein Glas.
»Eine Gabe der Götter«, erklärte das Mädchen und leerte seines mit einem kurzen Ruck wie ein Pony.
Ich kam mir ziemlich idiotisch vor, weil ich abgelehnt hatte, aber da war jetzt nichts mehr zu machen. Meukow hob die Flasche. »Noch einen, Natascha Petrowna?«
»Merci, Wladimir Iwanowitsch. Genug! Ich muß davon. Au revoir.«
Sie hielt mir die Hand hin. »Au revoir, Monsieur.«
Sie hatte einen kräftigen Druck. »Au revoir, Madame.«
Meukow, der mit hinausgegangen war, kam zurück. »Hat sie dich geärgert?«
»Nein!«
»Mach dir nichts draus. Sie ärgert jeden. Meint es aber nicht so.«
»Ist sie keine Russin?«
»Doch. In Frankreich geboren. Warum?«
»Ich habe einmal eine Zeitlang bei Russen gelebt. Es fiel mir auf, daß die Frauen es als Sport betrachteten, auf den Männern herumzuhacken. Mehr als andere.«
Meukow grinste. »Na, na! Aber was ist schlecht daran, einen Mann etwas aus dem Gleichgewicht zu bringen? Immer noch besser, als ihm morgens stolz die Knöpfe seiner Uniform zu putzen und die Stiefel, mit denen er dann die Hände von Judenkindern zertrampeln kann!«
Ich hob die Hände hoch. »Gnade! Heute scheint ein schlechter Tag für Emigranten zu sein. Gib mir lieber den Wodka, den ich vorhin nicht haben wollte.«
»Gut.«
Meukow horchte. »Da sind sie.«
Schritte kamen die Treppe herab. Ich hörte jetzt eine außerordentlich wohllautende, tiefe Frauenstimme. Es war die Puertoricanerin mit Lachmann. Sie ging vor Lachmann her, ohne sich darum zu kümmern, ob er mitkam. Sie hinkte nicht, und man konnte auch nicht sehen, daß sie einen künstlichen Fuß hatte.
»Sie holen den Mexikaner ab«, flüsterte Meukow.
»Armer Lachmann«, sagte ich.
»Arm?« erwiderte Meukow. »Er hat noch das, was er nicht hat!«
Ich lachte. »Das ist das einzige, was man immer behält, wie?«
»Arm ist man erst, wenn man nichts mehr will.«
»Na«, sagte ich. »Ich dachte, dann wäre man weise.«
»Ich meine es anders. Du bist übrigens schachmatt. Was ist heute los mit dir? Du spielst wie ein gefleckter Waldesel. Brauchst du eine Frau?«
»Nein.«
»Was ist denn los?«
»Allgemeine Abspannung, wenn die Gefahr vorbei ist«, sagte ich grinsend. »Solltest du aus deiner Jugend kennen.«
»Wir hockten immerfort zusammen. Du dagegen kümmerst dich nicht viel um andere Emigranten.«
»Ich will mich nicht erinnern.«
»Ist es das?«
»Und ich will nicht in die unsichtbare Gefängnisatmosphäre der Emigranten hinein. Ich kenne sie zu gut.«
»Du willst also ein Amerikaner werden.«
»Ich will gar nichts werden, ich möchte endlich einmal etwas sein. Wenn man es mir erlaubt.«
»Große Worte.«
»Man muß sich selbst Mut machen«, sagte ich. »Andere tun’s nicht.«
Wir spielten noch eine zweite Partie Schach. Ich verlor sie ebenfalls. Dann kamen die Bewohner des Hotels allmählich zurück, und Meukow mußte ihnen die Schlüssel aushändigen und Flaschen und Zigaretten heraufbringen. Ich blieb sitzen. Was war wirklich mit mir los? Ich beschloß, Meukow zu sagen, daß ich ein eigenes Zimmer nehmen wollte. Ich wußte nicht einmal genau, warum; wir störten uns gegenseitig nicht, und es war Meukow egal, ob ich bei ihm hauste oder nicht. Aber es schien mir plötzlich wichtig zu sein, wieder allein zu schlafen. In Ellis Island hatte ich in einem Saal mit anderen schlafen müssen; auch im Internierungslager in Frankreich war es so gewesen. Ich wußte, daß es mich an Zeiten erinnern würde, die ich lieber vergessen hätte, wenn ich wieder in einem Zimmer allein sein würde. Aber es half nichts, ich konnte diesen Erinnerungen nicht für immer ausweichen.
III
Ein Mensch«, sagte der ältere der zwei Lowybrüder, »hat einen sehr verschiedenen Wert. Vom Standpunkt der Chemie ist nicht viel an ihm dran. Etwa sieben Dollar an Eiweiß, Kalk und Zellulose. Er wird erst interessant, wenn man ihn vernichten will. Da ist sein Wert ziemlich gestiegen. Zur Zeit Caesars im Gallischen Krieg kostete es etwa siebzig Cent, einen Soldaten zu töten; zu Napoleons Zeiten, mit Artillerie und so weiter, schon über zweitausend Dollar, im Ersten Weltkrieg zehntausend, und in diesem jetzt, schätzt man, wird es fast fünfzigtausend kosten, einen Menschen umzubringen.«
Wir standen im Laden der Lowybrüder an der dritten Avenue, umringt von Möbeln, chinesischen Vasen, Krimskrams und echten und nicht ganz echten Antiken. Lowy war klein, dick, hatte Reste roter Haare hinten an seinem glänzenden Schädel wie Fransen hängen, und verwaschene blaue Augen.
»Dann wird der Krieg allmählich ausgerottet, weil er zu teuer wird?« sagte ich. »Auch ein moralischer Grund.«
»Leider nicht!« erwiderte Lowy prustend. »Die Militärs setzen große Hoffnungen auf die Atomwaffen. Durch sie wird eine Preisinflation in Massentöten vermieden. Man hofft, sogar das Niveau von Napoleon wiederzugewinnen.«
»Zweitausend Dollar pro Person?«
»Ja. Vielleicht noch weniger, dadurch daß man nicht nur Soldaten vernichtet, sondern auch Frauen und Kinder. Schließlich, Kinder wachsen ja auch zu Soldaten heran, und Frauen gebären Soldaten, – warum soll man sie da nicht unvorsichtigerweise gleich umbringen, bevor sie gefährlich werden? Der kluge Arzt wartet nicht, bis die Epidemie außer Kontrolle ist.«
Lowy starrte mich aus seinen hellen verzweifelten Augen an. »Unsere besten militärischen Köpfe haben bereits eine Formel gefunden. Sie erwarten so Großes von den neuen Bomben, daß sie für den nächsten Krieg – Sie wissen, Planung im voraus ist alles beim Militär –«
»Herr Lowy«, sagte ich, »wollen wir nicht abwarten, wie der jetzige ausgeht, bevor wir an den nächsten denken. Wie es heißt, soll dieser das Ende aller Kriege werden. Der letzte!«
Lowy schüttelte sich, als habe er Flöhe. »Das sagen die Politiker. Nicht die Generäle. Beide lügen. Die Schamlosigkeit ihrer Berufe läßt nicht zu, daß sie die Wahrheit sagen; sie läßt nicht einmal zu, daß sie sie kennen!«
Ich sah den aufgeregten kleinen Mann an. Er hatte eine echte Hanvase in der Hand, als wolle er sie durch das Schaufenster auf die Straße schleudern. Ich nahm sie ihm vorsichtig aus den Fingern und steckte dafür eine falsche Kwannon hinein, um die es nicht schade war, wenn er sie zerschmetterte. »Kennen Sie die Wahrheit?« fragte ich.
»Weichen Sie nicht aus! Natürlich kenne ich sie. Du sollst nicht töten! Liebe Deinen Nächsten! Basta! Aber wo wären die Politiker und Generäle, wenn das Gesetz wäre?« Lowy griff nach einer Zigarre. Es gelang ihm, sie anzuzünden, ohne die Kwannon aus den Händen zu verlieren. »Wissen Sie was?« fauchte er zwischen Wolken blauen Rauches, den er ausstieß wie eine anfahrende Lokomotive. »Man hat sogar schon eine neue Sprache erfunden, um das menschliche Gemüt zu schonen. Millionen Tote! Seit wir mit dem vorletzten Krieg in die Millionen gekommen sind, wirkte das immer verletzend. Beim nächsten werden unsere Militärs von Mega-Toten reden – Zehn Mega-Tote sind zehn Millionen alter Toter. Das klingt doch viel besser! Fünfzig, hundert Mega-Tote – was ist das schon? Man sieht sie ja nicht und wird sich rasch daran gewöhnen. Man sieht sie nicht, verstehen Sie? Das ist es! Man sieht sie nicht!«
Die Sonne stand schräg und still und schien Fahnen und Prismen von hellem Staub durch das Glas der Schaufenster in den Laden zu praktizieren wie ein Zauberer, der durch Wände schreitet wie durch Wasser. Die Spiegel an den Wänden schienen wie auf ein geheimnisvolles kosmisches Kommando plötzlich zu erwachen. Sie waren von einer Sekunde zur anderen mit altem Silber und raunendem Raum gefüllt. Was eben noch Fläche gewesen war, war jetzt eine Luke in die Unendlichkeit und warf sich von den gegenüberliegenden Wänden die bunten Schatten der Bilder dort zu. Ich liebte diese Spätnachmittage in den Antiquitätenläden der Zweiten und Dritten Avenue! Wie durch Magie erhielten diese verstaubten Sammlungen von Plunder und altem Kram zu einer bestimmten Stunde Leben. Die Zeit stand immer in ihnen auf eine tote und wehmütige Art still. Sie waren wie herausgeschnittene stille Stücke aus der lärmenden Avenue, die an ihnen vorbeifloß. Das Rauschen der Autos drang nicht zu ihnen vor, die Menschen, die vor ihnen an geblindeten Fenstern stehen blieben, hatten wenig mit ihnen zu tun. Sie waren ohne Zeit, erloschen wie kleine alte Öfen, die nicht mehr wärmten, aber doch noch eine Illusion von vergangener Wärme gaben. Sie waren aber in einer schmerzlosen und nicht traurigen Weise tot, wie Übriggebliebenes tot ist, das nicht tragische Erinnerung ist. Erinnerung, die nicht mehr schmerzt und nie geschmerzt hat. Wie merkwürdige Fische bewegten sich hinter ihren Scheiben träge ihre Inhaber, glotzten oft durch starke Brillen karpfenartig zwischen chinesischen Mandaringewändern und Gobelins hervor oder hockten zwischen Dämonen herum und lasen Detektivromane und gestrige Zeitungen.
So hatte ich die Lowybrüder kennengelernt, in dem Augenblick, wo das schräge Licht die Antiquitätenläden auf der rechten Seite der Avenue in die honigfarbene Verzauberung hob, während auf der anderen Seite die Fenster sich bereits mit den Spinnweben des Abends füllten. Es war der Augenblick, wo sie Leben bekamen, ein Spiegelleben mit geborgtem Licht, trügerisch, aber doch ebenso ein Leben, wie es die gemalte Uhr über einem Optikerladen eine Sekunde am Tage erhält, wenn die aufgemalte Zeit mit der wirklichen übereinstimmt. Die Tür öffnete sich plötzlich, der rothaarige der Lowybrüder trat aus seinem Aquarium heraus, zwinkerte, nieste, sah in das sanfte Licht, nieste wieder und bemerkte mich, als ich die Veränderung des Ladens in eine Höhle Aladins beobachtete. »Schöner Abend, was?« sagte er nirgendwohin.
Ich nickte. »Eine schöne Bronze haben Sie da.«
»Falsch«, erwiderte Lowy, ziemlich unvorschriftsmäßig für einen Händler.
»Gehört sie Ihnen nicht?«
»Warum?«
»Weil Sie sagen, daß sie falsch ist.«
»Ich sage, daß sie falsch ist, weil sie falsch ist.«
»Ein großes Wort«, erwiderte ich. »Für einen Händler.«
Lowy nieste wieder und zwinkerte dann wieder. »Ich habe sie als falsch gekauft. Wir sind hier ehrlich!«
Mich entzückte die Kombination von falsch und ehrlich in diesem Augenblick, in dem die Spiegel zu schimmern begannen. »Glauben Sie nicht, daß sie trotzdem echt sein könnte?« fragte ich.
Lowy trat aus der Tür heraus und besah sich die Bronze, die auf einem amerikanischen Schaukelstuhl lag. »Sie können sie für dreißig Dollar haben«, erklärte er dann. »Mit einem Untersatz aus Teakholz dazu. Geschnitzt!«
Ich besaß noch etwa achtzig Dollar. »Kann ich sie für ein paar Tage mitnehmen?« fragte ich.
»Sie können sie fürs Leben mitnehmen, wenn Sie sie bezahlen.«
»Nicht auf Probe? Für zwei Tage?«
Lowy drehte sich um. »Ich kenne Sie doch nicht. Das letztemal habe ich einer sehr vertrauenerweckenden Frau zwei Meißner Porzellanfiguren mitgegeben. Auf Probe.«
»Und? Sie verschwand für immer?«
»Sie kam wieder. Mit den zerbrochenen Porzellanen. Sie waren ihr auf dem überfüllten Omnibus durch einen Mann mit einem Werkzeugkasten aus der Hand gestoßen worden.«
»Pech!«
»Sie weinte, als hätte sie ein Kind verloren. Zwei Kinder, Zwillinge. Es war ein Paar Meißner Porzellane. Was konnten wir tun? Sie hatte kein Geld, die Sachen zu bezahlen. Hatte sie nur für ein paar Tage mitnehmen und sich daran freuen wollen. Und auf einer Bridgeparty in ihrer Wohnung einige Freundinnen damit ärgern. Alles sehr menschlich, wie? Was konnten wir tun? Den Verlust in den Schornstein schreiben. Sie sehen –«
»Eine Bronze zerbricht nicht so leicht. Besonders nicht, wenn sie falsch ist.«
Lowy blickte mich scharf an. »Sie glauben es nicht?«
Ich antwortete nicht. »Lassen Sie dreißig Dollar hier«, sagte er. »Sie können das Stück für eine Woche behalten und es dann zurückgeben. Wenn Sie es behalten und verkaufen wollen, teilen wir den Profit. Wie ist das?«
»Der Vorschlag eines Halsabschneiders. Aber ich nehme ihn an.«
Ich war meiner Sache nicht sicher, deshalb nahm ich an. Ich stellte die Bronze in mein Zimmer im Hotel. Lowy senior hatte mir noch gesagt, daß er sie aus einem Museum in New York habe, das sie als falsch ausgeschieden hätte. Ich blieb an diesem Abend zuhause. Als es dunkel wurde, machte ich kein Licht an. Ich lag auf dem Bett und beobachtete die Bronze, die am Fenster stand. Ich hatte in der Zeit im Museum in Brüssel eines gelernt: daß die Dinge erst sprechen, wenn man sie lange anschaut, und die, die sofort sprechen, nie die besten sind. Ich hatte von meinen nächtlichen Wanderungen sogar manchmal kleinere Dinge in die Besenkammer mitgenommen, wo ich tagsüber im Dunkeln hauste, um sie zu fühlen. Es waren oft Bronzen dabei, und da das Museum eine gute Sammlung früher chinesischer Stücke besaß, hatte ich jeweils ein Stück mit Erlaubnis meines Protektors in meine Einsamkeit mitgenommen. Ich konnte das, da er selbst oft Stücke zum Studium mit nach Hause nahm und, wenn etwas fehlte, erklärte, es bei sich zu haben. Ich hatte so ein gewisses Gefühl dafür bekommen, wie sich die Patina anfühlte, und da ich außerdem viele Stunden nachts vor den Kästen hockte, wußte ich auch etwas von ihrer Textur, obschon ich die Farbe nie wirklich bei vollem Licht gesehen hatte. Aber so wie ein Blinder ein erhöhtes Tastgefühl erhält, so hatte sich auch bei mir im Lauf der Zeit etwas Ähnliches ausgebildet. Ich traute ihm zwar nicht ganz, aber ich war manchmal doch sicher.
Die Bronze hatte sich gut angefühlt im Laden; die Konturen und die Reliefs hatten nicht den Eindruck der Neuheit gemacht, obschon sie sehr scharf waren und das vielleicht bei dem Experten des Museums gegen sie gesprochen hatte. Aber sie waren auch klar, und während ich die Augen schloß und sie lange und sehr langsam betastete, verstärkte sich der Eindruck, daß sie alt waren. Ich hatte eine ähnliche Bronze in Brüssel gekannt, und von ihr hatte man auch erst angenommen, daß sie eine Tang- oder Ming-Kopie sein könnte. Schließlich hatten die Chinesen ja schon in der Han-Zeit, um Christi Geburt, ihre Shung- und Chou-Bronzen kopiert und vergraben; es war schwer, da die Patina zu kontrollieren, wenn die Ornamente und der Guß nicht kleine Fehler aufwiesen.
Ich stellte die Bronze auf die Fensterbank zurück. Vom Hof her kam das Scheppern der Kehrichtkübel und das metallische Geschrei der Küchenhelfer und der weiche gutturale Baß des Negers, der sie hinaustrug. Die Tür wurde aufgerissen. Ich sah den Umriß des Zimmermädchens im erleuchteten Viereck und wie sie zurückfuhr. »Ein Toter!«
»Unsinn«, sagte ich. »Ich schlafe. Machen Sie die Tür zu. Mein Bett ist schon aufgedeckt.«
»Sie schlafen doch gar nicht! Was ist denn das?« Sie hatte schon die Bronze erspäht.
»Ein grüner Pißpott«, erwiderte ich. »Was sonst?«
»Was Sie auch immer haben! Aber eines sage ich Ihnen: so was trage ich morgens nicht hinaus! Ich nicht! Tun Sie das selber. Hier sind WCs im Hause.«
»Gut.«
Ich legte mich wieder hin und schlief ein, ohne daß ich es wollte. Als ich aufwachte, war es tiefe Nacht. Es dauerte eine Weile, ehe ich wußte, wo ich war. Dann sah ich die Bronze und glaubte fast, wieder im Museum zu sein. Ich setzte mich auf und atmete tief. Ich bin nicht mehr da, sagte ich unhörbar zu mir selbst, ich bin entkommen, ich bin frei, frei, frei, und das Wort »Frei« wiederholte ich in einem primitiven Coué-Rhythmus, hörbar jetzt, aber leise, eindringlich, immer wieder, bis ich ruhig geworden war. Ich hatte das oft auf der Flucht getan, wenn ich verstört aufgewacht war. Ich sah die Bronze an, die mit einem letzten Glimmer der Farbe das Nachtlicht auffing, und spürte plötzlich, daß sie lebte. Es war jetzt nicht so sehr die Form als die Patina. Die Patina war nicht tot, sie war nicht aufgeklebt und nicht künstlich mit Säuren hervorgerufen auf der aufgerauhten Oberfläche, sie war gewachsen, sehr langsam über die Jahrhunderte, sie kam aus dem Wasser, in dem sie gelegen hatte, aus den Mineralien der Erde, die sich mit ihr verschmolzen hatten, und wahrscheinlich, mit dem Streifen eines klaren Blaus, das sie am Fuß zeigte, aus den Phosphorverbindungen, die durch die Nähe eines Leichnams vor Hunderten von Jahren entstanden waren. Die Patina hatte den schwachen Schimmer, den nicht polierte Chou-Bronzen im Museum durch ihre Porosität gezeigt hatten, eine Porosität, die das Licht nicht verschluckte, wie es bei künstlich behandelten der Fall war, sondern es eher ein wenig seidig machte, eher wie grobe Rohseide.
Ich stand auf und setzte mich ans Fenster. Ich blieb sehr lange so sitzen, fast ohne zu atmen, sehr still und nichts als Schauen, aus dem ich langsam jeden Gedanken zurückzog. Auch das hatte ich in Brüssel in den endlosen Nächten und Doppelnächten geübt und geübt, – damals, um nicht wahnsinnig vor Furcht und Erwartung zu werden und in eine Panik zu verfallen, dann in den Nächten in den hallenden Sälen des Museums vor den Bildern und den Glaskästen mit den Antiken, um die Zeit schneller vorwärtszubringen, indem ich mich so bemühte, sie nicht nur zu ignorieren, sondern sie auf eine sanfte, nahezu atemlose Weise zu vergessen, bis mir das sich ändernde Licht zeigte, daß wieder eine lebende, bebende, natürliche Nacht vorüber war und ich in die tote künstliche und gräßliche des fensterlosen Besenzimmers zurückmußte, kein anderer Trost in dem Dunkel, das stickig war und nicht atmete, als die kühle, nie sehr kühle Bronzehaut eines Ku aus der Zeit des Kaisers Wu in den Händen, um sie vor dem leeren Zugriff der Gespenster der Reue und der Furcht zu bewahren.
Ich behielt die Bronze noch zwei Tage, dann ging ich wieder zur Dritten Avenue zurück. Diesmal war der zweite Lowybruder da, der dem ersten glich, der nur etwas eleganter und sentimentaler war, – soweit das bei einem Kunsthändler möglich ist.
»Bringen Sie die Bronze zurück?« fragte er und griff nach seiner Brieftasche, um mir die dreißig Dollar wiederzugeben.
»Sie ist echt«, erwiderte ich.
Er sah mich gütig und belustigt an. »Ein Museum hat sie abgestoßen.«
»Ich halte sie für echt. Ich komme sie Ihnen zurückzugeben, damit Sie sie verkaufen können.«
»Und Ihr Geld?«
»Das zahlen Sie mir mit der Hälfte des Gewinns aus. So ist es abgemacht.«
Der Lowybruder griff in die rechte Tasche, holte einen Zehndollarschein heraus, küßte ihn und steckte ihn in die linke Tasche. »Zu was darf ich Sie einladen?« fragte er.
»Warum? Glauben Sie mir?« sagte ich angenehm berührt deswegen. Ich war zu sehr gewohnt, daß mir niemand etwas glaubte; weder Polizisten noch Frauen noch Immigrationsinspektoren.
»Nein«, erwiderte Lowy junior fröhlich. »Ich habe nur mit meinem Bruder gewettet: fünf Dollar für ihn, daß Sie die Bronze zurückgeben, selbst wenn sie falsch ist, – zehn für mich, daß Sie sie zurückgeben, selbst wenn sie echt ist.«
»Sie sind der Optimist der Familie, scheint es.«