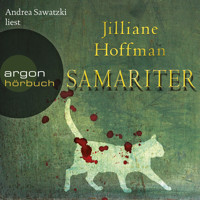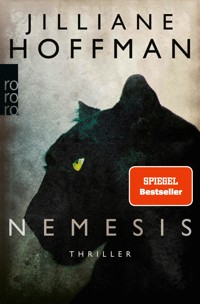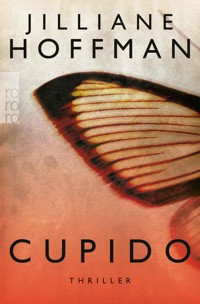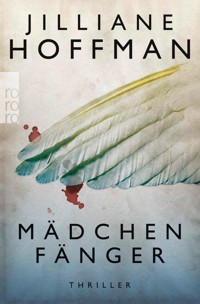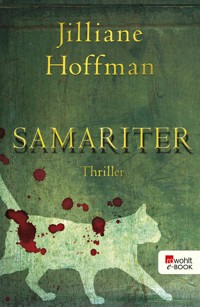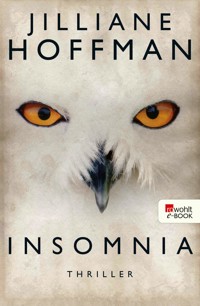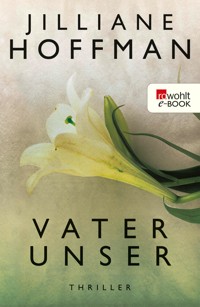Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die C.-J.-Townsend-Reihe
- Sprache: Deutsch
«No risk, no fun», denkt Gabriella und ignoriert ihre innere Stimme, die sie davor warnt, den gutaussehenden Reid in seine Kellerwohnung zu begleiten. Sie kennt ihn erst seit ein paar Stunden. Zu spät sieht sie die Kamera, zu spät bemerkt sie, dass sie nicht allein sind: Augen beobachten sie. Viele Augen. Böse Augen… Einige Jahre später: Eine Serie von bestialischen Frauenmorden erschüttert Miami. Ein Kreis einflussreicher Männer soll dahinterstecken. Nur einer kennt die Namen der Mitglieder des tödlichen Clubs: William Bantling, der vor zehn Jahren für die Cupido-Morde verurteilt wurde und noch immer im Todestrakt des Florida State Prison sitzt. Er ist bereit, mit Staatsanwältin Daria zu reden. Aber ist sie bereit, seinen Preis zu bezahlen?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jilliane Hoffman
Argus
Die C. J. Townsend Reihe
Thriller
Aus dem Englischen von Tanja Handels und Sophie Zeitz
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«No risk, no fun», denkt Gabriella und ignoriert ihre innere Stimme, die sie davor warnt, den gutaussehenden Reid in seine Kellerwohnung zu begleiten. Sie kennt ihn erst seit ein paar Stunden. Zu spät sieht sie die Kamera, zu spät bemerkt sie, dass sie nicht allein sind: Augen beobachten sie. Viele Augen. Böse Augen…
Einige Jahre später: Eine Serie von bestialischen Frauenmorden erschüttert Miami. Ein Kreis einflussreicher Männer soll dahinterstecken. Nur einer kennt die Namen der Mitglieder des tödlichen Clubs: William Bantling, der vor zehn Jahren für die Cupido-Morde verurteilt wurde und noch immer im Todestrakt des Florida State Prison sitzt. Er ist bereit, mit Staatsanwältin Daria zu reden. Aber ist sie bereit, seinen Preis zu bezahlen?
Über Jilliane Hoffman
Jilliane Hoffman war Staatsanwältin in Florida und unterrichtete jahrelang im Auftrag des Bundesstaates die Spezialeinheiten der Polizei – von Drogenfahndern bis zur Abteilung für Organisiertes Verbrechen – in allen juristischen Belangen. Mit ihren Romanen «Cupido», «Morpheus», «Vater unser» und «Mädchenfänger» hat sie sich einen festen Platz an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten gesichert.
Inhaltsübersicht
Für die üblichen Verdächtigen – Rich, Monster, Amanda, Mom, Dad und meine Schreibfreunde –, mit denen alles möglich scheint.
Und für Ed Sieban und Onkel Tommy McDermott, die ich immer vermissen werde.
Erster Teil
1
Die hübsche junge Frau in dem engen «COED»-T-Shirt lehnte sich rücklings über die Bar, sodass ihr kastanienbraunes Haar wie ein Fächer auf der weißen Kunstharztheke lag. Über ihr stand, in Vans-Turnschuhen riskant auf zwei Barhockern balancierend, ein Typ mit nacktem Oberkörper und dem eindrucksvollsten Waschbrettbauch, den Gabriella Vechio je gesehen hatte. Zwischen seinen Brustmuskeln klemmte ein Schnapsglas. Unter dem Jubel der Menge beugte er sich über die Studentin und goss ihr die bernsteinfarbene Flüssigkeit in den Mund. Southern Comfort spritzte ihr über Gesicht und T-Shirt, doch das störte das lachende Mädchen offensichtlich nicht. Und die johlende Menge erst recht nicht.
«Hey, Mann! Seht euch an, was der Kerl draufhat!», rief der DJ, bevor er die Musik hochdrehte. «Mach den Mund auf, Baby! Zeig uns, wie viel da reingeht!»
Gabby fuhr mit dem Finger über den gezuckerten Rand ihres Lemon-Drop-Martini und beobachtete die Szene am anderen Ende des Lokals. Es wurde immer voller, die Leute standen schon in dritter Reihe um die Bar, und der Indie-Rock von vorhin, als sie und ihre Freundinnen die Vorspeisen bestellt hatten, war längst dem dumpfen Puls der Top 40 gewichen. Beyoncé sang so laut, dass Messer und Gabeln, die noch auf dem Tisch lagen, klimperten und tanzten. Sogar die Kellnerin hatte gewechselt – ob es nun eine neue Blondine oder nur ein neues Outfit war, jedenfalls trug sie viel höhere Absätze und einen viel kürzeren Rock als das ausgelaugte Mädchen, das ihnen vor ein paar Stunden Quesadillas und Buffalo Wings gebracht hatte.
«Wie lang willst du denn bleiben?», fragte Gabbys Freundin Hannah stirnrunzelnd, während sie aufstand und ihre Tasche packte. Sie blickte missbilligend zu dem Spektakel an der Bar.
«Wie bitte?», gab Gabby zurück und zeigte auf ihr Ohr. Man konnte kaum noch ein Wort verstehen. Im Jezebels fing der Freitagabend mit der Happy Hour immer ganz ruhig an, aber sobald die Küche zumachte und es zu den Heinekens und Cosmos kein Essen mehr gab, wurde es rappelvoll. Nach neun verwandelte sich das Lokal schlicht in einen lärmenden Fleischmarkt. Weshalb Gabby eigentlich gar nicht gern herkam. Zwei Tage vor ihrem neunundzwanzigsten Geburtstag gehörte sie bereits zum Gammelfleisch. Zumindest hier im Jezzie, wo man schon mit fünfundzwanzig Gefahr lief, von den anderen als Oma bezeichnet zu werden.
«Ich habe gefragt, wie lange du noch bleibst», wiederholte Hannah. «Wir wollen dich hier nicht allein lassen. Nicht mit diesem Partyvolk …»
Gabby zuckte die Schultern und prostete Hannah und Daisy zu, der anderen Freundin, die danebensaß und mit großen Augen den Muskelmann und die Studentin anstarrte. «Ich trinke das nur noch aus. Kümmert euch nicht um mich; ich hab genau gegenüber geparkt.»
«Ich weiß nicht, wie’s euch geht, aber ich habe plötzlich einen Mordsdurst», verkündete Daisy, während auch sie langsam aufstand.
«Ich würde echt gern bleiben, aber ich habe Brandon versprochen …» Hannah nahm zögernd ihre Laptoptasche über die Schulter.
«Sei nicht albern. Ich wollte sowieso nicht mehr lange bleiben. Ich muss morgen tausend Sachen erledigen», log Gabby. «Geh ruhig nach Hause und amüsier dich mit Brandon, Hannah. Und denk dabei an mich», setzte sie mit einem Augenzwinkern hinzu.
«Wohl kaum. Heute Abend fällt das Amüsieren aus. Ich bin viel zu müde.»
«Armer Brandon», sagte Gabby lachend. «Ihr seid noch nicht mal verheiratet, und er geht jetzt schon freitagabends leer aus.»
«Bald ist ja Juli; und der Junge kann nicht behaupten, ich hätte ihn nicht gewarnt», erklärte Hannah. Dann sah sie sich unbehaglich im Lokal um. «Aber ich habe echt kein gutes Gefühl dabei, dich hier allein zu lassen, Gabby …»
Daisy fing Gabbys Blick auf. «Vielleicht kommt er ja wieder», sagte sie mit einem frechen Grinsen und legte sich den fliederfarbenen Kaschmirschal um.
Hannah lächelte, als hätte sie gerade einen schmutzigen Witz verstanden. Gabby spürte, dass sie rot wurde, und versteckte das Gesicht hinter dem Drink. Alle drei wussten, von wem Daisy sprach – dem witzigen, attraktiven MIT-Absolventen mit den roten Haaren, der letzten Freitag genau zur gleichen Zeit plötzlich an ihrem Tisch aufgetaucht war, kurz vor Ende der Happy Hour. Er hatte sie alle drei becirct, bevor der Rest seiner betrunkenen Clique ihn schließlich aufspürte und in die nächste Bar schleppte. Jeff, so hieß er. Und obwohl Gabby sich einzureden versuchte, dass dieser Mr. Auf-der-Suche-nach-einem-lukrativen-Job-als-Elektroingenieur nicht der einzige Grund war, weshalb sie den Mädels für heute Abend das Jezebels vorgeschlagen hatte, musste sie doch zugeben, dass er eine gewisse Rolle gespielt hatte. Aber dass sie so leicht zu durchschauen war, hätte sie nicht gedacht. Sie verdrehte die Augen. «Bloß nicht. Ich bitte euch. Ich warte nicht auf den.»
«Wie du meinst … darf ich dann?», antwortete Daisy lachend und nahm den Schal wieder ab, der perfekt zu dem schönen Trenchcoat und den schicken Stiefeletten von Alice & Olivia passte. Alles an Daisy war immer perfekt. Der niedliche Name, die Kleider, Größe 34, die schokoladenbraunen Locken, die ihr bis zum Po gingen, der dunkle spanische Teint, die verführerischen nussbraunen Augen. «Der war so was von süß! Ein bisschen zu jung, aber in dem Alter kannst du ihnen noch was beibringen, weißt du.» Sie seufzte. «Und die können immer. Dreimal hintereinander, wenn du Glück hast.»
«Du bist unmöglich», schimpfte Hannah.
Gabby zeigte auf den Platz neben sich. «Tu dir keinen Zwang an, Chica.» Aber sie meinte es nicht ehrlich. Heimlich hoffte sie, Daisy würde endlich gehen. Und hatte natürlich ein superschlechtes Gewissen deswegen. Seit dem ersten Tag am College, als das Schicksal sie in dem überfüllten Wohnheim der University of Buffalo zusammengeworfen hatte, waren Hannah und Daisy ihre besten Freundinnen. Und über all die Jahre waren sie Freundinnen geblieben, zehn Jahre mit Beziehungen, Trennungen, miesen Chefs, Familienproblemen, Krankheiten, Therapien, Umzügen in andere Staaten und wieder zurück, und all das natürlich begleitet von Dramatik und Ängsten. Doch es sah so aus, als bekäme Daisy die meisten Beziehungen und Trennungen, am meisten Drama ab. Daisys ungebrochene Beliebtheit hatte Gabby eigentlich nie gestört, aber seit einem Jahr hatte sie selbst derartiges Pech bei Männern, dass schon ein Date so unerreichbar schien wie ein Sechser im Lotto.
Früher im College, als alle drei süß und unzertrennlich gewesen waren, hatte man sie als die «Drei Engel für Charlie» gekannt. Hannah war die Schlaue, Gabby die Witzige und Daisy die Hübsche. Und heute, fast sieben Jahre nachdem die Engel offiziell zu Erwachsenen erklärt worden waren, hafteten diese Etiketten immer noch an ihnen. Allerdings bedeutete es kein Kompliment mehr, die Witzige zu sein. Das war natürlich einzig und allein Gabbys Komplex. Daisy war immer noch dieselbe tolle Freundin, die sie immer gewesen war. Aber der spaßige, wilde Sex-and-the-City-Lifestyle, zu dem sie ihr Leben gern stilisiert hatten, sollte eigentlich irgendwann zu Ende sein – wenn jede sich einen hochkarätigen Ehemann angelte und ein paar entzückende Babys bekam, die miteinander im Wohnzimmer eines schicken Apartments spielten, während die Mamis mit ihren Latte macchiatos in der Küche saßen und quatschten. Phase II, wie Gabby es nannte, sollte eigentlich vor dem dreißigsten Geburtstag beginnen. Oder zumindest in Gang kommen, was bedeutete, eine ernste Beziehung und möglichst einen Verlobungsring am Finger zu haben. Aber nicht umsonst lautete das Sprichwort: Leben ist, was einem passiert, wenn man gerade andere Pläne macht. Daran erinnerte Gabbys Mutter sie gern. Die Schlaue hatte überraschend als Erste die Schablone gesprengt, indem sie eine ernsthafte Beziehung einging. Die Hübsche holte immer noch von einer Vielzahl von Verehrern eine Vielzahl von Angeboten ein und hatte es nicht eilig, sich auf irgendetwas oder irgendjemanden festzulegen. Und die Witzige … nun, sie war noch «auf der Suche», wie Mrs. Vechio ihren Freundinnen mit leisem Seufzen erzählte, wenn die fragten, warum die kleine Gabriella denn immer noch nicht unter der Haube sei. Der Dreißigste kam mit Riesenschritten auf sie zu, und von Mr. Perfect fehlte jede Spur. Eine Beziehung mit Jeff, dem zukünftigen Ingenieur, konnte sie sich genauso gut vorstellen wie ein Dirty Dancing mit dem Muskelmann. Aber traurigerweise interessierte sich einfach niemand für die witzige Steuerberaterin, wenn auf dem Barhocker daneben die umwerfende Stylistin einer Modezeitschrift saß und ihr strahlendes Lächeln und ihren makellosen Körper zur Schau stellte.
«Ich würde bleiben, das kannst du mir glauben. Wenn ich nicht morgen früh um fünf zur Arbeit müsste», gab Daisy zurück. «Das Shooting soll vorbereitet werden, bevor die Sonne aufgeht. Wir brauchen das berühmte ‹erste Licht›, sonst ist der ganze Aufwand umsonst. Deswegen muss ich am Samstag ran.» Dann sah sie auf die Uhr und sagte: «Igitt, ich gehe um zehn nach Hause! Das ist echt peinlich. Vielleicht sollte ich lieber die Nacht durchmachen. Schlaf? Wer braucht Schlaf? Wisst ihr noch, wie wir früher drauf waren, Mädels?»
Hannah schauderte. «Ich versuche immer noch, das alles zu verdrängen, Daisy. Nur der Kater danach hat mich davon abgehalten, dem Alkohol hoffnungslos zu verfallen.»
«Das und deine protestantische Mutter, die dich nämlich umgebracht hätte», erklärte Daisy und leerte ihr Glas.
«Stimmt.»
«Bleibst du jetzt oder nicht?», fragte Gabby mit einem Anflug von Ungeduld und zwirbelte das glatte honigblonde Haar um ihren Zeigefinger. Die Strähne entrollte sich, sobald sie den Finger herauszog. In letzter Zeit hatte sie immer weniger Selbstvertrauen, wenn sie mit Daisy zusammen war. Als würde ihre Freundin nicht altern, nicht zunehmen und kein Frisurdebakel kennen. Mit 1,62 Metern und 58 Kilo war Gabby zwar nicht dick, aber eben nicht so dünn wie Daisy. Und ihr blondes Haar und die hellen Augen waren eigentlich auch nicht schlecht – solange sie nicht neben einer spanischstämmigen Sexbombe saß, die aussah wie die junge Sophia Loren. Gabriella konnte sich selbst nicht leiden, wenn sie solche Konkurrenzgedanken hatte, vor allem, da Daisy offensichtlich völlig ahnungslos war. Also schob sie den aufkeimenden Neid beiseite und zwang sich zu lächeln. «Soll ich die nächste Runde übernehmen?»
Daisy seufzte. «Nein. Das ist einer dieser Momente, in denen man das Richtige tun muss, sonst bereut man es später. Außerdem habe ich morgen Abend ein Date und muss frisch aussehen. Der Typ leitet einen Hedgefonds.» Sie fächelte sich Luft zu und rieb Daumen und Zeigefinger aneinander. «Jede Menge Kohle. Wir reden hier von ein paar Milliönchen, Mädels.»
«Das heißt aber auch harte Konkurrenz», stellte Hannah fest.
«Eben. Ich brauche mindestens fünf Stunden Schlaf, sonst kriege ich Ringe unter den Augen.»
«Dir stehen wahrscheinlich sogar Augenringe», bemerkte Gabriella.
«Augenringe stehen nur Zombies, Gabby, aber danke für das Kompliment», antwortete Daisy.
«Na schön, Mädels», sagte Gabby. «Ich bleibe auch nicht mehr lang.»
«Sei brav.» Hannah hielt warnend den Zeigefinger hoch. «Keine Spinner. Und keine Zirkusakrobaten», sagte sie und zeigte auf den immer noch hemdlosen Muskelmann. «Ach, und falls wir uns vorher nicht sehen, alles Liebe zum Geburtstag!»
«Ja! Alles Liebe!», schloss Daisy sich an und warf Gabby einen Luftkuss zu. «Ruf mich am Montag an. Und von mir aus tu alles, was ich auch tun würde, Zirkusakrobaten inklusive. Und schick mir eine SMS, falls der Rote und seine Freunde auftauchen. Vielleicht komme ich zurück!»
Gabriella hob prostend das Glas in ihre Richtung und sah ihre Freundinnen in der Menge der tanzenden Körper verschwinden. Das schlechte Gewissen verpuffte so schnell, wie es gekommen war, und wurde von einem berauschenden Freiheitsgefühl ersetzt. Gabby war keine Clubgängerin, aber jetzt war sie hier, in einem Club, ein paar entspannende Drinks intus und ohne Konkurrenz, die ihr Selbstbewusstsein dämpfte. Sie öffnete einen weiteren Blusenknopf, nippte an ihrem Martini und wippte zur Musik, als die Lichter gedimmt und die letzten Tische von der Mitte an die Wand geschoben wurden, um Platz zu schaffen für eine behelfsmäßige Tanzfläche. Sie füllte sich schnell. Das Lokal war voll. Bald würden die Türsteher niemanden mehr hereinlassen.
Es war zwar für die Clubszene noch früh, aber es bildeten sich schon Paare. Männer und Frauen. Frauen und Frauen. Jedenfalls wurde viel hemmungsloser getanzt als zu der Zeit, als Gabby von Club zu Club gezogen war. Und diese Klamotten der Mädchen – beziehungsweise der Mangel an Klamotten –, puh! Selbst wenn sie sich die Bluse bis zum Bauchnabel aufknöpfte, wäre es noch züchtig im Vergleich. Offenbar waren alle mit ihren besten Freunden hier, oder sie waren damit beschäftigt, neue beste Freunde zu finden. Auf einmal fühlte sich Gabby bloßgestellt – die alte Jungfer ohne Begleitung. Und die anderen sahen so verdammt jung aus …
Eine Schar junger Frauen mit Stilettos und Miniröcken schob sich vorbei und stieß gegen Gabbys Stuhl, sodass sie ihren Drink verschüttete. Sie schnaubte. Wahrscheinlich war es bescheuert zu glauben, er käme heute Abend wieder. Und noch bescheuerter zu glauben, er käme ihretwegen. Jetzt saß sie hier, in ihrem langweiligen Polyestermix-Kostüm direkt aus dem Büro, allein an einem Vierertisch, umgeben von Leuten, die weit entfernt waren von ihrem dreißigsten Geburtstag, von Kinderwunsch und der Suche nach Mr. Perfect. Das Hochgefühl der Freiheit war verflogen, und sie spürte den Anflug einer panikartigen Depression, die sie im Moment überhaupt nicht gebrauchen konnte. Gabby sah auf die Uhr und trank ihren Drink aus. Das war’s. Sie hatte es eine halbe Stunde ausgehalten. Zeit zu gehen …
Als sie gerade nach ihrer Handtasche griff und aufstand, brachte die Kellnerin einen frischen Lemon-Drop-Martini. «Mit vielen Grüßen von dem Herrn da vorne an der Bar», sagte sie und zeigte mit einem Schwenk ihrer blonden Lockenmähne in die entsprechende Richtung.
Gabby sah sich nach ihrem rothaarigen Ingenieur um. Hatte ihr Bauchgefühl doch recht gehabt? Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Wenn ja, wäre es eine tolle Geschichte, die sie ihren Enkeln erzählen könnte …
Doch sie konnte keinen großen, schlanken Rothaarigen entdecken. Sie tauchte den Finger in den Drink und strich über den Glasrand, während sie die Menge absuchte.
Das war der Moment, als Gabbys Blick auf den Fremden mit dem dunklen welligen Haar und den durchdringenden Augen fiel, der auf der anderen Seite der Tanzfläche an der Theke stand, eine Flasche Budweiser in der Hand, und zu ihr hersah. Er lächelte zurückhaltend und prostete mit dem Bier in ihre Richtung.
Und so kam es, dass Gabriella Vechio mit einem verhaltenen Lächeln und einer kleinen Handbewegung den Fremden an ihren Tisch einlud, der ihr Leben für immer verändern sollte.
2
Danke für den Drink», begann Gabby, als er sich zu ihr setzte.
«Woher wissen Sie, dass er von mir kommt?»
«Oh … ich habe es einfach angenommen», stotterte sie.
Er grinste. «Gern geschehen.»
«Ich bin Gabriella.»
«Ich bin Reid. Nett, Sie kennenzulernen, Gabriella.»
«Puh, das klingt so förmlich. Nur meine Mutter und mein Chef nennen mich Gabriella. Meine Freunde sagen Gabby.»
«Gabby. Okay.» Er nickte. «Aber Gabriella gefällt mir. Ein schöner Name. Wohnen Sie hier in der Gegend, Gabby?»
«Ich wohne in Forest Hills. Ich bin bloß nach der Arbeit hier vorbeigekommen.» Sie fingerte am Revers ihres Blazers herum. «Falls man das nicht sieht.»
«Was machen Sie?»
«Zumindest bin ich mit der Schule fertig», sagte Gabby mit einem kurzen Lachen.
«Ja. Das Publikum hier ist ein bisschen jung, oder?» Reid sah sich um. «Aber die Buffalo Wings sind großartig.»
«Ja. Und die Quesadillas auch. Meine Freundinnen und ich waren schon ein paarmal hier. Es gibt eine echt nette Happy Hour. Da ist das Publikum ein bisschen … na ja, reifer. Sie wissen schon, Leute, die aus dem Büro kommen und so weiter.»
Er nickte und sah sich um. «Und wo sind sie jetzt? Ihre Freundinnen?»
«Ach, die sind schon nach Hause», erklärte Gabby schnell. «Vor einer halben Stunde gegangen. Sie müssen morgen beide früh aufstehen. Ich habe nur noch mein Glas ausgetrunken und wollte gerade gehen, da haben Sie mir den Drink spendiert.»
«Ich bin froh, dass Sie noch geblieben sind. Und ich muss sagen, mir gefällt das Publikum hier.» Er sah sich nicht um, als er das sagte – seine dunklen, schokoladenbraunen Augen wichen keinen Augenblick von ihren. In seinen Pupillen schimmerten faszinierende helle Bernstein- und Goldflecken.
Gabriella wurde rot. Er war attraktiv, dieser Reid. Nicht so offensichtlich wie der Typ mit den Bauchmuskeln. Sein Kinn war etwas groß, aber er hatte ein nettes Lächeln, das sein ganzes Gesicht strahlen ließ, das war ihr gleich aufgefallen. Seine Zähne waren gerade und sehr weiß, wie aus der Werbung. Kein Zahnfleisch zu sehen. Manche Frauen standen auf Waschbrettbäuche oder Locken oder schöne Augen oder pralle Muskeln, aber Gabbys Schwäche war das Lächeln. Deswegen hatte sie immer einen Zahnarzt heiraten wollen, bis ihr auffiel, dass die oft schreckliche Zähne hatten. Wie ging das Sprichwort? Arzt, heil dich selbst? Zahnarzt, richte dir selbst die Zähne. Gabby betrachte Reids markantes, attraktives Gesicht vor dem Hintergrund des wilden Erstsemestergetümmels und dachte, vielleicht war genau das sein bester Zug – dass er nicht mehr einundzwanzig war. Sie schätzte ihn auf mindestens Ende zwanzig, aber fragen wollte sie nicht, damit er sie nicht das Gleiche fragte und sie die Enttäuschung in seinem Gesicht sehen musste. Demi Moore hatte mit Ashton Kutcher vielleicht einen Trend gesetzt, aber für die meisten weiblichen Erdlinge, die weder wie ein Hollywoodstar aussahen noch über ein hollywoodmäßiges Einkommen verfügten, war es nicht so leicht, auch nur einen kleinen Altersunterschied zu einem gutaussehenden Mann zu überbrücken. Schon gar nicht an einem Ort wie diesem. Wenn sie «achtundzwanzig» hörten, verstanden die meisten Männer «dreißig» und lasen sofort die Gedankenblase über dem lächelnden, angespannten Gesicht: «Auf der Suche nach Ehemann, Haus und Kind!» Und in dem Moment entschuldigten sie sich, um aufs Klo zu gehen, und tauchten nicht wieder auf. Vielleicht war Gabby albern und zu streng mit sich, aber heute wollte sie kein Risiko eingehen. Sie wollte einfach nur Spaß haben. «Ich bin Steuerberaterin bei Morgan & Tipley», antwortete sie. «Eine kleine Kanzlei in Midtown. Lexington und 43rd Street. Sie kennen sie bestimmt nicht. Ich arbeite seit ein paar Jahren dort. Es macht Spaß.»
«Steuerberatung … oho. Ich hätte Sie ganz woanders hingesteckt – das ist überhaupt nicht mein Fach. Ich kann zwar mit meinem eigenen Geld gut umgehen, aber mit fremdem Geld — ich weiß nicht so recht … Ich würde vielleicht neidisch werden.»
«Man kriegt es ja nicht in die Finger, die Versuchung ist also nicht groß.» Gabby trank einen Schluck. «Wo hätten Sie mich denn hingesteckt?»
«Keine Ahnung … Astronautin? Raketenforscherin? Kernphysikerin?»
«Sehe ich so intelligent aus? Das muss das Kostüm sein.»
«Nein. Eigentlich hätte ich Sie für eine Anwältin oder Juristin gehalten. Irgendwas, das mit dem Gesetz zu tun hat. Vielleicht auch FBI-Agentin, Polizistin oder Spionin. Nur mal so geraten. Für eine Steuerberaterin sehen Sie nicht langweilig genug aus.»
«Steuerberater können ziemlich lustig sein. Sie feiern gern. Vor allem am 16. April, wenn die Steuererklärungen abgegeben sind.»
«Wirklich? Mein Steuerberater heißt Sy und arbeitet für H&R Block, und ich glaube, er war seit Jahrzehnten auf keiner Party mehr. Erzählen Sie mal, Gabby, was gefällt Ihnen daran? An der Steuerberatung?»
«Hmmm … gute Frage. Mal sehen. Zum einen ist alles ganz objektiv, anders als in vielen anderen Berufen. Eine Freundin von mir ist Schriftstellerin, und sie weiß nie, ob es gut ist, was sie schreibt. Ich meine, es gibt immer einen, der sagt, sie hätte Mist geschrieben, auch wenn hundert andere sagen, es sei super. So was wäre nichts für mich. Am Ende rauft sie sich nur die Haare. Das Gleiche gilt für meine andere Freundin, die Stylistin ist. Irgendwer hat immer was zu kritisieren. Meint, er hätte ein besseres Ergebnis hinkriegen können: mehr Besucher bei der Modenschau, ein besseres Foto von einem besseren Model und so weiter. Aber Steuerberatung ist eindeutig, verstehen Sie? Wenn Sie alles richtig machen, geht es immer auf. Und wenn Sie wirklich alles richtig machen, dann sind auch die Kunden glücklich. Zahlen lügen nicht, und es ist ihnen egal, was andere Leute von ihnen denken.»
«Interessant …»
Gabby hatte noch nie einem Mann erklärt, was sie an ihrem Beruf mochte. Sie fragte sich, ob sie die «richtige» Antwort gegeben hatte. Doch egal, was sie sagte, Steuerberatung klang nie besonders aufregend. «Was machen Sie, Reid?»
«Ich bin Filmemacher.»
Gabbys Herz schlug schneller. Filmemacher standen wie Chirurgen ganz oben auf der Liste, was «Aufregung» und «guter Fang» anging. «Das klingt cool», sagte sie.
«Na ja, ich arbeite dran. Es ist nicht einfach, den Durchbruch zu schaffen. Viel Konkurrenz. Man muss sich was einfallen lassen, um sich von der Masse abzuheben.»
«Was für Filme machen Sie denn?»
«Also, freuen Sie sich nicht zu früh, Sie haben nicht den nächsten James Cameron vor sich. Ich, na ja … ich mache Dokumentarfilme.»
«Das ist doch aufregend.»
Er lächelte. «Finde ich auch. Ich finde, das echte Leben ist viel aufregender als irgendwelche Scheinwelten. Echte Menschen, die echte Emotionen zeigen. Die Herausforderung, solche Momente einzufangen. Aber … na ja, man verdient eben nicht viel Geld dabei, es sei denn, man heißt Michael Moore.»
«Ich finde, das klingt trotzdem aufregend. Geld ist schließlich nicht alles.»
«Ach … und Sie wollen Steuerberaterin sein?»
Gabby lachte. «Ich habe für viele Leute, die viel Geld verdienen, die Steuererklärungen gemacht, und deren Leben ist trotzdem das reinste Chaos, und glücklich sind sie nicht. Nein, Geld ist wirklich nicht alles.»
«Stimmt, es gibt noch eine ganze Menge anderes im Leben.»
Gabby zeigte auf ihr Ohr. Es war jetzt ziemlich laut im Lokal.
Reid beugte sich näher, legte seine Hand auf ihren Rücken und flüsterte in ihr Ohr. Sie spürte seinen warmen Atem im Nacken und bekam Gänsehaut, als seine starke Hand über ihr Kreuz strich. «Erzählen Sie mir mehr von sich, Gabriella. Ich möchte alles von Ihnen wissen.»
Sie lächelte kokett. Dass sie um ein Haar gegangen wäre, allein nach Hause zu ihrer Katze, wo sie sich irgendeinen blöden alten Film angesehen hätte! Anscheinend wendete sich das Blatt; sie konnte es spüren. Und so erzählte sie ihm, während er ihren Rücken streichelte und mit ihren Haaren spielte, bei zwei weiteren Lemon-Drop-Martinis alles, was er wissen wollte.
3
Oh, es gefiel ihr, wie er ihren Namen aussprach. Gabriella. Und es gefiel ihr, dass er sich nach ein paar Drinks, einem Haufen belangloser Konversation und, wichtiger noch, nach Scharen von jungen Frauen in hohen Schuhen und Miniröcken, die auf dem Weg zur Damentoilette an ihnen vorbeizogen, immer noch an ihren Namen erinnerte.
Reid strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht und kam näher. «Hören Sie», flüsterte er, den Mund dicht an ihrem Ohr. «Normalerweise lade ich Frauen nicht zu mir ein. Wirklich nicht, aber …»
Sie nickte. «Ja.» Der Raum drehte sich.
«Ja?»
«Ja, ich komme mit. Sie fragen normalerweise nicht, ich sage normalerweise nicht ja. Aber jetzt ist es raus. Ja.»
Er lächelte. «Toll. Ich wohne nicht weit von hier.»
«Toll.» Gabby bückte sich nach ihrer Handtasche unter dem Tisch, und plötzlich drehte sich alles. Sie griff sich mit beiden Händen an den Kopf, um das Gleichgewicht wiederzufinden. Und schickte ein Gebet zum Himmel, dass sie sich nicht übergeben musste. Den vierten Martini hätte sie sich sparen sollen. Der hatte ihr den Rest gegeben. Nur deswegen hatte sie die impulsive, verrückte Entscheidung getroffen, mit einem wildfremden Mann nach Hause zu gehen. Es war der Alkohol: Er machte sie heiß, und ihre hyperaktiven Pheromone halfen ihr bei der Entscheidungsfindung auch nicht. Schlimmer noch, sie war nüchtern genug, um zu merken, dass sie etwas Dummes tat, und sie tat es trotzdem. Verdammt … Ihr fehlte Sex, daran bestand kein Zweifel. Es war fast ein Jahr her. Und drei Jahre, seit sie mit jemandem zusammen gewesen war. Zwar glaubte sie nicht, dass Reid der «Richtige» war oder so was, oder dass sich nach heute Nacht überhaupt etwas zwischen ihnen entwickeln würde – nein, dazu müsste sie klar denken können. Andererseits war sein Lächeln wirklich umwerfend, und er drehte Filme, verdammt, was sie total anmachte. Außerdem ließ seine Hand, die unter dem Rock auf ihrem Schenkel lag, ihren ganzen Körper bitzeln. Vielleicht hatte sie vorschnell ja gesagt, aber wie Daisy sagen würde, wenn sie jetzt hier wäre: «Man lebt nur einmal …»
Glücklicherweise gaben ihre Beine nicht nach, als sie aufstand. Reid legte den Arm um sie und führte sie behutsam am Ellbogen durch die Menge, die dicht gedrängt um die Tanzfläche stand, an der Theke vorbei und auf die Straße. Auf dem Bürgersteig standen spärlich bekleidete Menschen zähneklappernd Schlange bis um die nächste Ecke. Für sie fing der Abend gerade erst an. Und die Nacht wäre erst vorbei, wenn die Sonne aufging.
Die kalte feuchte Luft war erfrischend. Sie ließ Gabby etwas nüchterner werden und entschleunigte den Schwindel, was guttat, auch wenn die Stille hier draußen fast ohrenbetäubend war. In ihrem Kopf dröhnte immer noch Britney.
«Alles klar?», fragte Reid, als er die Tür eines Wagens öffnete und sie auf den Beifahrersitz setzte.
«Bestens», log sie. «Alles in Ordnung. Wie nah wohnst du denn?»
«Nicht weit», sagte er, als er sich ans Steuer setzte.
«In Manhattan?»
«Wer kann sich Manhattan schon leisten?», entgegnete er lachend und fuhr auf die Straße.
«Ja. Stimmt. Is’ verdammt teuer hier. Alles isso teuer.» Fing sie jetzt an zu lallen? Verdammt. Er legte die Hand auf ihren Schenkel und wanderte mit den Fingern unter ihren Rock. Sie streichelte seine Hand und sah zu, wie die Lichtkegel der Straßenlaternen miteinander verschwammen und zu langen weißen Streifen wurden, als der Wagen in einen Tunnel tauchte, der aussah wie der Midtown-Tunnel. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Im nächsten Moment war sie eingeschlafen.
«Okay, Schlafmütze, wir sind da.»
Gabby schlug die Augen auf. Die Beifahrertür stand offen, und Reid lehnte sich herein. Hier gab es keine hellen Lichter, keine Wolkenkratzer, keine in zweiter Reihe geparkten Autos oder hupenden Taxis. Sie standen vor einem zweistöckigen Häuschen in einer ruhigen, verlassenen Wohnstraße. Gabby wusste nicht, wo sie waren, aber es war ganz bestimmt keiner der fünf New Yorker Bezirke. Am Ende der Straße konnte sie eine rote Ampel erkennen, doch es standen keine wartenden Autos davor. Eigentlich waren überhaupt nirgends Autos zu sehen. Auch wenn es kein reines Wohnviertel zu sein schien, hatten die paar Restaurants, die sie sah, schon die Rollläden heruntergelassen. Wie spät war es? Sie versuchte, auf ihre Uhr zu sehen, doch sie konnte die Zeiger nicht erkennen; es war zu dunkel, und sie war zu betrunken. Sie suchte im Fußraum nach ihren Schuhen, nahm sie in die Hand und stellte sich auf den Bürgersteig. Wieder drehte sich alles. Es wäre schrecklich peinlich, hinzufallen. Wo war sie? Dann trat sie in Strümpfen in eine eiskalte Pfütze. Gabby sah sich um. Der Bürgersteig glänzte. «Hat es geregnet?», fragte sie.
«Ob es geregnet hat?», antwortete er lachend. «Es hat geschüttet. Wie aus Eimern. Du hast den ganzen Weg verschlafen. Sogar den Stau. Zieh vielleicht besser die Schuhe an – der Gartenweg steht manchmal unter Wasser.»
«Ich hätte den letzten Martini nicht trinken dürfen», sagte sie, als sie in die Pumps schlüpfte und sich an seinem Arm festhielt.
«Keine Sorge; wenn wir drin sind, wärme ich dich auf.»
«Das klingt schön …»
Er legte ihr den Arm um die Hüfte und führte sie an der Seite des alten viktorianischen Häuschens mit der hübschen Veranda vorbei. Ein Pfad aus zerbröckelten Backsteinen führte durch einen ehemaligen Wintergarten zu einer Betontreppe, die nach unten führte wie in eine Krypta. Bis auf ein Licht im Keller auf der anderen Seite des Vorgartens lag das Haus vollkommen im Dunkeln.
«Ist das dein Haus?», fragte Gabby.
«Nein. Ich habe die Wohnung nach hinten gemietet.»
«Unten?»
«Genau.»
«Hübsches Haus.»
«Ja, na ja, ich hoffe, du hast gute Nerven. Es ist nämlich ein Beerdigungsinstitut.»
Gabby blieb stehen. «Was?»
«Nicht da, wo ich wohne, natürlich. Der obere Teil ist das Institut, wo die Toten aufgebahrt werden und so. Ich schätze, im anderen Teil des Kellers machen sie die anderen Sachen, die so gemacht werden, aber ich habe nie was gehört oder gesehen, versprochen.»
«Du meinst, da sind tote Leute drin?»
«Ich weiß nicht, ob im Moment welche da sind. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt hatte, aber dann war alles gut. Meine Freunde finden es natürlich ziemlich witzig. Und ich zahle eine unschlagbar niedrige Miete. Komm», sagte er und zog sie an der Hand hinter sich her. «Ich passe schon auf, dass dich kein Geist holt.»
«Ein Beerdigungsinstitut … Mann, das ist echt krass.» Doch zu ihrer eigenen Überraschung folgte sie ihm zur Treppe. «Wo zum Teufel sind wir?»
«Im Paradies», erwiderte er und lächelte sie an.
Als sie an der Treppe standen, zögerte sie. «Ein Beerdigungsinstitut … ich weiß nicht, Reid …» Jede Faser ihres Körpers sträubte sich dagegen, dort hinunterzugehen.
Er streichelte ihre Hand und beugte sich zu ihr, um sie zu küssen. «Ich pass auf dich auf. Versprochen», flüsterte er, den Mund an ihrem Ohr. «Du vertraust mir doch, oder? Wenn ich ein mieser Kerl wäre, hätte ich dir einfach nichts davon erzählt. Nur ein anständiger Mensch ist mit so was ehrlich, wenn er versucht, ein Mädchen zu sich nach Hause zu nehmen und zu verführen.»
«Oder ein Dummkopf», gab Gabby zurück und lachte.
«Oder ein Dummkopf», wiederholte er und zuckte die Schultern. Dann küsste er sie, lang und feucht und zärtlich. Seine warme Zunge schob sich in ihren Mund. Seine Hände wanderten zu ihrem Hintern.
Das reichte.
An der Hand führte er sie die Treppe hinunter in die rabenschwarze Dunkelheit.
«Gibt es hier kein Licht? Verdammt, ich … ich sehe überhaupt nichts, Reid. Die blöden Absätze … ich breche mir noch das Genick …», flüsterte sie mit einem nervösen Kichern. Sie fragte sich, warum sie flüsterte.
«Das Licht ist kaputt. Ich will es immer reparieren, aber ich vergesse es dauernd. Lass meine Hand nicht los und halt dich mit der anderen am Geländer fest; die Treppe ist ziemlich steil, Gabby. So. Jetzt haben wir’s gleich geschafft.»
Als sie unten waren, hörte sie das Klimpern des Schlüssels und sah sich um. Dichte Wolken hatten sich vor den Mond geschoben, und es war stockdunkel. Sie fragte sich, wie er das Schlüsselloch fand, denn sie konnte die Hand nicht vor Augen sehen. Sie fühlte sich mehr als unbehaglich, von Finsternis eingeschlossen in einem Betonschacht, auf einer Treppe weit entfernt vom Rest der Welt, direkt unter einem Bestattungsinstitut. Auch ohne Bestattungsinstitut – sie war keine Freundin von Kellern, nie gewesen. In den achtzehn Jahren im Haus ihrer Eltern konnte sie die paar Mal, da sie freiwillig in den Vorratskeller runtergegangen war, an den Fingern abzählen. Da unten wohnen böse Wesen, hatte ihre Schwester sie mit schadenfrohem Grinsen gewarnt, wenn Gabbys Mutter sie nach unten schickte, um ein Glas Gurken oder Marmelade zu holen. Böse Wesen, die keine Lebenden mögen …
«Vorsicht», sagte er, als er sie über die Schwelle führte. «Ich mache jetzt das Licht an.»
Nach ein oder zwei Sekunden war das Licht an, und erleichtert sah sie, dass sie in einer hellen, weißen Einbauküche standen, die in ein kleines Studio-Apartment führte. Keine Metalltische mit Leichen, die darauf warteten, präpariert und geschminkt zu werden. Keine Särge, die sich an den Wänden stapelten. Ein kleines Sofa, ein Couchtisch und ein Fernseher beherrschten das Wohnzimmer. In einer Ecke stand ein Tisch mit zwei Stühlen. Eine andere Ecke war von schwarzen, bodenlangen Vorhängen als Schlafbereich abgetrennt. Ein Vorhang war ein Stück zurückgezogen, und Gabby konnte ein schmales Doppelbett erkennen.
Jetzt stand Reid wieder hinter ihr. Er bewegte sich schnell, wie ein Vampir. Was in Anbetracht der Örtlichkeit irgendwie unheimlich war. Doch sie schüttelte die düsteren Gedanken ab. Natürlich war es der Alkohol, der sie auf seltsame Ideen brachte.
«Noch einen Drink?», fragte er, nahm ihr den Mantel ab und warf ihn aufs Sofa im Wohnzimmer. Ihr Jackett folgte.
«Wo sind wir? Auf Long Island? In New Jersey?» Trotz des betrunkenen Nebels machte sich langsam ein Anflug von Panik in ihr breit. Sie fuhr sich durchs Haar. «Ich dachte, du wohnst nicht weit vom Jezebels. Wie komme ich wieder nach Hause?»
«Mach dir keine Sorgen. Ich fahre dich morgen früh in die Stadt, oder wann immer du willst. Im Moment kannst du sowieso nicht Auto fahren. Trink noch etwas und entspann dich.» Er legte ihr die Hände auf die Schultern und massierte sie sanft. Seine weichen Lippen glitten über ihren Nacken und schickten ihr einen Schauer über den Rücken. «Du riechst so gut», murmelte er.
«Und du fühlst dich gut an», flüsterte sie. Er drängte sich an sie, und sie konnte ihn spüren, seinen harten Penis in ihrem Kreuz. Seine Hände glitten über ihre Schultern, die Arme herunter, in Richtung Hüften. «Ich sollte lieber nichts mehr trinken; ich hatte schon zu viel.»
«Aber es hilft dir beim Entspannen.»
Sie zuckte die Schultern. «Na gut. Aber normalerweise trinke ich nicht so viel, nur damit du das weißt.» Noch während sie es aussprach, fand sie ihre Entschuldigung dafür, sternhagelvoll bei einem Fremden in der Wohnung zu stehen, ein paar Meter von seinem Bett entfernt, ziemlich schwach. «Ich will, dass du das weißt», sagte sie, als er zurück in die Küche ging. «Das glaubst du mir wahrscheinlich nicht, aber … na ja, ich geh eigentlich nicht mit Männern nach Hause, die ich grade erst kennengelernt hab. Ehrlich gesagt, bis auf einen Typ im College, der kein Fremder war – ich kannte ihn aus dem Mathekurs –, tu ich so was nich. Mach ich nich.» Sie lallte, oder? Sie holte tief Luft. «Will nur sagen, ich bin kein Flittchen.»
Vielleicht war es ihre Phantasie, aber sie hatte das Gefühl, es lag ein komischer Geruch in der Luft. Es roch nach einem dieser Raumdüfte für die Steckdose, die sie in ihrer Wohnung benutzte, um den Geruch von Schimmel zu überdecken, der unter dem Ausguss wucherte, seit die Spülmaschine geleckt hatte. Aber da war noch etwas anderes; das, was durch den Raumduft verdeckt werden sollte. Ein schwacher Geruch von … etwas Medizinischem? Wie in einem Krankenhaus oder einem Altersheim. Oder einem Beerdigungsinstitut? Wonach zum Teufel roch es …? Sie versuchte den Gedanken zu verdrängen. Für einen Kerl war die Wohnung wirklich ordentlich. Und mit den schweren schwarzen Vorhängen vor dem Schlafzimmer irgendwie sexy. O Gott, was machte sie hier bloß?
Er kam zurück, reichte ihr einen Wodka Orange und sah zu, wie sie daran nippte. «Ich bin froh, dass du für mich eine Ausnahme gemacht hast. Ich will auch ehrlich sein – ich bin kein Frauenheld. Ich nehme so gut wie nie eine Frau mit nach Hause, Gabby. Nur, wenn es wirklich jemand Besonderes ist. Jemand, der anders ist als die anderen. Einzigartig. So wie du. Ich finde, du bist etwas Besonderes. Du bist nicht so wie die Frauen in der Bar. Diese anderen Frauen – die haben keine Ahnung, was sie wollen, keine Ahnung, wer sie sind. Aber du schon, Gabriella. Ich glaube, du weißt, was du willst, und du hast keine Angst, es dir zu holen. Vielleicht bin ich verrückt, aber ich habe das Gefühl, zwischen uns gibt es eine Verbindung, das habe ich schon gespürt, als ich dich in der Bar von weitem gesehen habe.» Er ließ die Hand durch ihr Haar gleiten, fuhr die Kontur ihres Gesichts nach, am Hals hinunter zu den Knöpfen ihrer Bluse. Dabei tastete er sie mit Blicken ab. «Und ich kann es kaum abwarten, mehr von dir zu sehen.»
Vielleicht waren es nur Worte, aber es waren genau die, die Gabby hören wollte. Reid packte sie und zog sie von hinten an sich. Sie spürte seinen Herzschlag an ihrem Rücken. Er roch sauber, nach Seife und einem frischen zitronigen Aftershave. Versace? Acqua di Gio? Doch als sie ihm endlich das Gesicht entgegenstreckte, um ihn zu küssen, lehnte er sich zurück und lächelte neckisch, während er hinter sich griff und einen langen schwarzen Seidenschal hervorholte. Er ließ ihn vor ihrem Gesicht baumeln.
«Oh», murmelte Gabby und hielt die Luft an. «Was is das?»
«Lass dich überraschen», raunte er, nahm sie bei der Hand und führte sie durch den offenen Vorhang in den Schlafbereich des Raums. Gabbys Herz begann schneller zu schlagen. Bondage mit einem Fremden – Daisy wäre beeindruckt. Gabby trank noch einen letzten großen Schluck, bevor er ihr das Glas sanft von den Lippen nahm und auf ein Tischchen stellte. Dann fasste er sie unter dem Kinn, hob ihr Gesicht und küsste sie. Seine Zunge war groß und warm und neugierig und tastete sich bis tief in ihren Mund. Gabby spürte, wie sie feucht wurde. Es war so lange her, dass sie mit einem Mann geschlafen hatte. So viele Gedanken waberten durch den dichten Nebel in ihrem Kopf. Sie fragte sich, ob er ein guter Liebhaber war, und wenn ja, ob sie es in ihrem Zustand überhaupt merken würde. Sie fragte sich, ob er sie für eine gute Liebhaberin halten würde. Was erwartete jemand, der auf Bondage stand, von einer Frau? Was für Spielzeug hatte er noch in seinem Schrank hinter den schicken schwarzen Vorhängen? Nach dem Schal zu urteilen, vermutete sie, dass er sich Zeit mit ihr nehmen würde. Was sie noch mehr anturnte. Sie schloss die Augen und versuchte, Nervosität und Unbehagen abzuschütteln. Wenn sie sich schon wie eine billige Schlampe aufführte und sich auf einen One-Night-Stand einließ, konnte sie nur hoffen, dass dabei tantrischer Sex für sie heraussprang, mit einem Typen, der stundenlang durchhielt, um sie anschließend zärtlich aufzuwecken und von neuem anzufangen.
Reid schien Gedanken lesen zu können. Während er sie küsste, zog er ihre Arme in die Höhe, bis über den Kopf. Sie spürte, wie er die glatte Seide immer wieder um ihre Handgelenke schlang. Es war sehr erotisch. Dann schlang er die Enden um etwas, das von der Decke zu hängen schien – eine Stange oder ein Haken oder Balken, Gabby wusste es nicht –, und zog sie hoch, sodass sie fast in der Luft hing, obwohl ihre Füße gerade noch den Boden berührten. Es tat ein bisschen weh, aber der Kontrollverlust war zugleich unheimlich und unglaublich sexy. Sie wollte ihn immer mehr.
«Oh», stöhnte sie überrascht.
Er knöpfte ihr die Bluse auf und öffnete sie, sodass der durchsichtige Spitzen-BH von Victoria’s Secret zum Vorschein kam. Das Licht war an, und Gabby dankte Gott, dass sie am Morgen schöne Unterwäsche angezogen hatte. Mit warmen Handflächen fuhr er über die Spitze. «Gefällt dir das?», fragte er, als unter der Berührung ihre Brustwarzen hart wurden.
Sie atmete scharf ein und nickte.
Jetzt zog er sich das Hemd über den Kopf und warf es aufs Bett. Sein Oberkörper war haarlos und muskulös. Nicht wie der eines Bodybuilders, aber durchtrainiert. Vor allem die Brustmuskeln. Dann ging er in die Knie und begann mit den Fingerspitzen ihre Beine zu streicheln, von den Knöcheln aus den Körper hinauf, wobei er ihren Rock über die Hüfte schob und den Slip freilegte. Langsam zog er die Nylonstrumpfhose herunter, den Slip ließ er ihr. «Ich habe gefragt, gefällt dir das?», wiederholte er, die Stimme schärfer. «Ich will hören, wie du es sagst, Gabriella. Sag mir, ob es dir gefällt. Sag mir, ob du willst, dass ich dich anfasse.»
Sie nickte wieder. Sie konnte nicht glauben, was sie hier tat, aber es fühlte sich berauschend an. «Ja», sagte sie laut. «Ja, es gefällt mir, Reid. Es gefällt mir sehr. Ich will, dass du mich anfasst.»
Er küsste sie wieder, dann trat er zurück. Mit einer schnellen Bewegung zog er ihr die Strumpfhose aus, band sie ihr um den Mund und verknotete sie am Hinterkopf. Sie konnte ihre Zunge nicht mehr bewegen und nicht sprechen. Ihr Herz schlug schneller. Plötzlich raste Angst durch ihren Körper. «Mehr wollte ich nicht wissen», flüsterte er.
Er ging auf die Vorhänge zu und zog den ersten zurück. Dahinter kam eine Videokamera auf einem Stativ zum Vorschein. Links von der Kamera standen auf einem Stahlwagen drei Computermonitore. Er öffnete den anderen Vorhang, hinter dem drei weitere Monitore auftauchten – sechs Bildschirme insgesamt. Die Stahlwagen sahen aus wie die Multimediawagen in der Schule, die vom Lehrer ins Klassenzimmer geschoben wurden, wenn die Kinder einen Lehrfilm zu sehen bekamen. Hinter den Wagen mit den Monitoren und der Videokamera war eine weitere Wand aus schwarzen Vorhängen. Alle Monitore waren eingeschaltet. Auf jedem Monitor sah Gabby ein anderes Gesicht.
«Hallo, Gabby», sagte ein Mann auf einem der Monitore und beugte sich zur Kamera.
«Guten Abend, schöne Frau», sagte ein anderer.
Und dann noch einer. «Hallo, Gabriella. Ein sexy Name, den du da hast, wirklich. Und schönes Haar.»
Der Mann auf dem ersten Monitor lachte. «Er steht eben auf echte Blondinen.»
Gabbys Augen weiteten sich vor Angst. Sie versuchte zu sprechen, aber der Knebel ließ es nicht zu. Sie zerrte an dem Schal um ihre Handgelenke, aber die Schlingen zogen sich nur noch enger zusammen, und ihre Hände verdrehten sich über dem Kopf. Sie versuchte, um sich zu treten, aber sie fand keinen Halt. Unkontrolliert baumelte sie herum, und ihre Füße berührten kaum den Boden.
Reid wandte sich von den Monitoren ab und wieder ihr zu. Er hatte sich eine enge schwarze Maske übergezogen, die sein Gesicht bedeckte. Bis auf die Mundöffnung waren nur seine Augen sichtbar. Die goldenen Sprenkel, die Gabby vor ein paar Stunden so anziehend gefunden hatte, glitzerten erregt.
Gabby versuchte zu schreien, aber sie konnte nicht. Sie hing nur hilflos da, ihr gefesselter Körper zuckte wehrlos. Sie dachte an ihre Mutter und Schwester in Bloomfield, die in ihren Betten lagen und süße Träume träumten. Sie fragte sich, was sie sagen würden, wenn herauskam, dass ein Fremder sie vergewaltigt hatte, mit dem sie freiwillig nach Hause gegangen war. Ihre Mutter würde zusammenbrechen und heulen und schreien und wahrscheinlich alles auf die böse Großstadt schieben, bis ihr Vater dafür sorgte, dass sie aufhörte. Doch ihr Vater würde Gabby die Schuld geben, weil sie wie eine Nutte mit dem nächstbesten Typ aus der Bar gegangen war. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Dann machte ihr Herz einen Aussetzer, als sie die aufgeregten Gesichter auf den Bildschirmen sah, die sie beobachteten. Eiskalte Angst packte sie. In diesem Moment wusste Gabby so sicher, wie morgens die Sonne aufging, dass sie diese Sonne nie wiedersehen würde. Auch ihre Familie würde sie nie wiedersehen, sie würde nicht mitbekommen, wie ihre Mutter schrie, oder den Vorwurf ihres Vaters spüren, wenn er beim nächsten Thanksgivingfest im Stillen ihr schlechtes Urteilsvermögen verdammte. Denn in diesem Moment wusste sie, dass sie sterben würde. Irgendwo hörte sie, wie ein Motor ansprang, aber es war nicht der Motor eines Fahrzeugs. Es hörte sich eher wie ein Mixer an. Oder wie eine Kreissäge. Szenen aus Horrorfilmen, die sie gesehen hatte, schossen ihr durch den Kopf.
«Gabriella, Baby», sagte Reid, als er langsam auf sie zukam und sein perfektes Lächeln durch den schwarzen Schlitz der Maske aufblitzen ließ. Einen Arm hatte er nach ihr ausgestreckt, den anderen versteckte er hinter dem Rücken. «Du bist im Begriff, berühmt zu werden. Bald bist du ein Star, Gabby. Und jetzt will ich dich einigen deiner größten Fans vorstellen …»
Zweiter Teil
4
Miami, Mai 2011
Detective Manny Alvarez von der Mordkommission des City of Miami Police Department kaute auf einer fettigen Rindfleisch-Empanada und blätterte die schrecklichen Fotos durch, die auf seinem Schreibtisch lagen. Der zugerichtete Leichnam einer jungen Frau, die nur ein schwarzes Höschen trug, lag in einem Müllcontainer, das lange blonde Haar mit dem Abfall verklebt, in dem sie gefunden worden war. Der erste Stoß Fotos zeigte nur ihr Gesicht, das zwischen Speiseresten, Mülltüten, alten Farbdosen und kaputten Möbelstücken mit vor Entsetzen weit aufgerissenen braunen Augen in den zynisch makellosen blauen Himmel über Miami starrte. Was von ihren Lippen noch übrig war, war zu einem fratzenhaften Grinsen verzerrt. Die Finger ihrer linken Hand ragten mit pink lackierten Nägeln aus dem übelriechenden Grab empor. Als Manny mit den Kollegen der Spurensicherung und dem Team der Gerichtsmedizin am Tatort angekommen war und zwischen Uniformierten und sensationslüsternen Gaffern auf der Leiter über dem stinkenden Container stand und sich bei 32 Grad im Schatten die cojónes abschwitzte, schoss ihm als Erstes der Gedanke durch den Kopf, dass etwas oder jemand unter ihr die arme Frau in den Abgrund zerrte, wie in dem Horrorfilm Drag Me to Hell. Es wirkte, als würde sie an ihren schönen blonden Haaren hinunter in den Müll gezogen werden, geradewegs in die Hölle, während sie verzweifelt – vergeblich – die Hände nach Hilfe ausstreckte.
Doch da war niemand, der ihr helfen konnte.
Ihr Name war Holly Skole, Fallnummer F10-24367, und sie war im Jahr 2011 das vierunddreißigste Mordopfer in der Stadt. Ihre Leiche war von Esteban «Papi» Muñoz entdeckt worden, dem Besitzer von Papito’s Café. Er war auf Holly gestoßen, als er die Reste des Tagesgerichts vom Vortag entsorgen wollte. Mit einem Griff an die Brust war der alte Mann zurückgetaumelt, auf sein Restaurant zu – und direkt in einen Geländewagen hinein, der eben auf den Parkplatz fuhr. Glücklicherweise brach er sich beim Zusammenprall mit der Stoßstange des Lexus nur zwei Rippen. Unglücklicherweise jedoch beendete ein Herzinfarkt, höchstwahrscheinlich ausgelöst durch den Anblick der Leiche im Müllcontainer, sein Leben. Doch erst nachdem der Notarzt da gewesen war und den sechzehnfachen Großvater in die Leichenhalle gebracht hatte, nachdem alles protokolliert und der beschlagnahmte Lexus abgeschleppt worden war und die Schaulustigen sich verdrückt hatten, erst dann kam jemand auf die Idee, sich einmal umzusehen und herauszufinden, was den alten abuelo eigentlich derartig erschreckt hatte. Schließlich schob ein blutjunger Verkehrspolizist, der vor zwanzig Minuten seinen Dienst angetreten hatte, die Klappe des Müllcontainers auf – und verbrachte den Rest des Morgens damit, seine Cornflakes auszukotzen.
Mit einem Schluck schlechtem Kaffee aus dem Automaten auf dem Flur spülte Manny den letzten Bissen der Empanada herunter, während er die Fotos durchblätterte und noch einmal die Berichte überflog. Abgelegte Leichen waren nie gut. Nicht dass ihm die blutigen Folgen von häuslicher Gewalt oder Gang-Schießereien sympathischer waren, aber wenn eine abgelegte Leiche gefunden wurde, befand sie sich meistens schon in fortgeschrittenem Verwesungsstadium, und sie stank und sah scheußlich aus. Der wahre Tatort fehlte – und damit die wichtigsten Spuren. Außerdem war es tragisch, wenn einem Opfer das letzte Quäntchen Würde genommen wurde, indem seine sterblichen Überreste wie Abfall einfach weggeworfen wurden. Verstörend vor allem, wenn die Leiche, die entsorgt wurde, einer hübschen neunzehnjährigen College-Studentin gehörte, die ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt hätte.
An die Vermisstenanzeige des Coral Gables Police Department war ein Foto der lebhaften Studentin aus Connellsville, Pennsylvania, geheftet, die an der University of Miami eingeschrieben war. Ebenmäßige Haut, ein ansteckendes Lächeln und honigblondes Haar. Holly hatte ein Teilstipendium für Tanz und studierte Kommunikationswissenschaft im Hauptfach, als sie im April nach der Feier des einundzwanzigsten Geburtstags einer Freundin im Hardcore-Nachtclub Menace spurlos verschwand. Neun Tage später wurde ihre Leiche im Design District am anderen Ende der Stadt gefunden – einer seit kurzem angesagten Gegend, angrenzend an das berüchtigte Problemviertel Overtown, wo 1982 die Rassenunruhen in Miami begonnen hatten.
Es war nicht schwer, sie zu identifizieren; Hollys Handtasche mit vollem Geldbeutel und all ihren Kreditkarten lag bei ihr im Müllcontainer. Dank ihrer besorgten Mutter, die aus Pennsylvania eingeflogen war, sobald Hollys Mitbewohnerin die Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, waren Fotos von Holly durch alle lokalen Medien gegangen, und so hatte Manny, als er auf der Leiter stand, sofort gewusst, wen er vor sich hatte. Und nun stand unter seinem Schreibtisch ein Pappkarton voller Familienfotos, die Cookie Skole ihm gegeben hatte, nachdem man ihre Tochter aus dem Müll gezogen hatte und die Ermittlung offiziell der Mordkommission übergeben worden war. Eigentlich hätte ein Foto gereicht, da die junge Frau ja tot war, aber wie erklärte man das einer am Boden zerstörten Mutter? Also hatte Manny den ganzen Karton genommen. Die Bilder reichten von Hollys Geburt bis zu einem Schnappschuss am letzten Weihnachtsfest, als sie zu Hause bei ihren Eltern unterm Weihnachtsbaum Geschenke öffnete. Die Fotos passten allerdings nicht so recht zu denen, die Holly auf ihrer Facebook-Seite zeigten, mit Mikrominiröcken und Netzoberteilen.
Holly Skole war zwar erst über eine Woche nach ihrem Verschwinden gefunden worden, aber offenbar noch nicht lange tot. Es sah sogar so aus, als hätte ihre Leiche nur wenige Stunden in dem Container gelegen, und der Rechtsmediziner gab an, dass die Totenstarre – die sich gewöhnlich spätestens zweiundsiebzig Stunden nach Eintritt des Todes wieder löste – noch in Kraft war. Das hieß, dass Holly erst seit kurzem tot war, als man sie fand. Und das wiederum hieß, dass sie über längere Zeit irgendwo festgehalten worden war, bevor ihr Mörder sie von ihrem Elend erlöste …
Sie hatte Verätzungen an den Füßen, Händen und im Gesicht, Fesselspuren an den Handgelenken und eine seltsame Verbrennung im Nacken. Laut toxikologischem Befund hatte man ihr mehrfach Diphenhydramin und Dextromethorphan injiziert – die Wirkstoffgruppen von Schlaf- und Erkältungsmitteln –, die bei erhöhter Dosierung Halluzinationen hervorriefen, wie Manny wusste. Holly war mit verschiedenen Objekten vergewaltigt und sexuell missbraucht worden. Todesursache war Ersticken. Doch die Verletzung, die Manny am meisten zu schaffen machte, war das Lächeln. Beziehungsweise das Fehlen eines solchen. Hollys Lippen waren mit Schwefelsäure weggeätzt worden, sodass Zähne und Zahnfleisch frei lagen und es von weitem aussah, als würde sie grinsen. Manny hatte den Eindruck, Hollys Mörder wollte, dass sie gefunden wurde. Er hatte gewollt, dass alle das groteske Grinsen sahen, das er ihr verpasst hatte, bevor es hungrigen Ratten zugeschrieben wurde oder der Verwesungsprozess das Seine tat. Kein Wunder, dass den armen Papi Muñoz der Schlag getroffen hatte, als er die Klappe des Containers öffnete. Er hatte in die Hölle hinuntergesehen – und die Hölle hatte zurückgegrinst.
Dreiundzwanzig Jahre als Cop in Miami – achtzehn davon bei der Mordkommission –, und trotzdem gab es leider immer noch Dinge, die selbst Manny Alvarez schockten, den sonst unerschütterlichen, körperlich einschüchternden, hundertzwanzig Kilo schweren Detective aus der Fassung brachten. Aus seiner Sicht gab es für die meisten Morde einen Grund. Jemand regte sich auf, verlor die Beherrschung und drückte ab, stieß mit dem Messer zu oder trat aufs Gas. Ein anderer wollte Rache, weil er sich ungerecht behandelt oder sich bestohlen oder betrogen fühlte, oder weil er nicht das Dope bekommen hatte, das ihm zustand. Oder einer brauchte Geld, und es löste sich ein Schuss, als er es sich zu nehmen versuchte. Oder es musste jemand einen Zeugen loswerden. Selbst Gang-Morde, die nur dazu dienten, anderen Angst zu machen oder in den Kreis aufgenommen zu werden – so pervers die Gründe auch sein mochten, es gab für das Töten zumindest ein Motiv. Aber hin und wieder landete ein Fall auf Mannys Schreibtisch, der sich allem Verstand widersetzte. Der keinen Grund, kein Motiv erkennen ließ. Ein Leben, nur um des Tötens willen ausgelöscht. Vielleicht, um eine kranke, archaische Neugier zu befriedigen, oder schlimmer noch – zum Spaß. Manny starrte das letzte Foto des missbrauchten Opfers an, aufgenommen auf dem Stahltisch in der Gerichtsmedizin. Das makabre Grinsen, die Fesselspuren, Verätzungen, Injektionen – alles eindeutige Hinweise auf sadistische Folter. Der Mörder hatte die junge Frau tagelang festgehalten, zweifellos, um mit ihr zu spielen, an ihr herumzuexperimentieren, ihr Angst zu machen, bis er sie am Ende schließlich erwürgte.
Der Verdächtige, dessen Kautionsverhandlung Manny hier vorbereitete, war kein Freund oder Ex-Liebhaber, kein Kollege oder ungeliebter Kommilitone von Holly. Er war weder mit ihr verwandt, noch war er sauer auf sie gewesen, soweit es Manny sah. Tatsächlich hatte Holly ihren Mörder offenbar erst am Abend ihres Verschwindens kennengelernt, eine schicksalhafte Begegnung, als sie nichts Böses ahnte. Sie war nicht beraubt worden; ihr Wagen stand noch auf dem Parkplatz des Menace, wo sie ihn stehengelassen hatte. Es gab keine irregulären Bewegungen auf ihrem Bankkonto, keine unbefugten Einkäufe mit ihren Kreditkarten. Es gab keinen Hinweis auf Drogengeschäfte oder die Verwicklung in Gang-Streitigkeiten. Die Vergewaltigung allein konnte die offenkundige Anwendung von Folter oder den gewaltsamen sexuellen Missbrauch nicht erklären. Die Verletzungen, die Holly erlitten hatte, gingen weit über das hinaus, was bei einem Vergewaltiger als «normales» Verhalten gelten würde. Selbst bei einem Vergewaltiger, der sein Opfer tötete. Ohne weitere Erläuterungen des Täters war dieser Mord einfach nicht zu verstehen, und die schrecklichste Erkenntnis zu Hollys Tod war, dass es keine Erklärung gab: Ihr Mord war vollkommen sinnlos.
Manny warf einen Blick auf die Uhr. Verdammt. Es war schon fast zwei Uhr. Höchste Zeit, sich auf den Weg rüber ins Gericht zu machen. Bei der Anhörung arbeitete er einer verspannten, hochhackigen Staatsanwältin zu, die wahrscheinlich halb zwei meinte, als sie zwei Uhr sagte – auch wenn Manny sicher war, dass ihr Fall niemals vor drei Uhr drankäme, weil heute der lahme Steyn auf der Bank saß, der selten vor zwei vom Mittagessen kam. Und dessen Verhandlungslisten den Umfang von Harry-Potter-Romanen hatten.
Manny kippte den Rest seines Kaffees hinunter und schob die Fotos und Berichte in die schon etwas ausgefranste Fächermappe. Es war Zeit, einen Pappkarton herauszuholen. Oder mehrere. Nach all den Jahren im Schützengraben entwickelte man ein Gefühl dafür, welche Fälle «Quickies» waren – jede Menge Beweise, kooperative Zeugen, ein belastendes Geständnis – und rasch zu einem Deal führten. Die anderen waren die Kopfschmerzfälle – schlampiger Tatort, keine Zeugen, Indizienbeweise, ein verschlossener, arroganter Mistkerl als Angeklagter. Ganz zu schweigen von den Jahren hanebüchener Berufungsverfahren, falls man den Kerl verurteilt bekam. Leider fiel Florida vs. Talbot Lunders in die Kopfschmerzsparte.
Manny wickelte die Reste seiner Empanada in die Alufolie und warf sie über den Kopf des einzigen anderen Detectives im Mannschaftsraum hinweg, der nicht gerade Mittag machte, quer durch den Raum. Das Päckchen landete auf dem überquellenden Mülleimer neben dem Kopierer und löste eine Papierlawine aus. Mike Dickerson, ein mürrisches Faktotum, so alt wie das Gebäude selbst, warf Manny einen finsteren Blick durch die schwarze Brille zu. «Pass bloß auf, Bär», brummte er und schüttelte den Sportteil des Miami Herald in Mannys Richtung. «Du bist kein Josh Johnson.» Dann vergrub er den Kopf wieder hinter der Zeitung und lutschte weiter an seinem Sandwich.
«Hätte ich aber werden können, Pops», sagte Manny mit einem tiefen Seufzer, als er die Papiertüte zusammenknüllte, in der die Empanada gesteckt hatte, und auch diese quer durch den Raum pfefferte. Diesmal traf er den Kopierer.
«Sehr witzig. Ich weiß ja nicht, womit du geworfen hast in den zehn Minuten, die du bei der Juniorliga mitspielen durftest, aber ich sag dir eins, Kleiner, du kannst einfach nicht zielen.»
«Hab dir immerhin das Toupet von der Platte geschossen.»
Unwillkürlich griff sich Mike an den Kopf.
«Mach dir nicht in die Hose, Pops. War nur ein Witz», sagte Manny und lachte tief. «Sitzt alles noch.»
«Du verdammter kahler Yeti.»
«Du solltest dich auch outen, Mikey. Viel besser als der Teppich. Die Ladys kriegen nicht genug davon – wollen dir ständig deine glatte, seidige Melone streicheln.»
An dem Tag, als Manny der Truppe beigetreten war, hatte er sich den Kopf rasiert und diese Frisur seitdem beibehalten. Nur seine sonstige Körperbehaarung ließ er wild wuchern – auf Armen, Händen, Rücken und Brust –, womit er sich den Spitznamen Bär verdient hatte. Bis mittags wuchs ihm ein Dreitagebart, und dazu trug er einen dichten, borstigen schwarzen Schnurrbart. Die Entscheidung zur Glatze hatte jedoch nicht nur mit Eitelkeit zu tun. Zum einen schwitzte er weniger. Zum anderen wirkte er als riesiger, stämmiger kahler Kubaner mit dichtem schwarzem Schnurrbart und dichten schwarzen Augenbrauen, die ständig gerunzelt waren, ziemlich bedrohlich. Die meisten Angeklagten überlegten es sich zweimal, ob sie sich mit ihm anlegen wollten. Womit er schneller zu Geständnissen kam als die meisten seiner Kollegen. Außerdem gefiel es anscheinend den Ladys. Dreimal war Manny verheiratet gewesen, ohne ein einziges Haar auf dem Kopf gehabt zu haben, als er seine drei Ex-Frauen kennenlernte, somit war klar, dass die Glatze ihm keineswegs die Chancen vermasselte.
Dickerson schnaubte und schüttelte wieder seine Zeitung. «Hast du nicht einen Mord aufzuklären, Manuelo?»
«Bin gerade auf dem Weg zum Gericht», antwortete Manny und zog sich das Sakko über.
«Wo hast du bitte das Ding ausgegraben?»
«Was denn?»
«Die Jacke.»
«Die Staatsanwaltschaft wollte, dass ich mich schick mache. Gefällt’s dir nicht?»
«Sind das Flicken an den Ellbogen?»
«Sehr witzig. Das sind keine Flicken, Pops. Das Ding ist original …», Manny warf einen Blick auf das Etikett in der Jacke, «… Haggar. Habe ich mir in der Aventura Mall besorgt.» Er zuckte die Schultern. «Ich finde meinen guten Anzug nicht. Muss noch in der Reinigung sein, seit dem letzten Prozess.»
«Schicke Krawatte.»
Manny wedelte mit der Spitze der blau-grünen Krawatte, die mit winzigen Football-Helmen der Miami Dolphins gemustert war. «Danke.»
Dickerson verdrehte wieder die Augen. «Und was machst du im Gericht?»
«Ich habe ein Arthur Hearing.» Arthur Hearing hieß in Florida der Haftprüfungstermin innerhalb des Vorverfahrens, bei dem über eine eventuelle Kaution verhandelt wurde und die Termine festgesetzt wurden.
Dickerson grinste anzüglich. «Ich wette, dein Staatsanwalt hat ein Paar hübsche Haxen und einen weiblichen Vornamen.»
«Wer zum Teufel sagt so was wie ‹Haxen›?»
«Du würdest nicht mal zur Beerdigung deiner Mutter freiwillig ein Jackett anziehen.»
«Jedenfalls nicht im Juni in Miami. Verdammt, für so was haben wir Kubaner das Guayabera-Hemd erfunden, Pops. Schick, wenn’s sein muss, und trotzdem kühl und bequem. Aber du hast recht – der Staatsanwalt ist eine Sie. Und sie hat tatsächlich hübsche Beine. Nicht dass ich hingesehen hätte.»
«Wusste ich’s doch», antwortete Dickerson mit dem gleichen anzüglichen Grinsen.
«Du kannst mich mal, alter Mann. Du hast ja keine Ahnung.»
«Welchen Fall hast du? Die Kleine aus dem Müllcontainer?»
«Ja. Sie heißt Holly Skole.»
«Hab die Fotos auf deinem Tisch gesehen.»
«Tut mir leid.»
«Wusste nicht, dass ihr schon einen Verdächtigen habt. Ist er was wert?»
«Ich will hier nicht über ungelegte Eier reden; so was geht immer schief. Du hast die Bilder gesehen – der Kerl ist ein Monster. Er muss zahlen für das, was er getan hat.»
«Ausnahmsweise sind wir uns einig, junger Jedi.»
Manny lachte. «Ausnahmsweise.» Dann nahm er seinen Ordner und machte sich auf den Weg aus dem Mannschaftsraum des Morddezernats hinein in das kontrollierte Chaos des restlichen Reviers.
«Ruf mich an, wenn du einsam bist, Sonnyboy», rief Dickerson ihm nach, bevor er sich wieder in seine Zeitung vertiefte. «Ich habe nur noch einhundertdreiundachtzig Tage übrig. Genügend Zeit, um von deinem Meister zu lernen …»
Die Stimme des alten Mannes wurde von der lärmenden Meute auf dem Flur verschluckt. Manny hatte früh gelernt, dass man sich nie auf die Eindeutigkeit eines Falls verlassen oder ein Urteil vorhersagen durfte. Kein Fall war wasserdicht, schon gar nicht dieser. Manny musste seinen Fall vorbereiten, als wollte er ein Haus bauen, wenn ein Hurrikan im Anmarsch ist – langsam, sorgfältig, mit einem starken Fundament.
Er setzte sich die Sonnenbrille auf und trat hinaus in die sen