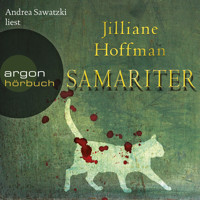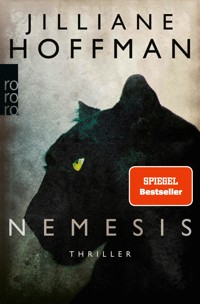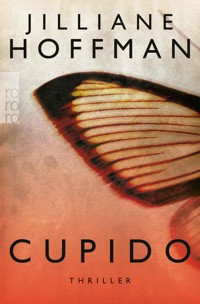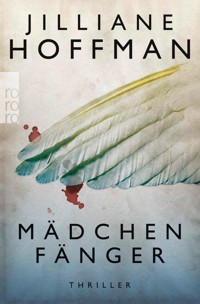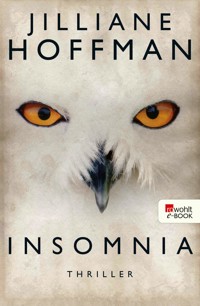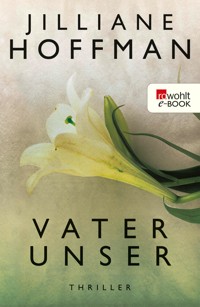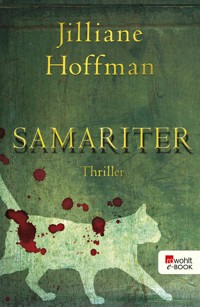
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine falsche Entscheidung. Die dein Leben verändert. Und ein anderes auslöscht. Eine bestialische Mordserie erschüttert Südflorida: Junge Frauen werden entführt und zu Tode gequält, ihre Leichen inmitten von Zuckerrohrfeldern abgelegt. Die Polizei hat keine Spur. Bis eine Zeugin auftaucht: Eines Nachts, während eines schweren Tropensturms, beobachtet die junge Mutter Faith Saunders eine Frau, auf der Flucht vor einem Mann. Starr vor Angst begeht Faith einen folgenschweren Fehler. Und ihr Leben verwandelt sich in einen Albtraum … Ein Thriller über Schuld und Zivilcourage, der unter die Haut geht: der neue, lang erwartete Psychothriller von Bestseller-Autorin Jilliane Hoffman, die u.a. mit «Cupido», «Morpheus» oder «Mädchenfänger» Millionen von Lesern weltweit begeistert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jilliane Hoffman
Samariter
Thriller
Über dieses Buch
Eine falsche Entscheidung.
Die dein Leben verändert.
Und ein anderes auslöscht.
Eine bestialische Mordserie erschüttert Südflorida: Junge Frauen werden entführt und zu Tode gequält, ihre Leichen inmitten von Zuckerrohrfeldern abgelegt. Die Polizei hat keine Spur. Bis eine Zeugin auftaucht: Eines Nachts, während eines schweren Tropensturms, beobachtet die junge Mutter Faith Saunders eine Frau, auf der Flucht vor einem Mann. Starr vor Angst begeht Faith einen folgenschweren Fehler. Und ihr Leben verwandelt sich in einen Albtraum …
Ein Thriller über Schuld und Zivilcourage, der unter die Haut geht: der neue, lang erwartete Psychothriller von Bestseller-Autorin Jilliane Hoffman, die u.a. mit «Cupido», «Morpheus» oder «Mädchenfänger» Millionen von Lesern weltweit begeistert hat.
Vita
Jilliane Hoffman war Staatsanwältin in Florida und unterrichtete jahrelang im Auftrag des Bundesstaates die Spezialeinheiten der Polizei – von Drogenfahndern bis zur Abteilung für Organisiertes Verbrechen – in allen juristischen Belangen. Mit ihren Romanen «Cupido», «Morpheus», «Vater unser», «Mädchenfänger» und «Argus» gelangte sie jeweils auf Anhieb an die Spitze der internationalen Bestsellerlisten.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel «All the little pieces» bei HarperCollins Publishers, UK.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«All the little pieces» Copyright © 2015 by Jilliane P. Hoffman
Redaktion Elisabeth Mahler
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildung Dorling Kindersley/Getty Images; cgtextures.com
ISBN 978-3-644-21681-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
[Hauptteil]
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Zweiter Teil
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
Dritter Teil
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
EPILOG
DANKSAGUNGEN
[Hauptteil]
Erster Teil
Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass,
sondern Gleichgültigkeit.
Das Gegenteil von Kunst ist nicht Hässlichkeit,
sondern Gleichgültigkeit.
Das Gegenteil von Glaube ist nicht Unglaube,
sondern Gleichgültigkeit.
Das Gegenteil von Leben ist nicht Tod,
sondern Gleichgültigkeit.
Elie Wiesel
1
Die regennasse Nachtluft roch giftig – bitter und rauchig – wie am Tag nach einem Wohnungsbrand, wenn die verkohlten Trümmer in chemischen Wasserpfützen vor sich hin schwelen. Der klebrige Geschmack schnürte ihr die Kehle zu. Er ließ sich nicht runterschlucken oder ausspucken.
Sie stolperte durch das Labyrinth des Zuckerrohrfelds. Ohne Mond, Sterne oder Lampe sah sie kaum die Hand vor Augen. Sie lief barfuß, und der rutschige Matsch war voller Steine, die sich wie Landminen anfühlten, wenn sie darauf trat, weil immer noch Glassplitter in ihren Fußsohlen steckten. Der Schmerz explodierte und schoss durch ihren Körper wie durch einen Blitzableiter bis in die Zähne. Wenn sie nicht mehr rennen musste, würde sie versuchen, die Scherben rauszuziehen. Aber so weit war sie noch nicht. Mit ausgestreckten Händen taumelte sie durch die Reihen der riesigen Zuckerrohrhalme, die ihre ein Meter sechzig weit überragten, in der Hoffnung, die würden sie auffangen, falls sie in etwas hineinlief.
Oder in jemanden.
Bei dem Gedanken fing sie zu zittern an. Ohnehin war ihr noch nie so kalt gewesen. Sie war in Florida aufgewachsen. Da wurde es nie kalt, selbst wenn von Kanada eine Wetterfront runterzog und die alten Leute und Nachrichtensprecher über die Eiseskälte klagten und um ihre Orangenbäume fürchteten. Jetzt war sie nass bis auf die Knochen, und der scheißkalte Wind dieses scheißkalten Sturms fuhr ihr durch die Glieder. Der Wind heulte durch das Feld und brachte die Zuckerrohrstangen zum Pfeifen, bis es klang, als schrien sie. Sie biss sich auf die Zunge, um das Klappern ihrer Zähne zu stoppen.
Es war schwer, den Impuls zu unterdrücken und um Hilfe zu rufen. Vielleicht war da ja jemand, irgendwo, hinter dem verdammten Zuckerrohr. Vielleicht nur ein paar Meter entfernt. Ein Haus. Eine Tankstelle. Eine Straße, die hier rausführte, aus diesen gottverdammten Feldern. Irgendwo in der Nähe war ein Acker niedergebrannt und abgeerntet worden. Das war der Geruch, den sie schmeckte – verbranntes Zuckerrohr. Vielleicht waren Leute da draußen, Farmer oder Saisonarbeiter, die in Zelten oder Hütten wohnten und abwarteten, bis der Sturm weiterzog und der Morgen anbrach, damit sie auch dieses Feld abbrennen konnten. Vielleicht würde sie jemand hören, ihr helfen, sie reinlassen.
Sie verstecken.
Doch bevor sie den Gedanken zu Ende gedacht hatte, wusste sie, dass er dumm war. Es sprach alles dagegen. Wahrscheinlich war sie weit weg von der nächsten Siedlung, weit weg von einem menschlichen Wesen. Wahrscheinlich war sie mutterseelenallein hier draußen, und ihre beste Chance war, sich im Zuckerrohr zu verstecken, bis die Sonne aufging und die Saisonarbeiter auf Pritschenwagen hergekarrt wurden. Wahrscheinlich wären die Einzigen, die ihre Hilfeschreie hören würden, die Männer, die sie jagten.
Sie dachte an die Gesichter ihrer Lieben: die süße kleine Ginger, die abends immer noch ein Fläschchen bekam, obwohl alle sagten, sie sei zu groß dafür. Luis, den Mistkerl – den eifersüchtigen, untreuen Mistkerl, der ihr öfter das Herz gebrochen hatte, als sie zählen konnte. O Gott, wie sie ihn liebte. Sie hatte ihn immer geliebt, würde ihn immer lieben. Mami, Papi, Abu, Cindy, Alonzo, Quina, Mae. Dann verdrängte sie die Gesichter. An sie zu denken, war wie eine Kapitulation, als würde sie sich im Geist schon von ihnen verabschieden.
Nein! Nein! Reiß dich zusammen!
Sie wischte sich über die Augen und schluckte das Schluchzen herunter. Die Männer waren irgendwo da draußen. Sie würden sie wimmern hören und einkreisen wie Geier, die dem Röcheln eines sterbenden Tiers folgten. Im Moment schritten sie die Felder ab, durch die sie irrte, und versuchten, sie per GPS zu orten, um das, was von ihr übrig war, aufzulesen. Sie versuchte, sich auf den Kiefernduft zu konzentrieren. Irgendwo unter dem Gestank von nassem, verbranntem Zuckerrohr atmete sie den frischen Geruch von Kiefern ein. Es war der Duft der Hoffnung. Dieser Richtung würde sie folgen. Keine sentimentalen Abschiede mehr. Sie war hart im Nehmen. Sie war weiter gekommen als die anderen.
Sie lebte noch.
Als sie sich den Weg durchs Zuckerrohr bahnte, schlugen ihr die Blätter ins Gesicht und gegen die Hände, als steckten sie mit ihren Verfolgern unter einer Decke. Sobald sie das abgebrannte Feld erreichte, würde sie rennen. Sie würde rennen, trotz der Schmerzen in den Füßen und der Todesangst. Natürlich hätte sie dann keine Deckung mehr. Wieder kamen ihr die Tränen.
Vielleicht warteten sie genau darauf, um sich die Mühe zu sparen, sie im Feld aufzuspüren. Diese Männer – diese Irren! – kannten sich wahrscheinlich aus in den Feldern. Deswegen hatten sie sie hierhergebracht. Sie kannten die Eingänge und die Ausgänge. Und dieses Haus. Dieses schreckliche Haus, in das sie sie gebracht hatten. Es war so mit Zuckerrohr zugewachsen, dass die Stangen sogar bis ins Innere wuchsen.
Hier kannst du nicht bleiben. Triff eine Entscheidung! Was ist schlimmer? Dich im Zuckerrohr verstecken und gefunden und zurückgebracht werden … an diesen Ort? Oder wegrennen? Es zu einem der Häuser schaffen, die vielleicht direkt hinter dem Feld stehen?
Wegrennen. Lieber kämpfend untergehen. Das würde Luis ihr raten. Gott, sie wünschte, er wäre hier. Er würde es diesen Arschlöchern zeigen. Er würde sie zerstückeln, sie zwingen, sich gegenseitig aufzu…
«Komm, Kätzchen, komm.»
Ihr Herz machte einen Aussetzer. Er war direkt hinter ihr. Er holte auf. Panisch sah sie sich um. Wo zum Teufel war er? Sie ließ sich auf Hände und Knie fallen, kroch unter die Stangen. Ein sengender Schmerz fuhr ihr durchs Bein, das mit den Scherben. Sie betastete ihren Fuß, fühlte die Stelle an der Ferse, wo sich die Haut ablöste, das warme Blut zwischen ihren Fingern. Sie biss sich auf die Hand, um den Schmerz zu ertragen. Die schlimmen Gedanken kehrten zurück. Die Gesichter ihrer Familie waren wieder da.
Wenigstens findet die Polizei Spuren von mir. Sie werden das ganze Blut finden und testen und wissen, dass ich hier war. Dann bin ich nicht einfach verschwunden. Keiner kann denken, ich wäre abgehauen, hätte Ginger sitzenlassen …
Wieder so ein lächerlicher Gedanke. Sie könnte hier verbluten, und niemand würde je erfahren, wie sie sich im Dunkeln durch das Feld geschleppt hatte, auf der Flucht vor ihren Mördern. Der Regen würde alles wegwaschen. Die Landarbeiter, die hierherkamen, konnten direkt auf ihrem Grab stehen, doch solange die Irren ihre Leiche nicht hier liegen ließen, würde niemand je etwas erfahren. Und wenn sie sie nicht hier töteten, würden sie sie zurück an den Ort bringen, wo sie ihr all die grauenhaften Dinge angedroht hatten, und dann gäbe es erst recht keine Spur von ihr. Oder sie hackten sie in Stücke, die sie wie Streusel auf dem Feld verteilten, weil sie wussten, dass auch dieser Acker bald abgebrannt wurde. Und danach wäre von ihr nur mehr Asche übrig. Falls die Saisonarbeiter je über ein Stück von ihr stolperten und falls dann die Spurensicherung käme, um wie bei CSI Asche und Knochensplitter zu identifizieren, dann, nur dann, würde vielleicht eines Tages ein Ermittler hier rauskommen und versuchen, ihre letzten Augenblicke zu rekonstruieren. Vielleicht würde der wissen wollen, was genau passiert war. Sie biss sich fester in die Hand. Aber das war unmöglich. Weil sich niemand vorstellen konnte, was sie in diesem Moment erlebte. Das Grauen ging über jede Vorstellungskraft hinaus.
«Weißt du, warum der Hund die Katze jagt?»
Er war weniger als einen Meter entfernt. Sie hörte seine Stimme über dem Kreischen des Zuckerrohrs. Und er wusste, dass sie ihn hörte – er schrie, aber seine breite Südstaatenstimme war ganz ruhig.
Kroch sie in die richtige Richtung?
«Weil sie wegrennt. Wenn die Katze nicht rennen würde, würde der Hund sie nicht jagen. Katze und Hund – die beiden könnten Freunde sein, Schätzchen. Aber wenn die Katze rennt …» Er beendete den Satz nicht. «Du machst den Hund nur wütend – müde und verdammt wütend. Also, komm raus, Kätzchen, bevor ich stinksauer werde. Dann tut es nur noch mehr weh, du Schlampe.»
Das Licht seiner Lampe schnitt durch das Zuckerrohr – auf und ab, rechts und links. Sie blieb, wo sie war, rollte sich ein und machte sich ganz, ganz klein.
«Vielleicht versteckt sich die Katze. Und betet, dass der Morgen kommt und irgendwelche Honduraner auftauchen, die sie retten.»
Der Lichtkegel schien direkt in die nächste Reihe. Sie starrte zu Boden, damit das Licht nicht ins Weiße ihrer Augen fiel, und klammerte sich an eine Zuckerrohrstange.
«Das wäre dumm.»
Seine Stiefel schmatzten im Schlamm.
«Hunde haben eine feine Nase. Katzen können sich nicht verstecken, weil der Hund die Muschi riecht. O ja. Und wenn der Hund sie findet, dann reißt er ihr die Beine aus, weil sie es ihm so schwer gemacht hat.» Er fing zu glucksen an. Dann brach er in schrilles Gelächter aus.
Sie hielt sich die Ohren zu.
«Hast du sie gesehen?» Das war die andere Stimme. Der zweite Irre, der sich über ein Walkie-Talkie meldete.
«Noch nicht, Bruder», antwortete die Sumpfstimme. «Aber das ist mein Lieblingsteil. Wir finden sie und zeigen ihr, warum es gar nicht schlau war abzuhauen. Das wird lustig!»
Sie hielt sich den Mund zu, damit ihr Atem sie nicht verriet. Am Himmel donnerte es laut.
«Geh rüber zum Traktor», sagte die Sumpfstimme in das Walkie-Talkie. «Pass auf, dass sie nicht durchkommt und die Straße erreicht. Wenn wir sie auf der Straße verlieren, sind wir am Arsch.»
Wieder donnerte es. Sie sah zum Himmel hinauf. Bitte, bitte, bitte – kein Blitz. Sonst würde das ganze Feld aufleuchten wie ein Jahrmarkt …
Der Irre mit der Sumpfstimme hob schnüffelnd die Nase. «Aber ich sag dir eins, ich glaube nicht, dass sie weit gekommen ist, weil ich hier irgendwo Muschi rieche.»
Heiße Tränen rannen ihr über das schmutzige Gesicht. Sie hatte noch so viel vor in ihrem Leben. Wie oft hatte sie sich eine zweite Chance gewünscht, weil sie so viel Mist gebaut hatte. Sie war immer eine Enttäuschung gewesen.
«Dino-Forscher finden immer noch Dino-Spuren im Schlamm, Millionen von Jahren später …»
Zusammengerollt wie ein Kind, die Hände auf den Ohren, wiegte sie sich vor und zurück. Jeden Tag hatte sie gesagt, sie würde sich ändern, würde alles besser machen – morgen. Und dann war morgen da – und wieder vorbei. Diesmal aber würde sie es wirklich tun. Für Ginger, die eine bessere Mama verdiente. Für ihre eigene Mutter, die sich immer so viele Sorgen um sie machte. Wenn sie morgen nur erlebte …
Der Lichtkegel war direkt vor ihr, Zentimeter von ihrem Fuß entfernt. «Wie lange, glaubst du, bleiben deine Fußspuren im Schlamm, bevor der Regen sie weggewaschen hat, Schätzchen?» Der Lichtkegel glitt zwischen die Stangen, knapp an ihrer Jeans vorbei. Dann stapften die Stiefel weiter. Pitsch. Patsch. Pitsch. Patsch.
Plötzlich drehte er sich um, lief zurück, ging vor ihr in die Knie und hielt ihr die Taschenlampe ins Gesicht. «Hallo, Schlampe», gurrte er. «Ich hab sie!», schrie er triumphierend.
Noch nicht. Ein Morgen habe ich noch. Sie warf ihm eine Handvoll Schlamm und Steine ins Gesicht und stach mit einem Stock nach seinem Auge. Als er überrascht aufschrie, sprang sie auf und trat ihm, so fest sie konnte, ins Gesicht. Sie wünschte, sie hätte ihre Stiefel an. Dann hätte sie ihm ein paar Zähne eingetreten. Sie hätte ihm die Stiletto-Absätze in den hässlichen Schädel gerammt und ihm die roten, bösen Augen ausgestochen. Aber die Stiefel hatten sie ihr weggenommen.
Er sackte zu Boden, und sie trat ihm noch zweimal ins Gesicht, bevor sie durch das Zuckerrohr wegrannte.
«Schlampe!», heulte er.
Es war nicht weit bis zur Lichtung, das spürte sie. Der Kiefernduft wurde stärker. Es gab noch Hoffnung. Und dann, wie durch ein Wunder, blitzte es, und sie sah den Pfad, der durch das Feld geschlagen worden war. Jesus hatte genau im richtigen Moment Licht gemacht und ihr den Weg nach draußen gezeigt.
«Sie haut ab!», hörte sie die irre Sumpfstimme brüllen. «Verdammte Scheiße, sie hat mir was ins Auge gestochen! Ich kann nichts mehr sehen! Hol den Wagen! Sie darf es nicht in die Stadt schaffen!»
2
Faith Saunders spürte ihre Lider schwer werden und klatschte sich auf die Wange, um wach zu bleiben. Sie ließ das Fenster des SUV herunter und streckte das Gesicht in den Regen. Sie musste wach bleiben. Es führte kein Weg daran vorbei. Es war Mitternacht, und sie hatte noch eine weite Strecke vor sich. Anhalten war keine Option. Nicht hier draußen. Hier gab es nicht einmal eine Haltebucht. Sie richtete sich auf, drückte den Rücken durch und stemmte sich gegen das Lenkrad, während sie versuchte, sich trotz der Erschöpfung und der hämmernden Kopfschmerzen, die sich hinter ihren Augen zusammenballten, auf die Straße zu konzentrieren. Seit sie bei ihrer Schwester Charity in Sebring überstürzt aufgebrochen war, sah es draußen unverändert aus – nass und leer und schwarz. Unendliches Schwarz. Es war eine halbe Stunde her, seit sie den letzten Wagen auf der Straße gesehen hatte.
Der späte tropische Wirbelsturm Octavius hatte auf dem Weg nach Texas in weiten Teilen des Sonnenstaats einen Zwischenstopp eingelegt und machte den Bewohnern von Central und South Florida seit zwei Tagen das Leben schwer, mit Regen und Windböen von achtzig Stundenkilometern. Die meisten Leute waren klug genug, auf die Warnungen zu hören: Sie verließen die Häuser nicht und hielten sich von den Straßen fern.
Die meisten.
Faith nagte an ihrer Lippe. Sie hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass sie sich verfahren hatte, aber sie wusste einfach nicht genau, wo sie war. Sie müsste auf der Route 441 sein, nur dass die Straße nicht wie die Route 441 aussah, die sie am Nachmittag auf dem Weg zu ihrer Schwester genommen hatte. Andererseits war sie bei Tageslicht zu Charity aufgebrochen, und ohne Straßenlaternen, Tankstellen, Schnellrestaurants, Motels oder andere Merkmale hätte sie die Strecke im Dunkeln eh nicht wiedererkannt. Hier gab es nichts als Hektar um Hektar Ackerland, und seit zig Kilometern fuhr sie durch unendliche Zuckerrohrfelder, deren buschige, hochaufragende Pflanzen sich bedrohlich über die Straße neigten. Das war Central Florida, weit ab vom Ballungsgebiet Orlando und der 140000-Zimmer-Hotelopolis von Disney, Universal und SeaWorld. Central Florida bot nicht viel mehr als eine Handvoll Kleinstädte, Ackerland, den Okeechobee-See und die Everglades.
Direkt vor ihr zuckte ein gleißender Blitz über den Himmel, und sie schnappte nach Luft. Ihr Blick huschte auf die Rückbank, wo Maggie, ihre vierjährige Tochter, im Kindersitz schlief, den Daumen im Mund und den fadenscheinigen Stoffesel im Arm. Faith zählte im Kopf die Sekunden. Als der Donner kam, war er so laut und intensiv, dass sie ihn buchstäblich durchs Auto rollen spürte. Angespannt blickte sie in den Rückspiegel und rechnete mit einem neuen Heulkrampf. Aus heiterem Himmel von ihren Cousinen fortgerissen, hatte Maggie einen ihrer Tobsuchtsanfälle hingelegt und die erste Dreiviertelstunde der Fahrt gebrüllt, geheult und gegen den Beifahrersitz getreten, bis sie vor Erschöpfung eingeschlafen war. Faith sah, wie sie fester am Daumen saugte, die winzigen, schmalen Finger um die sommersprossige Nase gelegt. Zum Glück blieben die Augen zu.
Faith fiel ein Stein vom Herzen, und sie griff nach hinten, um Maggies nacktes Knie zu streicheln. «Cha-Cha», die uralte gehäkelte Babydecke, ohne die Maggie nicht das Haus verließ, war vom Kindersitz gerutscht. Faith streckte den Arm aus, fand sie am Boden und versuchte, sie über Maggies nackte Beine zu werfen. Stattdessen landete die Decke auf ihrem Kopf, sodass die Beine frei waren, dafür aber ihr Oberkörper bedeckt. Nicht das, was sie beabsichtigt hatte, aber vielleicht besser so, dachte Faith, als ein weiterer gezackter Blitz den Himmel aufriss, so bedrohlich nah, dass sie ihn beinahe hätte anfassen können. Cha-Cha dämpfte die Donnerschläge und bannte die teuflischen Blitze, die den Wagen schaurig aufleuchten ließen.
Auch wenn der Streit mit Charity nicht Faiths Schuld gewesen war – sie hatte sich das Ende der Geburtstagsfeier ihrer Schwester weiß Gott anders vorgestellt –, würde sie sich für Maggie eine Wiedergutmachung für den plötzlichen Aufbruch einfallen lassen müssen. Vor den Augen all der Fremden hinaus in den Sturm! Vielleicht würde sie Maggie morgen mit ins Kino nehmen oder auf die Eisbahn zum Schlittschuhlaufen. Vielleicht sollte sie sie den Kindergarten schwänzen lassen, und sie könnten zusammen Kekse backen. Maggie wäre sowieso nicht in den Kindergarten gegangen, wenn sie wie geplant in Sebring übernachtet hätten. Und nach allem, was heute passiert war, konnte auch Faith einen Ausruhtag gut gebrauchen.
Sie schluckte zwei Kopfschmerztabletten, die sie im Handschuhfach gefunden hatte, und spülte sie mit einem Schluck eiskalten Kaffee herunter, den sie nachmittags auf der Hinfahrt an der Tankstelle geholt hatte. War sie wirklich erst vor – wie vielen? – zehn Stunden hochgefahren? Seufzend versuchte sie, sich wieder auf das Fahren zu konzentrieren und wach zu bleiben, versuchte, die hässlichen Gründe zu vergessen, warum sie überhaupt in dieser stürmischen Nacht hier draußen war. Die Erinnerung tat weh. Sosehr sie vergessen wollte, kehrten ihre Gedanken immer wieder zurück – in die Küche ihrer Schwester, zu der glotzenden, feixenden Menge fremder Leute, die sich um die provisorische Bar in der Essecke drängten und das Familiendrama verfolgten, als wäre es Teil der Abendunterhaltung. Charity hatte ihren Weg gewählt, und sie hatte den Mann gewählt, mit dem sie ihn gehen wollte. Es war Zeit, dass Faith diese Wahl akzeptierte und aufhörte, die Probleme ihrer Schwester lösen zu wollen. Denn die wollte sie offensichtlich nicht gelöst haben. Jahrelang hatten alle Charitys Unglück auf Nick geschoben, ihren bescheuerten nichtsnutzigen Ehemann, aber vielleicht war es an der Zeit, die Verantwortung bei der richtigen Person zu suchen. Und heute Abend … tja, heute Abend war das Fass übergelaufen. Wütende Tränen rannen Faith über die Wangen.
Selbst der schlechte kalte Kaffee verdeckte den unangenehm süßlichen Geschmack der Hurricanes nicht, die Nick ihr aufgedrängt hatte, als der Abend jung, die Party in vollem Gang und alles gut gewesen war. Faiths Kehle fühlte sich an, als hätte sie Tapetenkleister mit Maracuja-Geschmack getrunken. Sehnsüchtig wanderte ihr Blick zum offenen Handschuhfach, wo sie die Kopfschmerztabletten gefunden hatte. Unter einem Bündel Servietten lag ein altes, halbleeres Päckchen Marlboro Lights. Sie hatte in der Schule mit dem Rauchen angefangen und versuchte seit dem College, damit aufzuhören. Doch erst mit der Morgenübelkeit hatte sie es das erste Mal geschafft. Dann hatte sie vier Jahre lang erfolgreich die Finger von den Zigaretten gelassen, bis der alles verändernde Anruf gekommen war. Das Erste, was sie nach dem Auflegen getan hatte, war, sich eine Zigarette anzuzünden. Es war, als würde sie einen alten Freund willkommen heißen, den sie in diesem Moment dringend nötig hatte. Ihre Lunge hatte kaum Widerstand geleistet, und in kürzester Zeit rauchte sie wieder ein Päckchen am Tag. Diesmal fiel ihr das Aufhören viel schwerer, zumal eine neue Schwangerschaft momentan kein Thema war.
Sie griff nach der Klappe des Handschuhfachs und schlug sie zu. Ganz gleich wie dringend sie den alten Freund gebrauchen konnte, es kam nicht in Frage. Nicht mit Maggie auf dem Rücksitz. Wenn sie sich in nächster Nähe der sauberen Lungen ihrer kleinen Tochter eine Zigarette anzündete, wäre sie offiziell die schlechteste Mutter der Welt. Stattdessen kaute sie an einer Nagelhaut.
Der Regen wurde stärker, und Faith drosselte das Tempo auf dreißig. In sechs Minuten brach Charitys große runde Dreißig an. Wie würde sie den Moment feiern? Lag sie bewusstlos auf dem Sofa? Waren Nicks bescheuerte Freunde noch da? Hatten sie wilden Geburtstags-Sex? Von dem Gedanken wurde ihr übel. War sie wenigstens ein bisschen traurig über den Streit mit Faith?
Ursprünglich hatte Faith Charity und ihre drei Kinder – die elfjährige Kamilla, die fünfjährige Kourtney und die zweijährige Kaelyn – nächstes Wochenende nach Disney World einladen wollen, um Charitys Dreißigsten mit ihr und Maggie dort nachzufeiern. Keine Ehemänner – nur die sechs Mädels und Micky Maus im Land der ewigen Glückseligkeit. Lange im Voraus hatte Faith zwei Zimmer im Walt Disney World Dolphin Resort gebucht. Natürlich würde sie alles abblasen, dachte sie, während sie sich die Tränen abwischte. Es bestand keine Chance, dass sie sich bis Freitag wieder versöhnten. Vielleicht würden sie sich nie wieder versöhnen.
Nach zehn Jahren Ehe hatte Nick Charity vielleicht endlich zeigen wollen, dass ihm etwas ihr lag. Oder er wollte Faith einen Strich durch den Disney-Ausflug machen. Oder die Party für Charity war einfach eine gute Ausrede, um sich mit seinen Kumpels zu besaufen – Charity selbst hatte kaum Freundinnen, mit denen er noch nicht geschlafen hatte. Aus welchen Gründen auch immer: Nick «Big Mitts» Lavecki, der Mann, der den Geburtstag seiner Frau öfter vergessen als er daran gedacht hatte, hatte beschlossen, in letzter Minute eine Überraschungsparty für Charity zu organisieren. Und in letzter Minute hieß, dass er Faith erst heute Morgen eingeladen hatte.
«Heute Abend, Nick?» Faith hatte auf die Uhr über dem Kamin gesehen, in ihrem Haus in Parkland, 250 Kilometer von Sebring entfernt. Es war halb elf am Sonntagmorgen.
«Es wird nichts Besonderes. Nur ein paar Freunde, weißt du, bisschen Bier, was vom Supermarkt, Würstchen und Chicken-Nuggets, so was. Und eine Torte. Die besorge ich auch, beim Supermarktbäcker. Eine Schokoladentorte. Die sollen ‹Happy Birthday, altes Haus› draufschreiben oder so was.» Er lachte. «Und vielleicht einen Zuckerguss-Rollstuhl danebenmalen oder so.»
Sie schauderte. «Im Ernst, Nick?»
«Nein! War nur ein Witz, Faithey. Ich nehme die Kinder mit, die können schwarze Luftballons und Pappteller aussuchen.» Er lachte wieder. «Charity wird sich totlachen.»
Faith sah aus dem Küchenfenster. Der Sonnenschirm war umgefallen, und das Polster der Liege trieb im Pool, der kurz davor war überzulaufen. Jarrod saß ihr gegenüber und fragte lautlos Was ist los? Sie schüttelte den Kopf. «Das Wetter ist ziemlich eklig, Nick.»
«Hier oben ist es gar nicht so schlecht. Alle haben zugesagt, dass sie trotzdem kommen.»
«Alle? Wie viele Leute kommen denn?»
«Weiß nicht, dreißig oder vierzig oder so.»
«Wow. Wann hast du denn zu planen angefangen?»
«Keine Ahnung. Vor ’ner Woche oder so.»
«Danke, dass du mir so zeitig Bescheid gibst.»
«Ach so, ich dachte, ich hätte es dir gesagt. Ich verstehe, wenn du es nicht schaffst. Wir wohnen ja so weit weg. Wie hat Jarrod gesagt? Am Arsch der Welt?»
Seit drei Jahren ritt Big Mitts auf diesem Kommentar herum, der nicht für seine Ohren bestimmt gewesen war. «Er hat nur Spaß gemacht, Nick.»
«Ich weiß schon. Ich nehme dich nur auf den Arm, Faithey. Hör zu, ich versteh schon, wenn du es nicht schaffst. Das Wetter ist scheiße, und es ist eine lange Fahrt. Kein Problem. Charity versteht das bestimmt auch.»
Natürlich hatte Nick Verständnis dafür, wenn Faith nicht kam, weil er gar nicht wollte, dass sie kam. Wahrscheinlich hatten ihn die Kinder den ganzen Morgen gelöchert, ob Tante Faith, Onkel Jarrod und Maggie auch zu Mommys Party kämen. Wahrscheinlich rief er nur deswegen an. Und weil Charity stinksauer gewesen wäre, wenn sie herausgefunden hätte, dass ihre einzige Schwester nicht zu ihrem dreißigsten Geburtstag eingeladen war.
«Ich komme», hatte Faith gesagt.
Was ist los?, fragte Jarrod wieder.
«Toll», hatte Nick mit wenig Begeisterung geantwortet.
«Reservier mir die Couch. Ich fahre morgen früh zurück.»
«Die musst du vielleicht mit einem Freund teilen, Faithey.» Sie hasste es, wenn er sie so nannte. Hasste es. Es war Charitys Spitzname für sie, seit sie klein waren, aber wenn Nick es sagte, hatte sie das Gefühl, er machte sich über sie lustig. «Ich glaube, T-Bone war Erster», erklärte er glucksend, und sie wusste, dass er grinste. Die meisten von Nicks Kumpels hatten solche Spitznamen: T-Bone, Skinny, Slick, Gator. Dabei waren sie keine Gangster oder Mafiosi – sie waren einfach nur erwachsene Männer mit Spitznamen.
«Sag T-Bone, er kann im Wagen schlafen. Ich nehme die Couch.»
«Daddy, sag Tante Faif, sie soll Maggie mitbringen!», piepste eine lispelnde Stimme im Hintergrund.
«Wenn du kommst, bring Maggie mit», sagte Nick. «Die Kinder werden oben ins Kinderzimmer eingesperrt. Wir lassen sie nicht runter, wenn die Stripper kommen. Ehrenwort.»
«Du machst Witze, oder?»
«Ja, ich mach Witze. Ich hab meiner Frau keine Stripper bestellt. Zumindest keine, für die sie sich interessieren würde, auch wenn’s ’ne witzige Idee wäre, und sie wäre ’ne tolle Frau, wenn sie so cool wäre. Den Kindern bestellen wir Pizza. Ach ja, Jarrod ist natürlich auch eingeladen», setzte er hölzern nach. «Ich, äh, hoffe, er kommt auch.»
Jarrod fragte nicht mehr, was los war, weil er es sich inzwischen selbst zusammengereimt hatte. Und er hatte nicht die geringste Lust auf Nicks Couch. Er lehnte sich zurück und verschwand hinter der Zeitung wie ein Kind in der Schule, das nicht aufgerufen werden wollte.
«Hast du mal aus dem Fenster gesehen?», fragte er, als Faith Maggie wenige Stunden später im Kindersitz festschnallte. Sie hatte ihren Stoffesel in einer Hand und ein Päckchen Fruchtsaft in der anderen.
«Sie wird dreißig, Jarrod. Du weißt, was sie mitmacht. All seine Freunde werden da sein – wahrscheinlich nur seine Freunde. Es würde Nick ähnlich sehen, wenn er auch seine aktuelle Geliebte einlädt. Das ist nur ein bisschen Regen, kein Problem.»
«Da du anscheinend keine Nachrichten gesehen hast, darf ich dich darauf hinweisen, dass da draußen ein tropischer Wirbelsturm tobt. Das ist das eine. Das zweite ist: Das sind keine normalen Leute, Faith. Und es wird keine normale Party.»
Jarrod war weder ein Fan von Nick noch von Charity. Faiths Schwester und ihr Mann waren in völlig anderen Kreisen unterwegs: Jarrod war ehemaliger Strafverteidiger, Nick ein Kleinkrimineller. Hauptberuflich Getriebe-Mechaniker, war er immer auf der Suche nach einer Abkürzung – um Arbeitslosengeld einzusacken, das Finanzamt zu betrügen oder sonst einer krummen Tour. Abgesehen vom Wetter und den Dolphins hatten die beiden nicht viel, worüber sie reden konnten, es sei denn, Nick war auf der Suche nach einem Anwalt. Eigentlich war Charity nicht so, aber seit sie so früh Mutter geworden war und Nick geheiratet hatte, war sie vollkommen abhängig von ihm und hatte sich verändert. Und das war die Charity, die Jarrod sah.
«Mach kein Drama draus», hatte Faith gesagt.
«Deine Schwester ist die Drama-Queen. Warte nur, bis sie Nick mit einer ihrer Freundinnen im Bad erwischt – dann habt ihr das Drama.»
«Jarrod …», ermahnte sie ihn mit einem Blick auf Maggie, die plötzlich ganz still war und sie mit wippenden blonden Zöpfchen ansah, während sie versuchte, dem Gespräch zu folgen.
«Sorg dafür, dass keine Dolche herumliegen», hatte er noch gesagt.
«Du kannst gerne mitkommen.»
«Selten hatte ich so viel Lust, einen Antrag für ein Eilverfahren zu schreiben, wie heute.»
«Das glaube ich dir gern.»
«Noch lieber würde ich dir ausreden, in einem Tropensturm 250 Kilometer auf der Landstraße zu verbringen.»
«Ich wünschte, er hätte angerufen, bevor er die Party geplant hat», erwiderte sie. «Aber offensichtlich stand ich nicht mal auf der Liste der D-Gäste.»
«Bleib zu Hause, Faith. Bleib bei mir.»
«Komm mit.» Sie lächelte. «Nein, das wäre keine gute Idee. Du wärst kreuzunglücklich. Was machst du eigentlich den ganzen Tag allein bei so einem Regen?» Noch während sie die Frage stellte, wurde ihr flau im Magen. Sie hasste dieses Gefühl. Sie hasste es, dass sie es nach all den Monaten immer noch nicht abstellen konnte. Sie fragte sich, ob sie ihren Mann je wieder mit gutem Gewissen allein zu Hause lassen könnte. Angespannt drehte sie sich um und blickte aus der offenen Garage.
«Ich bestelle mir eine Pizza und mache den Antrag fertig.»
Sie nickte.
Er stellte sich hinter sie und rieb ihr die Schultern. «Ich habe kein gutes Gefühl, das Wetter ist scheußlich», sagte er zärtlich und küsste ihr Haar. «Nächste Woche fährst du doch mit ihr nach Orlando. Deine Schwester würde es verstehen. Wir könnten was Schönes kochen und uns bei dem Regen einen gemütlichen Abend machen.»
«Ich kann ihre Party nicht schwänzen. Morgen Nachmittag sind wir ja wieder da.»
«Was ist mit dem Kindergarten?»
«Es ist nicht wie in der Schule. Maggie kann ruhig einen Tag verpassen. Sie besucht ihre Cousinen!», sagte sie und wandte sich mit einem Lächeln an ihre Tochter. «Das ist aufregend, oder?»
«Was sind Dolche?», fragte Maggie, als eine Windbö einen riesigen Palmwedel von der Königspalme riss. Der Palmwedel landete direkt vor der Garage, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo sie und Jarrod standen.
Wieder zuckte ein Blitz über den Himmel und riss Faith aus ihren Gedanken zurück in die Gegenwart. Im gleißenden Licht sah sie, wie die Zuckerrohrstangen der schier endlosen Felder im Wind wogten – die engen, aufrechten Reihen wie eine Pflanzenarmee, die jeden Moment losmarschieren wollte. Dann war wieder alles schwarz.
Wo zum Teufel war sie? Sie konnte nur hoffen, dass sie sich noch auf der Route 441 befand, und nicht auf dem Weg nach Tampa. Sie dachte an das gruselige Zombie-Spiel, das Charity und sie als Kinder gespielt hatten. Man zählte mit geschlossenen Augen, und sobald man die Augen aufschlug, erstarrten die Zombies, die in der Zwischenzeit näher herangerückt waren.
Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als sie tiefer in die endlose Finsternis fuhr. Unwillkürlich hatte sie Angst vor dem, was sie da draußen sehen würde, wenn der nächste Blitz zuckte.
3
Jarrod hatte recht. Charity war wirklich eine Drama-Queen. Drei Stunden nach Partybeginn, als Nicks Hurricanes und ein paar Gläser Wein die Hemmschwelle abgebaut hatten, legte sie los. Als sie mitbekam, wie er im Wohnzimmer ein junges Mädchen anmachte, war der Waffenstillstand beendet.
«Warum glotzt du sie so an?», wollte sie laut von ihm wissen, als er in die Küche kam, um sich ein Bier zu holen.
«Was ist los?», fragte er hörbar genervt.
«Die Kleine. Die in dem nuttigen Kleid. Warum musst du sie anlabern?»
«Das ist Gators Freundin. Mach mir bloß keine Szene, Char. Ich hab ihr nur gesagt, dass mir ihr Kleid gefällt.»
«Ach ja, oder eher die Möpse in dem Kleid? Wie alt ist sie, sechzehn? Sie könnte deine Tochter sein, weißt du das? Du bist widerlich.»
«Ich habe sie nicht gefragt, wie alt sie ist. Das Kleid steht ihr. Steht ihr echt gut. Wenn du in so einem Kleid gut aussehen würdest, würde ich dir das auch sagen.»
Irgendein Idiot warf ein provozierendes «O-oh» in die Runde.
«Was soll das heißen?», hatte Charity beleidigt gefragt und sich zwischen Nick und die Theke gestellt, auf der sich die Plastikwanne mit dem Bier befand.
«Du weißt genau, was das heißt», sagte er und griff um sie herum nach einem Bier. Dann pikte er ihr in den Bauch. «Lass die Finger von der Schokolade und der Torte, Honey, und irgendwann passt du vielleicht auch wieder in so ein Kleid.»
In der Küche herrschte für Sekunden peinliches Schweigen. Dann fing einer der Spitznamen an zu johlen und zu lachen. Alle hatten gehört, was Nick gesagt hatte, und alle warteten gespannt auf Charitys Reaktion. Ein Wurfgeschoss. Oder zumindest eine verbale Retourkutsche.
Doch keiner wartete schon so lange wie Faith. «Was zum Teufel …?», begann sie und sah Charity an, die neben ihr stand, hilflos und so bedrohlich wie ein Kätzchen. Nick hatte ihre Schwester nie geschlagen, aber Faith dachte oft, vielleicht wäre das besser gewesen. Könnte man den Schaden sehen, den er mit seinen Worten anrichtete, würde Charity vielleicht begreifen, wie sehr er sie misshandelte.
Charity fing an zu weinen. Sie verschränkte die Arme vor dem Bauch, und es war offensichtlich, dass sie sich für ihr Aussehen schämte.
Es war nicht Faiths Aufgabe gewesen. Das verstand sie jetzt. Sie hätte nichts sagen dürfen. Sie hätte wissen müssen, dass nichts Gutes dabei herauskommen würde. Alle hatten zu viel getrunken. Auch Faith. Aber nachdem sie ihre Schwester all die Jahre jammern und klagen gehört hatte, war ihr aufgestauter Ärger einfach übergekocht, und sie war explodiert wie ein Vulkan.
«Weißt du, Nick», hatte Faith gezischt, «du hast selbst ein paar Schwimmringe um die Rippen. Charity, wann jagst du dieses Arschloch von Ehemann bitte endlich zum Teufel?»
Aber Charity hatte ihren Mann nicht angeschrien, zum Teufel gejagt oder rausgeworfen. Sie hatte Faith nicht die Hand gedrückt und ihr für die Unterstützung gedankt. Stattdessen hatte sie sich mit rotem Kopf und funkelnden grünen Augen auf dem Absatz umgedreht. «Du willst, dass ich ihn verlasse!», hatte sie gebrüllt. «Das ist das Einzige, was dir dazu einfällt! Das ist immer deine Antwort! Hör auf, mir so was einzureden! Hör endlich auf damit! Du hast ja keine Ahnung, was hier los ist!»
Statt sich gegen Nick zu wehren, wehrte sich Charity gegen Faith. Faith war wie vor den Kopf gestoßen. Ihr fehlten die Worte. Im ganzen Haus war es still geworden. Selbst die Musik lief nicht mehr. «Ich will, dass du für dich einstehst», hatte Faith gesagt, als sie die Sprache wiedergefunden hatte. «Ich will, dass du ausnahmsweise Selbstachtung zeigst. Du bist besser als dieser Loser. Du bist besser …», sie zeigte auf die volle Küche, «… als alle hier.»
Es war fürchterlich. Ihr wurde schlecht bei der Erinnerung, wie die Leute sie angestarrt hatten.
«Das ist echt nett. Leck mich am Arsch, Faith», hatte Charity gesagt.
Doch es wurde noch schlimmer.
«Diese Leute … das sind nicht deine Freunde. Das sind seine Freunde. Sie ziehen dich runter, sie sorgen dafür, dass du den Scheiß glaubst, den er redet – als müsstest du dir so was gefallen lassen!»
«Vielleicht will ich es nicht anders. Hast du daran schon mal gedacht? Du denkst, weil mein Leben nicht so perfekt ist wie deins, muss ich es ändern? Ist es dir nicht gut genug? Ich finde in dieser Scheißstadt keinen Job, weil ich blöde Kuh nicht auf dem College war. Und dass mein Mann meine Freundinnen vögelt, ist das auch meine Schuld? Nie bin ich gut genug, nie mache ich was richtig, oder, Faith? Hör auf, mich zu verurteilen! Neben dir fühle ich mich noch schlechter als neben ihm!»
In diesem Moment hätte sie gehen sollen, sich freundlich verabschieden und gehen. Aber das tat sie nicht.
«Ach so, auf einmal bin ich die Böse? Ich hab nie was gesagt! Ich hab immer nur zugehört, wenn du mich vollgeheult hast. Wenn du dich beklagt hast, was für ein Schwein er ist. Aber wenn du nicht den Mut hast zu gehen, dann lass dir wenigstens nicht von ihm einreden, du wärst nichts wert, denn am Ende glaubst du es. Schau dich um – du hast was Besseres verdient! Was soll er noch sagen oder tun, damit du es endlich kapierst? Wenn er dir an deinem Geburtstag vor allen Leuten sagt, du bist dick und dumm, und alle lachen dich aus, und du begreifst es immer noch nicht, was soll er noch machen? Er will, dass du gehst – verstehst du das nicht? Er will, dass du gehst, damit er nicht der Arsch ist, der seine Frau und die drei Kinder sitzenlässt. Aber du verpasst ständig dein Stichwort!»
«Hey», mischte sich Nick ein, und sein haariges Gesicht wurde dunkelrot. «Du bist hier in meinem Haus. Du und dein Spießer-Anwalt, ihr haltet euch vielleicht für was Besseres, aber du bist hier in meinem Haus.»
Der Vulkan spuckte immer noch Lava. Sie konnte nichts dagegen tun. «Das Haus gehört der Bank, die es bald zwangsvollstreckt. Versuch mal, deine Raten zu bezahlen, Nick, dann kannst du es dein Haus nennen. Behalt mal einen Job länger als sechs Monate. Und wenn du schon einen auf Herr des Hauses machst und die perfekte Hausfrau willst, dann besorg ihr wenigstens ein Auto, damit sie zum verdammten Supermarkt fahren und dir dein verdammtes Sixpack holen kann. Und eins noch: Reiß dich am Riemen und hör auf, wie ein totales Schwein mit ihren Freundinnen rumzuvögeln. Oder hab wenigstens so viel Anstand und geh in ein Motel. Hey», rief sie dann quer durch den Raum. «Gator! Behalt lieber deine Teenager-Freundin im Auge, sonst bist du sie bald los.»
«Ich konnte dich nie leiden», gab Nick wütend zurück. «Genauso wenig wie deinen beschissenen Mann.»
Charity hatte sich neben Nick gestellt. Er hatte den Arm um sie gelegt.
«Hau ab, Faith», sagte Charity. «Hau ab. Ich will, dass du sofort unser Haus verlässt.»
Nick griff nach Charitys Hand, und sie nahm sie. Das war wahrscheinlich das, was am meisten weh tat – mehr als die Blicke und das Gelächter. Die Spitznamen und ihre besseren Hälften sahen zu, wie Faith zur Tür ging und nach Maggie rief. Und der schreckliche Moment wurde noch schlimmer, als Maggie zu heulen anfing, weil sie nicht gehen wollte: Faith musste ihre schreiende, strampelnde Tochter schließlich aus dem Haus tragen.
Im Chaos und der Eile des Aufbruchs hatte Faith zu allem Überfluss ihre Tasche und ihr Handy bei Charity vergessen. Erst als Maggie endlich eingeschlafen war und Faith sicherheitshalber nach dem Weg sehen wollte, fiel es ihr auf, doch da war es zu spät zum Umkehren. Was eigentlich keine Rolle spielte. Selbst wenn sie erst zwei Kilometer gefahren wäre, hätte sie nicht kehrtgemacht. Sie fühlte sich mehr als gedemütigt – sie war am Boden zerstört. Am Boden zerstört und tieftraurig. Charity musste ihr die Sachen schicken – wahrscheinlich nachdem Big Mitts ihr Portemonnaie geplündert und das Handy verkauft hatte. Jetzt liefen ihr die Tränen über das Gesicht. Sie würde nie wieder einen Fuß ins Haus ihrer Schwester setzen.
In diesem Moment rannte etwas auf die Straße, direkt vor ihr Auto. Faith riss das Steuer herum, hörte einen dumpfen Aufprall und landete im Zuckerrohrfeld, die Scheinwerfer ins Dickicht der Stangen gerichtet, die nur noch Zentimeter entfernt waren.
Ihr Herz klopfte wild. Die Gedanken an Charity, Nick und die Spitznamen, die ihr hinterhergesehen hatten, als sie von ihrer Schwester in die stürmische Nacht geschickt worden war, waren verschwunden. Alles Selbstmitleid war weg, jedes Sinnen auf Rache für ihre Demütigung. Nur ein Gedanke raste ihr durch den Kopf. Ein einziger.
Was zum Teufel hatte sie angefahren?
4
Mit schwitzenden Händen das Lenkrad umklammernd, spähte sie durch die hektisch wedelnden Scheibenwischer. Was es auch war, es war weg.
Es hatte ausgesehen wie …?
Sie verdrängte den Gedanken, bevor ihr Gehirn ihn beenden konnte. Sie hatte es nur für den Bruchteil einer Sekunde gesehen. Es konnte kein Mensch gewesen sein. Ihre Scheinwerfer leuchteten stumm ins Zuckerrohrfeld.
Es musste ein Tier gewesen sein. Ein Reh. Ein Hund vielleicht. Immer wieder setzten Leute ihre Hunde in den Everglades aus. Es war schrecklich, aber so war es. Wahrscheinlich war sie mitten in den verdammten Everglades. Oder es war ein Bär. Sie hatte von einer Frau in Orlando gehört, die vor ihrer Haustür einen Bären dabei ertappte, wie er ihre Mülltonnen durchsuchte.
Was, wenn es noch da draußen war, unter dem Wagen?
Bei dem Gedanken wurde ihr schlecht. Der Himmel flackerte auf. Die finstere Zuckerrohr-Armee war im Dunkeln tatsächlich näher gerückt – die Stangen beugten sich bedrohlich über die Motorhaube und streckten die spitzen Blätter zornig nach dem Metall aus. Sie stellte das Radio ab und lauschte. Es war schwer, außer dem Prasseln des Regens, dem Rauschen des Zuckerrohrs und dem Pochen ihres Herzen irgendetwas auszumachen. Aber da war nichts. Kein Bellen, kein Winseln. Kein Stöhnen.
War sie eingenickt? Sie rieb sich die Augen und versuchte, den Nebel aus ihrem Kopf zu schütteln. Hatte sie sich nur eingebildet, sie hätte etwas gesehen? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Sie drehte sich nach Maggie um – die unter ihrem Cha-Cha immer noch tief und fest schlief –, dann öffnete sie die Tür und stieg hinaus in den Regen. Mit weichen Knien watete sie zur Motorhaube und hielt den Atem an, als sie sich dem Zuckerrohrfeld und dem Kühler näherte.
Nichts. Da war nichts. Nichts klebte an der Motorhaube. Nichts hing im Kühler. Nichts lag auf dem Boden.
«Hallo?», rief sie in die Nacht.
Keine Antwort.
Sie sah unter dem Wagen nach, konnte aber nichts erkennen. Also stolperte sie zur Fahrertür zurück, wobei sie im schlammigen Boden versank, und stieg wieder ein, den Blick in das wütende Zuckerrohr gerichtet. Sie zitterte, und in ihrem Kopf drehte sich alles. Es schüttete wie aus Eimern, und die Scheibenwischer kamen kaum hinterher.
Ich muss es mir eingebildet haben.
Langsam fuhr sie auf die Straße zurück, mit angehaltenem Atem, jeden Muskel ihres Körpers angespannt. Die Scheinwerfer beleuchteten die Stelle, wo der SUV gestanden hatte. Nichts. Da war nichts. Endlich atmete sie auf.
Du bist müde, das ist alles. Müde und aufgewühlt. Du kannst nicht klar denken.
Sie legte den Gang ein und starrte in das Zuckerrohr. Die Pflanzenarmee wand und wiegte sich in dem riesigen Feld, als wollte sie sie zurückwinken.
Jetzt bekam sie Angst – sie war körperlich und emotional völlig erschöpft und fürchtete, sie würde am Steuer einschlafen. Sie hatte kein Handy dabei und war weit weg von der Zivilisation, auch wenn sie sich immer noch nicht eingestehen wollte, dass sie sich verfahren hatte. Allein der Gedanke versetzte sie in Panik. Sie spürte, wie das Grauen im Bauch sich den Weg nach oben bahnte. Faith versuchte, es herunterzuschlucken, zusammen mit dem klebrigen Geschmack der Hurricanes. Den letzten Drink bei Charity hätte sie sich sparen sollen, verdammt. Es war schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Tank war ein Viertel voll, was reichen müsste, um sie nach Hause zu bringen, aber was, wenn sie in die falsche Richtung fuhr? Was, wenn ihr hier draußen das Benzin ausging? Niemand wusste, wo sie war. Jarrod rechnete erst morgen Nachmittag mit ihr. Charity hatte ihm bestimmt nicht gesagt, dass sie sie rausgeschmissen hatte. «Ach, übrigens hat Faith ihr Handy und ihre Handtasche hier vergessen, als sie heulend rausgerannt ist.» Wahrscheinlich wusste Charity nicht einmal, dass sie ihre Handtasche vergessen hatte. Faith hätte gleich umkehren und zurückfahren sollen, doch ihr Stolz hatte sie zu einer Fehlentscheidung verleitet. Sie hätte sich in Sebring ein Hotelzimmer nehmen und am nächsten Morgen mit klarem Kopf zurückfahren sollen. Aber Maggie hatte so getobt, da wollte Faith einfach nur nach Hause. Das war alles – sie wollte einfach nur nach Hause.
Eine Reihe von Fehlentscheidungen hatte sie hierhergeführt. Panik würde alles nur noch schlimmer machen. Alles, was sie brauchte, war ein Wegweiser, mehr nicht. Und ein Telefon, um Jarrod anzurufen, damit jemand wusste, wo sie war. Vielleicht würde er kommen, sie finden, sie nach Hause bringen …
Doch so schnell der Gedanke gekommen war, so schnell verscheuchte Faith die Vorstellung einer romantischen mitternächtlichen Rettung aus dem Sturm durch ihren Ehemann. Egal wie wütend sie auf Charity war, sie wollte nicht, dass Jarrod einen Grund hatte, ihre Schwester noch weniger zu mögen. Er war ohnehin kein Fan von ihr. Falls er erfuhr, was heute Abend passiert war, würde er das Charity nie vergeben. Und daran würde sich nichts mehr ändern – er hatte deutsche Wurzeln und war sehr streng in seinen Urteilen. Obwohl Faith sich nicht sicher war, wie es mit der Beziehung zu ihrer Schwester weitergehen würde, wollte sie nicht, dass ihr Mann sie zu einer Entscheidung drängte, für die sie nicht bereit war. Falls Faith und Charity sich wieder versöhnten – was ihnen nach früheren auch noch so heftigen Auseinandersetzungen gelungen war (immerhin waren sie Schwestern) –, würde Jarrod sie stets daran erinnern, wie Charity sie heute Abend behandelt hatte. Selbst wenn er es nicht aussprach, würde sie wissen, dass er von den Blicken, dem Gelächter und der Demütigung wusste. Und er würde es nicht nachvollziehen können, warum sie ihre Schwester möglicherweise wieder in ihr Leben ließ.
Trotzig wischte sie die Tränen ab. Charity war da gewesen, als Faith sie gebraucht hatte … nach jenem Telefonanruf, der alles verändert hatte. Charity kannte zwar die hässlichen Details nicht, aber sie hatte sie unterstützt; dazu brauchte sie nicht genau zu wissen, warum Faith so verzweifelt war, warum ihr Herz gebrochen war. Faith hatte Charity Jarrods Affäre aus dem gleichen Grund verschwiegen, aus dem Jarrod nicht erfahren musste, was heute Abend bei Charity passiert war: Faith wollte nicht, dass ihre Schwester ihren Mann hasste, für den Fall, dass sie ihm verzieh. Und sie wollte nicht, dass Charity sie verachtete, weil sie bei einem Mann blieb, der sie betrogen hatte. Nach all den Ratschlägen, die Faith ihr über die Jahre hinweg erteilt hatte, wollte sie nicht als Heuchlerin dastehen. Verdammt, ihr dröhnte der Kopf von all den schmerzhaften Erinnerungen und Vertrauensbrüchen. Sie wollte einfach nur nach Hause und über alles in Ruhe nachdenken, ehe sie weitere Fehlentscheidungen traf. Die gingen ihr inzwischen zu gut von der Hand.
Dann sah sie es – das leuchtende, rot-gelbe Schild in der Ferne. Ein Fastfood- oder ein Hotel-Schriftzug, sie konnte es noch nicht genau erkennen. Jedenfalls irgendein Zeichen von Zivilisation. Zum dritten Mal an diesem Abend fiel ihr ein Stein vom Herzen.
Da vorne war Leben.
5
Faith folgte der Leuchtreklame durch das Asphaltlabyrinth, das sich durch das Zuckerrohr wand, bis sie eine altmodische Shell-Tankstelle mit zwei Pumpen erreichte. Sie lag einsam an einer Kreuzung in einer ansonsten gottverlassenen Gegend. Die Tankstelle war geschlossen.
Wieder verspürte Faith Panik, mit der gleichen fiebrigen Heftigkeit wie den Regen, der auf das Autodach prasselte. Wo zum Teufel war sie? Was sollte sie tun? Auf dem Straßenschild an der Ecke stand «Main Street». Na gut. Hauptstraßen liefen immer durch das Zentrum, oder? Der Gedanke war tröstlich, auch wenn sie sich unwillkürlich fragte, wie der Rest der «Stadt» wohl aussah, wenn das hier das Zentrum sein sollte. Dann entdeckte sie ein Straßenschild mit einem Pfeil: US 441/US 98.
Auf welcher Straße sie vorher auch gewesen war, ob sie sich wirklich verfahren hatte oder nicht – es spielte keine Rolle mehr, denn jetzt wusste sie, wie sie nach Hause kam. Sie folgte dem Pfeil die verlassene Main Street hinunter, vorbei an blinkenden, über der Kreuzung baumelnden Ampeln, bis sie in einer kleinen Stadt war – zumindest sah es wie eine kleine Stadt aus, wenn auch nur mit einer einzigen Straße. Einige Gebäude waren verrammelt, der Gemischtwarenladen hatte geschlossen, und beim China-Restaurant waren die Rollläden unten. Außerdem gab es einen Secondhand-/Friseur-/Eisenwarenladen. Eine Straßenlaterne, die nicht funktionierte. Eine Arztpraxis.
Die Häuser wirkten alt und heruntergekommen, stammten wahrscheinlich aus den Vierzigern oder Fünfzigern. Die Schilder der Geschäfte, die wohl noch in Betrieb waren, waren handgemalt: Chubs Barbecue, Waschsalon Sudsy, Franks Restaurant. Andere Läden schienen dichtgemacht zu haben. Vielleicht schon vor Jahren. Der Ort hatte seine Glanzzeit offenbar lange hinter sich.
Weder auf der Straße noch auf den Parkplätzen standen Autos. Sie war völlig allein in dieser stillgelegten Stadt. Der Wind rüttelte an der zweiten – und letzten – Ampel über der Straße. Faith sah zu, wie sie an der Leitung vor- und zurückschwang wie ein Turner beim Felgaufschwung. Ein Blitz zerriss den Himmel und schlug beängstigend nahe ein. Kirschgroße Regentropfen begannen, auf den Wagen zu platschen, und es war unmöglich, mehr als ein paar Schritte weit zu sehen. Sie war mitten im Auge des Sturms. Dieses Regenband konnte sie weder abhängen noch umfahren. Resigniert rollte sie an den Straßenrand und blieb vor einem Schild mit der Aufschrift «Valdas Haar-Salon» stehen. Ob Valda nur für die Nacht oder für immer geschlossen hatte, ließ sich nicht sagen.
Der Adrenalinschub nach dem Abstecher ins Zuckerrohrfeld war abgeklungen. Nach dem Anflug von Panik setzte körperliche und mentale Erschöpfung ein. Und Mutlosigkeit, denn auch wenn sie nun auf der richtigen Straße war, war sie immer noch weit, weit weg von zu Hause.
Es war Zeit für eine kluge Entscheidung – vielleicht die erste an diesem Abend. Wahrscheinlich war es das Beste, wenn sie den Sturm aussaß und wartete, bis der schlimmste Sturzregen vorbei war. Sie wollte auf keinen Fall wieder vom Weg abkommen. Oder mit leerem Tank irgendwo liegen bleiben. Oder, noch schlimmer, einen Unfall bauen. Da draußen würde ihr keiner helfen. Also stellte sie den Motor ab, um Benzin zu sparen, drehte das Radio auf, damit Maggie das Donnern und den Regen nicht hörte, der inzwischen klang, als spielten einhundert Schlagzeuger auf dem Dach. Faith blickte zum Fenster hinaus: Die Wolken bewegten sich schnell; das Schlimmste wäre in zehn Minuten vermutlich vorbei.
Sie drehte sich um und beobachtete Maggie, die immer noch wie ein Gespenst unter ihrer Decke lag und friedlich schlief. Eine Hand war unter der Decke hervorgerutscht, und die kleinen Finger – deren Nägel ihre Cousinen leuchtend pink angemalt hatten, wie Faith bemerkte – hielten den Esel fest umklammert. Sie schlief tief und fest. Faith legte das Handtuch über Maggies nackte Beine. Wenn sie ihrer Tochter beim Schlafen zusah, fiel es ihr leicht zu vergessen, wie schwer es manchmal mit ihr war. Auch wenn die Rückseite des Beifahrersitzes eine andere Geschichte erzählte: Diesmal hatte Maggie bestimmt eine Delle hineingetreten. Maggies «Anfälle» waren einer der Gründe, weshalb Jarrod und sie beschlossen hatten, noch ein paar Jahre mit dem Neuwagen zu warten. Einem mit GPS. Sie wollten abwarten, bis Maggie die Trotzphase hinter sich hatte. Allerdings schien die sich nach und nach als Charakterzug zu entpuppen.
Faith lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. Heute Nacht hatte sie für weitere Sorgen keine Kapazitäten mehr. Sie wollte nicht mehr an Charitys Party denken, an Jarrods Praktikantin oder an die feixenden Spitznamen, die morgen früh bei einem Aspirin über sie lästern würden. Stattdessen konzentrierte sie sich auf die Dinge, die sie morgen tun würde: Sie musste den Stapel Bestellungen für die Sweet Sisters unterschreiben, den Werbetext für die Zeitung verfassen, und um vier hatte Maggie Ballett. Wenn sie auch noch einen Film ansehen wollten, müssten sie das vorher machen. Außerdem wartete ein voller Wäschekorb …
Ein lauter, dumpfer Schlag gegen die Scheibe riss sie aus den Gedanken. Erschrocken sah sie sich um. Die Fenster waren beschlagen. Sie wischte sich die Spucke vom Mund und sah auf die Uhr am Armaturenbrett: 1:11.
Bumm!
Am Fahrerfenster. Etwas hatte gegen die Scheibe geschlagen.
«Hilfe!», sagte eine Stimme.
Faith gerann das Blut in den Adern. Da draußen war jemand.
Es war immer noch dunkel, aber sie hörte den Regen nicht mehr. Sie fragte sich, ob sie träumte. Zögernd hob sie die Hand und begann, die beschlagene Scheibe mit den Fingern frei zu wischen. Das Glas war kalt. Und nass. Wasser rann ihr über die Hand und in den Ärmel ihrer Seidenbluse.
Etwas stimmte nicht. Etwas stimmte ganz und gar nicht.
Sie drückte das Gesicht an die Scheibe, um zu sehen, was draußen vor sich ging.
Und da begann der eigentliche Albtraum.
6
Draußen stand eine junge Frau und drückte die Hände an die Scheibe. Lange schwarze Strähnen klebten ihr an Gesicht und Hals. Unter dem schmutzigen, nassen T-Shirt zeichnete sich ein blauer Leoparden-BH ab. An ihren Ohrläppchen baumelten billige Libellen-Ohrringe. Sie starrte Faith aus hohlen braunen Augen an, darunter lief ihr die Wimperntusche in breiten Streifen über die Wangen. Sie drückte das Gesicht an die Scheibe. Ihre aufgeplatzten Lippen berührten das Glas. «Helfen Sie mir!», sagte sie mit rauer Stimme. Im Radio sang Katy Perry.
Erschrocken wich Faith zurück und schlug sich die Hüfte an der Mittelkonsole an. Sie sah sich um, aber alle Fenster waren beschlagen. Sie hatte keine Ahnung, wer oder was sonst noch da draußen war.
Die Frau warf einen Blick hinter sich. Ihr nasses Haar peitschte gegen das Fenster. Dann sah sie wieder zu Faith und trommelte gegen die Scheibe. Ihre Handflächen waren schmutzig. «Schnell! Verdammt! Lassen Sie mich rein!»
Sie schrie nicht. Sie redete nicht einmal laut. Sie klang aufgeregt, aber ihre Stimme war heiser und gedämpft. Faith rutschte von der Mittelkonsole, auf der sie gelandet war, und wischte mit dem Ärmel die Scheibe ab, um besser sehen zu können, was da draußen war. Das Gesicht der Frau war nur Zentimeter von ihrem entfernt; sie sah den Glitzerstein, den sie in der Unterlippe trug, den winzigen Ring in ihrer Nase. Zwei Silberringe durchbohrten eine Augenbraue. An der Innenseite des Unterarms reichte eine Reihe tätowierter blauer Sterne vom Handgelenk bis zum Ellbogen. Am Hals hatte sie das Tattoo eines rosa Herzen in Ketten. «Ich … ich … kann nicht», stammelte Faith und schüttelte den Kopf.
Die Frau gab ein Winseln von sich. «Er kommt!»
Plötzlich stand ein ganz in Schwarz gekleideter Mann neben ihr, der sich wie ein Vampir aus dichtem Nebel materialisiert zu haben schien. Er hatte dunkles, welliges schulterlanges Haar, das an seinem kantigen Kinn klebte, und Bartstoppeln, die älter als drei Tage waren. Er war schlank und groß – viel größer als das Mädchen. Seine langen Finger griffen nach ihrer schmalen Schulter, verschluckten sie, und er zog sie an sich. Sie stolperte rückwärts, stürzte beinahe, doch er fing sie auf. Dann drehte er sie um und drückte sie an sich. Ihre Füße zappelten in der Luft, als er sie hochhob. Faith sah, dass sie barfuß war; auch ihre Füße waren schmutzig. Der Mann setzte sie wieder am Boden ab und gab ihr einen festen Kuss auf den Mund. Dann sah er Faith an und grinste.
Die Szene war surreal, als würden sie das berühmte Cover des Life-Magazins nachstellen, auf dem der Soldat am Tag der Rückkehr die Krankenschwester begrüßt. Sie rieb sich die Augen. Sie hatte immer noch das Gefühl, dass sie träumte.
Inzwischen regnete es nicht mehr, und der Mond hatte sich hinter den Wolken hervorgeschoben, zumindest teilweise. Er war hell und gelb, gerahmt von dramatischen Wolken, als könnte jeden Moment eine Hexe vorbeifliegen. In der Ferne leuchteten lautlos Blitze auf, wie Bomben, die auf entfernte Städte hagelten. Ihr Blick fiel auf eine Gestalt, die sich zwischen den Bäumen auf dem verwilderten Grundstück gegenüber bewegte.
Im Mondlicht tauchten die zerfallenen Mauern und das bröckelnde Fundament eines alten Gebäudes auf, das, seit Jahrzehnten sich selbst überlassen, von Gebüsch und Kiefern überwachsen war. Ein Dach gab es längst nicht mehr. Hinter der Ruine befand sich ein Waldstück, und dahinter begannen wahrscheinlich die Zuckerrohrfelder. Der Maschendrahtzaun, der das Grundstück umgab, war verrostet und stellenweise heruntergetreten. Der Mann in dunklen Jeans, rot kariertem Hemd und einer weißen Baseballmütze tauchte zwischen den Kiefern neben dem Gemäuer auf.
Faith wischte hektisch über die Windschutzscheibe. Das rot karierte Hemd des Mannes stand offen, darunter kam ein Bierbauch zum Vorschein. Als er das Mädchen und den Mann in Schwarz entdeckte, blieb er stehen, als wäre da unter den Bäumen eine Grenze, die er nicht übertreten durfte. Er beugte sich vor, die Hände in den Hüften, um Luft zu holen, während er die beiden anstarrte.
«Nein!», schrie die Frau.
Faith sah wieder zu ihr. Der Mann in Schwarz hatte ihr den Arm um die Schultern gelegt und ging mit ihr zur anderen Straßenseite, wo der Mann im roten Hemd vor dem verlassenen Gemäuer wartete. Sie hielt sich an ihm fest und sah aus, als würde sie hinken. Er drückte ihr das Gesicht ans Ohr.
Der Mann mit dem Bierbauch – ein Redneck, wie dem Film Deliverance entsprungen – kam den beiden bis zur Straße entgegen. Faith sah die struppigen Haarbüschel auf seinen Wangen. Kein richtiger Bart, und kein Schnurrbart. Er lief aufgeregt hin und her wie ein wütender Hund hinter einem unsichtbaren Elektrozaun. Er riss sich die Baseballkappe vom Kopf und fuhr sich über den kahlen Schädel. Sie sah, dass eine Seite seines Gesichts rot war.
Der Mann in Schwarz brachte die Frau zu ihm. Sie gestikulierte und klammerte sich an den ersten Mann. Die drei wechselten ein paar Worte, die Faith nicht hören konnte, und dann schubste der rote Mann das Mädchen zurück zu dem Mann in Schwarz, bevor er wütend abzog. Die Frau taumelte, und der Mann in Schwarz fing sie auf, streichelte ihr über den Kopf. «Was gibt es da zu gucken!», schrie der Bierbauch plötzlich und zeigte in Faiths Richtung. Er spuckte auf den Boden. «Komm lieber her und spiel mit uns, Blondie. Nicht so schüchtern!» Dann trat er auf die Straße und kam auf sie zu. Der Elektrozaun war abgestellt.
Mit stark zitternder Hand griff Faith nach dem Schlüsselbund, das vom Zündschloss hing.
Der Mann in Schwarz stellte sich dem roten Mann in den Weg und gab ihm einen Stoß, der ihn rückwärts taumeln und auf die Straße stürzen ließ. «Ich habe dir gesagt, ich hab es unter Kontrolle!», rief er. «Reiß dich zusammen. Mach nicht alles noch schlimmer.»
Der Redneck rappelte sich hoch, packte das Mädchen am Arm und zog sie auf das verwilderte Grundstück, wo er hergekommen war. Faith hörte nicht, was er sagte, aber das Mädchen gestikulierte nicht mehr. Sie drehte sich um und warf einen letzten Blick in Faiths Richtung. Sie lächelte matt und nickte. Dann waren die beiden verschwunden.
Alles war innerhalb von Minuten passiert, vielleicht noch weniger. Aber was war eigentlich passiert? Ihr Herz schlug so laut, dass ihr das Blut in den Ohren rauschte. Sie sah sich nach Maggie um, dann fiel ihr der Mann in Schwarz wieder ein, und sie riss so schnell den Kopf herum, dass ihr Nacken knirschte.
Er stand direkt vor dem Fahrerfenster.
Wieder fuhr sie zurück und rammte sich die Mittelkonsole gegen die Hüfte.
Mit einem langen Fingernagel klopfte er an die Scheibe. Es machte ein kratzendes Geräusch.