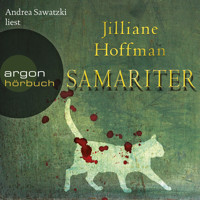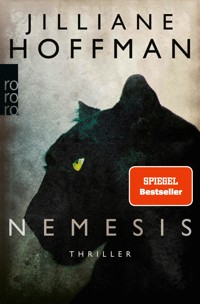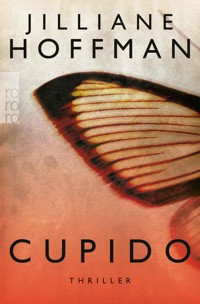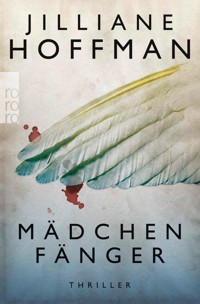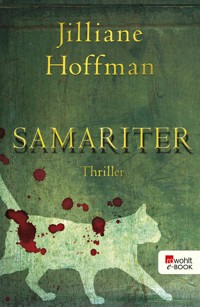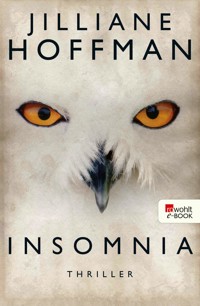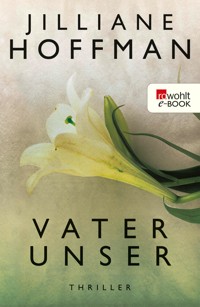9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die C.-J.-Townsend-Reihe
- Sprache: Deutsch
Es ist zurück. Es lebt. Es tötet. Ein Serienmörder, der korrupte Cops umbringt. Eine Staatsanwältin mit einem dunklen Geheimnis. Ein Monster, das im Todestrakt auf den Tag der Rache wartet. Drei Jahre ist es her, dass die Cupido-Morde ganz Florida in Atem hielten. Jetzt schlägt das Grauen wieder zu. Kann C.J. Townsend ihm noch einmal entkommen? «Jilliane Hoffman produziert feinsten Thrill, der unter die Haut kriecht. Nichts für schwache Nerven!» (Freundin)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jilliane Hoffman
Morpheus
Thriller
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz
Informationen zum Buch
Es ist zurück. Es lebt. Es tötet.
Ein Serienmörder, der korrupte Cops umbringt.
Eine Staatsanwältin mit einem dunklen Geheimnis.
Ein Monster, das im Todestrakt auf den Tag der Rache wartet.
Drei Jahre ist es her, dass die Cupido-Morde ganz Florida in Atem hielten. Jetzt schlägt das Grauen wieder zu. Kann C. J. Townsend ihm noch einmal entkommen?
«Jilliane Hoffman produziert feinsten Thrill, der unter die Haut kriecht. Nichts für schwache Nerven!». (Freundin)
Informationen zur Autorin
Jilliane Hoffman war Staatsanwältin in Florida und unterrichtete jahrelang im Auftrag des Bundesstaates die Spezialeinheiten der Polizei – von Drogenfahndern bis zur Abteilung für Organisiertes Verbrechen – in allen juristischen Belangen. Mit ihren Romanen «Cupido», «Morpheus», «Vater unser», «Mädchenfänger» und «Argus» gelang ihr auf Anhieb der Durchbruch an die Spitze der internationalen Bestsellerlisten.
Weitere Veröffentlichungen:
Cupido
Vater unser
Mädchenfänger
Für Rich, der weiterhin nie zweifelt.
Und natürlich für Amanda und Katarina.
In Erinnerung an Hank Hoffman.
EINS
Die schwere Flügeltür des Gerichtssaals 4-8 öffnete sich schwungvoll und stieß gegen den Stuhl des Vollzugsbeamten, der gerade mit dem untersten Knopf seiner grünen Dienstjacke spielte. Ein Detective in Zivil kam herein. Man hörte die Absätze seiner Schuhe dumpf auf dem abgewetzten braunen Teppich aufschlagen, als er langsam durch den Mittelgang ging, an der gebannten Menge vorbei, um schließlich in den Zeugenstand vor Richter Leopold Chaskels Mahagonithron zu treten.
C. J. Townsend, stellvertretende Staatsanwältin der Stadt Miami, spürte, wie ihr Mund trocken wurde. Sie biss sich auf die Lippen, um sie zu befeuchten, und versuchte, ihre Nervosität vor den Kameras, den Gerichtszeichnern und Reportern, die jede ihrer Regungen verfolgten, zu verbergen. Ihr Herz pochte, und am liebsten wäre sie davongerannt. Doch sie musste das hier durchstehen. Sie zwang sich, geradeaus zu sehen. Den gut aussehenden Mann im italienischen Designeranzug, der mit demonstrativ gequälter Miene auf der anderen Seite der Galerie am Tisch saß, würdigte sie keines Blickes.
Doch sie wusste, dass er sie beobachtete, dass er auf ihre Reaktion wartete. Nur für sie versteckte er ein Grinsen hinter seiner falschen Qual.
«Ist die Staatsanwaltschaft bereit fortzufahren?», fragte Richter Chaskel. Es gefiel ihm nicht, dass dieser Fall wieder auf seinem Tisch gelandet war. Er hatte einen Bilderbuch-Prozess hingelegt. Er hätte nie wieder aufgerollt werden dürfen. Jedenfalls nicht aus diesem Grund.
«Ja, das bin ich», antwortete Rose Harris, C. J.s Freundin – und ihre Kollegin in der Abteilung für Kapitalverbrechen der Staatsanwaltschaft Miami. Nach einem kurzen Moment erhob sie sich und wandte sich an den Detective: «Bitte nennen Sie uns für das Protokoll Ihren Namen.»
«Special Agent Dominick Falconetti, Florida Department of Law Enforcement.»
«Seit wann sind Sie dort tätig?»
«Seit fünfzehn Jahren beim FDLE. Davor vier Jahre beim Bronx Police Department in New York.»
«Agent Falconetti, richten wir unseren Blick zurück ins Jahr 2000. Damals waren Sie der leitende Ermittler im Fall Der Staat Florida gegen William Rupert Bantling, ist das richtig?»
«Ja, Ma’am. Das FDLE hatte eine Task-Force einberufen – die Task-Force Cupido, wie sie genannt wurde. Sie bestand aus Beamten von verschiedenen Dezernaten. Die Task-Force war 1999 gegründet worden, um in einer Serie von Entführungen und brutalen Morden in Miami Beach zu ermitteln. Der Täter hatte den Spitznamen Cupido bekommen, weil er den Opfern buchstäblich die Herzen raubte, und der Name ist hängen geblieben. Ich war von Anfang an mit dem Fall betraut, und so habe ich die Ermittlungen später dann auch geleitet.»
Rose Harris zeigte auf den Mann am Tisch. «Und die Ermittlungen führten zu einer Verhaftung, am 19. September 2000, und zwar zu der von William Rupert Bantling?»
«Ja.» Dominick sah in Bantlings Richtung, der auf der Unterlippe kaute und wirkte, als wäre er den Tränen nah. «Mr.Bantling wurde auf dem MacArthur Causeway von einem Beamten der Miami Beach Police festgenommen. Im Kofferraum seines Wagens lag die Leiche von Anna Prado.»
«Und daraufhin wurde Mr.Bantling wegen Mordes vor Gericht gebracht?»
«Ja.»
«Wer vertrat die Anklage in diesem Fall, Agent Falconetti?» Ihre Stimme wurde ein wenig schärfer.
Dominick zögerte einen Moment und sah zu C. J. hinüber. «Staatsanwältin C. J. Townsend», sagte er mit belegter Stimme. «Sie hat die Task-Force über ein Jahr lang unterstützt.»
«Im Laufe des Verfahrens haben Sie ein intimes Verhältnis mit Ms.Townsend angefangen, ist das richtig?»
«Ja», sagte er und sah verlegen zu Boden. «Zwischen uns hat sich eine Beziehung entwickelt.»
«Und Mr.Bantling wurde vor Gericht verurteilt, richtig?»
«Ja. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt.»
Jetzt stellte sich Rose Harris hinter Bantling an den Tisch. Sie legte ihm die Hand auf die Schulter, und er senkte demütig den Kopf.
«Doch dann haben Sie entdeckt, dass Mr.Bantling dieses Verbrechen gar nicht begangen hat, nicht wahr, Agent Falconetti?»
«Das weiß ich nicht mit Sicherheit.» Dominick rutschte nervös auf seinem Stuhl herum. Obwohl sie merkte, dass er ihren Blick suchte, starrte C. J. weiterhin geradeaus. Unter dem Tisch hatten ihre Knie angefangen zu zittern.
«Sie sind auf Beweismittel gestoßen, Agent Falconetti, die Ihnen Grund gaben, an Mr.Bantlings Schuld zu zweifeln, nicht wahr? Die dafür sprechen, dass er möglicherweise das Opfer eines Komplotts war?»
«Ja, an so etwas habe ich gedacht», sagte Dominick schließlich resigniert. Jetzt suchte er ihren Blick nicht mehr, sondern blickte zu Boden.
«Zeigen Sie dem Gericht bitte, auf was für Beweismittel Sie gestoßen sind. Was brachte Sie dazu, an Mr.Bantlings Schuld zu zweifeln und zu glauben, dass er das Opfer eines Komplotts war, so wie er es von Anfang an behauptet hatte?» Wie ein gut ausgebildeter Jagdhund ließ Rose Harris nicht mehr locker. «Zeigen Sie dem Gericht die Beweismittel, die Sie gefunden haben, die Beweismittel, die damals während des Verfahrens zurückgehalten wurden und die Sie im Nachhinein davon überzeugt haben, dass ein Unschuldiger fälschlich verurteilt und in die Todeszelle geschickt wurde!»
Dominick nickte erschöpft. Er war sichtlich am Ende. Er griff unter den Tisch und zog eine schwarze Tüte hervor, die mit dem roten Klebeband der Spurensicherung versiegelt war. Dann zog er sich Latexhandschuhe an und schlitzte mit einem gezackten Messer das Klebeband auf. Den Inhalt zog er mit einer großen Stahlpinzette hervor. Es war eine weiße Clownsmaske aus Gummi, die nun an einer verfilzten roten Haarsträhne an der Pinzette baumelte. Das verzerrte blutrote Grinsen des Clownsgesichts pendelte vor der Jury hin und her und posierte grotesk hüpfend für die Kameras. Die Menge schnappte nach Luft.
Das war zu viel. C. J. sprang auf und schrie: «Er ist nicht unschuldig! Er ist schuldig! Schuldig!»
«Ruhe! Ms.Townsend! Als Justizbeamtin sollten Sie doch wissen, wie Sie sich hier zu benehmen haben. Die Jury möge den Zwischenruf ignorieren!», zischte Richter Chaskel.
C. J. setzte sich wieder und vergrub das Gesicht in den Händen. Sie spürte den Blick des Mannes, spürte, wie er sich an ihrem Untergang weidete – wie er sich vorstellte, er hätte Dominicks Sägemesser in den Fingern, um ihr ein paar neue Muster auf den Körper zu zeichnen. Vielleicht könnte er sich auch die Maske für ein Stündchen ausleihen.
«Das befand sich in Ms.Townsends Schrank. Ganz oben in einem Karton zusammen mit alten Polizeiberichten aus Miami Beach», schloss Dominick.
Rose Harris wartete, bis das entsetzte Gemurmel im Saal erstarb. «Agent Falconetti, ist Ms.Townsend heute im Gerichtssaal anwesend?»
«Ja.»
«Bitte identifizieren Sie sie für das Protokoll.»
Dominick sah auf. Die Clownsmaske baumelte immer noch an der Pinzette in seiner linken Hand. Mit der rechten deutete er hinüber zur Galerie, wo C. J. saß. Das Klicken und Surren der Kameras erfüllte die Luft, als die Objektive seinem Finger folgten. «Das ist sie. Dort am Tisch.»
Rose nickte bedächtig. «Nehmen Sie zu Protokoll, dass Agent Falconetti die Angeklagte richtig identifiziert hat.»
C. J. schreckte im Bett hoch, ihr Gesicht war nass vor Schweiß und Tränen. Die Stille des stockdunklen Raums kreischte in ihrem Kopf, und sie presste die Hände auf die Brust, um ihr rasendes Herz zu beruhigen. Der Wecker auf der Kommode zeigte 4.07 Uhr. Sie streckte den Arm aus und tastete nach Dominick, sein warmer Rücken hob und senkte sich regelmäßig im Schlaf.
Alles in Ordnung. Alles ist gut. Kein Grund zur Panik. Es war nur ein Albtraum, redete sie sich selbst gut zu. Sie sah sich um, versuchte, im Schlafzimmer etwas zu erkennen – als plötzlich der Pager auf ihrem Nachttisch zu piepen begann.
Und eigentlich ging der Albtraum erst in diesem Moment richtig los.
ZWEI
«Fick dich doch ins Knie!», schrie die dicke Prostituierte. Sie hatte noch den Gummischlauch vom letzten Schuss um den Oberarm gewickelt, und die beiden Enden schlackerten durch die Luft, als sie gestikulierte.
«Reizend. Sei froh, dass deine Mutter dich nicht hören kann.» Officer Chavez hatte keine Lust auf solche Mätzchen. Er tat der dummen Kuh schon einen Gefallen, indem er sie nicht gleich verhaftete, und nun pöbelte sie ihn auch noch an? Gott, manchmal hasste er seinen Job wirklich. «Jetzt beweg dich schon, los, zieh Leine.»
«Du hast kein Recht dazu. Ich verdien hier mein Geld. Wie wär’s mit einem Blowjob, Officer? Zwanzig Mücken. Vielleicht macht dich das ja ein bisschen lockerer», gackerte sie.
«Ich zähle bis zehn. Wenn du dann noch da bist, gehe ich davon aus, dass du die Nacht im County Jail verbringen willst.» Das Gefängnis von Dade County war der letzte Ort, dem Victor Chavez in dieser lauen Nacht noch einen Besuch abstatten wollte. Zwei Stunden Papierkram für eine Nutte, die ein überlasteter, übellauniger Richter am nächsten Morgen ohnehin wieder laufen ließ.
«Knast – nein danke, du Scheißlatino», murmelte sie mit halb geschlossenen Lidern. Sie stolperte auf die Straße, wo sie von einem vorbeirasenden Mustang nur knapp verfehlt wurde. Auf das Reifenquietschen folgten lautes Hupen und eine Kanonade von Kraftausdrücken.
«Leck mich am Arsch!», schrie die Nutte noch einmal über die Schulter und wankte endlich davon.
Als Chavez der torkelnden Gestalt hinterhersah, begann das kleine Funkgerät an seiner Schulter zu knistern. «Alpha 816. Achtunddreißig, fünfunddreißig, mit Messer in Seitengasse, Nordost, 79. Straße und Biarritz Drive, hinter der Atlantic Cable Company. Männlicher Weißer, Mitte fünfzig, grauer Bart. Beschwerde wegen Ruhestörung.»
Achtunddreißig stand für eine verdächtige Person. Fünfunddreißig stand für betrunken. Beide zusammen ergaben den politisch korrekten Polizeicode für einen Obdachlosen. Es stand für Abschaum, und das hieß, dass sie Victor Chavez hinschickten.
Victor dachte darüber nach, was aus seinem Alltag geworden war. Langweilige Drecksarbeit. Er scheuchte Nutten von der Straße, Junkies zurück in ihre Löcher, Penner auf die nächste Parkbank. Und wenn er damit fertig war, durfte er einen Ehemann von seiner Frau wegzerren, die der gerade zu Brei geschlagen hatte. Als Nächstes rief man ihn dann zu einem Unfall, wenn ein besoffener Idiot den Weg von Miami Beach nach Hause nicht mehr gefunden hatte. Es war noch nicht mal ein Uhr morgens, und er hatte erst zwei Stunden hinter sich.
Victor hasste Nachtschichten. Er hasste es, von den Bossen des Miami Beach Police Department kontrolliert zu werden wie ein dummer Junge, und das praktisch jede Minute seiner Zehn-Stunden-Schicht. Er hasste die miesen Streifen und die Penner, die ihm den Rücksitz voll pissten, und er fragte sich, wann er seine Strafe wohl endlich abgebüßt und die Rechnung mit seinem Sergeant beglichen hätte.
Seit dem Cupido-Fall musste er Nachtschicht schieben, bekam keine Überstunden mehr und hatte jeden Feiertag Dienst. Wie lange sollte das noch so gehen? Er hielt es jedenfalls nicht mehr lange aus. Nächste Woche würde er zu Sergeant Ribero gehen und normale Arbeitszeiten verlangen, normale Polizeiarbeit. Nicht diesen Pipikram, Obdachlose und Spinner aufsammeln. So hatte er sich das nicht vorgestellt, als er vor fast vier Jahren Cop wurde. Zur Not würde er eben zum Hialeah P. D. wechseln, wo sein Bruder war. Vielleicht könnte er dort nach ein paar Jahren endlich zum Detective aufsteigen. Scheiß auf Meer, Strand und Sonne. Viel von der Sonne sah er hier ohnehin nicht.
Er drückte auf den Knopf des Funkgeräts und antwortete. «Alpha 816. QS L von der 20. und Collins.» QS L war der Code für: «Ich übernehme», doch in Victors Fall bedeutete es: «Okay, okay, ich übernehme die verdammte Drecksarbeit.»
Nicht mehr lange. Genau genommen hatte er den Cupido-Fall gar nicht versaut. Immerhin war er derjenige gewesen, der den Hurensohn angehalten hatte, als er mit dem toten Mädchen im Kofferraum über den MacArthur Causeway gebrettert war. Und das war nur eine der elf Frauen gewesen, die der aufgeschlitzt hatte. Aber leider war in den Augen seines Sergeant und der verklemmten Staatsanwältin eine aufgeschlitzte Leiche im Kofferraum einen Scheißdreck wert. Die Fahrzeugkontrolle, seine Fahrzeugkontrolle, war «faul» gewesen, und dafür musste er nun seit drei Jahren büßen. Aber nicht mehr lange.
Zufrieden mit seinem Entschluss, stieg Victor Chavez in den Streifenwagen. Zufrieden mit der Vorstellung, dass sein Job ihm vielleicht schon in einem Monat wieder Spaß machen würde. Auch wenn er dafür auf die Barrikaden steigen musste. Dann schaltete er das Blaulicht ein und machte sich auf den Weg in Richtung 79. Straße und Biarritz Drive, um irgendeinen armen Schlucker aus der Gasse zu verjagen, die wahrscheinlich sein Zuhause war.
DREI
Es war nichts zu sehen von hier, doch der Mann im Dunkeln meinte die Feiernden drüben am Ocean Drive hören zu können, wenn er die Ohren spitzte. Nur wenige Kilometer die Straße hinunter. Das aufgeputschte Stimmenwirrwarr von Hunderten von Leuten, das durch die schwüle Luft getragen wurde, das Geklapper von Dutzenden von Restaurantterrassen, das Stampfen der Bässe aus den Bars und Clubs und natürlich das gereizte Hupen und Motorheulen der Porsches, Mercedes und Bentleys, die den Ocean und den Washington Drive verstopften, auf der Suche nach dem Unmöglichen an einem Freitagabend – einem Parkplatz.
Dass du es nicht sehen kannst, heißt noch lange nicht, dass es nicht da ist.
Miami Beach, wo alles möglich ist, wo sich die Reichen und Berühmten – und die Möchtegernberühmten – tummeln. Sehen und gesehen werden. Die schönen Mädchen mit den unechten Brüsten, den engen, tief, tief ausgeschnittenen Shirts und der dunklen, warmen Bräune, die natürlich nahtlos ist. Die schönen Jungs mit den wie gemeißelten Körpern in Lycra, Leder, Schlangenhaut. Jeder feiert hier mit jedem, bei Cosmopolitans, Chocolate Martinis, Mojitos und anderen schicken exotischen Drinks. In der schwülen Luft pulsiert eine sexuelle Energie, die fast mit Händen zu greifen ist.
Er schloss die Augen und lauschte.
Und nur ein paar Kilometer von all der Dekadenz entfernt stand er hier in einer stinkenden Gosse. Die Straße war mit Schrott und Abfall übersät, alte Bierdosen und Flaschen, benutzte Kondome und leere Fastfood-Tüten überall. Die meisten Straßenlaternen waren längst kaputt, und die Stadt machte sich nicht die Mühe, sie zu ersetzen, denn das hier war keine Gegend, in der die Touristen ihr Geld ausgaben. Das hier war eine Sackgasse, die letzte Zuflucht von Säufern und Junkies. Allerdings war sie derzeit menschenleer. Die Polizei war schon da gewesen, hatte die Obdachlosen und andere unerwünschte Individuen bereits verscheucht.
Dass du es nicht sehen kannst, heißt noch lange nicht, dass es nicht da ist.
Er hörte den Wagen, bevor er ihn sah. Das Knirschen der Reifen auf dem Asphalt, als er langsam durch Scherben und Abfall rollte. Das Schnurren des Motors und das Ächzen der Wagentür. Das Funkgerät krächzte, dann schlug die Tür zu. Schritte klangen schwer auf der Straße. Sie hallten in der Gasse wider, wurden von den Wänden der geschlossenen Läden überlaut zurückgeworfen. Dann verklangen die Schritte, der Mann hatte kehrtgemacht und lief in die andere Richtung, ohne die Sackgasse, und was darin lauerte, zu erkunden.
Sein Herz raste vor Aufregung, und er sog den Geruch der Nacht tief ein. Seine Lungen füllten sich mit feuchter Luft, pumpten Sauerstoff in sein Blut. Es rauschte in seinem Kopf. Er wartete geduldig, bis die Schritte verklungen waren, dann trat er aus dem Dunkel. Er war vorsichtig, als er sich dem Wagen näherte, wich lautlos zerbrochenen Flaschen, rostigen Dosen aus. Seine in Latex steckenden Finger fanden das Messer in seiner Tasche. Zärtlich befühlte er die Klinge und lächelte. Das Blaulicht tanzte still auf den Häuserwänden, sein Rhythmus hatte etwas Hypnotisches.
Mögen die Spiele beginnen.
VIER
«Alpha 816.» Victor sprach in das Funkgerät an seiner Schulter und sah sich um. «Ich stehe an der Ecke 79. und Biarritz, es ging um eine Achtunddreißig, aber hier ist niemand zu sehen.»
«Alpha 816. Der genaue Ort war Atlantic Cable Company. Nordost, 79. Straße und Biarritz Drive. Männlicher Weißer mit Messer; es wurde um eine Einheit gebeten.» Die Stimme der Zentrale erfüllte die Gasse, doch sie verstummte, als Victor Chavez auf Antworten drückte, und ihm fiel plötzlich auf, dass er ganz allein hier draußen war.
«Alpha 816», sagte er. «Hier ist kein Mensch. Ich habe auch auf dem Parkplatz nachgesehen und bei den beiden Läden hier, aber die Luft ist rein. Alles sicher.»
«Alpha 816, verstanden», antwortete die Zentrale.
«Alpha 816. Dann bin ich jetzt erst mal auf zwölf.» Es war halb zwei Uhr morgens, und «zwölf» hieß Essenspause. Ein schöner, fettiger Burger würde den Rest dieser beschissenen Nacht erträglicher machen. Morgen war sein freier Tag – er würde im Fitness-Studio ein paar Extrarunden drehen.
«Alpha 816. Zwölf bis 2 Uhr 30», knarzte das Funkgerät zurück.
Dann war es still. Auf dem Weg zurück zum Streifenwagen überlegte er, ob er zurück nach South Beach fahren und in den Diner Ecke 11. Straße und Washington Drive gehen sollte. Vielleicht hätte er von da aus einen guten Blick auf die Bräute, die vorbeiliefen. Wie sie aus den Limos stiegen und sich vor dem Mynt anstellten, in getigerten Catsuits oder in Lederminis.
Er öffnete die Wagentür und stieg ein. Er hatte den Motor laufen lassen, während er durch die zugemüllte Gasse watete, damit es im Wagen kühl blieb. Selbst im November waren es nachts noch über fünfundzwanzig Grad, und das bei einer Luftfeuchtigkeit von neunzig Prozent. Das brachte sogar einen netten kubanischen Jungen wie ihn ins Schwitzen.
Im September hatte Chief Jordan für alle Streifenwagen des MBPD nagelneue Laptops angeschafft – um zu zeigen, wie fortschrittlich sein Department war. Dabei benutzten sie bei der Florida Highway Patrol und dem Miami P. D. die gleiche Ausrüstung schon seit zwei Jahren. Mit dem Computer sollte alles schneller gehen: Kennzeichen- und Führerscheinkontrollen, Fahndungsbilder und Suchmeldungen, Berichte, der Zugriff auf Datenbanken anderer Staaten und das Anfordern von Haftbefehlen. Die Laptops konnten scannen, E-Mails verschicken, hatten Internetzugang und Zugriff auf alle möglichen Datenbanken, wie zum Beispiel CJNet, das Netzwerk der Strafrechtspflege. In Victors Augen eine Technik, die viel zu viele Informationen bereitstellte und den Vorgesetzten nur zu leicht einen Anlass bot, jemanden wie ihn anzuscheißen – wenn er mal wieder was bei der Recherche übersehen hatte.
Er tippte den Bildschirm an, um – wie fast immer – einen nutzlosen Bericht zu schreiben über das, was er in der Gasse nicht gefunden hatte. Der Bildschirmschoner mit dem Wappen des MBPD verschwand. Als Victor die Worte las, die ihm plötzlich in fetter Blockschrift entgegensprangen, blendend weiß im Dämmerlicht des Streifenwagens, war er verwirrt. Einen Augenblick später wurde ihm die Bedeutung sonnenklar. Doch da war es bereits zu spät.
FÜNF
HALLO VICTOR. DREH DICH DOCH MAL UM .
Victors kurz geschorener Hinterkopf und sein breiter olivgrüner Nacken gaben im weißen Bildschirmschein ein fleischiges Ziel ab. Die Plexiglasscheibe, die den Fahrersitz von der Rückbank trennte, glitt lautlos zu Boden, dann schob sich ein Latex-behandschuhter Arm nach vorn. Verwundert starrte Victor den Bildschirm an, während sich die Rädchen in seinem Hirn langsam drehten. Wie eine Boa constrictor kroch der Arm um Victors Kopf. Dann riss er ihn hart und heftig am Kinn zurück, genau in dem Moment, als Victor sein Gesicht vom Bildschirm abwenden wollte, um nachzusehen, was da hinter ihm lauerte.
Victors Kopf schlug zurück und wurde fest an den Sitz gedrückt. Dann legte der Mann den Arm um Victors Hals und zog seinen Kopf nach hinten. Mit dem Messer schlitzte er den Kragen seiner Uniform auf, ohne ihn zu verletzen. Stattdessen heftete er das Hemd mit dem Messer an den Sitz, sodass Victors Kopf bewegungsunfähig auf der Nackenlehne hing, der Blick nach oben zum Überrollbügel, die Kehle entblößt. Victor strampelte und suchte instinktiv nach seiner Waffe, die rechts unter seinem Arm im Holster steckte, doch damit hatte der Mann auf dem Rücksitz gerechnet. Mit einer Hand drückte er Victor die Kehle zu, mit der anderen griff er nach der SIG-Sauer P-226. Vergeblich versuchte Victor seinen Hals zu befreien. Er strampelte mit den Beinen, lautes Hupen zerriss die Stille, als er gegen das Lenkrad trat. Der Laptop fiel aus seiner Halterung auf den Boden des Streifenwagens. Victor wand sich ungestüm, versuchte sich loszureißen, doch der Winkel war ungünstig und das Messer steckte fest im Polster.
Dann spürte er die Mündung der SIG-Sauer an der Schläfe. Langsam ließ die Latexhand seine Kehle los.
«Schsch.»
Der Druck des kalten Metalls an Victors Kopf beendete den Kampf sofort. Der Mann lauschte Victors entsetztem Keuchen und konnte die Gedanken fast hören, die Victor durch den Kopf gingen.
«Du schaffst es nicht. Ich blas dir die Birne weg, bevor du das Knie oben hast.» Er wusste, welche Überraschung Victor im Gurt an seiner linken Wade versteckte. Victors Augen zuckten panisch hin und her, doch er konnte das Gesicht hinter sich nicht erkennen.
Plötzlich krächzte das Funkgerät neben seinem Kopf. «Alpha 922, Alpha 459. 1530 Collins. Einundvierzig am Boden. Möglicherweise drei zweiunddreißig. Männlicher Schwarzer, nicht ansprechbar, am Straßenrand. Feuerwehr ist unterwegs.» Knisternd spuckte das Gerät die Antworten anderer Einheiten aus. Einheiten, die in diesem Augenblick quer durch Miami Beach rasten, um einem Notfall zu Hilfe zu kommen. Victors Pech war nur, dass es nicht sein Notfall war.
«Was … was wollen Sie?», stammelte Victor mit erstickter Stimme. Der Mann hörte ihm an, dass der große, böse Victor den Tränen nah war.
«Nicht weinen, Victor. Zuerst haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen.» Hinter dem Fahrersitz zog er ein zweites Messer aus der Jacke. Das hier war etwas Besonderes. Er hielt es nach vorn, damit Victor es besser sehen konnte.
Victors Augen weiteten sich in panischem Entsetzen. Er spürte die warme Nässe seiner Pisse in der Hose. Wieder trat er wild um sich, doch es war zwecklos.
«Und jetzt, Victor», sagte der Mann und lächelte, «schön weit aufmachen.»
SECHS
Das Signal ihres Pager ließ sie zusammenzucken, und C. J. tastete hastig im Dunkeln auf dem Nachttisch herum, um ihn abzuschalten.
«Bist du das?», murmelte Dominick verschlafen. Er rutschte näher an sie heran, die Augen noch geschlossen.
«Tut mir leid, dass du aufgewacht bist. Ich hab’s schon», sagte C. J. leise, als sie den Pager endlich in den Fingern hatte.
«Hast du diese Woche Bereitschaft?», murmelte er und streckte unter der Decke die Hand nach ihr aus.
Doch sie wich ihm aus und schwang die Beine aus dem Bett. Sie strich sich eine verschwitzte Strähne hinters Ohr. C. J. wollte nicht, dass er merkte, dass sie wieder schlecht geträumt hatte. «Ja, es war meiner. Ich habe das große Los gezogen.»
Bereitschaftsdienst war Teil ihres Jobs und bedeutete, dass sie nach Feierabend zur Verfügung zu stehen hatte, wenn Polizeibeamte Fragen zu richterlichen Verfügungen, hinreichendem Tatverdacht, Hausdurchsuchungen und Verhaftungen hatten. Oberstaatsanwalt Jerry Tigler vertrat die Politik, dass seine Staatsanwälte vierundzwanzig Stunden am Tag da sein mussten, um der Polizei zu helfen, vor allem seit das Büro der Staatsanwaltschaft von Miami um fünf Uhr nachmittags seine Pforten und Telefonleitungen schloss – im Gegensatz zu den Bezirksstaatsanwälten und den Beratungsstellen jeder anderen Großstadt, die rund um die Uhr Dienst hatten. Also hatte Tigler das County logistisch in zwei Regionen aufgeteilt – Nord und Süd – und jeden der zweihundertvierzig Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft mehrmals im Jahr zu einwöchigen Bereitschaftsdiensten verdonnert.
Die A-, B- und C-Ankläger – diejenigen, die mit Straftaten der so genannten ersten, zweiten und dritten Kategorie zu tun hatten – befassten sich mit eher generellen Fragen: Brauche ich einen Durchsuchungsbefehl, um das Haus eines Mannes zu durchsuchen, wenn seine Frau mich hereinlässt? Muss ich die Eltern informieren, wenn ich einen straffälligen Jugendlichen zu einem Raubüberfall verhöre, von dem ich weiß, dass er ihn im Jahr zuvor begangen hat? Darf ich einen Wagen durchsuchen, wenn ich glaube, dass der Fahrer eine .357 Magnum unter dem Sitz hat? Manche Fragen waren schnell beantwortet, andere waren komplizierter. Knifflig war es immer, wenn ein Polizist eine Reihe von Fakten und Ereignissen herunterleierte und dann den verschlafenen Ankläger fragte, ob er hinreichenden Tatverdacht für eine Festnahme habe. Knifflig, weil hinreichender Tatverdacht – die schwer messbare Menge von Hinweisen, die nötig ist, um die Festnahme einer Person zu rechtfertigen – der Entscheidung des Polizisten vor Ort obliegt, nicht der eines Staatsanwalts. Wie wahrscheinlich war es, dass ein Verbrechen vorlag und dass es sich hier um den Täter handelte? Und manchmal bogen die Polizisten vor Ort die Fakten zurecht, damit sie zu dem Verbrechen passten. Oder ließen manches einfach unter den Tisch fallen.
Eigentlich begann die rechtliche Funktion der Staatsanwaltschaft erst nach der Verhaftung, nämlich dann, wenn der Fall vor Gericht zur Verhandlung kam. Damit die verschiedenen Stellen ohne die ständige Gefahr, verklagt zu werden, arbeiten konnten, garantierte der Staat Florida der Polizei eingeschränkte Immunität bezüglich der Ermessensspielräume der Polizeiarbeit und der Staatsanwaltschaft eingeschränkte Immunität bezüglich der Ermessensspielräume der Anklage. Doch beides war nicht austauschbar, und Tiglers Politik zwang die Staatsanwälte auf den schmalen, trügerischen Grat zwischen freundlicher Beratung um drei Uhr morgens und handfester Beteiligung an der Polizeiarbeit.
Die einzelnen Verbrechenskategorien wurden von spezialisierten Staatsanwälten geahndet, und daher gab es auch spezielle Bereitschaftsdienste. Bei Sexualverbrechen wandte man sich an die Leute der Bekämpfung von Sexualverbrechen; häusliche Gewalt wurde von den Anklägern der Abteilung Häusliche Gewalt bearbeitet; und Mord wurden abwechselnd den Leitern der verschiedenen Abteilungen und den Staatsanwälten der Major Crimes Unit zugeteilt, der Abteilung für Kapitalverbrechen. Und dann gab es noch die Medienspektakel, die O. J. Simpsons mit ihren weißen Ford Broncos – Fälle, bei denen selbst ein Frischling von der Polizeiakademie kapierte, dass es ans Eingemachte ging. Sie wurden ausschließlich von Major Crimes betreut. Die zehn Elitestaatsanwälte der Major Crimes hatten ein vergleichsweise niedrigeres Pensum an Fällen zu bearbeiten, doch diese Morde waren Aufsehen erregend, sie waren haarsträubend, die Fakten grausam und brutal, die Sachlage komplex und vielschichtig. Den meisten, wenn nicht all ihren Angeklagten drohte als Höchststrafe der Tod – durch die Giftspritze oder den elektrischen Stuhl. C. J. war seit zwölf Jahren im Amt, die letzten sieben hatte sie bei Major Crimes verbracht.
Selten wurde ein Betrugsfall um drei Uhr morgens aufgedeckt, doch es wurden genug Morde in der Stadt verübt, dass die Pager der Mordbereitschaft regelmäßig nach Mitternacht losdudelten. Ein weiterer Grundsatz von Jerry Tigler war, dass Mordfälle vor Ort beurteilt werden mussten. Was bedeutete, dass der Gerufene nicht nur aus dem Bett geklingelt wurde, sondern auch aus dem Haus musste. Als Anklägerin der Major Crimes hatte C. J. alle acht Wochen Pager-Dienst. Als stellvertretende Leiterin war sie obendrein immer über den Pager erreichbar, wenn es um Schusswaffengebrauch oder sonstige Gewalt gegen einen Polizeibeamten ging. Ein zusätzliches Bonbon. Gedanken an den Wechsel zu einer Uni-Karriere drängten sich ihr immer wieder auf, wenn um drei Uhr morgens der Alarm losging.
«Vorsicht. Bleib unter der Decke und mach die Augen zu», warnte sie, bevor sie das Licht anknipste. Stöhnend zog sich Dominick das Kissen über den Kopf.
Während sie die Nummer wählte, fragte er: «Zu was bist du eingeteilt? Mord?»
«Diese Woche beides», sagte sie, als sie das Freizeichen hörte. «Schlaf wieder ein. Ich muss wahrscheinlich raus, egal, was es ist.»
Am anderen Ende meldete sich eine Männerstimme. «Nicholsby.»
Sie kannte den Namen. Er gehört zum Morddezernat von Miami Beach. «Detective Nicholsby, hier ist C. J. Townsend von der Staatsanwaltschaft. Ich habe gerade Ihre Nachricht bekommen –»
«Ach, ja, Ms.Townsend. Ich habe mit der Zentrale gesprochen. Man hat mir gesagt, dass Sie heute Nacht zuständig sind. Sie machen Major Crimes, richtig?» Der Detective klang unangenehm angespannt – normalerweise sollte der Fund einer Leiche um vier Uhr früh für einen Mann in seiner Funktion doch keine allzu große Überraschung sein. C. J. wusste aus Erfahrung, dass die Leute vom Morddezernat sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen ließen. Meistens machten sie sich sogar einen Spaß daraus, den zimperlichen Juristen der Staatsanwaltschaft die schaurigen Details lang und breit auszumalen, und das vor dem Frühstück.
«Ja, Detective», bestätigte sie. «Ich mache Mord, aber auch Waffengebrauch gegen Polizeibeamte. Worum geht es, Mord oder Polizei?»
«Also, es ist ein Mord.» Er zögerte. «Aber das ist nicht alles.»
«Mehrere Personen?»
«Nein. Nur einer – aber … also, es ist ziemlich schlimm.» Im Hintergrund hörte sie das Heulen mehrerer Polizeisirenen. Es klang nach einem richtigen Auflauf. Sie hörte, wie Nicholsby lange an seiner Zigarette zog, bevor er fortfuhr. «Ich habe einen toten Cop hier, Ms.Townsend. Und er ist übel zugerichtet.»
SIEBEN
«Verdammt», sagte sie leise und massierte sich die Schläfen. Sie konnte die Kopfschmerzen kommen fühlen. Dann streichelte sie sanft über Dominicks Rücken. «Ich muss los, Schatz.»
Dominick Falconetti hörte ihr an, dass etwas Schlimmes passiert war. Er spähte unter dem Kissen hervor. «Was ist los?»
Sie sah ihn an. Mit kastanienbraunen Augen blinzelte er ins helle Schlafzimmerlicht, sein graubraun meliertes Haar war ganz verwuschelt. Sie schüttelte den Kopf. «Ein Polizist», sagte sie leise.
«Ein Schusswechsel? Wo? Welches Department?»
«Nein, kein Schusswechsel.» Sie holte Luft. Sie wusste, dass es ihn nicht kalt lassen würde. Es war immer hart für einen Polizeibeamten, wenn ein Kollege im Dienst getötet wurde. Es würde ihn belasten, selbst wenn er den Mann gar nicht gekannt hatte. «Mord, Dom. Ein Polizist im Dienst. Tut mir leid. Mehr weiß ich nicht, nicht einmal seinen Namen.»
Dominick setzte sich auf. «Scheiße. Ein Cop? Was zum Teufel – wie? Wo?»
«Ich habe mit Nicholsby in Miami Beach gesprochen.» Sie stand auf und verschwand im begehbaren Kleiderschrank. «Er hat nichts gesagt, außer dass ich kommen soll.» Als sie wieder herauskam, hatte sie eine braune Hose über dem Arm und knöpfte sich eine cremefarbene Seidenbluse zu.
Dominick rieb sich den Schlaf aus den Augen und fuhr sich durchs Haar. «Ich komme mit. Ich ziehe mich nur schnell an», sagte er, während sie in die Hose schlüpfte und sich auf die Bank am Fußende des Betts setzte, um sich die Schuhe anzuziehen.
«Was willst du dort machen? Das Morddezernat vom Beach Department ist da. Die kriegen das schon hin.»
«Bei einem toten Cop wird das FDLE sowieso auf den Plan gerufen. Außerdem ist es vier Uhr früh, und du musst garantiert in eine miese Gegend.» Er schwieg einen Moment. «Ich will nicht, dass du um die Uhrzeit allein gehst.»
Sie sah auf und lächelte ihn an. «Danke, aber ich brauche keinen Geleitschutz, mein edler Ritter. Ich schaffe das schon. Außerdem wird die miese Gegend wahrscheinlich gerade von hundert bewaffneten Polizisten durchkämmt. Es hat sich angehört wie auf dem Rummelplatz. Schlaf du noch ein bisschen. Vielleicht rufen sie dich ja doch nicht an, dann kommst du endlich mal auf deine acht Stunden Schlaf.» Sie ging ins Bad, um sich die Zähne zu putzen.
Er wusste, es war sinnlos, mit ihr zu diskutieren. C. J. war eine unabhängige Frau und dickköpfig dazu. Sie hatte in ihrem Leben genug erlebt, um sich mit gutem Grund davor zu fürchten, um vier Uhr morgens allein das Haus zu verlassen, doch er wusste, sie musste tun, was von ihr gefordert war, und sie würde die Ängste einfach beiseite schieben, die sich ihr womöglich in den Weg stellten. Seit drei Jahren waren sie ein Paar, und heute war sie noch viel mutiger als am Anfang, als er sie kennen gelernt hatte. Während der Jahre bei der Polizei hatte er viele getroffen, die Opfer gewesen und später daran kaputtgegangen waren. Die vor Angst wie gelähmt waren, kaum noch einen Schritt vor die Haustür machen konnten. Die jede Fehlzündung eines Autos für einen Schuss hielten, vor dem sie in Deckung gingen. Bei C. J. war das anders. Es schien, als stellten ihre Ängste für sie eine Herausforderung dar, jeden Tag aufs Neue. Und so trat sie in ihrem Beruf den schlimmsten Verbrechern entgegen und halste sich immer neue Fälle auf, immer neue Tragödien. Wie eine Fallschirmspringerin, die nach einem Unfall, statt den Sport an den Nagel zu hängen, aus immer schwindelerregenderen Höhen springt.
«Ein toter Cop. Herrgott. Da unten ist sicher die Hölle los. Und Nicholsby hat nicht gesagt, was passiert ist?»
«Nein. Er hat nicht viel gesagt. Aber er klang ziemlich fertig. Ich mach mich lieber auf den Weg.» Sie beugte sich zu ihm. Ihre Lippen waren kühl und schmeckten nach Pfefferminz. Es war ein zärtlicher, inniger Kuss. Er legte ihr die Hand in den Nacken, ließ ihr dunkelblondes Haar durch seine Finger gleiten und zog sie an sich. Mit der anderen streichelte er ihr über die Wange. Er vermisste sie, immer noch, jedes Mal, wenn sie fort war. Und er machte sich immer noch Sorgen, jedes Mal, wenn sie ging.
«Tut mir leid», flüsterte sie. «Ich ruf dich an, sobald ich mehr weiß.» Dann richtete sie sich auf. «Heute ist Samstag. Wenn ich zurückkomme, bringe ich Bagels mit.»
«Sei vorsichtig, bitte. Ruf mich an, wenn du da bist, und bleib auf der I95.» Die Interstate 95 war die Schnellstraße, auf der man von Fort Lauderdale nach Miami kam, eine Strecke von knapp fünfzig Kilometern. Es wurde von schrecklichen Dingen gemunkelt, die passieren konnten, wenn man hier zur falschen Zeit die falsche Ausfahrt nahm.
«Ja, Daddy», sagte sie liebevoll und ging zur Tür. «Schlaf wieder ein. Und erzähl mir beim Frühstück, wie es sich anfühlt, ausgeschlafen zu sein. Ach, und vergiss nicht, Lucy rauszulassen.» Lucy war die taube Basset-Hündin, die sich in diesem Moment neben Dominick zu einer Kugel einrollte, dort, wo C. J. noch vor wenigen Minuten gelegen hatte. Sie tätschelte Lucys Kopf. «Schnell zugeschlagen, was, Lucy? Das Bett war noch nicht mal kalt.»
«Wo genau musst du eigentlich hin?»
«Irgendeine Sackgasse, die von der 79. Straße abgeht.» Sie warf ihm einen Kuss zu. «Ich liebe dich», flüsterte sie. «Bis später.»
Die Schlafzimmertür schloss sich leise, und dann war sie fort.
ACHT
Dominick schlug die Decke zur Seite und schob die schnarchende Lucy weiter zur Mitte. Jetzt sprang auch C. J.s dicker alter Kater Tibby aufs Bett und legte sich dazu. Dominick zog sich ein Hemd über, dann streckte er sich und setzte Kaffee auf. Er würde nicht mehr schlafen können. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sein Telefon klingelte.
Ein Cop war tot. Einer von ihnen.
Die Nachricht machte ihn wütend. Wütend, aber gleichzeitig auch traurig. Selbst ohne zu wissen, wer der Cop war oder wie er gestorben war – wahrscheinlich kannte er ihn nicht einmal, es gab so viele Polizisten in Miami. Und doch … Einer von ihnen hatte den Kampf verloren. Kopfschüttelnd stand er unter der grellen Küchenlampe und wartete darauf, dass der Kaffee durch die Maschine lief.
Unter Polizisten herrschte eine außergewöhnliche Kameradschaft. Schon in der ersten Woche auf der Polizeiakademie wurde jedem Frischling von seinen Sergeants und Lieutenants das Motto eingeimpft: «Wir gegen den Rest der Welt.» Die Ausbilder waren extrem erfahren, und die Erfahrung hatte sie extrem pessimistisch gemacht. Das Gebot der Akademie in den intensiven neun Monaten lautete: «Rechne immer mit dem Schlimmsten.» Und das tat er von da an auch. Er schoss jeden Tag auf Bösewichte aus Pappe, lernte Verstärkung anzufordern, wenn er in einer miesen Gegend auch nur niesen musste. Er übte Razzien in Abbruchhäusern, in denen sich immer auch ein paar unschuldige Geiseln befanden, und ließ keinen Pappkameraden ungeschoren entkommen. Nachdem er dreißig Runden Munition verschossen hatte und im Selbstverteidigungstraining grün und blau geprügelt worden war, beendete er den Tag bei ein paar Bier mit den Jungs. Das Leben drehte sich nur um den Job: Er schlief im selben Raum, aß denselben Fraß, atmete dieselbe Luft wie seine Kameraden. Er redete wie ein Cop, vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, und sein geschärfter Polizistenblick sah überall üble Machenschaften, die immer drauf und dran waren zu eskalieren. Keiner kannte einen besser als sein Partner. Und wenn einen jemand mit seinem Leben schützte, mit dem man nicht einmal verwandt war, schmiedete das ein eisernes Band, das die Männer in der blauen Uniform in bedingungsloser Treue zusammenhielt. Wenn es einen von ihnen erwischte, fühlten sich alle Cops getroffen, ganz tief drinnen.
Als Polizist, der einst auf dem übelsten Revier in der südlichen Bronx angefangen hatte, hatte Dominick in seiner Laufbahn schon jede Menge Kameraden betrauern müssen. Und zu viele davon hatte er leider mit eigenen Augen sterben sehen.
In zwölf Monaten war er zum Detective aufgestiegen, nach weiteren sechs ins Morddezernat, doch egal, wie vielen Vorgesetzten er in den Hintern kroch, sie versetzten ihn einfach nicht in eine andere Gegend. Er war gut in seinem Job, gut darin, Antworten zu finden. Zu gut wahrscheinlich. Doch als nach ein paar Jahren alle Bösen anfingen, gleich auszusehen, selbst wenn sie gar nicht böse waren, da wusste er, dass es Zeit war zu gehen. Und eines kalten, regnerischen, besonders miesen Morgens in New York hatte er die Landkarte der Vereinigten Staaten auf dem Tisch ausgebreitet und mit geschlossenen Augen draufgetippt, in der Hoffnung, sein Finger fiele auf einen Ort, wo die Verbrecher kurzärmlige Hemden trugen. Er hatte Miami getroffen – die geschäftige Großstadt mit dem tropischen Flair. Mehrere große Police Departments machten ihm ein Angebot – das Miami-Dade P. D., das City of Miami P. D., das Miami Beach P. D., das Broward Sheriff’s Office –, doch der Job als Special Agent beim Florida Department of Law Enforcement schien mehr als nur einen Tapetenwechsel zu bieten. Hier würde er seine Karriere noch einmal neu beginnen. Wenigstens verkaufte es ihm der Leiter des FDLE so, als er Dominick vor sechzehn Jahren als Special Agent verpflichtete.
Das FDLE war eine Behörde, die zwischen die örtlichen Police Departments und die Bundespolizei, das FBI, geschaltet war. Hier arbeiteten erfahrene Spezialisten an großen landesweiten Ermittlungen – an komplizierten Fällen, die die Grenzen der Polizeibezirke und örtlichen Zuständigkeiten überschritten. Mit staatlichen Geldern wurden in jeder der fünf Regionen des FDLE moderne Kriminallabore eingerichtet, die sich mit denen des FBI in Quantico messen konnten. Das FDLE war nicht die Notaufnahme, sondern eine hoch technisierte Ermittlungsbehörde, und Hausdurchsuchungen zu mitternächtlicher Stunde schienen für Dominick endgültig der Vergangenheit anzugehören. Natürlich war das nur die Theorie. Als der Direktor des FDLE in Miami einen Blick auf Dominicks Lebenslauf geworfen hatte, teilte er ihn prompt für die Violent Crime Squad ein, das Dezernat für Gewaltverbrechen. Und selbst wenn Dominick nicht jede Nacht zur Geisterstunde unterwegs war, konnte er nur davon träumen, wie die Kollegen vom Betrugsdezernat abends um fünf nach Hause zu gehen.
Die Kaffeemaschine röchelte ein letztes Mal und verströmte ihren heimeligen Duft. Lucy kam aus dem Schlafzimmer geschlichen und schnüffelte nach etwas Essbarem. Dominick schenkte sich eine Tasse ein und warf Lucy einen Bonzo-Knochen hin. Sie stieß ein glückliches Winseln aus und zog sich mit dem Leckerbissen in die Küchenecke zurück.
Es war ein gefährlicher Beruf. Jeder Cop wusste das, jeder akzeptierte es. Wenn die Schicht begann, legten sie die Schutzweste an und wurden so unablässig daran erinnert, dass Gefahren auf sie lauerten. Aber kein Cop glaubte, dass sein eigenes Dienstabzeichen die nächste Nummer sein könnte, die mit Code 10-7 über Funk verlesen wurde, ein letztes Lebewohl von der feierlichen Stimme eines Chiefs, während im Hintergrund der Trauermarsch eingespielt wurde. Wenn die Kugel kam, überlegte Dominick, kam sie für jeden Cop völlig unerwartet.
Lucy folgte Dominick auf den Balkon und rollte sich zu seinen Füßen zusammen, als er ans Geländer gelehnt seinen Kaffee trank. Elf Stockwerke unter ihm strömte das schwarze Wasser des Intercoastal Waterway vorbei und klatschte sanft an die Kaimauer. Langsam wurde es kühler, er spürte die kaum merkliche Veränderung der Luft. Es war fast Winter. Die Zeit der vollen Strände, der verstopften Straßen und der zweistündigen Wartezeiten in allen Restaurants. Er konnte das Quietschen Tausender von Reifen fast hören, wenn sich die Nordlichter aus ihren vereisten Garagen quälten und sich wie Zugvögel auf den Weg nach Süden machten, in den Sonnenstaat.
Auf der anderen Seite des Kanals, hinter den Ferienwohnungen und billigen Hotels und den Hochhäusern, die Pompano Beach und Fort Lauderdale überzogen, würden bald pink- und orangefarbene Streifen erscheinen und den dunklen Himmel zerreißen. Florida stand ein weiterer spektakulärer Sonnenaufgang bevor.
Dominick nippte an seinem Kaffee und wartete darauf, dass das Telefon klingelte.
NEUN
Während der Rushhour konnten die fünfzig Kilometer nach Miami Beach eine Ewigkeit dauern, doch um vier Uhr nachts brauchte C. J. kaum fünfzehn Minuten. Sie verließ die I95 an der 79. Straße und fuhr durch das düstere Randgebiet von Liberty City, wo Fenster und Türen der schmucklosen Häuser und kleinen Geschäfte mit schweren Eisengittern verrammelt waren. Selbst um diese Zeit hatten vereinzelte Pfandleihen die Fenster noch hell erleuchtet, und sie sah ein paar gesichtslose Gestalten, die ihrer Arbeit nachgingen. Wenige Kilometer weiter mündete die 79. Straße in den John F. Kennedy Causeway, der hinüber ins ruhige North Bay Village führte, bevor sich die Straße über die schwarze Wasserfläche der Biscayne Bay spannte und sie direkt ins Zentrum von Miami Beach brachte.
Als sie den Causeway passierte, sah sie die blinkenden Blaulichter schon, die sich in einem Radius von mindestens zwei Häuserblocks um eine geschlossene Chevron-Tankstelle scharten. Muss ziemlich schlimm sein. Während ihrer zwölf Jahre im Amt waren in Miami etwa zwanzig Polizeibeamte im Dienst ums Leben gekommen. Und jedes Mal rief der Tod eines Kollegen die gleiche heftige Reaktion hervor: Keiner ruht, bis einer dafür gezahlt hat. Das galt für Streifenpolizisten und Detectives ebenso wie für die Staatsanwaltschaft und jeden anderen Mitarbeiter in den Justizbehörden. Dienstanordnungen wurden zu persönlichen Rachefeldzügen.
C. J. parkte auf dem Tankstellengelände hinter einem leeren Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und machte sich auf den Weg zu einer Gruppe uniformierter Polizisten. Beamte vom Miami Beach P. D. und vom Metro Dade P. D. waren vor Ort, außerdem erkannte C. J. ein paar Männer der Florida Highway Patrol. Neben der Tankstelle befand sich ein großes leeres Grundstück, umgeben von einem zwei Meter hohen Maschendrahtzaun. Dahinter sperrte das gelbe Flatterband der Polizei die schmale Gasse auf der Rückseite eines geschlossenen Elektrohandels.
Dutzende von Funkgeräten plärrten und rauschten. C. J. ging auf die Polizisten des MBPD zu, die am Zaun standen. Die erste Riege.
Sie zog ihre Marke hervor. «Weiß jemand, wo ich Nicholsby vom Morddezernat Miami Beach finde? Ich bin von der Staatsanwaltschaft.»
Der Kreis öffnete sich schweigend und ließ sie durch. Nun sah C. J. den Streifenwagen des MBPD, der in der Gasse stand. Lautlos kreisten die blauen und roten Lichter auf seinem Dach und malten bunte Streifen auf den Lattenzaun an der Rückseite des Elektrogeschäfts und der Atlantic Cable Company nebenan. Auf der anderen Seite, hinter einem Stacheldrahtzaun, ragten drei riesige Satellitenschüsseln und ein Funkturm in die Luft, die zur Atlantic Cable Company gehörten.
Ein junger Cop nickte grimmig in die Richtung. «Nicholsby ist dort beim Wagen und redet mit der Spurensicherung.»
«Danke.» Auf der anderen Seite der Absperrung, am Eingang der Sackgasse, standen zwei Ermittler von der Spurensicherung in Windjacken, CRIME SCENE stand in neongelber Blockschrift auf ihrem Rücken. Bei ihnen war ein Detective in Polohemd und Khakihose, der an einer Zigarette zog. Anfang fünfzig vielleicht, mit seinen dunklen Augenringen und den hängenden Schultern sah er aus, als bräuchte er dringend einen Drink.
C. J. streckte ihm die Hand entgegen. «Detective Nicholsby? C. J. Townsend, Staatsanwaltschaft.»
«Ms.Townsend. Sie waren schnell.»
«Was ist passiert?» C. J. warf einen Blick auf den Streifenwagen.
«Um vier Uhr ging ein Anruf ein. Jemand hat einen Cop gemeldet, der in seinem Wagen zu schlafen schien. Die Zentrale hat einen Wagen hergeschickt, Schrader, einen Frischling. Er will den Kerl wecken, macht die Wagentür auf, und …» Nicholsby brach ab. «Die Spurensicherung hat Fotos von außen gemacht, aber wir warten noch auf den Gerichtsmediziner. Er wohnt irgendwo oben in Coral Springs.»
Der Streifenwagen stand am Eingang der Gasse. Die Fahrertür war einen Spalt geöffnet, aus dem der Zipfel eines weißen Lakens heraushing. Die Fenster sahen seltsam getönt aus. Selbst die Windschutzscheibe.
«Was ist denn mit den Scheiben los?», fragte sie. «Ist das Farbe?»
«Sie wurden angemalt.»
«Angemalt?»
«Mit Blut. Das kranke Arschloch hat den Wagen von innen mit dem Blut des Opfers ausgemalt. Deshalb ist er zunächst niemand aufgefallen. Man konnte nicht reinsehen. Vielleicht dachten die Leute, der Cop machte bei Blaulicht ein Nickerchen und hat die Scheiben abgedeckt, damit ihn keiner dabei erwischt. Hören Sie», sagte Nicholsby dann und zog sie am Arm vom Wagen weg. Sein Blick war finster, durchdringend. «Es ist ziemlich schlimm, Ms.Townsend.»
«Ich habe schon viele schlimme Sachen gesehen, Detective», sagte sie und versuchte unwillkürlich, seiner Berührung auszuweichen.
«Nein», erwiderte er, ohne sie loszulassen. «Ich meine, das hier ist richtig schlimm. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe, und ich hab viel gesehen. Ein paar von meinen Jungs haben es noch nicht verkraftet.» Er deutete mit einer Kopfbewegung hinter sich. Ein junger Polizist in der Uniform des MBPD hatte sich offensichtlich gerade in den Büschen am Zaun übergeben. «Um den muss sich wahrscheinlich unser Psychologe kümmern.»
Sie zog ihren Arm weg und sah ihm in die Augen. «Danke für die Warnung, Detective. Ich verkrafte das schon.»
«Okay.» Er zuckte die Achseln und ließ ihren Arm endlich los. «Wie Sie wünschen. Der Gerichtsmediziner muss jede Minute da sein.»
«Wer ist der Polizist? Wurde er schon identifiziert?»
«Nein. Bei der Vergabe der Streifenwagen hatte es einen Zahlendreher gegeben. In Wagen 8354 sollte eigentlich Gilroy sitzen, Vincent Gilroy. Aber das hier ist nicht Gilroy.»
«Was ist mit seiner Marke?»
«Weg. Genau wie das Namensschild an seiner Uniform. Der Drecksack hat es einfach abgeschnitten.»
«Und keiner hier kennt ihn?»
«Beim Miami Beach P. D. arbeiten fast vierhundert Cops. Kennen Sie sie alle? Außerdem würde ihn seine eigene Mutter nicht erkennen, so wie er zugerichtet ist. Dass es Gilroy nicht ist, wissen wir nur, weil Gilroy blonde Haare hat.»
Sie ging auf den Wagen zu. Unmöglich, etwas durch die Scheiben zu erkennen. Nur der weiße Zipfel, der unter der Tür heraussah, deutete auf die schaurige Fracht, die sie im Innern finden würde. Sie zog sich die Latexhandschuhe über, die Nicholsby ihr gegeben hatte, und streckte die Hand nach dem Türgriff aus, der mit schwarzem Staub überzogen war.
«Fingerabdrücke sind schon genommen worden?», fragte sie nach hinten.
«Ja, aber bis jetzt nur außen. Im Innern also bitte nichts anfassen.»
Langsam zog C. J. die Wagentür auf. Ein weiteres Stück des blutgetränkten Lakens rutschte heraus und bauschte sich zu ihren Füßen.
Sie zögerte eine Sekunde, dann streckte sie die Hand aus und zog das Laken zurück, das die Gestalt auf dem Fahrersitz verbarg. Stöhnend atmete sie aus, hielt sich die Hand vor den Mund und drehte sich auf dem Absatz um, fort von dem Grauen, das sich ihr bot, von der Leiche, die mit den eigenen Handschellen ans Lenkrad gekettet war.
«Mein Gott!», keuchte sie, die Hand noch immer vor den Mund gepresst.
«Ich habe Sie gewarnt», sagte Nicholsby.
«Nein, nein», flüsterte sie mit belegter Stimme, mehr zu sich selbst als zu ihm.
In diesem Moment rief eine Stimme von den anderen Streifenwagen herüber. Ein Polizist kam mit einem Zettel in der Hand auf sie zugerannt. «Detective. Wir wissen jetzt, wer er ist. Wir haben endlich den Mann aus der Dienstgarage erreicht, der die Streifenwagen heute Abend ausgegeben hat. War auf Kneipentour. Kleine Verwirrung bei der Ausgabe. Gilroy sollte 8354 bekommen, hatte aber 8534.»
«Und wer hatte 8354?»
Bevor der Uniformierte antworten konnte, sprach C. J. Sie klang erschöpft, ungläubig, erschüttert. «Chavez», sagte sie leise. «Ich kenne den Mann. Es ist Victor Chavez.»
ZEHN
Verzweifelt versuchte sie, Sinn in die Gedanken zu bringen, die ihr durch den Kopf rasten. Sie war nicht darauf vorbereitet gewesen, einen toten Polizisten derartig zugerichtet vorzufinden. Und sie war erst recht nicht darauf vorbereitet, einen toten Polizisten vorzufinden, mit dem sie einmal eng zusammengearbeitet hatte. Einen, der mehr war als irgendein gewöhnlicher Streifenpolizist …
Victor Chavez saß auf dem dunkelrot gefärbten Fahrersitz, sein Kopf war auf das Lenkrad gesackt.
Der Motor lief nicht, und die Leiche brütete in der Hitze vor sich hin. Die Leichenstarre hatte eingesetzt, die Hände in den Handschellen hielten das Lenkrad fest umklammert. Was von seinem Gesicht übrig war, hatte jemand zur Seite gedreht, wahrscheinlich Schrader, der Polizist, der ihn gefunden hatte. Vor Angst weit aufgerissene Augen starrten in Richtung Fenster ins Nichts. Es waren die Augen, die C. J. sofort erkannt hatte. «Die Augen eines Lügners», hatte sie einmal gedacht, matte braune Augen, die so viel mehr verrieten, als er hatte sagen wollen.
Jetzt starrte er sie an, das Grauen der letzten Sekunden seines kurzen Lebens war für immer in diesem Blick fixiert. Es war leicht nachzuvollziehen, warum ihn die anderen nicht erkannt hatten. Seine untere Gesichtshälfte war völlig zerfetzt. Aus dem Funkgerät an seiner Schulter knisterte die Stimme der Zentrale, die in diesem Moment – wie zum Hohn – zusätzliche Einheiten an den Fundort von Victors Leiche schickte.
C. J. hatte den Streifenwagen stehen lassen und den mit Flatterband abgegrenzten Bereich verlassen. Sie setzte sich auf die Haube von Nicholsbys Ford und nippte an der Wasserflasche, die ihr jemand gereicht hatte, in der Hoffnung, die Übelkeit würde davon vergehen. Plötzlich spürte sie eine Hand auf der Schulter. Es war Marlon Dorsett, der ebenfalls zum Morddezernat Miami Beach gehörte. C. J. hatte bei mehreren Fällen mit Marlon zusammengearbeitet und wusste, dass er einer der Besten war. Er lächelte sie mit blendend weißen Zähnen an.
«C. J.? Der Lieutenant sagte mir, dass Sie Bereitschaft haben. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen.»
«Ich?» C. J. lächelte matt. «Ich bin schon eine Ewigkeit hier. Ich war sogar vor der Musik da.» Sie nickte in Richtung des Streifenwagens. Der Gerichtsmediziner war endlich eingetroffen und maß in diesem Moment mit einem leuchtend orangefarbenen Maßband die tiefen Schnitte aus, die in Victor Chavez’ Kehle klafften, während die Männer der Spurensicherung ungeduldig auf ihren Auftritt warteten. Sobald der Gerichtsmediziner fertig war, würden sie sich wie die Geier auf den Wagen stürzen und ihn bis auf das Fahrgestell auseinander pflücken. «Wie geht’s Ihnen, Marlon?»
«Mir? Nicht schlecht. Klasse Frau, anstrengende Kinder, beschissener Job. Amerikanischer Durchschnitt eben.» Er schüttelte finster den Kopf. «Was für eine perverse Geschichte. Unfassbar, oder? Wie sich der da ausgetobt hat!» Sein Blick fiel auf ihre Wasserflasche. «Sie sehen nicht gut aus, C. J. Verkraften Sie das hier?»
«Ja, ja. Es ist nur … ich kannte Chavez. Von einem Fall. Das hat mich wohl einfach kalt erwischt.»
Marlon nickte und sah sich um. «Für jeden von uns ist es ein Schock. Wie geht’s Dom? Ist er auch hier?»
Doch bevor C. J. antworten konnte, hatte Nicholsby das hitzige Streitgespräch beendet, das er über sein Nextel geführt hatte, eine Art Funkgerät, das gleichzeitig Mobiltelefon und Walkie-Talkie war. Jetzt kam er zu ihnen und ließ seinen Ärger an Detective Dorsett aus.
«Was für ein verdammter Mist! Die Zentrale hat Chavez um 1 Uhr 30 wegen einer Achtunddreißig hier rausgeschickt. Er hat die Gasse gecheckt und anschließend zwölf gemeldet. Das war das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Und keiner ist auf die verdammte Idee gekommen, uns diese Information durchzugeben, während wir hier eine halbe Stunde lang versuchen, den Kerl zu identifizieren.» Er sah zu der sperrangelweit offenen Wagentür hinüber. «Die Leichenstarre hat eingesetzt, also wissen wir, dass er schon ein paar Stunden tot ist. Wir können unsere Straßensperren also getrost wieder abbauen –»
«Es sei denn, der Mistkerl ist in der Gegend geblieben, um zu sehen, wie wir reagieren», unterbrach ihn Marlon.
Nicholsby blickte auf das Meer blauer Uniformen. «Unwahrscheinlich. Um diese Uhrzeit haben wir nicht viele Zuschauer.»
«Zeugen?», fragte C. J.
«Keine», knurrte Nicholsby.
«Was ist mit der Achtunddreißig, die gemeldet wurde?», fragte sie.
«Ein Obdachloser. Keine Beschreibung. Soll mit einem Messer rumgefuchtelt haben. Das ist alles. Ich lasse den Anruf gerade sicherstellen.» Nicholsby zündete sich eine Zigarette an und seufzte frustriert.
«Wer war der Anrufer?», fragte C. J.
«Keine Ahnung. Hat keinen Namen genannt.»
«Das machen die nie. Wollen in nichts verwickelt werden», sagte Marlon. Er zögerte einen Moment, dann sagte er leise: «Oder es war eine Falle.»
«Was?», fragte C. J.
Nicholsby nickte. «Auch die Möglichkeit ziehen wir in Betracht. Anscheinend hat der Typ, dieser Chavez, einen Haufen Feinde gehabt. Jemand hat sich an der Sicherheitsscheibe zur Rückbank zu schaffen gemacht, es sieht so aus, als wäre er von hinten angegriffen worden. Wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Aber erst mal hoffe ich, das Schwein hat im Wagen seine Visitenkarte hinterlassen. Ein Fingerabdruck, ein Haar, Sperma, mir egal. Irgendwas. Würde mir das Leben sehr erleichtern. Ich hab meine Leute in Miami Beach ausgeschickt, um Fragen zu stellen.»
«Das County ist drin», sagte Marlon. «Und die City.» Das County war das Miami-Dade Police Department, die City das City of Miami P. D. «Chief Jordan hat mit Dees gesprochen, dem Leiter der City. Er sagt, er schickt sein ganzes gottverdammtes Morddezernat vorbei, wenn wir es brauchen.»
«Überall laufen die Telefone heiß», sagte Nicholsby. «Vor fünf Minuten habe ich einen Anruf aus Tallahassee bekommen, sie fragen, ob wir ihre Hilfe brauchen. Der Gouverneur weiß auch schon Bescheid. Alle wurden aus dem Bett geholt, an allen Bäumen wird gerüttelt, bevor die Sonne aufgeht. Ich habe Costidas gesagt, er soll jede verdammte Kanaille auftreiben, die je in Miami Beach verhaftet worden ist. Jeden Junkie, jede Nutte, jeden Kokser, jedes Bandenmitglied. Alles, was Beine hat. Damit fangen wir an.»
«Irgendjemand wird den Mund aufmachen. Ist nur eine Frage der Zeit», sagte Marlon mit einem Seufzer. «Wir kriegen den Kerl.»
«Oder die Kerle.» Knurrend trat Nicholsby seine Zigarette aus.
Die drei saßen schweigend da und beobachteten die Beamten der Gerichtsmedizin, die Victors starren Körper vom Fahrersitz des Streifenwagens zerrten. Mit der Leichenstarre waren die Muskeln in der Position festgefroren, in der er sich zum Zeitpunkt des Todes befunden hatte. Es würde weitere zwölf bis vierundzwanzig Stunden dauern, bis die Totenstarre voll eingetreten war und die Muskeln sich wieder zu lockern begannen. Erst dann wäre die Leiche wieder beweglich. Victors steifer, gekrümmter Körper unter dem weißen Laken bot einen makabren Anblick, als ihn die Mitarbeiter des Gerichtsmediziners jetzt zu einer bereitstehenden Bahre trugen.
C. J. beobachtete, wie die Leiche in den Wagen geladen wurde. Das smaragdgrüne Schild, das der Gerichtsmediziner an Victors großem Zeh befestigt hatte, lugte unter dem weißen Laken hervor und baumelte sachte im Wind. Als ein Mitarbeiter der Gerichtsmedizin den Reißverschluss des schwarzen Leichensacks zuzog, verschwand zuletzt auch der Zeh.
«Ich habe gesehen, was mit seinem Gesicht passiert ist», sagte sie langsam. Sie sträubte sich davor, ihr unheimliches Gefühl bestätigt zu bekommen, doch sie stellte die Frage trotzdem. «Was halten Sie davon?»
«Hm», begann Marlon, «der Schnitt durch die Kehle, der ihm fast den Kopf abgesäbelt hat? Der sollte ihn kaltmachen. Die abgeschnittene Zunge? Wir glauben, es ist eine Botschaft.»
«Das war, um ihm das Maul zu stopfen», meinte Nicholsby und klaubte die letzte Zigarette aus seinem Newport-Päckchen heraus.
Dann wurde die Tür des Vans der Gerichtsmedizin von Miami-Dade County zugeschlagen, und die Menge der blinkenden Streifenwagen teilte sich lautlos, um den Leichenwagen vorbeizulassen.
ELF
Der süßliche Geruch des Todes dringt bis ins feinste Gewebe, und kein Waschpulver, keine Seife, kein chemisches Reinigungsmittel kann das Kleidungsstück je wieder davon befreien. Genauso wenig lässt sich der Geruch, einmal wahrgenommen, je wieder aus der Erinnerung löschen. Vielleicht war es eine psychosomatische Reaktion – ein Phantomgeruch, der sich für immer an einen bestimmten Anblick heftete. Doch egal, was es war, C. J. hatte aus Erfahrung gelernt, und so ließ sie die Plastiktüte mit der braunen Hose und der cremefarbenen Seidenbluse in den Müllschlucker auf dem Gang im elften Stock fallen und schlurfte zurück in ihre Wohnung.