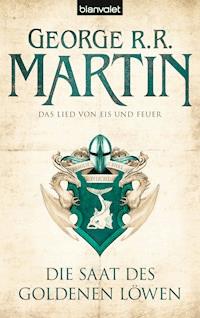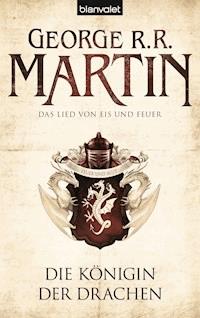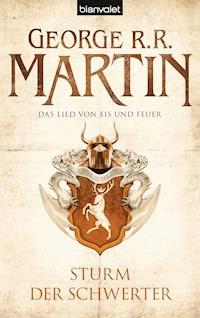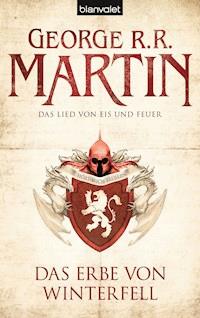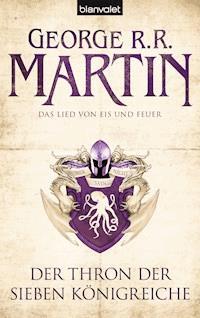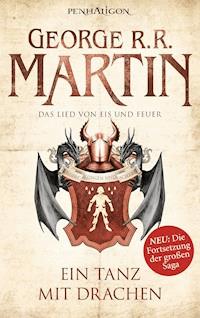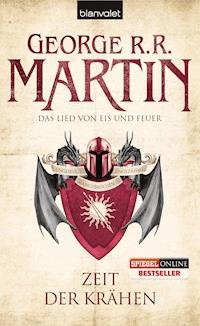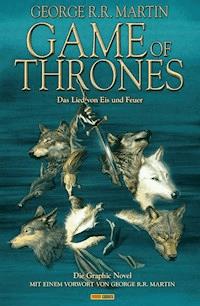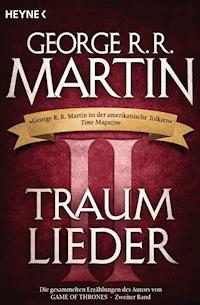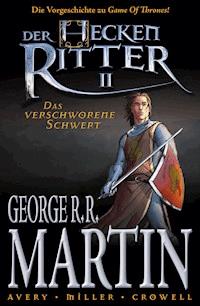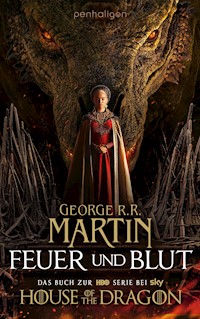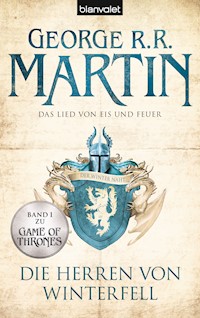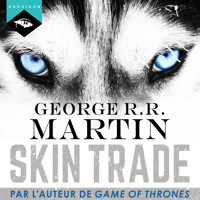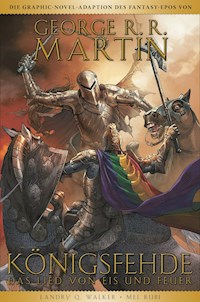Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In jener apokalyptischen Nacht des Jahres 1971 starb eine Band, eine Legende, eine ganze Generation. Sechzigtausend Zuschauer haben es live miterlebt: Der Sänger der Nazgûl bricht, von der Kugel eines Scharfschützen getroffen, auf offener Bühne tot zusammen. Der Sommer der Liebe ist vorbei. Zehn Jahre später geschieht das Unglaubliche: Die Nazgûl sind zurück! Ein neuer Messias hat sie wiederauferstehen lassen − doch ihre Musik hat sich in ein rasendes Requiem verwandelt und kündet von Wahnsinn und Tod ... Viele Fans schätzen diesen Roman als George R. R. Martins bestes Buch. Vor Das Lied von Eis und Feuer hat der erfolgreichste Fantasy-Autor des 21. Jahrhunderts ein Werk verfasst, das ebenso zeitlos wie unvergesslich ist. Der große Phantastik-Klassiker des Autors von GAME OF THRONES!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Deutsch von Peter Robert
Überarbeitete Neuausgabe
[GOLKONDA]
Die Originalausgabe erschien 1983 unter dem Titel
Armageddon Rag
bei Poseidon Press, einem Imprint von Simon & Schuster, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1986 unter dem Titel
Armageddon Rock. Ein Langspiel-Roman in Stereo
bei Fantasy Productions in Erkrath.
Die vorliegende Neuausgabe basiert
auf der 1989 bei Heyne in München erschienenen Taschenbuchausgabe
und wurde in Zusammenarbeit mit dem Übersetzer durchgesehen und überarbeitet.
Those Were the Daze
© 1981 Stephen W. Terrell, Sidhe Gorm Music, BMI
© 1983 by George R. R. Martin
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
vermittelt durch die Agentur Utoprop | Werner Fuchs
© der Übersetzung 2014 by Peter Robert
Mit freundlicher Genehmigung des Übersetzers
© dieser Ausgabe 2014 by Golkonda Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Hannes Riffel
Korrektur: Catherine Beck & Heide Franck
Gestaltung: s.BENeš [www.benswerk.de]
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
Golkonda Verlag
Charlottenstraße 36
12683 Berlin
www.golkonda-verlag.de
ISBN: 978-3-944720-35-7 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-944720-36-4 (E-Book)
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Weitere Bücher im Golkonda Verlag
Phantastik im Golkonda Verlag
Für die Beatles,
für die Airplane und die Spoonful und die Dead,
für Simon & Garfunkel, Joplin und Hendrix,
für Buffalo Springfield und die Rolling Stones,
für die Doors und die Byrds, die Mamas und die Papas,
für Melanie, für Donovan, für Peter, Paul und Mary,
für die Who und die Moody Blues und Moby Grape,
für Country Joe and the Fish, Paul Revere und die Raiders,
für Bob Dylan und Phil Ochs und Joan Baez und Joni Mitchell,
für die Mothers of Invention und die Smothers Brothers,
für die Hollies und die Association und die Beach Boys
und sogar für Herman’s Hermits,
für Creedence Clearwater Revival,
für verlorene Unschuld und hell leuchtende Träume,
und besonders für Parris:
Wenn ich dich anschaue, höre ich die Musik.
Those Were the Daze
(mit einer Entschuldigung an Norman Lear)
Oh, the way that Hendrix played
Everyone was getting laid
Dope was of the highest grade
Those were the days
Always knew who you could trust
Cruising in your micro-bus
They were them and we were us
Those were the days
All the things we’re into then
Tarot Cards, I Ching, and Zen
Mister, we could use a man like
Timothy Leary again!
Hardly needed any cash
Everybody shared their stash
Always had a place to crash
Those were the days!
Ein Dankeschön
Die Nazgûl hätten überhaupt nie gespielt, wäre nicht Gardner R. Dozois gewesen, der mich bat, eine Story für eine von ihm geplante Anthologie zu schreiben, und damit einige Räder ins Rollen brachte. Und sie hätten nie einen so guten Sound gehabt, wäre nicht mein Rockberater-Trio gewesen: Lew Shiner von den Dinosaurs, Stephen W. Terrell von der Potato Salad Band und Parris. Ihnen allen meinen Dank.
George R. R. Martin
Oktober 1982
Eins
Sandy Blair hatte wirklich schon bessere Tage erlebt. Natürlich hatte sein Agent die Rechnung für das Mittagessen bezahlt, aber das machte nur zum Teil wett, wie er Sandy wegen des Abgabetermins für den Roman auf die Nerven gegangen war. Die U-Bahn war voller Rüpel, und die Rückfahrt nach Brooklyn schien ewig zu dauern. Der Fußmarsch zu dem schicken braunen Sandsteingebäude drei Straßen weiter, das er als sein Zuhause bezeichnete, kam ihm länger und kälter vor als sonst. Bis er endlich da war, endlich daheim, brauchte er ganz dringend ein Bier. Er holte sich eins aus dem Kühlschrank, öffnete es und stieg müde zu seinem Arbeitszimmer im dritten Stock und dem Stapel leerer Blätter hinauf, aus dem er ein Buch machen sollte. Wieder einmal hatten die Kobolde es nicht geschafft, in seiner Abwesenheit rasch ein paar Kapitel rauszuhauen; Seite siebenunddreißig steckte immer noch in der Schreibmaschine. Man bekam einfach keine guten Kobolde mehr, dachte Sandy verdrossen. Er starrte die Wörter voller Widerwillen an, nahm einen kräftigen Schluck aus der Flasche in seiner Hand und sah sich nach einer Ablenkung um.
Dabei bemerkte er das rote Licht an seinem Anrufbeantworter und stellte fest, dass Jared Patterson angerufen hatte. Genau genommen war es Jareds Sekretärin gewesen, was Sandy einigermaßen amüsierte; auch nach sieben Jahren und allem, was geschehen war, hatte Patterson noch immer Schiss vor ihm. »Jared Patterson bittet Mister Blair, sich so bald wie möglich mit ihm in Verbindung zu setzen. Es geht um einen Auftrag«, sagte die freundliche, professionelle Stimme. Sandy hörte sich die Aufzeichnung zweimal an, bevor er sie löschte. »Jared Patterson«, sagte er nachdenklich zu sich selbst. Der Name rief verdammt viele Erinnerungen wach.
Sandy wusste, dass er Pattersons Nachricht eigentlich ignorieren sollte. Der Hurensohn verdiente es nicht besser. Trotzdem, das war aussichtslos; er war einfach zu neugierig. Er nahm den Hörer ab und wählte, wobei er mit gelindem Erstaunen feststellte, dass er sich immer noch an die Nummer erinnerte, und das nach sieben Jahren. Eine Sekretärin hob ab. »Hedgehog«, meldete sie sich. »Mister Pattersons Büro.«
»Hier ist Sander Blair«, brummte Sandy. »Jared hat mich angerufen. Sagen Sie dem Feigling, dass ich zurückrufe.«
»Ja, Mister Blair. Mister Patterson hat Anweisung gegeben, Sie sofort durchzustellen. Bleiben Sie bitte dran.«
Gleich darauf tönte Pattersons vertraute spöttisch-joviale Stimme in Sandys Ohr. »Sandy! Toll, dass du mal was von dir hören lässt, wirklich. Lange her, Alter. Wie läuft’s denn so?«
»Spar dir den Scheiß, Jared«, sagte Sandy scharf. »Du bist nicht glücklicher, was von mir zu hören, als ich, was von dir zu hören. Was zum Teufel willst du? Und mach’s kurz, ich hab zu tun.«
Patterson gluckste. »Redet man so mit einem alten Freund? Immer noch kein Benehmen, wie ich sehe. Na schön, also ganz wie’s dir beliebt. Ich möchte, dass du ’ne Story für denHedgehogmachst. Recht so, ganz ohne Umschweife?«
»Schiebs dir sonst wohin«, sagte Sandy. »Warum zum Teufel sollte ich für dich schreiben? Du hast mich gefeuert, du Arschloch.«
»O je, da ist aber jemand verbittert«, meinte Jared tadelnd. »Das war vor sieben Jahren, Sandy. Ich kann mich kaum noch dran erinnern.«
»Komisch. Ich erinnere mich noch recht gut. Ich hätt’s nicht mehr drauf, hast du gesagt. Ich hätte keinen Draht mehr zu dem, was so läuft, hast du gesagt. Als Chefredakteur wäre ich für die jugendliche Leserschaft zu alt, hast du gesagt. Mit mir ginge derHogden Bach runter, hast du gesagt. Lauter so’n Scheiß. Dabei war ich es, der das Blatt überhaupt erstgroßgemacht hat, und das weißt du verdammt gut.«
»Hab ich nie bestritten«, sagte Jared Patterson forsch. »Aber die Zeiten haben sich geändert, und du nicht. Wenn ich dich behalten hätte, wären wir mitFreepundBarbund all den anderen zugrunde gegangen. Mit diesem ganzen Gegenkultur-Zeugs musste mal Schluss sein. Ich meine, wer brauchte denn das? Die ganze Politik, Kritiker, die die heißen neuen Trends in der Musik hassten, die Drogengeschichten ... Es hat’s einfach nicht gebracht, weißt du?« Er seufzte. »Hör mal, ich hab nicht angerufen, um über alte Geschichten zu quatschen. Ich hatte gehofft, du wärst inzwischen drüber weg. Zum Teufel, Sandy, dich zu feuern hat mir mehr wehgetan als dir.«
»Na klar«, erwiderte Sandy. »Du hast an eine Verlagskette verkauft und eine hübsche, gemütliche Festanstellung als Herausgeber gekriegt, während du drei Viertel deiner Belegschaft gefeuert hast. Das muss dich ja dermaßen schmerzen.« Er schnaubte. »Du bist immer noch ein Arschloch, Jared. Wir haben dieses Blatt zusammen aufgebaut, als was Gemeinschaftliches. Es war nicht deins. Du hättest es nicht einfach verkaufen dürfen.«
»He, der ganze Gemeinschaftskram war gut und schön, solange wir jung waren, aber du scheinst zu vergessen, dass es mein Geld war, das die ganze Chose über Wasser gehalten hat.«
»Dein Geld und unser Talent.«
»Himmel, du hast dich kein bisschen geändert, was?«, sagte Jared. »Schön, denk, was du willst, aber unsere Auflage ist dreimal so hoch wie damals, als du Chefredakteur warst, und wir haben irrsinnige Anzeigeneinnahmen. DerHedgehoghat jetzt Klasse. Wir werden für richtige Journalistenpreise nominiert. Hast du in letzter Zeit mal reingeschaut?«
»Klar«, antwortete Sandy. »Tolles Zeug. Restaurantkritiken. Kurzbiographien von Filmstars. Suzanne Somers auf dem Titel, du meine Güte! Videospiele im Lesertest. Ein Rendezvous-Service für einsame Singles. Wie nennt ihr euch jetzt gleich noch? Die Zeitung für Alternative Lebensstile?«
»Das haben wir geändert, das mit ›alternativ‹ haben wir weggelassen. Jetzt heißt es einfach ›Lebensstile‹. Zwischen den beiden Hs im Logo.«
»Himmel«, sagte Sandy. »Dein Musikredakteur hat grüne Haare!«
»Er versteht echt viel von Popmusik«, meinte Jared abwehrend. »Und hör auf, mich anzuschreien. Dauernd schreist du mich an. Allmählich tut’s mir leid, dass ich dich angerufen habe, weißt du. Willst du nun über diesen Auftrag sprechen oder nicht?«
»Offen gesagt, mein Lieber, ist mir das völlig schnuppe. Wieso glaubst du, dass ich einen Auftrag von dir nötig habe?«
»Niemand hat behauptet, dass du ihn nötig hast. Ich leb ja nicht hinterm Mond, ich weiß, dass du gut klargekommen bist. Wie viele Romane hast du veröffentlicht? Vier?«
»Drei«, berichtigte Sandy.
»Und derHedgehoghat jeden einzelnen rezensiert. Du solltest dankbar sein. Dich zu feuern war das Beste, was ich für dich tun konnte. Du warst immer ein besserer Autor als ein Redakteur.«
»O danke, Massa, danke. Ich is’ so ewig dankbar. Ich verdanken Euch alles.«
»Du könntest wenigstens höflich sein«, meinte Jared. »Hör mal, du brauchst uns nicht, und wir brauchen dich nicht, aber ich dachte mir, es wäre schön, wieder zusammenzuarbeiten, nur wegen der alten Zeiten. Gib’s zu, es wär doch ’n Kick, deinen Namen wieder im altenHogzu haben, oder? Und wir zahlen besser als damals.«
»Ich brauch das Geld nicht.«
»Wer hat das denn behauptet? Ich weiß alles über dich. Drei Romane, ein schickes Haus und ein Sportwagen. Was ist es, ein Porsche oder so was?«
»Ein Mazda RX-7«, sagte Sandy kurz.
»Ja, und du lebst mit einer Immobilienmaklerin zusammen, also halt mir keine Vorträge über Verrat, Sandy, alter Knabe.«
»Was willst du, Jared?«, fragte Sandy gereizt. »Ich hab genug von dem Geplänkel.«
»Wir haben eine Story, die für dich genau das Richtige wäre. Wir wollen ein großes Ding draus machen, und ich dachte, du hättest vielleicht Interesse. Es geht um einen Mordfall.«
»Was hast du denn jetzt vor, versuchst du denHoginTrue Detectivezu verwandeln? Vergiss es, Jared, ich mach keinen Krimischeiß.«
»Der Typ, der ermordet wurde, war Jamie Lynch.«
Der Name des Opfers ließ Sandy stutzen, und eine witzige Bemerkung erstarb ihm auf der Zunge. »Der Promoter?«
»Genau der.«
Sandy lehnte sich zurück, nahm einen kräftigen Schluck Bier und dachte darüber nach. Von Lynch hatte man seit Jahren nichts mehr gehört; er hatte seine große Zeit schon hinter sich gehabt, noch bevor Sandy beimHoggefeuert worden war, aber seinerzeit war er ein wichtiger Mann in der Rock-Subkultur gewesen. Das konnte eine interessante Story sein. Um Lynch hatte es immer Kontroversen gegeben. Er hatte auf zwei Hochzeiten getanzt, war Promoter und Manager zugleich gewesen. Als Promoter hatte er einige der größten Touren und Konzerte seiner Zeit organisiert. Für deren Erfolg hatte er gesorgt, indem er die Bands engagierte, die er als Manager unter seinen Fittichen hatte, und indem er sie nicht bei Konkurrenzkonzerten auftreten ließ. Mit heißen Talenten wie American Taco, der Fevre River Packet Company und den Nazgûl unter seiner Fuchtel war er ein Mann gewesen, mit dem man rechnen musste. Zumindest bis 1971, als das Desaster in der West Mesa, die Auflösung der Nazgûl und ein paar Verhaftungen wegen Drogengeschichten ihn auf den langen Weg nach unten gebracht hatten. »Was ist mit ihm passiert?«, fragte Sandy.
»Ziemlich derbe Sache«, sagte Jared. »Jemand ist in sein Haus oben in Maine eingedrungen, hat ihn in sein Büro gezerrt und ihn dort kaltgemacht. Sie haben ihn auf seinem Schreibtisch festgebunden und ihn quasi geopfert. Ihm das Herz rausgeschnitten. Immerhin hatte er also eins. Erinnerst du dich an die alten Witze? Na, egal. Jedenfalls war die ganze Szene irgendwie grotesk. Mansonmäßig, verstehst du? Also, da musste ich an die Artikelserie denken, die du damals ungefähr zu der Zeit verfasst hast, als sie Sharon Tate abgemurkst haben, weißt du, diese Untersuchung der ... Wie hast du das genannt?«
»Die dunkle Seite der Gegenkultur«, sagte Sandy trocken. »Wir haben für diese Serie Preise gekriegt, Jared.«
»Ja, richtig. Ich wusste doch noch, dass sie gut war. Also hab ich an dich gedacht. Das ist genau was für dich. Echter Sixties-Stoff, verstehst du? Wir stellen uns was Langes und Gehaltvolles vor, wie diese tiefschürfenden Sachen, auf die du dich immer gestürzt hast. Wir werden die Meldung von dem Mord als Aufhänger benutzen, verstehst du, und du könntest ein paar Ermittlungen anstellen und schauen, ob du vielleicht irgendwas aufstöbern kannst, was der Polizei entgangen ist. Aber vor allem solltest du den Mord als Sprungbrett für eine Art Rückblick auf Jamie Lynch und seine Promotions benutzen, auf all seine Gruppen und seine Konzerte und seine Zeit und so. Vielleicht könntest du einige der Jungs von seinen alten Gruppen aufsuchen, von der Fevre River Gang und den Nazgûl und all denen, sie interviewen und ein paar Geschichten à la ›Was ist aus ihnen geworden‹ darin unterbringen. Das wäre so ’ne Art Nostalgie-Stück, stell ich mir vor.«
»Deine Leserschaft denkt doch, die Beatles wären die Band, bei der Paul McCartney war, bevor er die Wings gründete«, sagte Sandy. »Die werden nicht mal wissen, wer Jamie Lynch war, Herrgott noch mal!«
»Da liegst du nun wieder falsch. Wir haben immer noch eine Menge von unseren alten Lesern. Die Art Feature, die ich in dieser Lynch-Geschichte sehe, wird richtig gut ankommen. Also, kannst du’s schreiben oder nicht?«
»Natürlich kann ich. Die Frage ist, warum sollte ich?«
»Wir zahlen Spesen und unseren Spitzentarif. Das ist beides nicht zu verachten. Und du musst das Blatt hinterher nicht an der Straßenecke verkaufen. Darüber sind wir raus.«
»Na toll«, erwiderte Sandy. Er wollte Jared sagen, er könne ihn mal kreuzweise, aber so ungern er es zugab, der Auftrag hatte eine gewisse perverse Anziehungskraft. Es wäre schön, wieder für denHogzu schreiben. Das Blatt war schließlich sein Baby; es hatte sich zwar in ein ziemlich verwahrlostes und oberflächliches Kind verwandelt, aber es war trotzdem seins, und es belegte seine Loyalität noch immer ausdauernd mit Beschlag. Außerdem: Wenn er diese Lynch-Sache machte, würde sie dazu beitragen, demHogetwas von seiner alten Qualität wiederzugeben, wenn auch nur für einen Moment. Wenn er ablehnte, würde jemand anders den Artikel schreiben – und nur weiteren Müll produzieren. »Ich sag dir was«, meinte Sandy. »Du garantierst mir, dass ich damit den Titel kriege, und du gibst es mir schriftlich, dass der Beitrag genau so gedruckt wird, wie ich ihn schreibe, ohne ein Wort zu ändern, keine Kürzungen, nichts, dann überlege ich es mir vielleicht.«
»Sandy, du willst es so, du sollst es so haben. Ich käme gar nicht auf den Gedanken, an deinem Zeug rumzupfuschen. Kannst du das Ding bis Dienstag fertig haben?«
Sandy lachte rau. »Scheiße, nein. Tiefschürfend, hast du gesagt. Ich will so viel Zeit, wie ich dafür brauche. Vielleicht hab ich’s in einem Monat fertig. Vielleicht auch nicht.«
»Der Aufhänger wird überholt sein«, jammerte Jared.
»Na und? Ein kurzer Text in deinem Nachrichtenteil reicht doch fürs Erste. Wenn ich das mache, dann mach ich es richtig. Das sind die Bedingungen, akzeptier sie oder lass es bleiben.«
»Jedem anderen als dir würde ich sagen, verpiss dich«, erwiderte Patterson. »Aber zum Teufel, warum nicht? Wir kennen uns schon so lange. Du hast es, Sandy.«
»Mein Agent wird anrufen und sich um alles Schriftliche kümmern.«
»He!«, sagte Jared. »Nach allem, was wir durchgemacht haben, willst du was Schriftliches? Wie oft hab ich dich aus dem Gefängnis geholt? Wie oft haben wir zusammen einen Joint geraucht?«
»Oft«, meinte Sandy. »Nur waren es immer meine Joints, soweit ich mich erinnere. Vor sieben Jahren hast du mir drei Stunden Kündigungsfrist und anstatt einer Abfindung das Geld für den Bus gegeben, Jared. Deshalb machen wir diesmal einen schriftlichen Vertrag. Mein Agent ruft dich an.« Er hängte auf, bevor Patterson eine Chance hatte, Einwände zu erheben, schaltete den Anrufbeantworter ein, um irgendwelche Rückrufversuche abzufangen, und lehnte sich mit den Händen hinter dem Kopf und einem leicht nachdenklichen Lächeln auf seinem Stuhl zurück. Worauf zum Teufel ließ er sich da nur wieder ein?
Sharon würde das nicht gefallen, dachte er. Seinem Agenten würde es auch nicht gefallen. Aber ihm gefiel es irgendwie. Ohne Zweifel war es ziemlich blöd, sich nach Maine davonzumachen, um in einem Mordfall herumzupfuschen; die rationalere Seite von Sandy Blair wusste das, wusste, dass seine Abgabetermine und Hypothekenverpflichtungen zuerst kommen sollten, dass er sich bei dem relativen Hungerlohn, den derHedgehogzahlen würde, die Zeit kaum leisten konnte, die er für diese Sache wohl aufwenden musste. Trotzdem, er war in letzter Zeit ruhelos und schlecht gelaunt gewesen, und er musste mal eine Weile von dieser verdammten Seite siebenunddreißig wegkommen, und es war überhaupt schon zu lange her, dass er irgendwelchen Blödsinn gemacht hatte, irgendwas Spontanes oder Neues oder auch nur ein bisschen Abenteuerliches. Damals war er sogar wild genug gewesen, um Jared auf die Palme zu bringen. Sandy vermisste die alten Zeiten. Er erinnerte sich daran, wie er und Maggie um zwei Uhr früh nach Philly gefahren waren, weil er ein Cheesesteak haben wollte. Und daran, wie Lark und Bambi und er nach Kuba gegangen waren, um Zuckerrohr zu ernten. Und an seinen Versuch, in die französische Fremdenlegion einzutreten, an Froggys Suche nach der perfekten Pizza und an die Woche, die sie mit der Erforschung der Abwasserkanäle verbracht hatten. An die Märsche, die Kundgebungen, die Konzerte, die Rockstars und Underground-Helden und Dopetypen, die er kannte, an die ganzen ausgeflippten Geschichten, die sein Buch mit Zeitungsausschnitten zu einem dicken Wälzer gemacht und seinen Horizont erweitert hatten. Das alles vermisste er. Es hatte gute und schlechte Tage gegeben, aber alles war wesentlich aufregender gewesen, als in seinem Arbeitszimmer zu hocken und immer noch mal Seite siebenunddreißig zu lesen.
Sandy begann die unteren Schubladen seines Schreibtischs zu durchwühlen. Ganz hinten bewahrte er die Andenken auf, Dinge, die völlig unnütz waren, die er aber einfach nicht wegwerfen konnte – Flugblätter, die er geschrieben, Schnappschüsse, die er nie in ein Fotoalbum geklebt hatte, seine Sammlung alter Wahlkampfplaketten. Unter all dem fand er die Schachtel mit seinen alten Visitenkarten. Er zog das Gummiband ab und nahm ein paar heraus.
Es gab zwei verschiedene Sorten. Die eine, mit tiefschwarzer Tinte auf steifen weißen Karton gedruckt, wies ihn als Sander Blair aus, akkreditierter Korrespondent der National Metropolitan News Network, Inc. Sie war noch dazu echt; das war der richtige Name der Firma, die denHedgehogherausbrachte, oder zumindest war es so gewesen, bis Jared an die Verlagskette verkauft hatte. Sandy hatte den Namen der Firma selbst vorgeschlagen; er argumentierte – vollkommen zutreffend, wie sich im Nachhinein zeigte –, dass ein Reporter der National Metropolitan News Network, Inc. bei manchen Anlässen erheblich leichter an einen Presseausweis kommen würde als ein Reporter von etwas namensHedgehog.
Die zweite Karte war übergroß, mit Silbermetallic-Aufdruck auf hellviolettem Papier. Sie zeigte einen Igel – das Symbol, das dem Blatt seinen Namen gab –, der sich in den Zähnen stocherte und als Windel eine amerikanische Flagge trug. Oben links stand »Sandy«, und unter der Abbildung hieß es in etwas größerer Schrift: »Ich schreib für’nHog.« Auch diese Karte hatte ihren Sinn und Zweck. In Situationen, in denen die normale Karte weniger als nutzlos war, konnte sie Türen öffnen und Zungen lösen.
Sandy steckte sich jeweils ein Dutzend von beiden in die Brieftasche. Dann griff er nach seiner Bierflasche und ging gemächlich nach unten.
Als Sharon um sechs nach Hause kam, sah sie ihn im Schneidersitz auf dem Wohnzimmerteppich hocken, umgeben von Straßenkarten, alten Büchern mit Zeitungsausschnitten von Storys aus der Blütezeit desHogund leeren Michelob-Flaschen. Sie stand in ihrem beigen Kostüm im Flur, mit der Aktentasche in der Hand und vom Wind zerzausten Haaren, und starrte ihn hinter getönten Gläsern hervor erstaunt an. »Was ist denn hier los?«, fragte sie.
»’Ne lange Geschichte«, erwiderte Sandy. »Hol dir ’n Bier, und ich erzähl’s dir.«
Sharon sah ihn unschlüssig an, entschuldigte sich und ging nach oben, wo sie in eine maßgeschneiderte Jeans und eine weite Baumwollbluse schlüpfte. Dann kam sie mit einem Glas Rotwein in der Hand zurück. Sie setzte sich in einen der großen Lehnsessel. »Schieß los.«
»Das Mittagessen war ein Schlag ins Wasser«, sagte Sandy, »und die verdammten Kobolde haben kein Wort geschrieben, während ich weg war, aber das Gespenst derHedgehog-Vergangenheit hat fröhliche Urstände gefeiert, als ich zurückkam.« Er erzählte ihr die ganze Geschichte. Sie hörte mit demselben freundlichen, professionellen Lächeln zu, das sie zur Schau stellte, wenn sie Luxusvillen und Apartments verkaufte, zumindest am Anfang. Am Schluss runzelte sie jedoch die Stirn. »Du machst keine Witze, oder?«, fragte sie.
»Nein«, sagte Sandy. Das hatte er befürchtet.
»Ich fass es nicht«, meinte Sharon. »Du hast einen Abgabetermin, oder etwa nicht? Was Patterson auch bezahlt, den Roman wird es nicht ersetzen. Das ist dumm, Sandy. Du warst bei den letzten beiden Büchern schon zu spät dran. Kannst du dir das diesmal wieder leisten? Und seit wann bist du ein Kriminalreporter? Was hat es für einen Sinn, in Dingen herumzupfuschen, von denen du nichts verstehst? Hast du denn irgendeine Ahnung von Mordfällen?«
»Ich hab die halbeTravis McGee-Serie gelesen«, sagte Sandy.
Sharon gab einen entrüsteten Laut von sich. »Sandy! Sei einmal ernst.«
»Na schön«, meinte er. »Ich bin also kein Krimiautor. Na und? Ich weiß ’ne Menge über Jamie Lynch, und ich weiß ’ne Menge über Sekten. Das hier hat alle Merkmale einer Sache im Manson-Stil. Vielleicht kann ich ein Buch draus machen, ’ne ganz andere Art von Buch, so was wieKaltblütig. Betrachte es als Entwicklungsprozess. Du bist doch ganz groß in Entwicklungsprozessen.«
»Du sprichst nicht von Entwicklung«, fauchte Sharon. »Du sprichst von Regression. DerHedgehoggibt dir einen Freibrief, dich unverantwortlich zu verhalten, und du bist ganz wild drauf. Du willst da rauffahren und Sam Spade spielen, mit Rockstars von gestern und alten Yippies reden und für einen Monat oder so die sechziger Jahre noch mal durchleben, auf Pattersons Kosten. Wahrscheinlich wirst du versuchen zu beweisen, dass es Richard Nixon war.«
»Ich hatte Lyndon B. Johnson in Verdacht«, erwiderte Sandy.
»Er hat ein Alibi. Er ist tot.«
»Au Scheiße«, sagte Sandy mit seinem gewinnendsten Grinsen.
»Hör auf, den Schlaumeier zu spielen«, fuhr Sharon ihn an. »Das bringt überhaupt nichts. Werd erwachsen, Sandy. Das ist kein Spiel. Das ist dein Leben.«
»Wo ist dann bitte Ralph Edwards?« Er klappte sein Buch mit den Zeitungsausschnitten zu und legte es beiseite. »Die Sache regt dich richtig auf, wie?«
»Ja«, sagte Sharon knapp. »Das ist kein Scherz, ganz gleich, was du denkst.« Jetzt hatte sie es schließlich doch geschafft, ihn runterzuziehen; Ärger war ansteckend. Aber er beschloss, es ein letztes Mal zu versuchen. »Ich werd nicht allzu lange wegbleiben«, sagte er. »Und Maine kann zu dieser Jahreszeit sehr hübsch sein, wo es grade Herbst wird. Komm doch mit. Nimm’s als Urlaub. Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen, und wenn du mitkämst, würdest du vielleicht meine Einstellung dazu ein bisschen besser verstehen.«
»Klar«, sagte sie mit vor Sarkasmus triefender Stimme. »Ich ruf einfach Don in der Agentur an und sag ihm, dass ich für wer weiß wie lang freinehme und dass er für mich einspringen soll. Der freut sich bestimmt ein Loch in den Bauch! Ich muss an meine Karriere denken, Sandy. Dir ist das vielleicht egal, aber mir nicht.«
»Mir auch nicht«, gab er verletzt zurück.
»Außerdem«, fügte Sharon zuckersüß hinzu, »wäre es bestimmt ein bisschen lästig, mich dabeizuhaben, wenn du beschließt, in der Gegend rumzuvögeln, oder was meinst du?«
»Verdammt, wer hat gesagt, dass ich ...«
»Du brauchst es nicht zu sagen. Ich kenne dich. Nur zu, es macht mir nichts aus. Wir sind nicht verheiratet, wir führen eine offene Beziehung. Fang dir nur nichts ein.«
Sandy stand auf. Er kochte vor Wut. »Du weißt, Sharon, ich liebe dich, aber ich schwöre dir, manchmal bringst du mich zur Weißglut. Das ist eine Story. Ein Auftrag. Ich bin Schriftsteller, und ich werde über den Mord an Jamie Lynch schreiben. Das ist alles. Sieh zu, dass du nicht ganz die Fasson verlierst.«
»Du benutzt so drollige nostalgische Ausdrücke«, sagte Sharon. »Ich hab seit dem College nicht mehr die Fasson verloren, mein Lieber.« Sie stand auf. »Und außerdem reicht’s mir jetzt wirklich. Ich bin in meinem Arbeitszimmer.«
»Ich breche morgen ganz früh auf«, sagte Sandy. »Ich hab gedacht, wir könnten vielleicht was essen gehen.«
»Ich hab zu tun«, erwiderte Sharon und lief zur Treppe.
»Aber ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich werd vielleicht länger ...«
Sie drehte sich um und sah ihn an. »Besser nicht allzu lange, sonst vergesse ich dich noch ganz und komm auf die Idee, die Schlösser auszuwechseln.«
Sandy sah ihr nach, als sie hinaufging. Mit jedem Klicken eines Absatzes auf Holz wuchs die Frustration in ihm. Als er hörte, wie sie ihr Arbeitszimmer betrat, ging er steifbeinig in die Küche, holte sich noch ein Bier und versuchte dann, sich wieder den Reisevorbereitungen zu widmen, aber es dauerte nur einen Augenblick, bis er merkte, dass er zu wütend war, um sich zu konzentrieren. Was er brauchte, war Musik. Er trank einen Schluck Bier und lächelte. Ein bisschen Rock.
Ihre Plattensammlung füllte zwei hohe Schränke beiderseits der Lautsprecherboxen, riesige alte JVC 100er, die Sandy jahrelang treue Dienste geleistet hatten. Sharons Schrank war voll mit Blues, Broadway-Songs und sogar – zu Sandys nie endendem Entsetzen – Disco. »Ich tanze eben gern«, sagte Sharon immer, wenn er ihr damit kam. Sandys Platten waren ausschließlich Folk und alter Rock. Er konnte sich nicht damit abfinden, was mit der Musik in den letzten zehn Jahren passiert war, und die einzigen Alben, die er heutzutage kaufte, waren Wiederveröffentlichungen, die er brauchte, um alte, durch das Abspielen abgenutzte Lieblingsplatten zu ersetzen.
Sandy hielt sich nicht lange damit auf, die zu seiner Stimmung passende Musik auszusuchen. Es gab nur eine denkbare Wahl. Lediglich fünf Alben kamen dafür infrage, eingeordnet zwischen den Mothers of Invention und den New Riders of the Purple Sage. Er zog sie heraus und sah sie durch. Die Hüllen waren ihm so vertraut wie die Gesichtszüge eines alten Freundes, und genauso war es mit den Titeln. Das erste,Hot Wind out of Mordor, hatte ein tolkienartiges Cover, Hobbits, die sich in das pastellfarbene Unterholz duckten, während in der Ferne Vulkane rotes Feuer spuckten und die dunklen Reiter auf ihren schuppigen, geflügelten Streitrossen über ihnen kreisten.Nazgûlbot eine surreale Landschaft mit roter Sonne und scharlachrotem Nebel, verzerrten Bergen und Formen, die halb lebendig und halb Maschinen waren, alles grell, fiebrig und heiß. Das große Doppelalbum war vorne, hinten und im Innern glänzend schwarz, ohne Beschriftung, leer bis auf vier winzige Paare glutroter Augen, die aus der linken unteren Ecke spähten. Nirgendwo ein Titel. Es war das ›Schwarze Album‹ getauft worden, in bewusster Parodie auf das Weiße Album der Beatles. Das folgende,Napalm, zeigte Kinder in einem Dschungel, die sich brennend und schreiend hinkauerten, während merkwürdig verformte Flugzeuge über ihren Köpfen dahinrasten und Feuer auf sie herabspuckten. Erst wenn man genau hinsah, erkannte man, dass die Szene eine neue Darstellung des Covers vonHot Wind out of Mordorwar, genauso wie die Songs darin Antworten auf frühere, harmlosere Kompositionen der Gruppe waren ... obwohl sie nie ganz harmlos gewesen waren.
Sandy sah sich jedes Album der Reihe nach an und stellte es wieder in den Schrank, bis er nur noch das fünfte in der Hand hatte, das letzte, das Ende, nur Wochen vor West Mesa aufgenommen.
Die Hülle war dunkel und bedrohlich, in düsteren Schattierungen von Schwarz, Grau und Violett gehalten. Es war eine Fotografie von einem Konzert, retuschiert, um das Publikum, die Halle, die Bühnenanlage, einfach alles zu tilgen. Nur die Band war übrig geblieben; die vier standen auf einer endlosen, leeren Ebene, Dunkelheit ballte sich vor ihnen und unter ihnen und drang auf sie ein, die Schatten waren ein einziges schleimiges Gewimmel von schlüpfrigen, albtraumhaften Gestalten. Eine riesige, purpurne Sonne hinter ihnen ließ ihre Umrisse scharf hervortreten und warf lange Schatten, so schwarz wie die Sünde und so scharf wie die Schneide eines Messers.
Sie standen da, wie sie immer dagestanden hatten, wenn sie spielten. Im Hintergrund, zwischen den mit wirbelnden Mustern aus Schwarz und Rot lackierten Drums, saß mit finsterem Blick Gopher John, ein großer Mann mit einem Mondgesicht, dessen Züge in seinem dichten, schwarzen Bart fast verschwanden. In seinen gewaltigen Händen sahen die Sticks wie Zahnstocher aus, und doch schien er sich in Anbetracht seiner Größe zu ducken, schien wie ein großes, wildes Tier, das man in seinem Nest überrascht hat, zwischen diesen Drums zu hocken. Vor Gopher Johns dunklem Nest standen Maggio und Faxon, die das Schlagzeug auf beiden Seiten flankierten. Maggio drückte die Gitarre an seine bloße, knochige Brust. Er grinste höhnisch, seine langen dunklen Haare und der schlaffe Schnurrbart bewegten sich in einem unsichtbaren Wind, und seine Brustwarzen wirkten ausgeprägt und rot. Faxon trug eine weiße Fransenjacke; auf seinen Lippen lag ein dünnes Lächeln, während er seinen elektrischen Bass zupfte. Er war sauber rasiert, mit langen blonden Haarflechten und grünen Augen, aber wenn man ihn so sah, ahnte man nicht, was für einen scharfen Verstand er besaß.
Und ganz vorne stand Hobbins, mit gespreizten Beinen, den Kopf zurückgeworfen, sodass sein hüftlanges weißes Haar in einer Kaskade hinter ihm herabfiel, die Augen ein flammendes Scharlachrot, eine Hand um ein Mikrofon geschlossen und die andere wie eine Klaue in die Luft gereckt. Er trug einen schwarzen Jeansanzug mit aus Knochen gefertigten Knöpfen, und auf seinen Schritt war eine amerikanische Flagge mit dem Auge von Mordor genäht, dort, wo sonst die Sterne waren. Er sah wie ein übernatürliches Wesen aus, schmächtig und klein und doch von einer Vitalität erfüllt, die ein gellender Aufschrei wider die Dunkelheit war und sie in Schach hielt.
Vor der großen purpurnen Sonne stand, in spitzen schwarzen Buchstaben, die wie ein mit einer Schlange gepaarter Blitz aussahen, ein einziges Wort:Nazgûl. Und ganz unten, sehr schwach, grau vor dem schwarzen Hintergrund, wisperte es:Music to Wake the Dead.
Sandy ließ das Album aus der Hülle gleiten und legte es vorsichtig auf den Plattenspieler, schaltete ihn ein und drehte den Verstärker voll auf. Heute Abend wollte er es laut, so wie damals, 71, als er es zum ersten Mal so gehört hatte, wie es nach Ansicht der Nazgûl gespielt werden sollte. Wenn das Sharon, die oben ihren Papierkram hin und her schob, ärgerte, war das ihr Pech.
Einen Moment herrschte nichts als Stille, dann wurde ein schwaches Geräusch immer lauter; es klang wie das Pfeifen eines Teekessels oder vielleicht wie ein Raketengeschoss, das rasend schnell näher kam. Das Geräusch stieg an, bis es ein schrilles Heulen war, das einem ins Gehirn schnitt, dann folgte der schwere Sound der Drums, als Gopher John den Beat darunterlegte, die Gitarren setzten ein, und schließlich war da Hobbins und warf sich mit voller Kraft in »Blood on the Sheets«. Bei den ersten Textzeilen überlief Sandy ein merkwürdiger kleiner Schauer.Baby, you cut my heart out, sangen die Nazgûl,Baby, you made me bleeeeed!
Er schloss die Augen und hörte zu, und es war fast, als ob sich ein Jahrzehnt in Luft aufgelöst, als ob es West Mesa nie gegeben hätte, als ob Nixon immer noch im Weißen Haus säße und der Vietnamkrieg tobte und die Bewegung lebendig wäre. Aber irgendwie blieb sogar in dieser zerrissenen Vergangenheit eines dasselbe, und in der von den Songs der Nazgûl durchdrungenen Dunkelheit trat es deutlicher denn je hervor.
Jamie Lynch war tot. Sie hatten ihm tatsächlich das Herz herausgeschnitten.
Zwei
Sheriff Edwin Theodore wurde aus Gründen, die für Sandy Blair nicht sofort ersichtlich waren, von allen und jedem in seinem Zuständigkeitsbereich »Notch« genannt. Notch war ein kleiner, dünner Mann mit kerzengerader Haltung, schmalem, spitzem Gesicht, randloser Brille und eisengrauem Haar, das er glatt zurückgekämmt trug. Er sah aus, als müsste er eigentlich eine Mistgabel halten und aus einem Gemälde herausstarren. Nach nur einem Blick auf Notch beschloss Sandy, ihn Sheriff Theodore zu nennen.
Der Sheriff betastete Sandys steife, weiße, offiziöse Visitenkarte, während er Sandy selbst unschlüssig ansah. Für einen Moment fühlte sich Sandy unter Theodores blassem, wässrigem, prüfendem Blick, als wäre es wieder 1969 und er hätte Haare bis zum Hintern und ein Friedenszeichen aus rostfreiem Stahl an einem Lederriemen um den Hals. Es kostete ihn Mühe, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass er trotz seines schäbigen Äußeren nicht viel schlechter aussah als jeder andere Reporter. Zwar trug er Jeans, aber wenigstens waren es teure Jeans, und sein braunes Cordjackett sollte hinlänglich akzeptabel sein, auch wenn es schon ein bisschen älter war. Er fuhr sich mit einer Hand unsicher durch den dicken schwarzen Haarwust und war kurzzeitig heilfroh, dass er schon vor Längerem aufgehört hatte, einen Bart zu tragen.
Theodore gab ihm die Karte zurück. »Von einem National Metropolitan News Network hab ich noch nie was gehört«, sagte er brüsk. »Welcher Sender ist das?«
»Kein Fernsehen«, erwiderte Sandy. Er entschloss sich, mit offenen Karten zu spielen. »Wir publizieren in New York ein nationales Musik- und Unterhaltungsblatt. Bei Lynchs Verbindungen zur Rockmusik versteht es sich von selbst, dass wir eine Story dazu bringen.«
Sheriff Theodore antwortete mit einem kleinen, sparsamen Brummen. »Die Pressekonferenz war vor zwei Tagen«, antwortete er. »Die haben Sie versäumt. Die meisten Jungs von den anderen Zeitungen waren da und sind schon wieder weg. Gibt nichts Neues.«
Sandy zuckte die Achseln. »Ich arbeite an einer längeren Geschichte«, sagte er. »Ich würde Sie gern zu dem Fall interviewen, über alle Theorien sprechen, mit denen Sie sich befassen, und vielleicht rausfahren und einen Blick auf Lynchs Haus werfen, wo es passiert ist. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte?«
Theodore ignorierte die Frage. »Hab ich alles auf der Pressekonferenz erzählt. Sonst gibt’s nichts zu sagen. Hab keine Zeit, jedem dämlichen Reporter, der zu spät hier raufkommt, noch mal das Gleiche zu erzählen.« Er sah sich mit verärgertem Gesichtsausdruck im Dienstraum um und gab einem seiner Deputys ein Zeichen. »Ich lass Sie von einem meiner Männer zu Lynchs Haus rausfahren, und der kann dann Ihre Fragen beantworten, aber ich kann ihn nicht mehr als eine Stunde entbehren, also müssen Sie sich beeilen, Mister Blair, oder das National Metropolitan News Network hat eben verdammt noch mal Pech gehabt. Ist das klar?«
»Äh, sicher«, meinte Sandy, aber Theodore hatte keine Antwort erwartet. Nur wenige Minuten später wurde er in einen der Wagen des Sheriffs verfrachtet, und schon war er in Begleitung eines schlaksigen, pferdegesichtigen Deputys namens David (»Sie können Davy zu mir sagen«) Parker auf dem Weg raus aus der Stadt. Parker war etwa in Sandys Alter, obwohl sein sich lichtendes braunes Haar ihn älter aussehen ließ. Er hatte ein freundliches Lächeln und bewegte sich unbeholfen.
»Wie lange werden wir bis zu dem Haus brauchen?«, fragte Sandy, als der Wagen sich in den Verkehr einordnete.
»Kommt drauf an, wie schnell wir fahren«, antwortete Parker. »In Luftlinie ist es nicht weit, sind aber alles Nebenstraßen. Dauert ’ne Weile.«
»Mehr als eine Stunde haben wir nicht, hieß es.«
Parker lachte. »Ach, das. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Meine Schicht ist bald rum, und hab nichts Besseres zu tun, also kann ich Sie genauso gut zu Lynch kutschieren. Notch ist bloß sauer auf die Reporter. Zwei von ihnen haben nach der Pressekonferenz seinen Namen falsch geschrieben.«
»Er lautet doch Theodore?« Sandy warf einen Blick in seine Notizen.
»Ja. Aber Edwin, nicht Edward.«
Sandy prüfte das noch einmal nach, als der Deputy sagte: »Da wir grade von Namen sprechen – Sie sind Sandy Blair, stimmt’s? Der Schriftsteller?«
»Äh, ja.«
»Ich hab Ihre Bücher gelesen. Zwei davon jedenfalls.«
»Welche zwei?«, fragte Sandy verblüfft.
»Offene WundenundAbtrünnig«, sagte Parker. »Klingt, als wären Sie überrascht.«
»Bin ich auch.«
Parker warf ihm einen schiefen Blick zu. »Auch Cops lesen, wissen Sie. Na ja, manche Cops. Und das hier ist nicht die Wildnis, wie ihr New Yorker denkt. Wir haben hier Filme, Bücher, Zeitungen, sogar Rock and Roll.«
»Ich wollte nicht ...«, begann Sandy, besann sich dann jedoch eines Besseren. »Wie fanden Sie die Romane?«, fragte er.
»Offene Wundenwar für meinen Geschmack zu deprimierend«, sagte Parker. »Sie schreiben ziemlich gut, das muss ich Ihnen lassen. Der Schluss vonAbtrünnighat mir nicht gefallen.«
»Warum nicht?«, fragte Sandy, ein bisschen verwirrt angesichts der Vorstellung, den Inhalt seines ersten Romans in den Wäldern von Maine auf dem Weg zum Schauplatz eines Mordes mit einem Deputy durchzukauen.
»Weil Ihr Held ein Arschloch ist. Was soll das? Er hat endlich ’n anständigen Job, er macht etwas Geld, übernimmt zum ersten Mal in seinem Leben Verantwortung, und dann schmeißt er alles hin. Für was? Nicht mal er weiß das. Wenn ich mich richtig erinnere, hört es damit auf, dass er eine Straße entlangläuft und sich fragt, wohin sie führt. Es kümmert ihn nicht mal, dass er arbeitslos ist, dass er jeden im Stich gelassen hat, der sich auf ihn verlassen hat.«
»Aber darum geht’s doch«, sagte Sandy. »Es kümmert ihn wirklich nicht. Es ist ein Happy End. Er ist frei. Endlich. Er hat aufgehört, sich zu verkaufen.«
»Möchte wissen, wie lang das gedauert hat«, sagte Parker.
»Was meinen Sie damit?«
»Wann haben Sie das Buch geschrieben?«
»Ich hab damals so 69 rum damit angefangen, aber ich bin nicht dazu gekommen, es fertig zu schreiben, bis ich vor sieben Jahren vomHogweggegangen bin.«
»Na gut«, sagte Parker, »dieses ganze Getue von wegen frei sein war damals vielleicht ganz schön, aber ich würd gerne wissen, wie’s auf die Dauer damit steht. Wie gefällt Ihrem Burschen die Armut, nachdem er sie zehn Jahre genossen hat? Wo schneit er heutzutage mal eben so rein? Ich vermute mal, er kriegt jetzt nicht mehr so oft ’ne Frau ins Bett wie in Ihrem Buch. Ich möchte diesen Heini in den Achtzigern sehen, mein Freund. Jede Wette, dass er sich wieder verkauft.«
»Touché«, sagte Sandy mürrisch. »Na schön, der Roman ist ein bisschen naiv. Was soll ich sagen? Er war eine Spiegelbild seiner Zeit und seines gesellschaftlichen Umfelds. Sie hätten dabei sein müssen.«
Parker warf ihm einen schnellen Blick zu. »Ich bin ungefähr so alt wie Sie.«
»Vielleicht kam es darauf an, auf welcher Seite der Barrikade Sie standen.«
»Auf gar keiner. Ich war drüben in Vietnam und hab auf mich schießen lassen, während Sie und Ihre Figuren gekifft und rumgevögelt haben.« Der Deputy lächelte immer noch, aber in seiner Stimme schwang eine leichte Bitterkeit mit, die Sandy auf die Nerven ging.
»Wegen mir waren Sie da nicht, mein Freund«, sagte Sandy. Das Thema war ihm unangenehm; er wechselte es. »Reden wir über diese Lynch-Geschichte. Wer hat’s getan?«
Parker hatte ein herzliches Lachen. »Sie kommen direkt zur Sache. Zum Teufel, wir wissen nicht, wer’s getan hat.«
Sie waren vor einiger Zeit von der Hauptstraße abgebogen und schlängelten sich auf einem schmalen, unbefestigten Weg durch dichten Baumbestand. Im Licht des späten Nachmittags war alles orange- und rostfarben. Dabei wurden sie ordentlich durchgeschüttelt, aber Sandy klappte trotzdem das Notizbuch auf seinem Knie auf und schaute auf einige seiner Fragen hinab. »Glauben Sie, der Mörder ist von hier?«, fragte er.
Parker lenkte den Wagen geschickt um eine scharfe Kurve. »Das ist unwahrscheinlich. Lynch ist ziemlich für sich geblieben. So viel sollte Ihnen dieser verdammte Weg sagen. Er wollte in Ruhe gelassen werden, glaube ich. Oh, ich denke schon, dass es zwischen Lynch und denen, die mit ihm zu tun hatten, Spannungen gab. Ich meine, er war nicht gerade harmoniesüchtig. Aber keiner hatte irgendeinen Grund, loszuziehen und ihn umzubringen, geschweige denn auf diese Weise ... na ja, Sie wissen schon.«
»Ihm das Herz rauszuschneiden, meinen Sie?« Sandy machte sich eine Notiz. Die Bewegung des Wagens verwandelte seine Handschrift in wirres Gekritzel.
Parker nickte. »Wir sind hier in Maine. So was passiert in New York. Oder vielleicht in Kalifornien«, fügte er nachdenklich hinzu.
»Haben sie’s gefunden?«
»Das Messer?«
»Das Herz.«
»Nein. Weder noch.«
»Na schön«, sagte Sandy. »Also war’s niemand von hier. Irgendwelche Verdächtigen? Sie haben bei Ihren Ermittlungen doch bestimmt irgendjemanden im Auge.«
»Na ja, wir beschäftigen uns mit ein paar Theorien. Allerdings scheint nichts so recht zu passen. Zuerst dachten wir, vielleicht war es ein Raubüberfall. Mag sein, dass Lynch im Musik-Business kein Land mehr sah, aber er war trotzdem noch verdammt reich. Davon abgesehen gibt es keinen Hinweis, dass irgendwas entwendet wurde.«
»Sie vergessen das Herz«, sagte Sandy.
»Ja«, meinte Parker zurückhaltend. »Ansonsten vermuten wir, dass vielleicht Drogen im Spiel waren. Lynch ist ein paarmal vorbestraft, das wissen Sie ja.«
Sandy nickte. »Er hat seine Gruppen mit Haschisch und Koks versorgt. Das ist allgemein bekannt. Gibt es da einen Zusammenhang?«
»Oh, kann sein. Angeblich wurden bei Lynch eine Menge wilder Partys gefeiert. Er soll immer Drogen griffbereit gehabt haben. Gefunden haben wir keine. Vielleicht hat ihn jemand wegen seines Vorrats umgebracht.«
Sandy schrieb das auf. »Okay«, sagte er. »Was noch?«
Der Deputy zuckte die Achseln. »Bei diesem Mord gibt’s noch ’ne Reihe anderer komischer Sachen.«
»Erzählen Sie.«
»Ich weiß was Besseres. Ich zeig’s Ihnen. Wir sind da.« Sie bogen um eine weitere Kurve, ließen den Kamm eines Hügels hinter sich, und plötzlich lag Jamie Lynchs Haus vor ihnen. Parker brachte den Wagen auf dem Kies der kreisrunden Auffahrt zum Stehen, und Sandy stieg aus.
Auf allen Seiten von Wald umgeben, breitete sich das Anwesen behaglich in dem wuchernden Herbstlaub aus. Es war modern und geschmackvoll, aus rotgrauem Stein und Naturholz gebaut, mit einer Veranda aus roten Steinplatten an einer Seite und einer großen Terrasse darüber. Ein Dutzend Stufen aus unlackiertem Holz führten von der Auffahrt zur Haustür. Alle Fenster waren mit Fensterläden fest verschlossen. Ein großer Baum wuchs durch das Dach.
»Durchs Wohnzimmer fließt auch ’n kleiner Bach«, erklärte Parker. »Bei Nacht ist das Haus sogar noch eindrucksvoller. Dann ist hier alles erleuchtet.«
»Können wir reingehen?«
Parker zog einen Schlüsselbund aus seiner Jacke. »Deshalb sind wir ja hier.«
Sie gingen durch den Haupteingang hinein. Innen war alles holzgetäfelt und mit Teppichen ausgelegt. Jeder Raum befand sich auf einer anderen Ebene, sodass sie dauernd kleine dreistufige Treppen hinauf- und hinuntergingen und Sandy kaum noch feststellen konnte, mit wie vielen Stockwerken er es zu tun hatte. Parker machte mit ihm einen raschen Rundgang. Es gab Oberlichter, bemalte Glasfenster und – wie angekündigt – einen Bach, der durch das Wohnzimmer floss, um den Stamm eines alten Baumes herum. Die Küche war modern und sauber. Die vier Schlafzimmer hatten Wasserbetten, verspiegelte Decken und offene Kamine. Und die Musikanlage war unglaublich.
Lynch hatte eine ganze Wand voller Platten, und in jedem Raum standen Lautsprecherboxen. Alles könne vom Wohnzimmer, dem Schlafzimmer des Hausherrn oder von Lynchs Büro aus angesteuert werden, sagte Parker. Er zeigte Sandy die Schaltzentrale, die sich hinter einer verschiebbaren Holzvertäfelung in dem riesigen Wohnzimmer verbarg. Sie sah aus wie die Brücke des Raumschiffs Enterprise. Die Hauptlautsprecher waren größer als Parker und hauchdünn. »Mit so einer Anlage hätte man Woodstock beschallen können«, sagte Sandy erstaunt. »Das Zeug hat Konzertniveau.«
»Es ist laut«, stimmte Parker zu. »Was in dem Fall eine gewisse Rolle gespielt hat.«
Sandy fuhr zu ihm herum. »Wieso?«
»Da komm ich noch drauf«, sagte der Deputy. »Lassen Sie mich zuerst mal das hier mit Ihnen durchgehen. Kommen Sie.« Sie stapften zurück in die Eingangshalle. Parker öffnete eine weitere verschiebbare Wandvertäfelung, und noch mehr Lämpchen und Schalter kamen zum Vorschein. »Die Alarmanlage«, sagte er. »Davon konnte Lynch nicht genug haben. Er war ein totaler Sicherheitsfanatiker. Paranoider Bursche. Man könnte meinen, jemand wäre drauf aus gewesen, ihn umzubringen. Die Alarmanlage ist nie ausgelöst worden. Niemand ist eingebrochen. Der Tod ist geradewegs zur Haustür reinspaziert.«
»Das heißt, er kannte den Mörder?«
»Wir glauben, ja. Entweder das, oder es war der Bi-Ba-Butzemann.«
»Weiter.«
»Also, wir nehmen an, dass es folgendermaßen ablief: Der oder die Mörder fuhren einfach vor, stiegen aus und kamen die Vordertreppe rauf. Lynch empfing sie und ließ sie ein. Das Schloss wurde nicht aufgebrochen oder so. Sie gingen ins Wohnzimmer. Da fing dann der Streit an. Wir haben Spuren eines Kampfes gefunden, und wir denken, dass Lynch schnell überwältigt und bewusstlos oder ohne Widerstand zu leisten in sein Büro geschleift wurde. Vielleicht war er auch schon tot. Aber das glauben wir nicht. Der Wohnzimmerteppich weist Schleifspuren auf. Sie haben das Büro noch nicht gesehen. Kommen Sie.«
Sandy folgte ihm gehorsam zurück durchs Wohnzimmer. Diesmal machte Parker ihn auf die Spuren im Teppich aufmerksam, bevor er wieder die Schlüssel herauszog und die Bürotür aufschloss.
Jamie Lynchs Arbeitszimmer war dreimal so lang wie breit, mit schrägen Oberlichtern, aber ohne Fenster. Die einzigen Möbel waren ein großer hufeisenförmiger Mahagoni-Schreibtisch, ein Sessel und zwanzig schwarze Aktenschränke, die auf dem milchweißen Teppichboden wie dunkle Felswände aufragten. Eine Längswand war vom Boden bis zur Decke von Spiegelkacheln mit eingearbeiteten dekorativen Wirbeln bedeckt, um das Büro größer erscheinen zu lassen. Die anderen Wände waren mit Postern und Fotografien tapeziert; Hochglanzbilder von berühmten und berüchtigten Schützlingen Lynchs, Fotos von Jamie mit diversen Berühmtheiten, Konzertplakate, Flugblätter, Vergrößerungen von Plattencovern, Reklameposter. Sandy musterte sie mit einem leichten Anflug von Nostalgie. Da war Che, und da war Janis Joplin, direkt nebeneinander. Gleich neben dem berüchtigten pornographischen American-Taco-Poster, dessentwegen ein Konzert abgesagt worden war und das fast einen Aufstand ausgelöst hatte, verkaufte Nixon Gebrauchtwagen. Die Nordwand hinter dem Schreibtisch wurde vollständig von alten Fillmore-Postern eingenommen. »Eine ganz hübsche Sammlung«, kommentierte Sandy.
Parker setzte sich auf die Schreibtischkante. »Hier haben sie ihn getötet.«
Sandy wandte sich von den Postern ab. »Auf dem Schreibtisch?«
Der Deputy nickte. »Sie hatten Stricke. Damit haben sie ihn auf dem Schreibtisch festgebunden, die Arme und Beine gespreizt, eine Schlinge um jedes Glied.« Er zeigte hin. »Dort sind Blutflecken auf dem Teppich.« Neben einem Schreibtischbein war ein großer, unregelmäßig geformter Fleck mit einigen kleineren drum herum. Auf dem weißen Teppich waren sie jetzt, nachdem Parker darauf hingewiesen hatte, überdeutlich zu erkennen. »Nicht viel Blut«, meinte Sandy.
»Ah«, sagte Parker lächelnd. »Interessanter Gesichtspunkt. In Wirklichkeit gab es eine Menge Blut, aber unser Killer war da sehr heikel. Er hat eins der Poster runtergerissen und es auf dem Schreibtisch unter dem Opfer ausgebreitet, damit das Holz nicht ruiniert wurde. Sie können sehen, wo es fehlt.« Er nickte zur Wand hinüber.
Sandy drehte sich um, und schließlich bemerkte er die leere Stelle zwischen den Postern, hoch oben an der Ostwand, etwa drei Meter weit weg. Er runzelte beunruhigt die Stirn, war aber im Augenblick nicht imstande zu sagen, warum. »Merkwürdig.« Er wandte sich wieder Parker zu. »Wie wurde Lynch gefunden?«
»Die Musik war zu laut.«
Sandy zog sein Notizbuch hervor. »Musik?«
Parker nickte. »Vielleicht hörte Lynch gerade eine Platte, als der Tod zu ihm kam. Vielleicht hat der Täter eine aufgelegt, um Lynchs Schreie zu übertönen. Jedenfalls lief dieses Album. Immer wieder, unaufhörlich. Und zwar laut. Sie haben’s selbst gesagt, das ist keine gewöhnliche Heimanlage. Es war drei Uhr morgens, und wir bekamen eine Beschwerde wegen der Lautstärke von Lynchs nächstem Nachbarn, einen knappen Kilometer die Straße runter.«
»So laut?«, sagte Sandy beeindruckt.
»So laut. Und dumm war es auch noch. Die Streife hat den Killer auf dem Waldweg wahrscheinlich nur um ein oder zwei Minuten verfehlt. Das alles passt nicht zusammen. Wer auch immer das getan hat, war ansonsten äußerst sorgfältig. Keine Fingerabdrücke, keine Mordwaffe, kein Herz, kaum konkretes Beweismaterial, keine Zeugen. Wir haben eine Reifenspur gefunden, aber sie ist zu alltäglich und damit nutzlos. Warum war also die Anlage so weit aufgedreht? Wenn es darum ging, Lynchs Schreie zu übertönen, warum wurde sie nicht abgeschaltet, als er tot war?«
Sandy zuckte mit den Schultern. »Sagen Sie’s mir.«
»Kann ich nicht«, gab der Deputy zu. »Aber ich hab eine Idee. Ich glaube, es war irgend so ’ne Hippiesekten-Sache.«
Sandy starrte ihn an und lachte unsicher. »Hippiesekten?«
Parker sah aus, als wäre er äußerst zufrieden mit sich. »Blair, Sie glauben doch nicht etwa, dass jeder Reporter, der hier rumschnüffeln will, so ausgiebig herumgeführt wird, oder? Ich zeige Ihnen das alles, weil ich vermute, dass Sie mir dafür vielleicht was zurückgeben können. Sie wissen Sachen, die ich nicht weiß. Ganz bestimmt. Also reden Sie.«
Sandy blieb die Spucke weg. »Ich hab nichts zu sagen.«
Parker kaute auf seiner Unterlippe. »Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Können Sie das aus Ihrer Story raushalten?«
»Weiß ich nicht«, sagte Sandy. »Ich bin nicht sicher, ob ich irgendeine inoffizielle Information haben will. Warum ist das so geheim?«
»Seit die Nachricht von Lynchs Tod in der Zeitung erschienen ist, haben schon drei Spinner angerufen, um ein Geständnis abzulegen. Dabei wird es nicht bleiben. Wir wissen, dass die Geständnisse Unfug sind, weil keiner von denen auch nur eine der Schlüsselfragen beantworten konnte, die wir ihnen gestellt haben. Ich will Ihnen eine dieser Fragen verraten, und auch die Antwort.«
»Na schön«, sagte Sandy neugierig.
»Wir fragen sie, welche Musik lief. Die Antwort ...«
»Mein Gott«, fiel Sandy ihm ins Wort. »Die Nazgûl, stimmt’s?« Ohne nachzudenken, platzte er damit heraus. Irgendwie wusste er plötzlich, dass es so sein musste.
Deputy Davie Parker starrte ihn an, einen sehr merkwürdigen Ausdruck auf seinem langen Pferdegesicht. Sein Blick schien nur ein kleines bisschen eisiger zu werden. »Das ist wirklich interessant«, sagte er. »Wie wär’s, wenn Sie mir mal erzählen, woher Sie das ganz zufällig wissen, Blair?«
»Ich ... ich wusste es einfach, und zwar in dem Moment, als Sie damit rausrücken wollten. Es musste so sein. Lynch war ihr Manager. Das Album ... Ich würde alles drauf wetten, dass esMusic to Wake the Deadwar, stimmt’s?«
Parker nickte.
»Hören Sie sich den ersten Song an. Im Text geht’s irgendwo darum, jemandem das Herz rauszuschneiden. Es wirkte so ... ich weiß nicht, so ...«
»Passend«, sagte Parker. Er hatte ein leises, argwöhnisches Stirnrunzeln aufgesetzt. »Ich hab mir die Platte angehört, und mir ist diese Textstelle auch aufgefallen. Hat mich zum Nachdenken gebracht. Bei Manson und seinem Verein, da gab’s doch auch eine Verbindung zu einem Album, oder nicht?«
»Das Weiße Album der Beatles. Manson glaubte, die Musik würde zu ihm sprechen und ihm sagen, was er tun sollte.«
»Yeah. Darüber weiß ich ’n bisschen was. Bin losgegangen und hab mir ’n paar Bücher in der Bücherei im Ort geholt. Aber Sie wissen ’ne ganze Menge mehr, Blair. Deshalb hab ich gedacht, Sie könnten uns vielleicht helfen. Also, wie sieht’s aus? Könnte das hier noch so ’ne Manson-Sache sein?«
Sandy zuckte die Achseln. »Manson sitzt im Gefängnis. Einige von der Family sind noch auf freiem Fuß, aber größtenteils in Kalifornien. Warum sollten sie nach Maine kommen, um Jamie Lynch kaltzumachen?«
»Was ist mit anderen Sekten von Spinnern? Wie Manson, wenn auch vielleicht nicht ganz genauso?«
»Weiß ich nicht«, gab Sandy zu. »Zu dieser abgedrehten Szene hab ich schon lange keinen Kontakt mehr, deshalb kann ich wirklich nicht sagen, was sich da abspielt. Aber die Nazgûl ... Es müssten Leute in unserem Alter sein, würde ich meinen, wenn sie sich ihre fixen Ideen von den Nazgûl holen. Das ist eine Band aus den Sechzigern, und sie haben sich schon vor mehr als einem Jahrzehnt aufgelöst.Music to Wake the Deadwar ihr letztes Album. Sie haben seit West Mesa kein Stück mehr gespielt oder aufgenommen.«
Parkers Augen wurden schmal. »Das ist noch so was sehr Interessantes, was Sie da gerade gesagt haben, mein Freund. Nur weiter. Was ist West Mesa?«
»Sie machen Witze«, sagte Sandy. Parker schüttelte den Kopf. »Zum Teufel«, sagte Sandy, »West Mesa ist berühmt. Oder berüchtigt. Haben Sie nie die Berichte im Fernsehen gesehen? Darüber wurde sogar ein Dokumentarfilm gedreht.«
»In der entmilitarisierten Zone war der Empfang ziemlich schlecht«, sagte Parker.
»Sie sind kein Rockfan, so viel ist mir klar. West Mesa war ein Rockkonzert, eins der drei, von denen jeder gehört hat. Woodstock war die Morgendämmerung, Altamont war der Einbruch der Dunkelheit, und West Mesa war die pure, schwarze, albtraumhafte Mitternacht. Sechzigtausend Leute draußen bei Albuquerque, im September 1971. Ziemlich klein für so ein Konzert. Die Nazgûl waren die Headliner. Mitten in ihrem Auftritt hat jemand dem Leadsänger Patrick Henry Hobbins mit einem Scharfschützengewehr den Schädel weggeblasen. Acht weitere Leute sind bei der darauf folgenden Panik gestorben, aber es wurde nicht mehr geschossen, nur diese eine Kugel. Den Killer haben sie nie erwischt. Er verschwand in der Nacht. Und die Nazgûl haben nie wieder gespielt.Music to Wake the Deadwar bereits aufgenommen, und sie haben das Album ungefähr drei Wochen nach West Mesa rausgebracht. Selbstredend hat es ein Heidengeld eingespielt. Lynch und die Plattenfirma haben jede Menge Druck auf die drei überlebenden Nazgûl ausgeübt, ein Erinnerungsalbum für Hobbins nachzulegen oder ihn zu ersetzen und die Gruppe zusammenzuhalten, aber daraus ist nichts geworden. Ohne Hobbins gab es keine Nazgûl. West Mesa hat mit ihnen Schluss gemacht, und es war auch für Jamie Lynch der Anfang vom Ende. Immerhin hatte er dieses Konzert organisiert.«
»Interessant«, sagte Parker. »Also haben wir zwei ungelöste Mordfälle.«
»Was, mit dreizehn Jahren Abstand?«, wandte Sandy ein. »Da gibt es keinen Zusammenhang.«
»Nein? Dann will ich Ihnen mal was über das Poster erzählen, Blair.«
Sandy schaute verständnislos drein.
»Sie erinnern sich – unser reinlicher Killer hat ein Poster von der Wand gerissen, um damit den Schreibtisch abzudecken. Darauf wurde Lynch umgebracht. Es war ziemlich versaut, aber nachdem wir’s ’n bisschen sauber gemacht hatten, konnten wir erkennen, was es zeigte. Es war so was wie eine stimmungsvolle Lithographie von einer Wüstenlandschaft bei Sonnenuntergang. Über der Sonne waren vier dunkle Gestalten, die auf fliegenden Eidechsenwesen ritten, Drachen oder so, nur hässlicher. Ganz unten stand ...«
»Ich weiß, was da stand«, unterbrach Sandy. »Jesus Christus. Da standNazgûlundWest Mesa, stimmt’s? Das Konzertplakat. Aber Sie können doch nicht ... das muss ein Zufall sein ...« Doch noch während er das sagte, drehte Sandy sich um und begriff, was ihn vorhin gestört hatte, als Parker ihn auf die leere Stelle an der Bürowand aufmerksam gemacht hatte. Er wirbelte wieder herum. »Das ist kein Zufall«, platzte er heraus. »Wer auch immer Lynch umgebracht hat, er hätte irgendeins von diesen vielen Postern nehmen können, die direkt hinter dem Schreibtisch hängen, in Reichweite. Stattdessen sind sie bis ganz da hinten hingegangen und auf irgendwas draufgeklettert, um das West-Mesa-Plakat runterzureißen.«
»Für ’n alten Hippie sind Sie gar nicht so dumm«, bemerkte Parker.
»Aber warum? Was hat das zu bedeuten?«
Der Deputy erhob sich vom Rand des Schreibtischs und seufzte. »Ich hab irgendwie gehofft, Sie würden’s mir sagen, Blair. Ich hatte diese naive Idee, Ihnen würde, wenn ich Ihnen von dem Poster und dem Album erzähle, plötzlich ein Licht aufgehen, und Sie würden mir erklären, dass es eine geheime Sekte gibt, die diese Jungs anbetet und in der Gegend rumläuft und Leute zum Takt ihrer Musik ermordet. Das hätte mir das Leben verdammt viel einfacher gemacht, glauben Sie’s mir. Aber da hab ich wohl Pech gehabt, hm?«
»Sieht fast so aus«, sagte Sandy.
»Also, dann besorgen wir’s uns eben aus erster Hand. Wir knöpfen uns diese drei Musiker vor und stellen ihnen ein paar Fragen.«
»Nein«, erwiderte Sandy. »Ich hab eine bessere Idee. Lassen Sie mich das machen.«
Parker runzelte die Stirn.
»Ich meine es ernst«, erklärte Sandy. »Es gehört sowieso zu meiner Story. Ich muss Leute interviewen, die Lynch kannten, und so was wie einen Rückblick auf ihn und seine Zeit zusammenschustern. Es ist nur logisch, mit den Nazgûl anzufangen. Wenn um sie oder ihre Musik so was wie ein Kult entstanden ist, müssten sie davon doch etwas wissen, stimmt’s? Ich könnte Sie dann ins Bild setzen.«
»Sind Sie in Verhörtechniken ausgebildet?«, fragte Parker.
»Von wegen Verhör«, sagte Sandy. »Ich bin ich, und Sie sind Sie, und ich kriege mehr aus den Nazgûl raus, als Sie’s je könnten. Wir hatten damals ein Sprichwort. DerHogweiß Sachen, von denen die Bullen keine Ahnung haben.«
Der Deputy grinste. »Kann sein, dass da was dran ist. Ich weiß nicht. Darüber muss ich mit Notch reden. Vielleicht. Dieser Zusammenhang mit den Nazgûl ist eh nur so was wie eine entfernte Möglichkeit, und wir müssen verdammt viele andere Spuren verfolgen und haufenweise Leute vernehmen. Wir gehen Lynchs ganze Korrespondenz und alle seine Akten durch. Eine Menge Leute mochten ihn nicht besonders. Notch wird wahrscheinlich einverstanden sein, wenn ich ihm zurede. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie in Kontakt mit mir bleiben?«
Sandy hob die offene Hand. »Pfadfinderehrenwort.«
»Irgendwie sehen Sie nicht gerade wie ’n Pfadfinder aus«, bemerkte Parker.
Lächelnd behielt Sandy die Hand oben, krümmte jedoch drei Finger und spreizte die beiden übrigen zu dem bekannten V ab. »Dann eben Frieden?«
Parker nickte. »Ich will sehen, was ich tun kann. Sind Sie sicher, dass Sie auf sich aufpassen können? Ich hab dabei ein ungutes Gefühl. Einer Ihrer Musiker könnte sehr gut der Killer sein. Oder alle drei. Lynch war zehn Zentimeter größer und vierzig Pfund schwerer als Sie, und sie haben ihm mit einem Messer das Herz rausgeschnitten.«
»Ich werd keine Dummheiten machen«, sagte Sandy. »Außerdem hab ich diese Jungs früher schon interviewt. Einmal 1969, dann noch mal 1971. Das sind keine Killer. Wenn überhaupt, dann scheinen sie in dieser kleinen Episode eher die Opfer zu sein, oder? Erst Hobbins, jetzt Lynch.«
»Vielleicht gefällt jemandem ihre Musik nicht.«
Sandy stieß ein spöttisches Schnauben aus. »Ihre Musik war großartig, Deputy. Sie sollten sich dieses Album mal anhören, ohne nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen. Das Zeug hat Power. Hören Sie sich Maggios Gitarrenriffs in ›Ash Man‹ an und was Gopher John auf den Drums macht. Und die Texte. Wahnsinn. Besonders die zweite Seite – die besteht nur aus einem einzigen langen Stück, einem richtigen Klassiker, auch wenn die meisten Radiosender es seiner Länge wegen nicht ganz spielen. So was wie die Nazgûl gab’s nicht noch mal, weder vorher noch nachher. Sie waren so gut, dass sie den Leuten Angst machten. Manchmal denke ich, das war der Auslöser für West Mesa, dass es Hoover oder die Scheiß-CIA oder so jemand war, der vor Angst ’ne Darmverschlingung kriegte, weil Hobbins’ Gesang und sein gottverdammtes Charisma die Leute auf die Botschaft in der Musik einstimmten. Da ist mehr als eine Band gestorben, als dieser Schuss abgefeuert wurde. Damit hat man eine Idee getötet und eine Bewegung lahmgelegt.«
»Na ja, mir ist Johnny Cash lieber«, sagte Parker lakonisch. »Kommen Sie, ich nehme Sie mit zurück in die Stadt, und wir sprechen mit Notch, bevor ich es mir noch mal anders überlege.«
Sandy lächelte. »Sie wissen doch bestimmt, Davie, dass es nicht viel zu sagen hat, was Sie sich noch mal anders überlegen? Der erste Zusatzartikel zur Verfassung gilt noch immer, und ich kann losgehen und den Nazgûl Fragen stellen, ob es Notch passt oder nicht.«
»Lassen Sie das nicht Notch hören«, erwiderte Parker. Bevor sie zum Wagen zurückkehrten, machten sie das Licht hinter sich aus. Sandy hielt in dem dunklen Wohnzimmer einen Moment lang inne. Die Nacht war angebrochen, und durch die Oberlichter konnte man die matte Scheibe des Mondes sehen, dessen fahles Licht von dem bemalten Glas in ein halbes Dutzend verschiedener Farben zerschnitten wurde. Als er den Raum in diesem seltsamen Licht sah, verspürte Sandy einen plötzlichen Stich nervöser Angst. Ganz kurz klang das sanfte Gurgeln des Baches so, wie Blut klingen mochte, das aus dem Mund eines Sterbenden lief, und das Geräusch der Blätter, die über das Oberlicht schabten, wurde zum Geräusch von Fingernägeln, die im Todeskampf über eine hölzerne Schreibtischplatte kratzten. Aber es dauerte nur einen Moment; dann waren die Geräusche wieder nur Geräusche, die normalen nächtlichen Laute von Blättern und fließendem Wasser, und Sandy sagte sich selbst, dass er ein Narr war.
Draußen hatte Parker den Wagen angelassen, und die Scheinwerfer blendeten ihn, als er die Treppen hinabstolperte. Wenn er es versuchte, wäre es nur zu leicht, den Klang von Musik zu hören, die schwach aus dem dunklen, leeren Haus hinter ihm drang, das ferne Dröhnen der Drums und das einsame Klagen der Gitarren und der Stimme, und Bruchstücke eines Songs von den Lippen eines Mannes, der längst tot war.
Sandy versuchte es nicht.