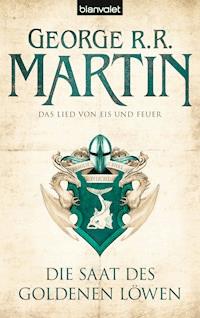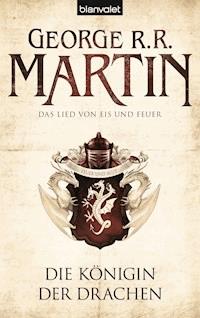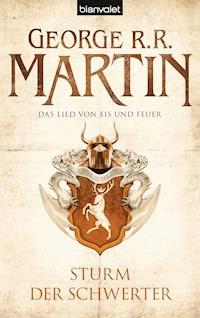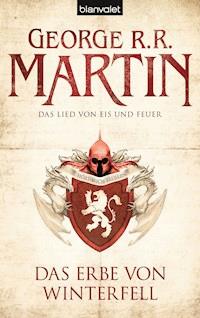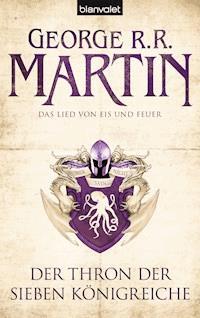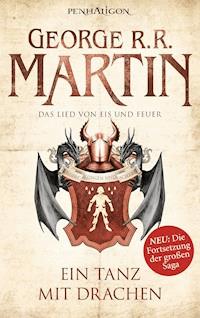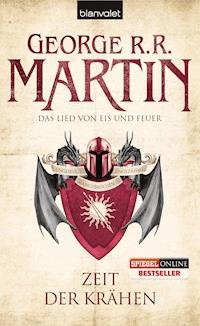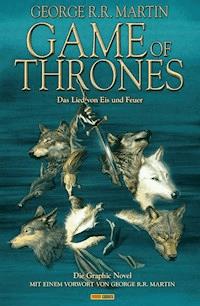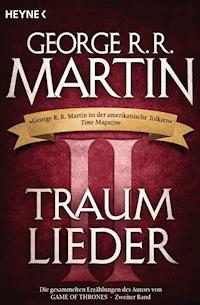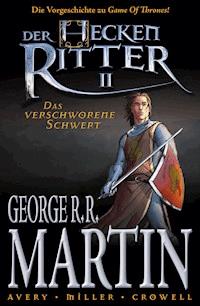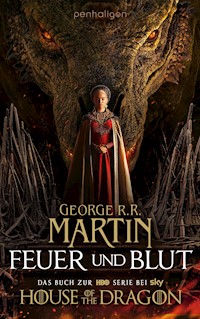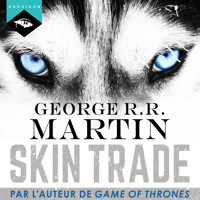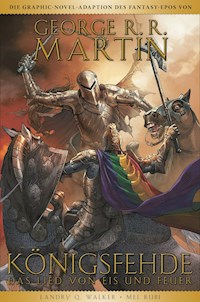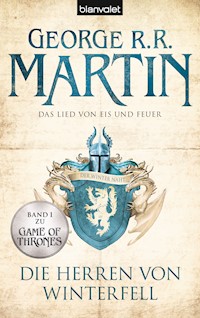
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Lied von Eis und Feuer - mit Gutscheinpunkten lesen!
- Sprache: Deutsch
Der Einstieg in die größte Fantasy-Saga unserer Zeit in vollständig überarbeiteter Neuausgabe!
Eddard Stark, der Herr von Winterfell, wird an den Hof seines Königs gerufen, um diesem als Berater und Vertrauter zur Seite zu stehen. Doch Intriganten, Meuchler und skrupellose Adlige scharen sich um den Thron, deren Einflüsterungen der schwache König nichts entgegenzusetzen hat. Während Eddard sich von mächtigen Feinden umringt sieht, steht sein Sohn, der zukünftige Herrscher des Nordens, einer uralten finsteren Macht gegenüber. Die Zukunft des Reiches hängt von den Herren von Winterfell ab.
Der erste Band zur Serien-Sensation GAME OF THRONES!
Alle Bände von »Das Lied von Eis und Feuer«:
Band 1: Die Herren von Winterfell
Band 2: Das Erbe von Winterfell
Band 3: Der Thron der Sieben Königreiche
Band 4: Die Saat des goldenen Löwen
Band 5: Sturm der Schwerter
Band 6: Die Königin der Drachen
Band 7: Zeit der Krähen
Band 8: Die dunkle Königin
Band 9: Der Sohn des Greifen
Band 10: Ein Tanz mit Drachen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
George R. R. Martin
Die Herren vonWinterfell
Das Lied von Eis und Feuer 1
Ins Deutsche übertragenvon Jörn Ingwersen
Vollständig durchgesehen und überarbeitetvon Sigrun Zühlke und Thomas Gießl
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel »A Game of Thrones« (Pages 1-359 + Appendix)bei Bantam Dell, a division of Random House, Inc., New York.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
25. AuflageTaschenbuchausgabe Januar 2010bei Blanvalet, einem Unternehmen der VerlagsgruppeRandom House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Copyright © 1996 by George R. R. MartinCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1997by Verlagsgruppe Random House GmbHPublished in agreement with the author c / o Ralph M. Vicinanza, Ltd.All rights reservedRedaktion: Andreas HelwegKarten U2 / U3: Franz VohwinkelUH · Herstellung: samSatz: DTP Service Apel, HannoverISBN 978-3-641-03586-0V002www.blanvalet.de
Prolog
»Wir sollten umkehren«, drängte Gared, als es im Wald um sie zu dunkeln begann. »Die Wildlinge sind tot.«
»Machen dir die Toten Angst?«, fragte Ser Weymar Rois mit nur dem Anflug eines Lächelns.
Gared ließ sich darauf nicht ein. Er war ein alter Mann, über fünfzig, und junge Lords hatte er schon so manchen kommen und gehen sehen. »Tot ist tot«, sagte er. »Die Toten sind nicht unsere Sache.«
»Sind sie denn tot?«, fragte Rois leise. »Welchen Beweis haben wir?«
»Will hat sie gesehen«, sagte Gared. »Wenn er sagt, dass sie tot sind, dann ist mir das Beweis genug.«
Will hatte es gewusst. Früher oder später würde man ihn in den Streit hineinziehen. »Meine Mutter hat mich gelehrt, dass Tote keine Lieder singen«, warf er ein.
»Das hat meine Amme auch gesagt«, erwiderte Rois. »Glaub nie etwas, das du an der Zitze einer Frau hörst. Selbst von den Toten kann man etwas lernen.« Seine Stimme hallte nach, zu laut im dämmrigen Wald.
»Wir haben noch einen langen Ritt vor uns«, erklärte Gared. »Acht Tage, vielleicht neun. Und es wird Nacht.«
Unbeeindruckt sah Ser Weymar Rois zum Himmel auf. »Das wird es jeden Tag um diese Zeit. Beraubt dich die Dunkelheit deiner Manneskraft, Gared?«
Will konnte den angespannten Zug um Gareds Mund erkennen, den kaum unterdrückten Zorn in seinen Augen unter der dicken, schwarzen Kapuze seines Umhangs. Gared gehörte seit vierzig Jahren der Nachtwache an, als Mann und schon als Junge, und er war es nicht gewohnt, dass man sich über ihn lustig machte. Doch es war mehr als das. Hinter dem verletzten Stolz bemerkte Will noch etwas anderes bei diesem alten Mann. Man konnte es wittern, eine nervöse Anspannung, die der Angst gefährlich nahe kam.
Will teilte sein Unbehagen. Vier Jahre war er auf der Mauer. Als man ihn zum ersten Mal auf die andere Seite geschickt hatte, waren ihm all die alten Geschichten wieder eingefallen, und fast war ihm das Herz in die Hose gerutscht. Später hatte er darüber gelacht. Inzwischen war er ein Veteran, hatte hundert Patrouillen hinter sich, und die endlose, finstere Wildnis, welche die Südländer den Verfluchten Wald nannten, konnte ihn nicht mehr schrecken.
Bis zum heutigen Abend. Heute war irgendetwas anders. Eine Schärfe lag in dieser Finsternis, bei der sich ihm die Nackenhaare sträubten. Neun Tage waren sie geritten, nach Norden und Nordwesten und dann wieder nach Norden, hart auf den Fersen einer Bande von Wildlingen. Jeder Tag war schlimmer als der Tag zuvor gewesen. Heute war der Schlimmste von allen. Kalter Wind wehte von Norden her und ließ die Bäume rascheln, als wären sie lebendig. Den ganzen Tag schon schien es Will, als würden sie beobachtet, von etwas Kaltem, Unerbittlichem. Auch Gared hatte es gespürt. Will wollte nichts lieber als schnellstmöglich zurück in den Schutz der Mauer reiten, nur war das nichts, was man seinem Kommandanten anvertraute.
Besonders nicht einem Kommandanten wie diesem.
Ser Weymar Rois war der jüngste Sohn eines alten Hauses mit allzu vielen Erben. Er war ein hübscher Junge von achtzehn Jahren, mit grauen Augen, anmutig und schlank wie eine Klinge. Auf seinem mächtigen, schwarzen Streitross ragte der Ritter über Will und Gared mit ihren kleineren Kleppern hoch auf. Er trug schwarze Lederstiefel, schwarze Wollhosen, schwarze Hirschlederhandschuhe und ein feines, geschmeidiges Hemd aus schimmernden, schwarzen Ketten über Schichten von schwarzer Wolle und gehärtetem Leder. Ser Weymar gehörte noch kein halbes Jahr zu den Brüdern der Nachtwache, doch konnte niemand behaupten, er hätte sich auf seine Berufung nicht vorbereitet. Zumindest was seine Garderobe anging.
Sein Umhang war die Krönung. Zobel, dick und schwarz und weich wie die Sünde. »Ich wette, die hat er alle eigenhändig gemeuchelt, der Mann«, hatte Gared in der Kaserne beim Wein erklärt, »hat den kleinen Biestern die Hälse umgedreht, unser großer Krieger.« Alle hatten in sein Lachen mit eingestimmt.
Es fällt schwer, Befehle von einem Mann anzunehmen, über den man lachen musste, wenn man mal zu tief ins Glas geschaut hat, dachte Will, während er zitternd auf seinem Klepper saß. Gared musste wohl ebenso empfinden.
»Mormont hat gesagt, wir sollten sie verfolgen, und das haben wir getan«, sagte Gared. »Sie sind tot. Die werden uns keinen Ärger mehr machen. Vor uns liegt ein harter Ritt. Nur das Wetter gefällt mir nicht. Wenn es schneit, könnte der Rückweg zwei Wochen dauern, und es könnte sein, dass wir uns noch über Schnee freuen. Schon mal einen Eissturm erlebt, Mylord?«
Der junge Herr schien ihn nicht zu hören. Er betrachtete die herabsinkende Dämmerung auf diese halb gelangweilte, halb abwesende Art und Weise, die er meist an den Tag legte. Will war lange genug mit dem Ritter unterwegs gewesen, um zu wissen, dass man ihn am besten nicht störte, wenn er so dreinblickte. »Erzähl mir noch einmal, was du gesehen hast, Will. Sämtliche Einzelheiten. Lass nichts aus.«
Will war Jäger gewesen, bevor er sich der Nachtwache angeschlossen hatte. Nun, eigentlich Wilderer. Reiter hatten ihn im Mallisters-Wald auf frischer Tat ertappt, als er gerade einen Hirsch häutete, der den Mallisters gehörte, und ihm war nur die Wahl geblieben, das Schwarz anzulegen oder eine Hand einzubüßen. Niemand konnte so lautlos durch die Wälder streifen wie Will, und die Schwarzen Brüder hatten nicht lange gebraucht, um sein Talent zu erkennen.
»Das Lager liegt zwei Meilen von hier, hinter diesem Kamm, gleich neben einem Bach«, sagte Will. »Ich war so nah dran, wie ich mich traute. Sie sind zu acht, Männer wie Frauen. Kinder konnte ich keine sehen. An den Fels haben sie einen Unterstand gebaut. Mittlerweile ist er ziemlich schneebedeckt, aber ich konnte ihn trotzdem erkennen. Es brannte kein Feuer, aber die Feuerstelle war nicht zu übersehen. Niemand hat sich gerührt. Ich habe sie lange beobachtet. Kein Lebender kann so lange still liegen.«
»Hast du Blut gesehen?«
»Nein, das nicht«, räumte Will ein.
»Hast du Waffen gesehen?«
»Ein paar Schwerter, ein paar Bögen. Ein Mann hatte eine Axt. Sah schwer aus, mit doppelter Klinge, ein grausiges Stück Eisen. Es lag neben ihm, direkt bei seiner Hand.«
»Hast du darauf geachtet, wie die Leichen lagen?«
Will zuckte mit den Achseln. »Einige sitzen an den Stein gelehnt. Die meisten liegen am Boden. Als wären sie gestürzt.«
»Oder als würden sie schlafen«, vermutete Rois.
»Als wären sie gestürzt«, beharrte Will. »Eine Frau liegt da im Eisenholz, halb verborgen von den Zweigen. Mit abwesendem Blick.« Er lächelte leise. »Ich habe darauf geachtet, dass sie mich nicht sieht. Als ich näher kam, habe ich gesehen, dass auch sie sich nicht mehr rührt.« Unwillkürlich lief ihm ein Schauer über den Rücken.
»Ist dir kalt?«, fragte Rois.
»Ein wenig«, murmelte Will. »Der Wind, Mylord.«
Der junge Ritter wandte sich zu seinem ergrauten Krieger um. Erfrorene Blätter umflüsterten sie, und Rois’ Streitross wurde unruhig. »Was, glaubst du, hat diese Leute getötet, Gared?«, fragte Ser Weymar beiläufig. Er strich über seinen langen Zobelmantel.
»Es war die Kälte«, sagte Gared mit eiserner Bestimmtheit. »Ich habe im letzten Winter gesehen, wie Menschen erfrieren, und auch in dem davor, als ich fast noch ein Junge war. Alle reden von vierzig Fuß hohem Schnee und dass der Wind von Norden her heult, doch der eigentliche Feind ist die Kälte. Sie schleicht sich leise an als Wind, und anfangs zittert man, und die Zähne klappern, und man stampft mit den Füßen und träumt von Glühwein und hübschen, heißen Feuern. Sie brennt, das tut sie. Nichts brennt wie die Kälte. Doch nur eine Weile. Dann kriecht sie in dich hinein und fängt an dich auszufüllen, und nach einer Weile hast du keine Kraft mehr, dich zu wehren. Es fällt leichter, sich hinzusetzen oder einzuschlafen. Man sagt, man spürt am Ende keine Schmerzen. Erst wird man schwach und müde, und alles lässt nach, und dann ist es, als würde man in einem Meer aus warmer Milch versinken. Friedlich eigentlich.«
»Diese Beredsamkeit, Gared«, bemerkte Ser Weymar. »Nie hätte ich so etwas bei dir vermutet.«
»Ich hatte die Kälte selbst schon in mir, junger Herr.« Gared schob seine Kapuze zurück und ließ Ser Weymar einen langen, gewissenhaften Blick auf die Stümpfe werfen, wo einst seine Ohren gesessen hatten. »Zwei Ohren, drei Zehen und der kleine Finger meiner linken Hand. Ich bin noch gut weggekommen. Meinen Bruder haben wir erfroren auf seinem Posten gefunden, mit einem Lächeln auf dem Gesicht.«
Ser Weymar zuckte mit den Schultern. »Du solltest dich wärmer anziehen, Gared.«
Gared warf dem jungen Herrn einen bösen Blick zu, und die Narben um seine Ohrlöcher, wo Maester Aemon ihm die Ohren abgeschnitten hatte, wurden rot vor Zorn. »Wir werden sehen, wie warm Ihr Euch kleiden könnt, wenn der Winter kommt.« Er zog seine Kapuze hoch und kauerte auf seinem Klepper, schweigend und brütend.
»Wenn Gared sagt, dass es die Kälte war …«, setzte Will an.
»Hast du letzte Woche Wache geschoben, Will?«
»Ja, Mylord.« Es verging keine Woche, in der er nicht ein ganzes Dutzend Mal Wache schob. Worauf wollte der Mann hinaus?
»Und was hat die Mauer getan?«
»Geweint«, sagte Will. Jetzt war alles klar, nachdem der junge Lord ihn darauf hingewiesen hatte. »Sie hätten nicht erfrieren können. Nicht, wenn die Mauer weint. Es war nicht kalt genug.«
Rois nickte. »Kluger Kopf. Wir hatten in dieser Woche ein paar Mal leichten Frost und hin und wieder einen leichten Schneeschauer, doch sicher keinen Frost, der so hart war, dass er acht erwachsene Menschen töten konnte. Menschen in Fell und Leder, wenn ich dich erinnern darf, mit Obdach in der Nähe und der Möglichkeit, ein Feuer zu machen.« Das Grinsen des Ritters war anmaßend. »Will, bring uns dorthin. Ich möchte diese Toten mit eigenen Augen sehen.«
Und dann war nichts mehr zu ändern. Der Befehl war erteilt, und die Ehre hieß sie, sich zu fügen.
Will ritt voraus, und sein zottiger, kleiner Klepper suchte sich sorgsam einen Weg durchs Unterholz. In der Nacht zuvor war ein wenig Schnee gefallen, und Steine und Wurzeln und verborgene Mulden lagen gleich unter der Kruste und warteten auf die Sorglosen und Unachtsamen. Dahinter kam Ser Weymar, und sein großes, schwarzes Streitross schnaubte voller Ungeduld. Ein Streitross war das falsche Reittier für Patrouillen, nur war das einem jungen Lord nicht beizubringen. Gared bildete die Nachhut. Beim Reiten murmelte der alte Krieger vor sich hin.
Immer dunkler wurde es. Der wolkenlose Himmel wandelte sich zu einem dunklen Rot, der Farbe einer alten Prellung, dann schließlich war er schwarz. Die ersten Sterne kamen hervor. Die Sichel des Mondes stieg auf. Will war dankbar für das Licht.
»Wir können doch bestimmt auch schneller vorankommen«, sagte Rois, nachdem der Mond ganz aufgegangen war.
»Nicht mit diesem Pferd«, sagte Will. Die Angst machte ihn unverschämt. »Vielleicht möchte Euer Lordschaft vorausreiten?«
Ser Weymar Rois geruhte nicht zu antworten.
Irgendwo tief in den Wäldern heulte ein Wolf.
Will lenkte seinen Klepper zu einem alten, knorrigen Stück Eisenholz und stieg ab.
»Wieso hältst du an?«, fragte Ser Weymar.
»Am besten gehen wir den Rest des Weges zu Fuß, Mylord. Es ist gleich dort hinter diesem Kamm.«
Rois wartete einen Moment lang, starrte in die Ferne, mit nachdenklicher Miene. Kalter Wind flüsterte durch die Bäume. Sein großer Zobelmantel wehte hinter ihm, als steckte Leben darin.
»Irgendetwas stimmt hier nicht«, murmelte Gared.
Der junge Lord warf ihm ein verächtliches Lächeln zu. »Ist das so?«
»Spürt Ihr es denn nicht?«, fragte Gared. »Lauscht der Finsternis!«
Will konnte es spüren. Vier Jahre war er bei der Nachtwache, und noch niemals hatte er sich so sehr gefürchtet. Was war das?
»Wind. Raschelnde Bäume. Ein Wolf. Was davon beraubt dich deiner Manneskräfte, Gared?« Als Gared nicht antwortete, glitt Rois elegant aus seinem Sattel. Er band das Streitross an einem tiefhängenden Ast fest, abseits der anderen Pferde, zog sein Langschwert aus der Scheide, sodass Mondlicht am schimmernden Stahl hinablief. Es war eine prachtvolle Waffe, auf einer Burg geschmiedet und allem Anschein nach nagelneu. Will bezweifelte, ob es je im Zorn des Kampfes geschwungen worden war.
»Die Bäume stehen eng«, warnte Will. »Das Schwert wird Euch behindern, Mylord. Greift besser zum Messer.«
»Wenn ich Anleitung bräuchte, würde ich darum bitten«, sagte der junge Lord. »Gared, bleib hier. Bewach die Pferde.«
Gared stieg ab. »Wir brauchen ein Feuer. Ich kümmere mich darum.«
»Wie dumm bist du, alter Mann? Wenn Feinde in diesem Wald sind, ist ein Feuer das Letzte, was wir brauchen.«
»Es gibt auch Feinde, die ein Feuer fernhält«, sagte Gared. »Bären und Schattenwölfe und … und andere …«
Ser Weymars Mund wurde zu einem schmalen Strich. »Kein Feuer.«
Gareds Kapuze verbarg sein Gesicht, doch Will konnte das harte Funkeln in seinen Augen sehen, als er den Ritter anstarrte. Einen Moment lang fürchtete er, der ältere Mann könne zum Schwert greifen. Es war ein kurzes, hässliches Ding, der Griff vom Schweiß entfärbt, die Klinge vom vielen Gebrauch gekerbt, doch Will hätte keinen Eisenhirschen für das Leben des Lords gegeben, wenn Gared es aus seiner Scheide gezogen hätte.
Schließlich sah Gared zu Boden. »Kein Feuer«, murmelte er leise.
Rois nahm es als Einwilligung und wandte sich ab. »Geh voraus«, wies er Will an.
Will bahnte ihnen einen Weg durchs Dickicht, dann stieg er den Hang zum flachen Kamm hinauf, wo er seinen Aussichtspunkt unter einem Wachbaum gefunden hatte. Unter der dünnen Schneekruste war der Boden feucht und matschig, rutschig, mit Steinen und verborgenen Wurzeln, über die man stolpern konnte. Lautlos kletterte Will voran. Hinter sich hörte er das sanfte, metallische Rasseln vom Kettenhemd seines Herrn, das Rascheln der Blätter und unterdrückte Flüche, als lange Äste nach seinem Langschwert griffen und an seinem prachtvollen Zobel zerrten.
Der große Wachbaum stand genau dort oben auf dem Kamm, wo Will ihn in Erinnerung hatte, die untersten Äste kaum einen Fuß über dem Boden. Will schob sich darunter, flach auf dem Bauch durch Schnee und Schlamm, und blickte auf die leere Lichtung unter sich hinab.
Ihm stockte das Herz. Einen Moment lang wagte er nicht zu atmen. Mondlicht schien auf die Lichtung herab, auf die Asche der Feuerstelle, den schneebedeckten Unterstand, den großen Felsen, den kleinen, halb gefrorenen Bach. Alles war genau so, wie er es noch wenige Stunden zuvor verlassen hatte.
Nur war keiner mehr da. Alle Leichen waren verschwunden.
»Bei allen Göttern!«, hörte er hinter sich. Ein Schwert schlug gegen einen Ast, als Ser Weymar Rois den Kamm erklomm. Er stand neben dem Wachbaum, das Langschwert in der Hand, der Umhang wehte in seinem Rücken, da Wind aufkam, edel und im Licht der Sterne für jedermann gut zu sehen.
»Runter!«, flüsterte Will aufgebracht. »Irgendwas stimmt hier nicht.«
Rois rührte sich nicht von der Stelle. Er schaute auf die leere Lichtung hinab und lachte. »Deine Toten scheinen ihr Lager abgebrochen zu haben, Will.«
Wills Stimme versagte ihm den Dienst. Er rang um Worte, die nicht kommen wollten. Es war nicht möglich. Sein Blick ging über das verlassene Lager hin und her, blieb an der Axt hängen. Die riesenhafte Streitaxt mit doppelter Klinge lag noch immer da, wo er sie zuletzt gesehen hatte, unangetastet. Eine wertvolle Waffe …
»Steh auf, Will!«, befahl Ser Weymar. »Da ist niemand. Ich will nicht, dass du dich unter einem Busch versteckst.«
Widerstrebend fügte sich Will.
Ser Weymar musterte ihn mit offener Verachtung. »Ich werde nicht von meinem ersten Streifzug in die Schwarze Festung zurückkehren, ohne einen Erfolg vorweisen zu können.« Er sah sich um. »Auf den Baum. Beeil dich! Such nach einem Feuer.«
Will wandte sich wortlos ab. Es hatte keinen Sinn zu streiten. Der kalte Wind fuhr ihm in die Glieder. Will trat an den Baum, einen gewölbten, graugrünen Wachbaum, und begann zu klettern. Bald schon klebten seine Hände vom Harz, und er hatte sich in den Nadeln verirrt. Wie eine Mahlzeit, die er nicht verdauen konnte, breitete sich Angst in seiner Magengrube aus. Er flüsterte ein Gebet an die namenlosen Götter des Waldes und befreite seinen Dolch aus dessen Scheide. Er klemmte ihn zwischen die Zähne, um beide Hände zum Klettern frei zu haben. Der Geschmack von kaltem Eisen schenkte ihm Trost.
Weit unten rief plötzlich der junge Lord: »Was gibt es da?« Will spürte die Unsicherheit in seiner Stimme. Er hörte auf zu klettern. Er lauschte. Er suchte.
Der Wald gab Antwort: das Rascheln des Laubs, das eisige Rauschen des Baches, der ferne Schrei einer Schneeeule.
Die Anderen machten kein Geräusch.
Aus den Augenwinkeln bemerkte Will eine Bewegung. Fahle Formen glitten durch den Wald. Er wandte den Kopf um, sah einen weißen Schatten in der Dunkelheit. Dann war er wieder verschwunden. Zweige schwankten sanft im Wind. Will öffnete den Mund, um einen Warnruf auszustoßen, doch die Worte erfroren ihm in der Kehle. Vielleicht täuschte er sich. Vielleicht war es nur ein Vogel gewesen, ein Schatten auf dem Schnee, das Mondlicht, das ihn täuschte. Was hatte er denn schon gesehen?
»Will, wo bist du?«, rief Ser Weymar herauf. »Kannst du etwas erkennen?« Langsam drehte er sich um, das Schwert in seiner Hand. Er musste sie gespürt haben, ganz wie Will sie spürte. Es war nichts zu sehen. »Antworte mir! Warum ist es so kalt?«
Es war kalt. Zitternd klammerte sich Will fester an seinen Sitz. Sein Gesicht presste sich hart an den Stamm des Wachbaumes. Er konnte das süße, klebrige Harz an seiner Wange fühlen.
Ein Schatten trat aus dem Dunkel des Waldes. Er blieb direkt vor Rois stehen. Hoch ragte er vor ihm auf, hager und hart wie alte Knochen, mit Haut so weiß wie Milch. Seine Rüstung schien die Farbe zu verändern, wenn er sich bewegte. Hier war er weiß wie frischer Schnee, dort schwarz wie ein Schatten, überall gesprenkelt mit dem dunklen Graugrün der Bäume. Mit jedem Schritt verliefen die Muster wie Mondlicht auf dem Wasser.
Will hörte Ser Weymar Rois mit langem Zischen den Atem ausstoßen. »Kommt nicht näher«, warnte der junge Lord. Seine Stimme überschlug sich wie die eines Kindes. Er warf den langen Zobelmantel über die Schulter, um die Arme für den Kampf frei zu haben, und nahm sein Schwert in beide Hände. Der Wind hatte sich gelegt. Es war sehr kalt.
Mit lautlosen Schritten trat der Andere vor. In seiner Hand hielt er ein Langschwert, wie Will es nie zuvor gesehen hatte. Kein den Menschen bekanntes Metall war zu dieser Klinge geschmiedet worden. Es lebte im Mondlicht, durchscheinend, eine kristallene Scherbe, so dünn, dass sie fast zu verschwinden schien, wenn man sie von der Seite sah. Ein schwacher, blauer Schimmer lag über dieser Waffe, gespenstisches Licht, das ihren Rand umspielte, und irgendwie wusste Will, dass sie schärfer als jedes Barbiermesser war.
Ser Weymar trat ihm tapfer entgegen. »Dann tanzt mit mir.« Herausfordernd hob er sein Schwert hoch über den Kopf. Die Hände zitterten vom Gewicht oder vielleicht auch von der Kälte. Doch in diesem Augenblick, so dachte Will, war er kein Junge mehr, sondern ein Mann der Nachtwache.
Der Andere zögerte. Will sah seine Augen, dunkler und blauer, als Menschenaugen jemals sein konnten, ein Blau, das brannte wie Eis. Sie richteten sich auf das Langschwert, das dort oben bebte, betrachteten das Mondlicht, das kalt über das Metall lief. Einen Herzschlag lang wagte er zu hoffen.
Lautlos traten sie aus der Dunkelheit hervor, Zwillinge des Ersten. Drei von ihnen … vier … fünf … Ser Weymar musste die Kälte gespürt haben, die mit ihnen kam, doch sah er sie nicht, hörte sie nicht mehr. Will hätte schreien müssen. Es war seine Pflicht. Und sein Tod, wenn er es täte. Er zitterte, klammerte sich an den Baum und schwieg.
Das helle Schwert schnitt durch die Luft.
Ser Weymar trat ihm mit Stahl entgegen. Als sich die Klingen trafen, erklang kein Singen von Metall auf Metall, nur ein hoher, dünner Ton, den man kaum hören konnte, wie ein Tier, das vor Schmerzen schrie. Rois hielt einem zweiten Hieb stand und einem dritten, dann wich er einen Schritt zurück. Ein weiteres Blitzen von Hieben, und wieder wich er zurück.
Hinter ihm, rechts von ihm und links, überall um ihn herum, standen schweigend Zuschauer, und die sich wandelnden Muster auf ihren feinen Rüstungen machten sie beinahe unsichtbar im Wald. Dennoch rührten sie sich nicht, um einzugreifen.
Wieder und wieder trafen die Schwerter aufeinander, bis Will sich am liebsten die Ohren zugehalten hätte, um das seltsam gequälte Klagen der Hiebe nicht hören zu müssen. Schon keuchte Ser Weymar von den Mühen, und sein Atem dampfte im Mondlicht. Seine Klinge war weiß vom Frost, doch die des Anderen tanzte mit blassblauem Licht.
Dann kam Rois’ Parade um einen Herzschlag zu spät. Das helle Schwert schnitt unter seinem Arm durchs Kettenhemd. Der junge Lord schrie vor Schmerzen auf. Blut quoll zwischen den Ketten hervor. Es dampfte in der Kälte, und die Tropfen leuchteten rot wie Feuer, als sie in den Schnee tropften. Ser Weymar strich mit der Hand über seine Seite. Als er sie wieder fortnahm, waren seine Hirschlederhandschuhe blutdurchtränkt.
Der Andere sagte etwas in einer Sprache, die Will nicht kannte. Seine Stimme klang wie das Knacken von Eis auf einem winterlichen See, und die Worte waren voller Hohn.
Ser Weymar geriet in Wut. »Für Robert!«, rief er und richtete sich ächzend auf, hob das eisbedeckte Langschwert und schwang es mit seinem ganzen Gewicht in flachem Bogen. Die Parade des Anderen kam beinahe träge.
Als sich die Klingen trafen, zerbarst der Stahl.
Ein Schrei hallte durch den nächtlichen Wald, und das Langschwert sprang in hundert spröde Teile, deren Scherben wie ein Nadelregen niedergingen. Rois fiel auf die Knie, schrie und schützte seine Augen. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor.
Wie ein Mann traten die Zuschauer vor, als hätte jemand ein Zeichen gegeben. Schwerter hoben sich und stießen herab, all das in tödlicher Stille. Es war ein kaltes Schlachten. Die blassen Klingen durchschnitten die Ketten wie Seide. Will schloss die Augen. Weit unter sich hörte er Stimmen und Gelächter, das spitz wie Eiszapfen klang.
Als er den Mut fand, wieder hinzusehen – und es war viel Zeit vergangen –, fand er den Kamm unter sich leer.
Er blieb auf dem Baum, wagte kaum zu atmen, während der Mond langsam über den schwarzen Himmel kroch. Schließlich, als seine Muskeln verkrampften und seine Finger von der Kälte schon taub waren, kletterte er hinunter.
Rois’ Leiche lag bäuchlings im Schnee, den einen Arm von sich gestreckt. Der dicke Zobelmantel war an einem Dutzend Stellen zerschnitten. Als er da so tot im Schnee lag, sah man, wie jung er war. Ein Kind.
Er fand, was von dem Schwert noch übrig war, in einigen Schritten Entfernung, das Ende zersplittert und verdreht wie ein Baum, in den der Blitz geschlagen hatte. Will kniete nieder, sah sich wachsam um und sammelte es auf. Das geborstene Schwert sollte sein Beweis sein. Gared würde es erklären können, und wenn nicht er, dann sicher der Alte Bär Mormont oder Maester Aemon. Ob Gared noch bei den Pferden wartete? Er musste sich beeilen.
Will erhob sich. Ser Weymar ragte über ihm auf.
Seine feinen Kleider waren zerfetzt, das Gesicht eine Ruine. Eine Scherbe seines Schwertes steckte in der blinden weißen Pupille seines linken Auges.
Das rechte Auge stand offen. Die Pupille brannte blau. Sie sah.
Das zerbrochene Schwert glitt aus kraftlosen Fingern. Will schloss die Augen, um zu beten. Lange, anmutige Hände strichen über seine Wange, dann schlossen sie sich um seinen Hals. Sie waren in feinstes Hirschleder gehüllt und von Blut verklebt, aber dennoch waren sie kalt wie Eis.
BRAN
Kalt und klar hatte der Tag gedämmert, mit einer Frische, die vom Ende des Sommers kündete. Sie brachen im Morgengrauen auf, zwanzig insgesamt, um der Enthauptung eines Mannes beizuwohnen, und Bran ritt unter ihnen, ganz nervös vor Aufregung. Es war das erste Mal, dass man ihn für alt genug erachtete, mit seinem Hohen Vater und seinen Brüdern zu gehen und zu sehen, wie das Recht des Königs vollstreckt wurde. Es war das neunte Jahr des Sommers und das siebte in Brans Leben.
Man hatte den Mann vor eine kleine Festung in den Bergen geführt. Robb hielt ihn für einen Wildling, der mit seinem Schwert einen Eid auf Manke Reuber, den König-jenseits-der-Mauer, abgelegt hatte. Beim bloßen Gedanken daran bekam Bran eine Gänsehaut. Er erinnerte sich an die Geschichten, die die Alte Nan ihnen am Ofen erzählt hatte. Die Wildlinge seien grausame Männer, so sagte sie, Sklavenhändler und Mörder und Diebe. Sie verkehrten mit Riesen und Ghulen, entführten kleine Mädchen mitten in der Nacht und tranken Blut aus polierten Hörnern. Und ihre Frauen teilten in der Langen Nacht die Betten mit den Anderen, um schreckliche, halbmenschliche Kinder zu zeugen.
Doch der Mann, der dort mit Händen und Füßen an die Mauer der Festung gefesselt das Recht des Königs erwartete, war alt und knochig, nicht viel größer als Robb. Er hatte beide Ohren und einen Finger an den Frost verloren und war ganz in Schwarz gekleidet wie ein Bruder der Nachtwache, nur dass seine Kleider zerlumpt und dreckig waren.
Der Atem von Mann und Pferd vermischte sich, dampfte in der kalten Morgenluft, als sein Hoher Vater den Mann von der Mauer lösen und zu ihnen bringen ließ. Robb und Jon saßen aufrecht und regungslos auf ihren Pferden, dazwischen auf seinem Pony Bran, der sich Mühe gab, älter als sieben zu wirken, und so tat, als hätte er das alles schon einmal gesehen. Leiser Wind ging durch das Tor der Festung. Über ihren Köpfen flatterte das Banner der Starks von Winterfell: ein grauer Schattenwolf, der über ein eisweißes Feld hetzt.
Brans Vater saß feierlich auf seinem Pferd, das lange braune Haar wehte leicht im Wind. Mit dem gestutzten Bart wirkte er älter als die fünfunddreißig Jahre, die er zählte. Etwas Grimmiges lag an diesem Tag um seine grauen Augen, und er wirkte ganz und gar nicht wie der Mann, der abends am Feuer saß und mit sanfter Stimme vom Zeitalter der Helden und den Kindern des Waldes erzählte. Er hatte sein väterliches Gesicht abgenommen, so dachte Bran, und das Gesicht des Lord Stark von Winterfell aufgesetzt.
Es wurden Fragen gestellt und Antworten gegeben, dort in der kalten Morgenluft, doch konnte sich Bran später nicht an vieles von dem erinnern, was gesagt worden war. Schließlich gab sein Hoher Vater das Kommando, und zwei seiner Gardisten schleppten den zerlumpten Mann zu dem Eisenbaumstumpf in der Mitte des Platzes. Sie zwangen seinen Kopf auf das harte, schwarze Holz. Lord Eddard Stark stieg ab, und sein Mündel Theon Graufreud holte das Schwert hervor. »Eis« wurde dieses Schwert genannt. Es war so breit wie eine Männerhand und größer noch als Robb. Die Klinge war aus valyrischem Stahl, mit Zauberkraft geschmiedet und schwarz wie Rauch. Nichts war so scharf wie valyrischer Stahl.
Sein Vater schälte die Handschuhe von den Händen und reichte sie Jory Cassel, dem Hauptmann seiner Leibgarde. Er packte Eis mit beiden Händen und sagte: »Im Namen Roberts aus dem Hause Baratheon, des Ersten seines Namens, König der Andalen und der Rhoynar und der Ersten Menschen, Herr der Sieben Königslande und Protektor des Reiches, durch das Wort Eddards aus dem Hause der Stark, Lord von Winterfell und Wächter des Nordens, verurteile ich dich zum Tode.« Er hob das Großschwert hoch über seinen Kopf.
Brans Halbbruder Jon Schnee kam näher heran. »Halt dein Pony gut fest«, flüsterte er. »Und wende dich nicht ab. Vater wird merken, wenn du es tust.«
Bran hielt sein Pony gut fest und wandte sich nicht ab.
Mit einem einzigen festen Hieb schlug sein Vater den Kopf des Mannes ab. Blut spritzte über den Schnee, rot wie Sommerwein. Eines der Pferde bäumte sich auf und wäre fast durchgegangen. Bran konnte seine Augen nicht vom Blut lösen. Gierig sog es der Schnee um den Stumpf auf und färbte sich rot.
Der Kopf prallte von einer dicken Wurzel ab und rollte davon. Fast kam er bis zu Graufreuds Füßen. Theon war ein schlanker, dunkler Jüngling von neunzehn Jahren, der alles amüsant fand. Er lachte, setzte seinen Fuß an den Kopf und stieß ihn von sich.
»Esel«, murmelte Jon so leise, dass Graufreud es nicht hören konnte. Er legte Bran eine Hand auf die Schulter, und Bran sah seinen Halbbruder an. »Gut gemacht«, erklärte Jon feierlich. Jon war vierzehn, ein alter Hase, was Recht und Gesetz anging.
Auf dem langen Weg zurück nach Winterfell schien es noch kälter geworden zu sein, obwohl sich der Wind inzwischen gelegt hatte und die Sonne hoch am Himmel stand. Bran ritt mit seinen Brüdern weit vor der Gesellschaft, und sein Pony hatte alle Mühe, mit den Pferden der anderen mitzuhalten.
»Der Deserteur ist tapfer gestorben«, befand Robb. Er war groß und breit und wurde jeden Tag noch größer, besaß die Farbe seiner Mutter, die helle Haut, rotbraunes Haar und die blauen Augen der Tullys von Schnellwasser. »Wenigstens hatte er Mut.«
»Nein«, erwiderte Jon Schnee leise. »Es war kein Mut. Er ist voller Furcht gestorben. Das konnte man seinen Augen ansehen, Stark.« Jons Augen waren grau, dunkelgrau, fast schwarz, doch ihnen entging nur wenig. Er war im gleichen Alter wie Robb, doch sie sahen sich überhaupt nicht ähnlich. Wo Robb muskulös war, war Jon schlank, wo Robb hell war, Jon dunkel, und wo sein Halbbruder stark und schnell war, zeigte Jon Grazie und Behändigkeit.
Robb blieb unbeeindruckt. »Sollen sich die Anderen seine Augen holen«, fluchte er. »Er ist gut gestorben. Um die Wette bis zur Brücke?«
»Gemacht«, sagte Jon und trat sein Pferd in die Flanken. Robb fluchte und folgte ihm, und so galoppierten sie den Pfad hinab, Robb lachend und johlend, Jon still und konzentriert. Die Hufe der Pferde warfen Mengen von Schnee auf.
Bran versuchte nicht, ihnen zu folgen. Sein Pony konnte nicht mithalten. Die Augen des zerlumpten Mannes kamen ihm wieder in den Sinn. Nach einer Weile war Robbs Lachen verklungen, und im Wald kehrte wieder Stille ein.
So tief war er in Gedanken versunken, dass er den Rest der Gesellschaft gar nicht hörte, bis sein Vater schon neben ihm ritt. »Geht es dir gut, Bran?«, fragte er nicht unfreundlich.
»Ja, Vater«, erklärte Bran. Er blickte hoch. In Fell und Leder gewickelt, hoch auf seinem großen Streitross, ragte sein Vater wie ein Riese über ihm auf. »Robb sagt, der Mann sei tapfer gestorben, aber Jon sagt, er hätte sich gefürchtet.«
»Was glaubst du?«, fragte sein Vater.
Bran dachte darüber nach. »Kann ein Mann tapfer sein, auch wenn er sich fürchtet?«
»Das ist der einzige Moment, in dem er tapfer sein kann«, erklärte ihm sein Vater. »Verstehst du, warum ich es getan habe?«
»Er war ein Wildling«, sagte Bran. »Sie verschleppen Frauen und verkaufen sie den Anderen.«
Sein Hoher Vater lächelte. »Die Alte Nan hat euch wieder Geschichten erzählt. In Wahrheit war der Mann ein Eidbrüchiger, ein Deserteur aus der Nachtwache. Niemand ist gefährlicher. Der Deserteur weiß, dass sein Leben verwirkt ist, wenn er gefasst wird, daher wird er vor keinem Verbrechen zurückschrecken, so schändlich es auch sein mag. Doch du missverstehst mich. Die Frage ist nicht, warum der Mann sterben musste, sondern warum ich es tun musste.«
Darauf wusste Bran keine Antwort. »König Robert hat einen Henker«, sagte er unsicher.
»Das stimmt«, bestätigte sein Vater. »Wie alle Könige der Targaryen vor ihm. Doch unsere Tradition ist die ältere. Das Blut der Ersten Menschen fließt noch heute in den Adern der Starks, und wir halten an dem Glauben fest, dass ein Mann, der ein Urteil spricht, auch selbst das Schwert führen soll. Wenn du jemandem das Leben nehmen willst, bist du es ihm schuldig, ihm in die Augen zu blicken und seine letzten Worte zu hören. Wenn du es nicht ertragen kannst, dann verdient der Mann vielleicht auch nicht den Tod.
Eines Tages, Bran, wirst du Robbs Vasall sein und selbst ein Lehen von deinem Bruder und deinem König erhalten, dann wird es an dir sein, Recht zu sprechen. Wenn dieser Tag kommt, darfst du keine Freude an dieser Aufgabe empfinden, doch darfst du dich auch nicht abwenden. Ein Herrscher, der sich hinter bezahlten Henkern versteckt, vergisst bald, was der Tod bedeutet.«
Das war der Moment, in dem Jon wieder auf der Kuppe des Hügels vor ihnen erschien. Er winkte und rief ihnen zu: »Vater, Bran, kommt schnell und seht, was Robb gefunden hat!« Dann war er erneut verschwunden.
Jory schloss zu ihnen auf. »Ärger, Mylord?«
»Zweifellos«, sagte sein Hoher Vater. »Kommt, sehen wir mal, welches Unheil meine Söhne diesmal ausgegraben haben.« Er setzte sein Pferd in Trab. Jory und Bran und alle anderen folgten ihm.
Sie fanden Robb am Flussufer nördlich der Brücke, und neben ihm saß Jon noch immer zu Pferd. Beim letzten Neumond dieses Spätsommers hatte es heftig geschneit. Robb stand knietief im Weiß, die Kapuze vom Kopf geschoben, sodass die Sonne sein Haar leuchten ließ. Er wiegte etwas im Arm, auf das die Jungen beschwichtigend einredeten.
Die Reiter suchten sich sorgsam einen Weg durch die Schneewehen, ließen die Pferde auf der verhüllten, unebenen Erde nach festem Tritt suchen. Jory Cassel und Theon Graufreud waren als Erste bei den Jungen. Graufreud lachte und scherzte. Bran hörte ihn aufstöhnen. »Bei allen Göttern!«, rief er und kämpfte darum, sein Pferd im Zaum zu halten, während er nach seinem Schwert griff.
Jory hatte das Schwert schon gezückt. »Zurück, Robb!«, rief er, als sich sein Pferd unter ihm aufbäumte.
Robb grinste und blickte von dem Bündel in seinen Armen auf. »Sie kann dir nichts tun«, sagte er. »Sie ist tot, Jory.«
Inzwischen brannte Bran vor Neugier. Er hätte seinem Pony die Sporen gegeben, doch sein Vater ließ sie neben der Brücke absteigen und zu Fuß weitergehen. Bran sprang ab und rannte.
Nun waren auch Jon, Jory und Theon Graufreud abgestiegen. »Was bei allen Sieben Höllen ist das?«, fragte Graufreud.
»Ein Wolf«, erklärte Robb.
»Eine Missgeburt«, sagte Graufreud. »Seht euch nur an, wie groß er ist.«
Brans Herz schlug laut in seiner Brust, als er durch den hüfthohen Schnee an die Seite seines Bruders eilte.
Halb unter blutigem Schnee verborgen lag eine riesenhafte dunkle Gestalt im Tod zusammengesunken. Eis hatte sich in ihrem zottigen Fell gebildet, und ein schwacher Geruch von Verwesung hing daran wie das Duftwasser einer Frau. Bran sah blinde Augen, aus denen Maden krochen, ein großes Maul voll gelber Zähne. Doch war es die Größe, die seinen Atem stocken ließ. Der Wolf war größer als sein Pony, doppelt so groß wie der größte Jagdhund in der Meute seines Vaters.
»Das ist keine Missgeburt«, sagte Jon ganz ruhig. »Es ist ein Schattenwolf. Sie werden größer als jede andere Rasse.«
Theon Graufreud sagte: »Seit zweihundert Jahren hat man keinen Schattenwolf mehr südlich der Mauer gesehen.«
»Jetzt sehe ich einen«, erwiderte Jon.
Bran riss seinen Blick von dem Monstrum los. Da bemerkte er das Bündel in Robbs Armen. Er stieß einen Freudenschrei aus und trat näher. Das Wolfsjunge war ein winziges Knäuel aus grauschwarzem Fell, die Augen noch geschlossen. Blindlings schmiegte es sich an Robbs Brust, während der es wiegte, und auf der Suche nach Milch gab es ein leises Wimmern von sich. Zögerlich streckte Bran eine Hand aus. »Mach nur«, erklärte ihm Robb. »Fass ihn ruhig an.«
Bran streichelte das Wolfsjunge kurz und voller Aufregung, dann wandte er sich um, als Jon sagte: »Hier, für dich.« Sein Halbbruder legte ihm ein weiteres Junges in den Arm. »Wir haben fünf davon.« Bran setzte sich in den Schnee und hielt das Tier an sein Gesicht. Sein Fell fühlte sich weich und warm an seiner Wange an.
»Schattenwölfe streunen nach so vielen Jahren durch das Reich«, murmelte Hullen, der Stallmeister. »Das gefällt mir nicht.«
»Es ist ein Zeichen«, sagte Jory.
Vater sah ihn fragend an. »Es ist nur ein totes Tier, Jory«, sagte er. Dennoch schien es ihm Sorge zu bereiten. Schnee knirschte unter seinen Stiefeln, als er den Kadaver umdrehte. »Wissen wir, woran die Wölfin gestorben ist?«
»Da ist etwas in ihrem Hals«, erklärte Robb stolz, weil er die Antwort wusste, bevor sein Vater auch nur danach gefragt hatte. »Da, gleich unter dem Unterkiefer.«
Sein Vater kniete nieder und suchte mit der Hand unter dem Kopf der Wölfin. Er riss etwas los und hielt es hoch, damit alle es sehen konnten. Die Spitze eines zerbrochenen Geweihs, die Sprossen gesplittert, blutbeschmiert.
Plötzlich legte sich ein Schweigen über die Gesellschaft. Voller Sorge betrachteten die Männer das Geweih, und niemand wagte, etwas zu sagen. Selbst Bran konnte ihre Angst spüren, wenn er sie auch nicht verstand.
Sein Vater warf das Geweih beiseite und wusch seine Hände im Schnee. »Es überrascht mich, dass sie noch lange genug gelebt hat, um werfen zu können«, sagte er. Seine Stimme brach den Bann.
»Vielleicht war es nicht so«, sagte Jory. »Ich habe Geschichten gehört … vielleicht war die Wölfin schon tot, als die Welpen kamen.«
»Im Tod geboren«, warf ein anderer ein. »Noch größeres Unglück.«
»Wie dem auch sei«, sagte Hullen. »Die werden auch bald tot sein.«
Bran stieß einen wortlosen Schrei des Entsetzens aus.
»Je eher, desto besser«, stimmte Theon Graufreud zu. Er zückte sein Schwert. »Gib mir das Tier, Bran.«
Das kleine Ding wand sich an seiner Brust, als höre und verstehe es. »Nein!«, schrie Bran grimmig auf. »Es ist meins.«
»Steckt Euer Schwert weg, Graufreud«, sagte Robb. Einen Moment lang klang er gebieterisch wie sein Vater, wie der Lord, der er eines Tages sein würde. »Wir werden diese Welpen behalten.«
»Das kannst du nicht tun, Junge«, sagte Harwin, der Hullens Sohn war.
»Es wäre eine Gnade, sie zu töten«, warf Hullen ein.
Bran sah seinen Hohen Vater Hilfe suchend an, erntete jedoch nur einen fragenden Blick, ein Stirnrunzeln. »Hullen spricht recht, mein Sohn. Besser ein schneller Tod als ein schwerer durch Kälte und Hunger.«
»Nein!« Er fühlte, wie Tränen in seine Augen traten, und wandte sich ab. Vor seinem Vater wollte er nicht weinen.
Robb weigerte sich standhaft. »Ser Rodriks rote Hündin hat letzte Woche wieder geworfen«, sagte er. »Es war ein kleiner Wurf, nur zwei lebende Welpen. Sie müsste Milch genug haben.«
»Sie wird die Kleinen in Stücke reißen, wenn sie trinken wollen.«
»Lord Stark«, sagte Jon. Es war seltsam zu hören, wie er seinen Vater so ansprach, so förmlich. Von verzweifelter Hoffnung erfüllt, sah Bran ihn an. »Wir haben fünf Welpen«, erklärte er dem Vater. »Drei männlich, zwei weiblich.«
»Was ist damit, Jon?«
»Ihr habt fünf eheliche Kinder», sagte Jon. »Drei Söhne, zwei Töchter. Der Schattenwolf ist das Wahrzeichen Eures Hauses. Diese Welpen sind für Eure Kinder bestimmt, Mylord.«
Bran sah, wie sich die Miene seines Vaters wandelte und die anderen Männer einander Blicke zuwarfen. In diesem Augenblick liebte er Jon von ganzem Herzen. Trotz seiner sieben Jahre verstand Bran, was sein Bruder eben getan hatte. Die Rechnung stimmte nur deshalb, weil Jon sich ausgenommen hatte. Er hatte die Mädchen mitgerechnet, selbst Rickon, den Kleinsten, nur nicht den Bastard, der den Nachnamen »Schnee» trug, jenen Namen, den der Sitte nach all jene im Norden bekamen, die das Unglück hatten, nicht mit eigenem Namen geboren zu sein.
Auch ihr Vater verstand. »Du willst keinen Welpen für dich, Jon?«, fragte er leise.
»Der Schattenwolf ziert das Banner des Hauses Stark«, erklärte Jon. »Ich bin kein Stark, Vater.«
Ihr Hoher Vater betrachtete ihn nachdenklich. Robb beeilte sich, die Stille zu durchbrechen. »Ich will ihn selbst füttern, Vater«, versprach er. »Ich werde ein Handtuch mit warmer Milch tränken und ihn daran nuckeln lassen.«
»Ich auch!«, plapperte Bran ihm nach.
Eindringlich musterte der Lord seine Söhne. »Leichter gesagt als getan. Ich werde nicht zulassen, dass ihr die Zeit der Diener damit vergeudet. Wenn ihr diese Welpen wollt, werdet ihr sie selbst füttern. Habt ihr verstanden?«
Bran nickte eifrig. Das Wolfsjunge krümmte sich in seinem Griff, leckte ihm mit warmer Zunge über das Gesicht.
»Außerdem müsst ihr sie abrichten«, sagte ihr Vater. »Ihr müsst sie abrichten. Der Hundeführer wird sich mit diesen Ungeheuern nicht befassen, das verspreche ich euch. Und mögen euch die Götter beistehen, wenn ihr sie vernachlässigt, sie quält oder schlecht abrichtet. Das hier sind keine Hunde, die betteln und bei einem Tritt den Schwanz einziehen. Ein Schattenwolf kann einem Menschen den Arm aus der Schulter reißen, so leicht wie ein Hund eine Ratte tötet. Seid ihr sicher, dass ihr sie wollt?«
»Ja, Vater«, sagte Bran.
»Ja«, willigte Robb ein.
»Vielleicht sterben die Welpen trotz alledem.«
»Sie werden nicht sterben«, sagte Robb. »Wir werden sie nicht sterben lassen.«
»Dann behaltet sie. Jory, Desmond, sammelt die restlichen Welpen ein. Es wird Zeit für die Rückkehr nach Winterfell.«
Erst als sie aufgestiegen und wieder unterwegs waren, gestattete sich Bran, den süßen Duft des Sieges einzuatmen. Mittlerweile hatte sich der Welpe an sein Leder geschmiegt, drückte sich warm an ihn, geborgen für den langen Heimweg. Bran überlegte, wie er ihn nennen sollte.
Auf halbem Weg über die Brücke hielt Jon plötzlich an.
»Was ist, Jon?«, fragte ihr Hoher Vater.
»Könnt Ihr es nicht hören?«
Bran hörte den Wind in den Bäumen, das Klappern ihrer Hufe auf Planken aus Eisenholz, das Jaulen seines hungrigen Welpen, doch Jon lauschte nach etwas anderem.
»Da«, sagte Jon. Er riss sein Pferd herum und galoppierte über die Brücke. Sie sahen, wie er abstieg, wo der tote Schattenwolf im Schnee lag, und niederkniete. Einen Augenblick später kam er lächelnd zurückgeritten.
»Er muss von den anderen fortgekrochen sein«, sagte Jon.
»Oder er wurde vertrieben«, sagte ihr Vater mit einem Blick auf den sechsten Welpen. Dessen Augen waren rot wie das Blut des zerlumpten Mannes, der am Morgen gestorben war. Bran fand es merkwürdig, dass allein dieser Welpe die Augen geöffnet hatte, während die anderen noch blind waren.
»Ein Albino«, sagte Theon Graufreud mit gequältem Vergnügen. »Der hier wird noch schneller sterben als die anderen.«
Jon Schnee warf dem Mündel seines Vaters einen langen, kalten Blick zu. »Das glaube ich kaum, Graufreud«, sagte er. »Der hier gehört mir.«
CATELYN
Catelyn hatte diesen Götterhain noch nie gemocht.
Sie war eine geborene Tully aus Schnellwasser weit im Süden, am Roten Arm des Trident. Im Götterhain dort gab es einen Garten, hell und luftig, in dem hohe Mammutbäume ihre Schatten über singende Bäche warfen, Vögel in verborgenen Nestern zwitscherten und die Luft von Blumenduft erfüllt war.
Die Götter von Winterfell hielten sich andere Bäume. Es war ein dunkler, urweltlicher Ort, drei Morgen von altem Wald, zehntausend Jahre unberührt, als die finstere Burg darum entstand. Es roch nach feuchter Erde und Fäulnis. Hier wuchsen keine Mammutbäume. Es war ein Wald aus unbeugsamen Wachbäumen, die mit graugrünen Nadeln bewaffnet waren, aus mächtigen Eichen, aus Eisenholz, so alt wie das Reich selbst. Die dicken, schwarzen Stämme standen eng zusammen, während krumme Äste ein festes Dach bildeten und unförmige Wurzeln unter der Erde miteinander rangen. Es war ein Ort tiefer Stille und drückender Schatten, und die Götter, die hier lebten, hatten keine Namen.
Doch wusste sie, dass sie ihren Mann hier heute Abend finden würde. Immer wenn er jemandem das Leben nahm, suchte er danach die Stille des Götterhaines.
Catelyn war mit den Sieben Ölen gesalbt und hatte ihren Namen im Regenbogen aus Licht bekommen, der die Septe von Schnellwasser erfüllte. Sie hing dem Glauben an, wie ihr Vater und Großvater und auch dessen Vater vor ihr. Ihre Götter hatten Namen, und ihre Gesichter waren ihr so vertraut wie die ihrer Eltern. Götterdienst war ihr ein Septon, der Duft von Weihrauch, ein siebenseitiger Kristall, in dem das Licht spielte, Stimmen, die ein Lied sangen. Die Tullys hielten sich – wie alle großen Häuser – einen Götterhain, doch war dieser nur ein Ort, an dem man schlendern oder lesen oder in der Sonne liegen konnte. Götterdienst gehörte in die Septe.
Ihretwegen hatte Ned eine kleine Septe gebaut, in der sie für die Sieben Gesichter Gottes singen konnte, doch in den Adern der Starks floss noch das Blut der Ersten Menschen, und seine Götter waren die alten, die namenlosen, gesichtslosen Götter des Grünen Waldes, den sie mit den verschwundenen Kindern des Waldes teilten.
In der Mitte des Hains ragte ein uralter Wehrholzbaum über einem kleinen Teich auf, in dem das Wasser schwarz und kalt war. »Der Herzbaum«, wie Ned ihn nannte. Die Borke des Wehrholzbaums war weiß wie Knochen, seine Blätter waren dunkelrot wie tausend blutverschmierte Hände. In den Stamm des großen Baumes war ein Gesicht geschnitzt, dessen Züge lang und melancholisch waren, die tief liegenden Augen rot vom getrockneten Harz und merkwürdig wachsam. Sie waren alt, diese Augen, älter selbst als Winterfell. Sie hatten gesehen, wie Brandon, der Erbauer, den ersten Stein gesetzt hatte, falls die Geschichten stimmten. Sie hatten gesehen, wie die Granitmauern der Burg um sie herum gewachsen waren. Es hieß, die Kinder des Waldes hätten die Gesichter während der frühen Jahrhunderte in die Bäume geschnitzt, noch bevor die Ersten Menschen die Meerenge überquert hatten.
Im Süden waren die letzten Wehrholzbäume schon vor tausend Jahren geschlagen oder niedergebrannt worden, nur nicht auf der Insel der Gesichter, wo die grünen Männer ihre stille Wacht hielten. Hier oben war es anders. Hier hatte jede Burg ihren Götterhain, jeder Götterhain hatte seinen Herzbaum und jeder Herzbaum sein Gesicht.
Catelyn fand ihren Gatten unter dem Wehrholzbaum auf einem moosbedeckten Stein sitzen. Das Großschwert Eis lag auf seinem Schoß, und er reinigte die Klinge in diesem Wasser, das so schwarz war wie die Nacht. Tausend Jahre Humus bedeckten den Boden des Götterhains, schluckten die Schritte ihrer nackten Füße, doch die roten Augen des Wehrholzbaums schienen ihr zu folgen, als sie näher kam. »Ned«, rief sie ihn leise.
Er hob den Kopf, um sie anzusehen. »Catelyn«, sagte er. Seine Stimme klang kühl und förmlich. »Wo sind die Kinder?«
Immer fragte er sie das. »In der Küche. Sie streiten um die Namen für die Wolfswelpen.« Dabei breitete sie ihren Umhang auf dem Waldboden aus und setzte sich an den Teich, mit dem Rücken zum Wehrholzbaum. Sie spürte die Augen, die sie beobachteten, doch gab sie sich alle Mühe, nicht auf sie zu achten. »Arya ist schon verliebt, Sansa ist entzückt und dankbar, nur Rickon ist sich noch nicht ganz sicher.«
»Fürchtet er sich?«, fragte Ned.
»Ein wenig«, räumte sie ein. »Er ist doch erst drei.«
Ned legte die Stirn in Falten. »Er muss lernen, sich seiner Angst zu stellen. Er wird nicht ewig drei sein. Und der Winter naht.«
»Ja«, gab Catelyn ihm Recht. Die Worte ließen sie erschauern, wie sie es stets taten. Der Sinnspruch der Starks. Jedes Adelsgeschlecht hatte seinen Sinnspruch. Familienmottos, Prüfsteine, allerlei Gebete, die mit Ehre und Ruhm prahlten, Loyalität und Wahrheitsliebe versprachen, Treue und Mut schworen. Nicht so die Starks. Der Winter naht lauteten die Worte der Starks. Nicht zum ersten Mal dachte sie, welch seltsame Menschen diese Nordmänner doch waren.
»Der Mann ist gut gestorben, das muss ich ihm lassen«, sagte Ned. Er hielt einen Streifen öligen Leders in einer Hand. Beim Sprechen wischte er leicht an seinem Großschwert entlang, polierte das Metall zu dunklem Glanz. »Um Brans willen war ich froh. Ihr wäret stolz auf Bran gewesen.«
»Ich bin immer stolz auf Bran«, erwiderte Catelyn und betrachtete das Schwert, während er es putzte. Sie konnte die Maserung tief im Stahl erkennen, wo das Metall beim Schmieden hundert Mal gefaltet worden war. Catelyn hatte für Schwerter nichts übrig, doch konnte sie nicht abstreiten, dass Eis eine ganz eigene Schönheit besaß. Es war in Valyria geschmiedet worden, vor dem Untergang des alten Freistaates, als die Schmiede ihr Metall ebenso mit Zauberei wie mit dem Hammer bearbeiteten. Vierhundert Jahre war es alt und scharf wie an dem Tag, als es geschmiedet worden war. Der Name, den es trug, war noch weit älter, ein Erbe aus der Zeit der Helden, als die Starks Könige des Nordens waren.
»Er war der Vierte in diesem Jahr«, sagte Ned grimmig. »Der arme Mann war halb verrückt. Irgendetwas hat ihn derart in Angst und Schrecken versetzt, dass ich ihn mit Worten nicht erreichen konnte.« Er seufzte. »Ben schreibt, die Stärke der Nachtwache sei auf unter tausend Mann gefallen. Es sind nicht nur die Deserteure. Sie verlieren auch Männer auf den Patrouillen.«
»Sind es die Wildlinge?«, fragte sie.
»Wer sonst?« Ned hob Eis an, blickte am kühlen Stahl entlang. »Und es wird noch schlimmer werden. Es könnte der Tag kommen, an dem ich keine andere Wahl habe, als zu den Fahnen zu rufen und gen Norden zu reiten, um ein für alle Mal mit diesem König-jenseits-der-Mauer aufzuräumen.«
»Jenseits der Mauer?« Der Gedanke ließ Catelyn erschauern.
Ned sah das Grauen auf ihrem Gesicht. »Von Manke Reuber haben wir nichts zu befürchten.«
»Es gibt finsterere Dinge jenseits der Mauer.« Sie drehte sich dem Herzbaum zu, der fahlen Rinde und dem roten Gesicht, das dort schaute, lauschte und seine langen, langsamen Gedanken dachte.
Ned lächelte milde. »Ihr hört der Alten Nan zu oft bei ihren Märchen zu. Die Anderen sind tot wie die Kinder des Waldes, achttausend Jahre schon. Maester Luwin wird Euch erklären, dass sie nie gelebt haben. Kein Lebender hat je einen von ihnen gesehen.«
»Bis heute Morgen hatte auch kein Lebender je einen Schattenwolf gesehen«, erinnerte ihn Catelyn.
»Ich sollte klug genug sein, nicht mit einer Tully zu streiten«, sagte er mit reuigem Lächeln. Er schob Eis in die Scheide zurück. »Doch Ihr seid nicht gekommen, um mir Ammenmärchen zu erzählen. Ich weiß, wie sehr Ihr diesen Ort sonst meidet. Was gibt es, Mylady?«
Catelyn nahm ihres Gatten Hand. »Heute kam traurige Nachricht, Mylord. Ich wollte Euch nicht behelligen, bevor Ihr Euch gereinigt hattet.« Es gab keine Möglichkeit, den Schlag zu mildern, daher sagte sie es rundheraus. »Es tut mir so leid, Geliebter. Jon Arryn ist tot.«
Seine Augen suchten sie, und sie konnte sehen, wie hart es ihn traf, ganz wie sie es gewusst hatte. In seiner Jugend war Ned auf Hohenehr großgezogen worden, und der kinderlose Lord Arryn war ihm und seinem Mitmündel Robert Baratheon ein zweiter Vater geworden. Als der Irre König, Aerys II. Targaryen, ihre Köpfe forderte, hatte der Lord von Hohenehr lieber seine Banner mit Mond und Falke zur Rebellion aufgenommen, als jene aufzugeben, die zu schützen er geschworen hatte.
Und eines Tages vor fünfzehn Jahren war sein zweiter Vater ihm auch noch zum Bruder geworden, als er und Ned gemeinsam in der Septe von Schnellwasser standen, um zwei Schwestern zu ehelichen, die Töchter des Lord Hoster Tully.
»Jon …«, sagte er. »Ist dieser Nachricht zu vertrauen?«
»Es war das Siegel des Königs, und der Brief ist in Roberts eigener Handschrift verfasst. Er sagte, es habe Lord Arryn schnell dahingerafft. Selbst Großmaester Pycelle sei hilflos gewesen, aber er habe ihm Mohnblumensaft gebracht, sodass Jon nicht lange leiden musste.«
»Das ist nur ein kleiner Trost«, sagte er. Sie konnte den Schmerz auf seinem Gesicht sehen, doch selbst jetzt dachte er zuerst an sie. »Deine Schwester«, sagte er. »Und Jons Junge. Hast du von ihnen gehört?«
»Die Nachricht besagt nur, es gehe ihnen gut und sie seien wieder auf Hohenehr«, antwortete Catelyn. »Ich wünschte, sie wären nach Schnellwasser gegangen. Die Ehr liegt hoch und einsam, und schon immer war ihr Mann dort zu Hause, nicht sie. Jeder Stein wird sie an Lord Jon erinnern. Ich kenne meine Schwester. Sie braucht den Trost von Familie und Freunden.«
»Ihr Onkel erwartet sie im Grünen Tal, oder nicht? Wie ich gehört habe, hat Jon ihn zum Ritter der Pforte gemacht.«
Catelyn nickte. »Brynden wird alles für sie tun, was in seiner Macht steht, und auch für den Jungen. Das ist tröstlich, dennoch …«
»Geht zu ihr«, drängte Ned. »Nehmt die Kinder mit. Erfüllt ihre Säle mit Lärm und Geschrei und Gelächter. Ihr Junge braucht andere Kinder um sich, und Lysa sollte in ihrem Schmerz nicht allein sein.«
»Wenn ich nur könnte«, erwiderte Catelyn. »Der Brief enthielt noch andere Kunde. Der König kommt nach Winterfell, um Euch einen Besuch abzustatten.«
Es dauerte einen Moment, bis Ned ihre Worte begriff, doch als er sie dann verstand, verloren seine Augen ihre Düsternis. »Robert kommt hierher?« Als sie nickte, breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus.
Catelyn wünschte, sie hätte seine Freude teilen können. Doch hatte sie gehört, was man auf den Burghöfen tuschelte: ein toter Schattenwolf im Schnee, mit einem gebrochenen Geweih in der Kehle. Angst rollte sich wie eine Schlange in ihr zusammen, doch zwang sie sich, diesen Mann anzulächeln, den sie liebte und der nicht an Vorzeichen glaubte. »Ich wusste, dass es dir gefallen würde«, sagte sie. »Wir sollten deinem Bruder auf der Mauer Nachricht geben.«
»Ja, natürlich«, stimmte er zu. »Ben wird dabei sein wollen. Ich werde Maester Luwin sagen, er soll seinen schnellsten Vogel schicken.« Ned erhob sich und zog sie auf die Beine. »Verdammt noch mal, wie viele Jahre mag es her sein? Und er gibt uns nicht mehr Nachricht als diese? Wie groß ist sein Gefolge, stand es in der Nachricht?«
»Ich denke hundert Ritter mindestens, mit all deren Gefolge, und noch einmal halb so viele freie Ritter. Cersei und die Kinder reisen mit ihnen.«
»Robert wird sich um ihretwillen Zeit lassen«, sagte er. »Das ist mir nur lieb. So bleibt uns mehr Zeit für die Vorbereitungen.«
»Auch die Brüder der Königin gehören dem Gefolge an«, erklärte sie.
Da verzog Ned das Gesicht. Zwischen ihm und der Familie der Königin gab es nur wenig Liebe, wie Catelyn wusste. Die Lennisters von Casterlystein hatten sich Roberts Sache erst spät angeschlossen, als der Sieg schon mehr als sicher war, und das hatte er ihnen nie verziehen. »Nun, wenn der Preis für Roberts Gesellschaft eine Heimsuchung durch die Lennisters ist, dann soll es so sein. Es klingt, als würde Robert die Hälfte seines Hofstaats mitbringen.«
»Wohin der König auch geht, folgt ihm sein Reich doch auf dem Fuße«, sagte sie.
»Es wird schön sein, die Kinder zu sehen. Der Jüngste nuckelte noch an der Brust dieser Lennister, als ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Er muss inzwischen fünf sein.«
»Prinz Tommen ist sieben«, erklärte sie ihm. »Genauso alt wie Bran. Bitte, Ned, hüte deine Zunge. Diese Lennister ist unsere Königin, und man sagt, ihr Stolz wüchse mit jedem Jahr.«
Ned drückte ihre Hand. »Natürlich muss es ein Fest geben, mit Sängern, und Robert wird jagen wollen. Ich werde Jory mit einer Ehrengarde gen Süden schicken, die ihn auf dem Königsweg in Empfang nimmt und hierher eskortiert. Bei den Göttern, wie sollen wir sie nur alle verköstigen? Schon auf dem Weg, sagtet Ihr? Verdammt sei der Mann. Man sollte ihm sein königliches Fell über die Ohren ziehen.«
DAENERYS
Ihr Bruder hielt den Umhang hoch, damit sie ihn betrachten konnte. »Ein Kunstwerk. Fass ihn an. Mach nur. Streich über diesen Stoff.«
Dany berührte ihn. Der Stoff war so weich, dass er wie Wasser durch ihre Finger zu rinnen schien. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals etwas derart Weiches getragen zu haben. Es machte ihr Angst. Sie zog ihre Hand zurück. »Ist er wirklich für mich?«
»Ein Geschenk von Magister Illyrio«, sagte Viserys lächelnd. Heute Abend war ihr Bruder in bester Stimmung. »Die Farbe wird das Veilchenblau in deinen Augen unterstreichen. Und auch Gold sollst du bekommen und Juwelen aller Art. Illyrio hat es versprochen. Heute Abend sollst du wie eine Prinzessin aussehen.«
Eine Prinzessin, dachte Dany. Sie hatte schon vergessen, wie es war. Vielleicht hatte sie es nie wirklich gewusst. »Warum gibt er uns so viel?«, fragte sie. »Was will er von uns?« Seit fast einem halben Jahr nun wohnten sie im Haus des Magisters, aßen seine Speisen, wurden von seinen Dienern umsorgt. Dany war dreizehn, alt genug zu wissen, dass man solche Gaben nur selten ohne Gegenleistung bekam, hier in der Freien Stadt Pentos.
»Illyrio ist kein Narr«, sagte Viserys. Er war ein magerer junger Mann mit fiebrigem Blick in blasslilafarbenen Augen und nervösen Händen. »Der Magister weiß, dass ich meine Freunde nicht vergessen werde, wenn ich meinen Thron erst besteige.«
Dany sagte nichts. Magister Illyrio handelte mit Gewürzen, Edelsteinen und anderen, weniger pikanten Dingen. Wie man hörte, hatte er Freunde in allen Neun Freien Städten und selbst jenseits davon in Vaes Dothrak und den sagenhaften Ländern abseits der Jadesee. Außerdem hörte man, er habe nie einen Freund gehabt, den er nicht mit Freuden für den angemessenen Preis verkauft hätte. Das redeten die Leute auf der Straße, doch war Dany klug genug, ihrem Bruder nicht zu widersprechen, wenn er das Netz seiner Träume wob. Sein Zorn, einmal entfacht, wütete furchtbar. Viserys nannte es »den Drachen wecken«.
Ihr Bruder hängte den Umhang neben die Tür. »Illyrio wird die Sklavinnen schicken, damit sie dich baden. Achte darauf, dass sie den Stallgestank abwaschen. Khal Drogo besitzt eintausend Pferde, aber heute Abend will er etwas anderes besteigen.« Er betrachtete sie eingehend. »Du sitzt noch immer schief da. Richte dich auf.« Mit den Händen schob er ihre Schultern zurück. »Zeig ihnen, dass du eine Frau geworden bist.« Sanft strichen seine Finger über ihre knospenden Brüste und umfassten eine Brustwarze. »Du wirst mich heute Abend nicht enttäuschen. Falls du es doch tust, wird es dir übel bekommen. Du willst den Drachen doch nicht wecken, oder?« Seine Finger kniffen sie schmerzlich fest durch den groben Stoff. »Oder?«, wiederholte er.
»Nein«, gab sie demütig zurück.
Ihr Bruder lächelte. »Gut.« Er strich ihr über das Haar, fast liebevoll. »Wenn man die Geschichte meiner Regentschaft schreibt, süßes Schwesterchen, wird es heißen, sie habe in der heutigen Nacht begonnen.«