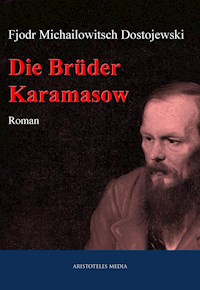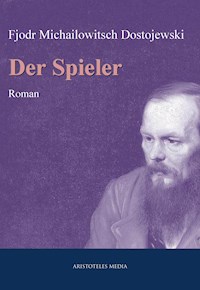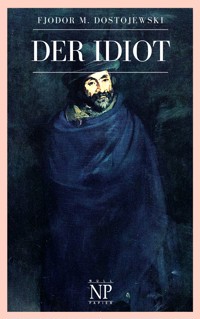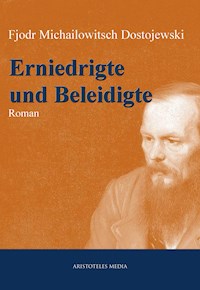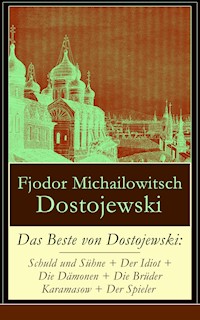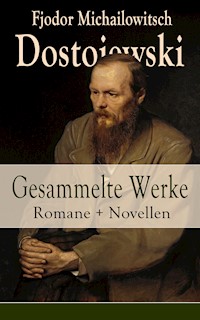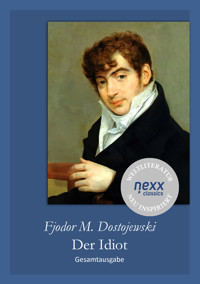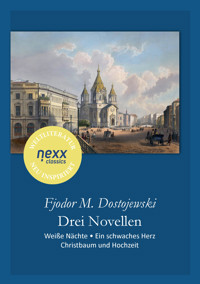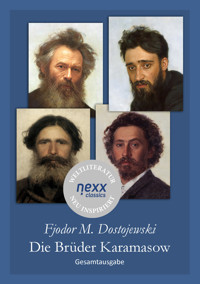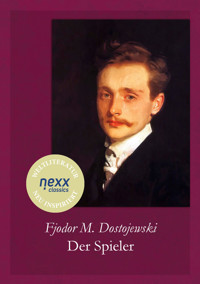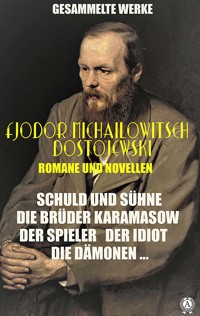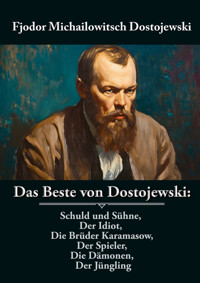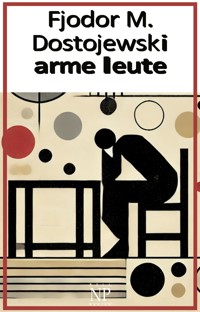
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Der Band beinhaltet die ersten Dichtungen Dostojewskis: den Briefroman der »Armen Leute« und die Petersburger Geschichte, wie Dostojewski sie ausdrücklich nannte, vom »Doppelgänger«. Die eine ist in der Reihenfolge der Werke Dostojewskis mit dem Jahre 1845, die andere mit dem Jahre 1846 verbunden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fjodor M. Dostojewski
Arme Leute & Der Doppelgänger
Fjodor M. Dostojewski
Arme Leute & Der Doppelgänger
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: H. Röhl 3. Auflage, ISBN 978-3-954181-54-4
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Arme Leute
Der Doppelgänger
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Vorbemerkung
Der Band bringt die ersten Dichtungen Dostojewskis: den Briefroman der »Armen Leute«, und die Petersburger Geschichte, wie Dostojewski sie ausdrücklich nannte, vom »Doppelgänger«. Die eine ist in der Reihenfolge der Werke Dostojewskis mit dem Jahre 1845, die andere mit dem Jahre 1846 verbunden.
Die »Armen Leute« waren zu ihrer Zeit ein Ereignis: sie wirkten, trotz Gogol, der vorhergegangen war, wie der Einbruch einer neuen Literaturrichtung, der naturalistischen, die auf die romantische folgte, und lenkten mit einem Male die Aufmerksamkeit von ganz Jung-Rußland auf den neuen Dichter. Heute lesen wir das Werk nicht wegen seines zeitlichen und literarischen Wertes, den wir in seiner Tragweite kaum noch verstehen, sondern um des Ewigen und Lyrisch-Mächtigen willen, von dem es in seiner rührenden Frische und scheuen Menschlichkeit voll ist.
Der »Doppelgänger«, mit den dunklen, unheimlichen und unberechenbaren Mächten, die wie ein nächtiges Schattenspiel in dem Dichter lebten, kündete den späteren Dostojewski an: nicht Dostojewski den Idylliker, der nur selten mehr durchbrechen sollte, sondern Dostojewski den Fatalisten und Tragiker. Schon in den »Armen Leuten« war die ungemeine Psychologie in der Menschenschilderung aufgefallen, aber es war eine Psychologie der Nähe und Innigkeit gewesen. Jetzt, in dem »Doppelgänger«, wurde eine Psychologie des Abgrundes und der Erschütterung daraus, und man ahnte bereits, daß sie zu einer ganzen Weltanschauung und russischen Menschenanschauung auswachsen konnte. -- Das Doppelgängerproblem selbst lag in der Zeit. Poe hatte ihm im William Wilson den romantischen Helden gegeben, E. Th. A. Hoffmann in den Elixieren des Teufels aus ihm eine romantische Aventüre gezogen. Dostojewski dagegen -- und eben dies kennzeichnete ihn so -- brachte dasselbe Problem mit der irren Phantastik zusammen, die das Wirkliche, das Graue, der Alltag besitzen kann, und ließ es in Wahngebilden aus dem kranken Hirn eines Menschen steigen, der äußerlich zunächst nicht anders ist wie Tausende um ihn.
Moeller van den Bruck
Arme Leute
»Nein, ich danke für diese Märchendichter! Anstatt etwas Nützliches, Angenehmes, Erquickendes zu schreiben, kratzen sie da die kleinsten Kleinigkeiten aus der Erde hervor und schnüffeln überall herum!... Ich würde Ihnen einfach verbieten, zu schreiben! Zum Beispiel, was soll das: man liest... unwillkürlich denkt man doch nach, -- aber... aber... es kommen einem nur alle möglichen Ungereimtheiten in den Kopf. Nein, wirklich, ich würde ihnen verbieten, zu schreiben, ganz einfach und unter allen Umständen: schlankweg verbieten!«
Fürst W. F. Odojewskij.
8. April.
Meine unschätzbare Warwara Alexejewna!
Gestern war ich glücklich, über alle Maßen glücklich, wie man glücklicher gar nicht sein kann! So haben Sie Eigensinnige doch wenigstens einmal im Leben auf mich gehört! Als ich am Abend, so gegen acht Uhr, erwachte (Sie wissen doch, meine Liebe, daß ich mich nach dem Dienst ein bis zwei Stündchen etwas auszustrecken liebe), da holte ich mir meine Kerze -- und wie ich nun gerade mein Papier zurechtgelegt habe und nur noch meine Feder spitze, schaue ich plötzlich ganz unversehens auf -- da: wirklich, mein Herz begann zu hüpfen! So haben Sie doch erraten, was ich wollte! Ein Eckchen des Vorhanges an Ihrem Fenster war zurückgeschlagen und an einem Blumentopf mit Balsaminen angesteckt, genau so, wie ich es Ihnen damals anzudeuten versuchte. Dabei schien es mir noch, daß auch Ihr liebes Gesichtchen am Fenster flüchtig auftauchte, daß auch Sie aus Ihrem Zimmerchen nach mir ausschauten, daß Sie gleichfalls an mich dachten! Und wie es mich verdroß, mein Täubchen, daß ich Ihr liebes, reizendes Gesichtchen nicht deutlich sehen konnte! Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo auch wir mit klaren Augen sahen, mein Kind. Das Alter ist keine Freude, meine Liebe. Auch jetzt ist es wieder so, als flimmerte mir alles vor den Augen. Arbeitet man abends noch ein bißchen, schreibt man noch etwas, so sind die Augen am nächsten Morgen gleich rot und tränen so, daß man sich vor fremden Leuten fast schämen muß. Aber doch sah ich im Geiste gleich Ihr Lächeln, mein Kind, Ihr gutes, freundliches Lächeln, und in meinem Herzen hatte ich ganz dieselbe Empfindung, wie damals, als ich Sie einmal küßte, Warinka -- erinnern Sie sich noch, Engelchen? Wissen Sie, mein Täubchen, es schien mir sogar, als ob Sie mir mit dem Finger drohten. War es so, Sie Unart? Das müssen Sie mir unbedingt ausführlich erzählen, wenn Sie mir wieder einmal schreiben.
Nun, wie finden Sie denn unseren Einfall, ich meine, das mit Ihrem Fenstervorhang, Warinka? Gar zu nett, nicht wahr? Sitze ich an der Arbeit, oder lege ich mich schlafen, oder stehe ich auf -- immer weiß ich dann, daß auch Sie dort an mich denken, sich meiner erinnern, und auch selbst gesund und heiter sind. Lassen Sie den Vorhang herab, so heißt das: »Gute Nacht, Makar Alexejewitsch, es ist Zeit, schlafen zu gehen!« Heben Sie ihn wieder auf, so heißt das: »Guten Morgen, Makar Alexejewitsch, wie haben Sie geschlafen, und wie steht es mit Ihrer Gesundheit, Makar Alexejewitsch? Ich selbst bin, Gott sei Dank, gesund und wohlgemut!«
Sehen Sie nun, mein Seelchen, wie fein das ersonnen ist. So sind gar keine Briefe nötig! Schlau, nicht wahr? Und diese kniffliche Erfindung stammt von mir! Nun was -- bin ich nicht erfinderisch, Warwara Alexejewna?
Ich muß Ihnen doch noch berichten, mein Kind, daß ich diese Nacht recht gut geschlafen habe, eigentlich gegen alle Erwartung gut, womit ich denn auch sehr zufrieden bin; zumal man in einer neuen Wohnung, schon aus Ungewohntheit, sonst niemals gut zu schlafen pflegt; es ist eben doch immer nicht alles so, wie es sein muß. Als ich heute aufstand, war es mir ganz wie -- wie -- nun, wie so einem lichten Falken ums Herz -- froh und sorgenfrei! Was ist das doch heute für ein schöner Morgen, mein Kind! Unser Fenster wurde aufgemacht: die Sonne scheint herein, die Vögel zwitschern, die Luft ist erfüllt von Frühlingsdüften und die ganze Natur lebt auf, -- nun, und auch alles andere war genau so, wie es sich gehört, genau wie es sein muß, wenn es Frühling wird. Ich versank sogar ein Weilchen in Träumerei und dabei dachte ich nur an Sie, Warinka. Ich verglich Sie in Gedanken mit einem Himmelsvögelchen, das so recht zur Freude der Menschen und zur Verschönerung der Natur erschaffen ist. Dabei dachte ich auch, daß wir, Warinka, wir Menschen, die wir in Sorgen und Ängsten leben, die kleinen Himmelsvöglein um ihr sorgenloses und unschuldiges Glück beneiden könnten, -- nun und Ähnliches mehr, alles von der Art, dachte ich. Das heißt, ich machte nur so entfernte Vergleiche... Ich habe da ein Büchelchen, Warinka, in dem ist von solchen Dingen die Rede, und alles ist ganz ausführlich beschrieben. Ich schreibe das deshalb, weil ich nur sagen will, daß es doch sonst immer verschiedene Auffassungen gibt, nicht wahr, meine Liebe? Jetzt aber ist es Frühling, und da kommen einem gleich so angenehme Gedanken, so geistreiche und erfinderische obendrein, und sogar zärtliche Träumereien kommen einem. Die ganze Welt erscheint einem in rosigem Licht. Deshalb habe ich auch dies alles geschrieben. Übrigens habe ich es meist dem Büchelchen entnommen. Dort äußert der Verfasser ganz denselben Wunsch, nur in Versen:
»Ein Vogel, ein Raubvogel möchte ich sein!«
Und so weiter. Dort kommen auch noch verschiedene andere Gedanken vor, aber -- nun, Gott mit Ihnen! Doch sagen Sie, wohin gingen Sie denn heute morgen, Warwara Alexejewna? Ich hatte mich noch nicht zum Dienst aufgemacht, da gingen Sie bereits fröhlich über den Hof, hatten schon wie ein Frühlingsvöglein Ihr Zimmerchen verlassen. Und wie mein Herz sich freute, als ich Sie sah! Ach, Warinka, Warinka! Grämen Sie sich doch nicht! Mit Tränen hilft man keinem Kummer, glauben Sie mir, ich weiß es, weiß es aus eigener Erfahrung. Jetzt leben Sie doch so ruhig und sorgenlos, und auch mit Ihrer Gesundheit geht es besser. -- Nun, was macht Ihre Fedora? Ach, was ist das für ein guter Mensch! Sie müssen mir alles ganz genau beschreiben, Warinka, wie Sie mit ihr leben und ob Sie auch mit allem zufrieden sind? Fedora ist mitunter etwas brummig, aber Sie müssen das nicht weiter beachten, Warinka. Gott mit ihr! Sie ist doch eine gute Seele.
Ich habe Ihnen schon früher von unserer Theresa geschrieben -- sie ist gleichfalls eine gute und treue Person. Was hab’ ich mir doch um unsere Briefe für Sorgen gemacht! Wie sollte man sie befördern? Da kam uns denn zu unserem Glück diese Theresa, kam wie von Gott gesandt. Sie ist eine gute, bescheidene, stille Person. Aber unsere Wirtin ist wahrhaft erbarmungslos, so versteht sie es, sie auszunutzen. Die Arme wird mit Arbeit ganz überhäuft.
Doch in was für eine Wildnis bin ich hier geraten, Warwara Alexejewna! Das ist mir mal eine Wohnung, das muß ich sagen! Früher lebte ich doch in einer solchen Einsamkeit, Sie wissen ja: friedlich, still, wenn einmal eine Fliege flog, hörte man es. Hier aber -- Lärm, Geschrei, Gezeter! Aber Sie wissen ja noch gar nicht, wie das hier eigentlich alles ist. Denken Sie sich ungefähr einen langen Korridor, einen ganz dunklen und unsauberen. Rechts ist die Brandmauer, ohne Fenster, ohne Türen; links aber ist Tür an Tür, ganz wie in einem Hotel, so eine lange Reihe Türen. Und hinter jeder Tür ist nur ein Zimmer, Nummer Soundsoviel, und in jeder dieser Nummern wohnen zwei bis drei zusammen, je nachdem, und die zahlen gemeinsam die Miete. Ordnung dürfen Sie nicht verlangen -- das ist hier wie in der Arche Noah! Doch sind es, glaube ich, trotzdem gute Menschen, alle sind sie so gebildet, sogar gelehrt. Unter anderen wohnt hier ein Beamter -- ein sehr belesener Mann: er spricht von Homer, und noch von verschiedenen anderen Schriftstellern, von allem spricht er, -- ein kluger Mensch! Dann wohnen hier noch zwei ehemalige Offiziere, die immer nur Karten spielen. Dann ein Seemann, der englische Stunden gibt. -- Warten Sie mal, ich werde Sie einmal zum Lachen bringen, mein Kind: ich werde in meinem nächsten Brief alle die Leute satirisch beschreiben, das heißt, wie sie hier hausen, und zwar ganz ausführlich!
Unsere Wirtin ist ein sehr kleines und unsauberes altes Weib, geht den ganzen Tag in Pantoffeln und in einem Schlafrock umher und schimpft ununterbrochen die Theresa. Ich wohne in der Küche, oder richtiger gesagt -- Sie müssen sich das so denken: hier neben der Küche ist noch ein Zimmer (unsere Küche ist, muß ich Ihnen sagen, rein und hell und sehr anständig), ein ganz kleines Zimmerchen, so ein bescheidenes Winkelchen eigentlich nur... oder noch richtiger wird es so sein: die Küche ist groß und hat drei Fenster, und bei mir ist nun parallel der Querwand eine Scheidewand angebracht, so daß es sozusagen noch ein Zimmerchen gibt, eine Nummer »über den Etat«, wie man sagt. Alles ist geräumig und bequem, und sogar ein Fenster habe ich und überhaupt alles, -- mit einem Wort nochmals, es ist alles gut und bequem. Das ist also mein Winkelchen. Aber nun müssen Sie nicht etwa denken, Kind, daß irgend etwas dabei sei und ich einen Hintergedanken habe: weil das immerhin nur eine Küche ist! Das heißt, genau genommen lebe ich ja in demselben Raum, nur hinter einer Scheidewand, aber das hat nichts zu sagen! Ich lebe hier ganz heimlich und mäuschenstill, ganz bescheiden und ruhig. Habe hier mein Bett aufgestellt, einen Tisch, eine Kommode, zwei Stühle, jawohl, genau ein Paar, und habe das Heiligenbild aufgehängt. Es gibt gewiß bessere Wohnungen, sogar viel bessere, aber die Hauptsache ist doch die Bequemlichkeit; ich wohne ja hier nur deshalb, weil ich es so am bequemsten habe -- Sie brauchen nicht zu denken, daß ich es aus irgendeinem anderen Grunde tue. Ihr Fensterchen liegt mir gerade gegenüber, über den Hof, und der Hof ist auch nur so ein kleines Höfchen, da sieht man Sie denn ganz deutlich hin und wieder im Vorübergehen, -- das ist doch immer etwas geselliger für mich Armen, und auch billiger.
Bei uns hier kostet selbst das kleinste Zimmer mit der Beköstigung zusammen fünfunddreißig Rubel monatlich. Das ist nichts für meinen Beutel! Mein Winkelchen aber kostet nur sieben Rubel, und für die Beköstigung zahle ich fünf, während ich früher für alles in allem runde dreißig Rubel zahlte, dafür aber auf vieles verzichten mußte: so konnte ich nicht immer Tee trinken, jetzt dagegen, oh, da bleibt mir noch genug für Tee und Zucker. Es ist, wissen Sie, doch so -- tatsächlich: man schämt sich irgendwie, wenn man keinen Tee trinken kann, Warinka. Hier wohnen nur Leute, die ihr Auskommen haben, und da geniert man sich eben. Und eigentlich: nur wegen der anderen trinkt man ihn, den Tee, Warinka, nur des Ansehens wegen, weil es hier zum guten Ton gehört. Mir wäre es ja sonst ganz gleich, ich bin nicht einer, der viel auf Genüsse gibt.
Und dann, was man so noch als Taschengeld braucht -- denn irgend etwas hat man doch immer nötig -- nun, sei es ein Paar Stiefel, ein Kleidungsstück -- wieviel bleibt denn da übrig? So geht denn mein ganzes Gehalt auf. Ich klage ja nicht, ich bin ganz zufrieden. Für mich genügt es. Hat es doch schon viele Jahre genügt! Hin und wieder gibt es auch noch Gratifikationen.
Nun, leben Sie wohl, mein Engelchen. Ich habe da ein paar Blumen gekauft, zwei Töpfchen, eines mit Balsaminen und eines mit Geranium -- nicht teuer. Vielleicht lieben Sie auch Reseda? Auch Reseda ist zu haben, schreiben Sie nur. Aber alles recht ausführlich, ja? Übrigens müssen Sie da nicht irgendwie etwas argwöhnen, Kind, ich meine -- was mich betrifft, und daß ich jetzt so ein Zimmer gemietet habe. Nein, nur die Bequemlichkeit veranlaßte mich dazu, nur, daß es in allem so bequem war, das verleitete mich. -- Ich habe doch, das muß ich Ihnen noch sagen, Kind, ich habe doch Geld gespart, ich habe etwas beiseite gelegt: oh ja: ich besitze schon etwas! Achten Sie nicht darauf, daß ich so still und zaghaft bin, daß es aussieht, als könne mich eine Fliege mit den Flügeln umstoßen. Nein, mein Kind, ich bin gar nicht so schwach und habe gerade den Charakter, den ein Mensch mit ruhigem Gewissen und in der Festigkeit, die uns unsere Anständigkeit gibt, haben muß. Leben Sie wohl, mein Engelchen. Da habe ich schon ganze zwei Bogen vollgeschrieben und es ist bereits höchste Zeit zum Dienst. Ich küsse Ihre Fingerchen, Warinka, und verbleibe
Ihr ergebenster Diener und treuester Freund
Makar Djewuschkin.
P. S. Um eines bitte ich Sie noch: antworten Sie mir recht ausführlich, mein Engelchen. Ich sende Ihnen hier eine Düte Konfekt, Warinka; verschmausen Sie es mit Behagen und machen Sie sich um Gottes willen keine Sorgen um mich und nehmen Sie mir nur nicht irgend etwas übel. Und nun leben Sie wohl, mein Kind.
8. April.
Sehr geehrter Makar Alexejewitsch!
Wissen Sie, daß man Ihnen endlich einmal die Freundschaft wird kündigen müssen? Ich schwöre Ihnen, guter Makar Alexejewitsch, es fällt mir furchtbar schwer, Ihre Geschenke anzunehmen. Ich weiß doch, wieviel sie kosten und was das für Ihren Beutel ausmacht, zu wieviel Entbehrungen Sie sich deshalb zwingen, wie Sie sich das Notwendigste selbst verweigern. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, daß ich nichts nötig habe, ganz und gar nichts, daß es nicht in meinen Kräften steht, die Wohltaten, mit denen Sie mich überschütten, zu erwidern. Und wozu diese Blumen? Die Balsaminen, nun, das ginge noch an, aber wozu nun noch Geranium? Es braucht einem nur ein unbedachtes Wort zu entschlüpfen, wie zum Beispiel meine Bemerkung über Geranium, da müssen Sie auch schon sofort Geranium kaufen. So etwas ist doch bestimmt teuer? Wie wundervoll die Blüten sind! So leuchtend rot, und Stern steht an Stern. Wo haben Sie nur ein so schönes Exemplar aufgetrieben? Ich habe den Blumentopf auf das Fensterbrett gestellt, an die sichtbarste Stelle. Auf das Bänkchen vor dem Fenster werde ich noch andere Blumen stellen, lassen Sie mich nur erst reich werden! Fedora kann sich nicht genug freuen -- unser Zimmer ist jetzt ein richtiges Paradies, so sauber und hell und freundlich. Aber wozu war denn das Konfekt nötig? Übrigens: ich erriet es sogleich aus Ihrem Brief, daß irgend etwas nicht richtig ist: Frühling und Wohlgerüche und Vogelgezwitscher -- nein, dachte ich, sollte nicht gar noch ein Gedicht folgen? Denn wirklich, es fehlen nur noch Verse in Ihrem Brief, Makar Alexejewitsch. Und die Gefühle sind zärtlich und die Gedanken rosafarben -- alles, wie es sich gehört! An den Vorhang habe ich überhaupt nicht gedacht. Der Zipfel muß an einem Zweige hängen geblieben sein, als ich die Blumentöpfe umstellte. Da haben Sie es!
Ach, Makar Alexejewitsch, was reden Sie da und rechnen mir Ihre Einnahmen und Ausgaben vor, um mich zu beruhigen und glauben zu machen, daß Sie alles nur für sich allein ausgeben! Mich können Sie damit doch nicht betrügen. Ich weiß doch, daß Sie sich des Notwendigsten um meinetwillen berauben. Was ist Ihnen denn eingefallen, daß Sie sich ein solches Zimmer gemietet haben, sagen Sie doch, bitte! Man beunruhigt Sie doch, man belästigt Sie dort, das Zimmer wird gewiß eng und unbequem und ungemütlich sein. Sie lieben Stille und Einsamkeit, hier aber -- was wird denn das für ein Leben sein? Und bei Ihrem Gehalt könnten Sie doch viel besser wohnen. Fedora sagt, daß Sie früher unvergleichlich besser gelebt hätten als jetzt. Haben Sie wirklich Ihr ganzes Leben so verbracht, immer einsam, immer mit Entbehrungen, ohne Freude, ohne ein gutes, liebes Wort zu hören, immer in einem bei fremden Menschen gemieteten Winkel? Ach Sie, mein guter Freund, wie Sie mir leid tun! So schonen Sie doch wenigstens Ihre Gesundheit, Makar Alexejewitsch! Sie erwähnen, daß Ihre Augen angegriffen seien, -- so schreiben Sie doch nicht bei Kerzenlicht! Was und wozu schreiben Sie denn noch? Ihr Diensteifer wird Ihren Vorgesetzten doch wohl ohnehin schon bekannt sein.
Ich bitte Sie nochmals inständig, verschwenden Sie nicht soviel Geld für mich. Ich weiß, daß Sie mich lieben, aber Sie sind doch selbst nicht reich... Heute war ich ebenso froh, wie Sie, als ich erwachte. Es war mir so leicht zumut. Fedora war schon lange an der Arbeit und hatte auch mir Arbeit verschafft. Darüber freute ich mich sehr. Ich ging nur noch aus, um Seide zu kaufen, und dann setzte ich mich gleichfalls an die Arbeit. Und den ganzen Morgen und Vormittag war ich so heiter! Jetzt aber -- wieder trübe Gedanken, alles so traurig, das Herz tut mir weh.
Mein Gott, was wird aus mir werden, was wird mein Schicksal sein! Das Schwerste ist, daß man so nichts, nichts davon weiß, was einem bevorsteht, daß man so gar keine Zukunft hat, und daß man nicht einmal erraten kann, was aus einem werden wird. Und zurückzuschauen, davor graut mir einfach! Dort liegt soviel Leid und Qual, daß das Herz mir schon bei der bloßen Erinnerung brechen will. Mein Leben lang werde ich unter Tränen die Menschen anklagen, die mich zugrunde gerichtet haben. Diese schrecklichen Menschen!
Es dunkelt schon. Es ist Zeit, daß ich mich wieder an die Arbeit mache. Ich würde Ihnen gern noch vieles schreiben, doch diesmal geht es nicht: die Arbeit muß zu einem bestimmten Tage fertig werden. Da muß ich mich beeilen. Briefe zu erhalten ist natürlich immer angenehm: es ist dann doch nicht so langweilig. Aber weshalb kommen Sie nicht selbst zu uns? Wirklich, warum nicht, Makar Alexejewitsch? Wir wohnen ja jetzt so nahe, und soviel freie Zeit werden Sie doch wohl haben. Also bitte, besuchen Sie uns! Ich sah heute Ihre Theresa. Sie sieht ganz krank aus. Sie hat mir so leid getan, daß ich ihr zwanzig Kopeken gab.
Ja, fast hätte ich es vergessen: schreiben Sie mir unbedingt alles möglichst ausführlichst -- wie Sie leben, was um Sie herum vorgeht -- alles! -- Was es für Leute sind, die dort wohnen, und ob Sie auch in Frieden mit ihnen auskommen? Ich möchte das alles sehr gern wissen. Also vergessen Sie es nicht, schreiben Sie es unbedingt! Heute werde ich unabsichtlich ganz gewiß keinen Zipfel des Vorhanges anstecken. Gehen Sie früher schlafen. Gestern sah ich noch um Mitternacht Licht bei Ihnen. Und nun leben Sie wohl. Heute ist wieder alles da: Trauer und Trübsal und Langeweile! Es ist nun einmal so ein Tag! Leben Sie wohl.
Ihre
Warwara Dobrosseloff.
8. April.
Sehr geehrte Warwara Alexejewna!
Ja, mein Kind, ja, meine Liebe, es muß wohl wieder einmal so ein Tag sein, wie er einem vom Schicksal öfter beschieden ist! Da haben Sie sich nun über mich Alten lustig gemacht, Warwara Alexejewna! Übrigens bin ich selbst daran schuld, ich ganz allein! Wer hieß mich auch, in meinem Alter, mit meinem spärlichen Haarrest auf dem Schädel, auf Abenteuer ausgehen... Und noch eins muß ich sagen, mein Kind: der Mensch ist bisweilen doch sonderbar, sehr sonderbar. Oh du lieber Gott! Auf was er mitunter nicht zu sprechen kommt! Was aber folgt daraus, was kommt dabei schließlich heraus? Ja, folgen tut daraus nichts, aber heraus kommt dabei ein solcher Unsinn, daß Gott uns behüte und bewahre! Ich, mein Kind, ich ärgere mich ja nicht, aber es ist mir sehr unangenehm, jetzt daran zurückzudenken, was ich Ihnen da alles so glücklich und dumm geschrieben habe. Und auch zum Dienst ging ich heute so stolz und stutzerhaft: es war solch ein Leuchten in meinem Herzen, war so wie ein Feiertag in der Seele, und doch ganz ohne allen Grund, -- so frohgemut war ich! Mit förmlicher Schaffensgier machte ich mich an die Arbeit, an die Papiere -- und was wurde schließlich daraus? Als ich mich dann umsah, war wieder alles so wie früher -- grau und nüchtern. Überall dieselben Tintenflecke, wie immer dieselben Tische und Papiere, und auch ich ganz derselbe: wie ich war, genau so bin ich auch geblieben, -- was war da für ein Grund vorhanden, den Pegasus zu reiten? Und woher war denn alles gekommen? Daher, daß die Sonne einmal durch die Wolken geschaut und der Himmel sich heller gefärbt hatte. Nur deshalb -- dies alles? Und was können das für Frühlingsdüfte sein, wenn man auf einen Hof hinaussieht, auf dem aller Unrat der Welt zu finden ist! Da muß ich mir also nur so aus Albernheit alles eingebildet haben. Aber es kommt doch bisweilen vor, daß ein Mensch sich in seinen eigenen Gefühlen verwirrt und in die Weite schweift und Unsinn redet. Das kommt von nichts anderem, als von alberner Hitzigkeit, in der das Herz eine Rolle spielt. Nach Hause kam ich nicht mehr wie andere Menschen, sondern schleppte mich heim: der Kopf schmerzte. Das kommt dann schon so: eins zum anderen. Ich muß wohl meinen Rücken erkältet haben. Ich hatte mich, recht wie ein alter Esel, über den Frühling gefreut und war im leichten Mantel ausgegangen. Auch das noch! In meinen Gefühlen aber haben Sie sich getäuscht, meine Liebe! Sie haben meine Äußerungen in einem ganz anderen Sinn aufgefaßt. Nur um väterliche Zuneigung handelt es sich, Warinka, denn ich nehme bei Ihnen, in Ihrer bitteren Verwaistheit, die Stelle Ihres Vaters ein, das sage ich aus reiner Seele und aus reinem Herzen. Wie es auch sei: ich bin doch immerhin Ihr Verwandter, wenn auch nur ein ganz entfernter Verwandter, vielleicht wie das Sprichwort sagt: das siebente Wasser in der Suppe, aber immerhin: Ihr Verwandter bleibe ich dennoch, und jetzt bin ich sogar Ihr bester Verwandter und einziger Beschützer. Denn dort, wo es am nächsten lag, daß Sie Schutz und Beistand suchten, dort fanden Sie nur Verrat und Schmach. Was aber die Gedichte betrifft, so muß ich Ihnen sagen, mein Kind, daß es sich für mich nicht schickt, mich auf meine alten Tage noch im Dichten zu üben. Gedichte sind Unsinn! Heute werden in den Schulen die Kinder geprügelt, wenn sie dichten... da sehen Sie, was Dichten ist, meine Liebe.
Was schreiben Sie mir da, Warwara Alexejewna, von Bequemlichkeit, Ruhe und was nicht noch alles? Mein Kind, ich bin nicht anspruchsvoll, ich habe niemals besser gelebt, als jetzt: weshalb sollte ich jetzt anfangen zu mäkeln? Ich habe zu essen, habe Kleider und Schuh -- was will man mehr? Nicht uns steht es zu, Gott weiß was für Sprünge zu machen! -- bin nicht von vornehmer Herkunft! Mein Vater war kein Adliger und bezog mit seiner ganzen Familie ein geringeres Gehalt, als ich. Ich bin nicht verwöhnt. Übrigens, wenn man ganz aufrichtig die Wahrheit sagen soll, so war ja wirklich in meiner früheren Wohnung alles unvergleichlich besser. Man war freier, unabhängiger, gewiß, mein Kind. Natürlich ist auch meine jetzige Wohnung gut, ja sie hat in gewisser Hinsicht sogar ihre Vorzüge: es ist hier lustiger, wenn Sie wollen, es gibt mehr Abwechslung und Zerstreuung. Dagegen will ich nichts sagen, aber es tut mir doch leid um die alte. So sind wir nun einmal, wir alten Leute, das heißt, wenn wir Menschen schon anfangen, älter zu werden. Die alten Sachen, an die wir uns gewöhnt haben, sind uns schließlich wie verwandt. Die Wohnung war, wissen Sie, ganz klein und gemütlich. Ich hatte ein Zimmerchen für mich. Die Wände waren... ach nun, was soll man da reden! -- Die Wände waren wie alle Wände sind, nicht um die Wände handelt es sich, aber die Erinnerungen an all das Frühere, die machen mich etwas wehmütig... Sonderbar -- sie bedrücken, aber dennoch ist es, als wären sie angenehm, als dächte man selbst doch gern an all das Alte zurück. Sogar das Unangenehme, worüber ich mich bisweilen geärgert habe, sogar das erscheint jetzt in der Erinnerung wie von allem Schlechten gesäubert und ich sehe es im Geiste nur noch als etwas Trautes, Gutes. Wir lebten ganz still und friedlich, Warinka, ich und meine Wirtin, die selige Alte. Ja, auch an die Gute denke ich jetzt mit traurigen Gefühlen zurück. Sie war eine brave Frau und nahm nicht viel für das Zimmerchen. Sie strickte immer aus alten Zeugstücken, die sie in schmale Bänder zerschnitt, mit ellenlangen Stricknadeln Bettdecken, damit allein beschäftigte sie sich. Das Licht benutzten wir gemeinschaftlich, deshalb arbeiteten wir abends an demselben Tisch. Ein Enkelkindchen lebte bei ihr, Mascha, ich erinnere mich ihrer noch, wie sie ganz klein war -- jetzt wird sie dreizehn sein, schon ein großes Mädchen. Und so unartig war sie, so ausgelassen, immer brachte sie uns zum Lachen. So lebten wir denn zu dreien, saßen an langen Winterabenden am runden Tisch, tranken unseren Tee, und dann machten wir uns wieder an die Arbeit. Die Alte begann oft Märchen zu erzählen, damit Mascha sich nicht langweile oder auch, damit sie nicht unartig sei. Und was das für Märchen waren! Da konnte nicht nur ein Kind, nein, auch ein erwachsener, vernünftiger Mensch konnte da zuhören. Und wie! Ich selbst habe oft, wenn ich mein Pfeifchen angeraucht hatte, aufgehorcht, habe mit Spannung zugehört und die ganze Arbeit darüber vergessen. Das Kindchen aber, unser Wildfang, wurde ganz nachdenklich, stützte das rosige Bäckchen in die Hand, öffnete seinen kleinen Kindermund und horchte mit großen Augen; und wenn es ein Märchen zum Fürchten war, dann schmiegte es sich immer näher, immer angstvoller an die Alte an. Uns aber war es eine Lust, das Kindchen zu betrachten. Und so saß man oft und bemerkte gar nicht, wie die Zeit verging, und vergaß ganz, daß draußen der Schneesturm wütete. --
Ja, das war ein gutes Leben, Warinka, und so haben wir fast ganze zwanzig Jahre gemeinsam verlebt. -- Doch wovon rede ich da wieder! Ihnen werden solche Geschichten vielleicht gar nicht gefallen und mir sind diese Erinnerungen auch nicht so leicht, -- namentlich jetzt in der Dämmerung. Theresa klappert dort mit dem Geschirr -- ich habe Kopfschmerzen, auch mein Rücken schmerzt ein wenig, und die Gedanken sind alle so seltsam, als schmerzten sie gleichfalls: ich bin heute traurig gestimmt, Warinka!
Was schreiben Sie da von besuchen, meine Gute? Wie soll ich denn zu Ihnen kommen? Mein Täubchen, was werden die Leute dazu sagen? Da müßte ich doch über den Hof gehen, das würde man bemerken und dann fragen, -- da gäbe es denn ein Gerede und daraus entstünden Klatschgeschichten und man würde die Sache anders deuten. Nein, mein Engelchen, es ist schon besser, wenn ich Sie morgen bei der Abendmesse sehe; das wird vernünftiger sein und für uns beide unschädlicher. Seien Sie mir nicht böse, mein Kind, weil ich Ihnen einen solchen Brief geschrieben habe. Beim Durchlesen sehe ich jetzt, daß alles ganz zusammenhanglos ist. Ich bin ein alter ungelehrter Mensch, Warinka; in der Jugend habe ich nichts zu Ende gelernt, jetzt aber würde nichts mehr in den Kopf gehen, wenn man von neuem mit dem Lernen anfangen wollte. Ich muß schon gestehen, mein Kind, ich bin kein Meister der Feder und weiß, auch ohne fremde Hinweise und spöttische Bemerkungen, daß ich, wenn ich einmal etwas Spaßigeres schreiben will, nur Unsinn zusammenschwatze. -- Ich sah Sie heute am Fenster, ich sah, wie Sie den Vorhang herabließen. Leben Sie wohl, Gott schütze Sie! Leben Sie wohl, Warwara Alexejewna.
Ihr Freund, der ganz uneigennützig Ihr Freund sein will,
Makar Djewuschkin.
P. S. Ich werde, meine Liebe, über niemanden mehr Satiren schreiben. Ich bin zu alt geworden, Kind, um müßigerweise noch Scherze zu machen. Man würde dann auch über mich lachen, denn es ist schon so, wie unser Sprichwort sagt: Wer einem anderen eine Grube gräbt, der -- fällt selbst hinein.
9. April.
Makar Alexejewitsch!
Schämen Sie sich denn nicht, mein Freund und Wohltäter, sich so etwas in den Kopf zu setzen! Haben Sie sich denn wirklich beleidigt gefühlt? Ach, ich bin oft so unvorsichtig in meinen Äußerungen, aber diesmal hätte ich doch nicht gedacht, daß Sie meinen harmlos scherzhaften Ton für Spott halten könnten. Seien Sie überzeugt, daß ich es niemals wagen werde, über Ihre Jahre oder Ihren Charakter zu scherzen. Ich habe es nur -- wie soll ich sagen --: aus Leichtsinn geschrieben, aus Gedankenlosigkeit, oder vielleicht auch nur deshalb, weil es gerade furchtbar langweilig war... was aber tut man mitunter nicht alles aus Langeweile? Außerdem glaubte ich, daß Sie sich selbst in Ihrem Brief ein wenig lustig hätten machen wollen. Nun macht es mich sehr traurig, daß Sie unzufrieden mit mir sind. Nein, mein treuer Freund und Beschützer, Sie täuschen sich, wenn Sie mich der Gefühllosigkeit und Undankbarkeit verdächtigen. In meinem Herzen weiß ich alles, was Sie für mich taten, als sie mich gegen den Haß und die Verfolgungen schändlicher Menschen verteidigten, nach seinem wahren Wert zu schätzen. Ewig werde ich für Sie beten, und wenn mein Gebet bis hin zu Gott dringt und er mich erhört, dann werden Sie glücklich sein.
Ich fühle mich heute ganz krank. Schüttelfrost und Fieber wechseln ununterbrochen. Fedora beunruhigt sich sehr. Es ist übrigens ganz grundlos, was Sie da schreiben -- und weswegen Sie sich fürchten, uns zu besuchen. Was geht das die Leute an? Sie sind mit uns bekannt und damit Basta!
Leben Sie wohl, Makar Alexejewitsch. Zu schreiben weiß ich nichts mehr, und ich kann auch nicht: fühle mich wirklich ganz krank. Ich bitte Sie nochmals, mir nicht zu zürnen und von meiner steten Verehrung und Anhänglichkeit überzeugt zu sein, womit ich die Ehre habe zu verbleiben
Ihre dankbare und ergebene
Warwara Dobrosseloff.
12. April.
Sehr geehrte Warwara Alexejewna!
Ach, mein Liebes, was ist das nun wieder mit Ihnen! Jedesmal erschrecken Sie mich! Ich schreibe Ihnen in jedem Brief, daß Sie sich schonen sollen, sich warm ankleiden, nicht bei schlechtem Wetter ausgehen, daß Sie in allem vorsichtig sein sollen, -- Sie aber, mein Engelchen, hören gar nicht darauf, was ich sage! Ach, mein Täubchen, Sie sind doch wirklich noch ganz wie ein kleines Kindchen! Sie sind so zart, wie so ein Strohhälmchen, das weiß ich doch. Es braucht nur ein Windchen zu wehen und gleich sind Sie krank. Deshalb müssen Sie sich auch in acht nehmen, müssen Sie selbst darauf bedacht sein, sich nicht der Gefahr auszusetzen und Ihren Freunden nicht Kummer, Sorge und Trübsal zu bereiten.
Sie äußerten im vorletzten Brief den Wunsch, mein Kind, über meine Lebensweise und alles, was mich umgibt und angeht, Genaueres zu erfahren. Gern will ich Ihren Wunsch erfüllen. Ich beginne also -- beginne mit dem Anfang, mein Kind, dann ist gleich mehr Ordnung in der Sache.
Also erstens: die Treppen in unserem Hause sind ziemlich mittelmäßig; die Paradetreppe ist noch ganz gut, sogar sehr gut, wenn Sie wollen: rein, hell, breit, alles Gußeisen und wie Mahagoni poliertes Holzgeländer. Dafür ist aber die Hintertreppe so, daß ich lieber gar nicht von ihr reden will: feucht, schmutzig, mit zerbrochenen Stufen, und die Wände sind so fettig, daß die Hand kleben bleibt, wenn man sich an sie stützen will. Auf jedem Treppenabsatz stehen Kisten, alte Stühle und Schränke, alles schief und wackelig, Lappen sind zum Trocknen aufgehängt, die Fensterscheiben eingeschlagen; Waschkübel stehen da mit allem möglichen Schmutz, mit Unrat und Kehricht, mit Eierschalen und Tischresten; der Geruch ist schlecht... mit einem Wort, es ist nicht schön.
Die Lage der Zimmer habe ich Ihnen schon beschrieben; sie ist -- dagegen läßt sich nichts sagen -- wirklich bequem, das ist wahr, aber es ist auch in ihnen eine etwas dumpfe Luft, das heißt, ich will nicht geradezu sagen, daß es in den Zimmern schlecht riecht, aber so -- es ist nur ein etwas fauliger Geruch, wenn man sich so ausdrücken darf, in den Zimmern, irgend so ein süßlich scharfer Modergeruch, oder so ungefähr. Der erste Eindruck ist zum mindesten nicht vorteilhaft, doch das hat nichts zu sagen, man braucht nur ein paar Minuten bei uns zu sein, so vergeht das, und man merkt nicht einmal, wie es vergeht, denn man fängt selbst an, so zu riechen, die Kleider und die Hände und alles riecht bald ebenso, -- nun, und da gewöhnt man sich eben daran. Aber alle Zeisige krepieren bei uns. Der Seemann hat schon den fünften gekauft, aber sie können nun einmal nicht leben in unserer Luft, dagegen ist nichts zu machen. Unsere Küche ist groß, geräumig und hell. Morgens ist es allerdings etwas dunstig in ihr, wenn man Fisch oder Fleisch brät und es riecht dann nach Rauch und Fett, da immer etwas übergegossen wird, und auch der Fußboden ist morgens meist naß, aber abends ist man dafür wie im Paradies. In der Küche hängt bei uns gewöhnlich Wäsche zum Trocknen auf Schnüren, und da mein Zimmer nicht weit ist, das heißt, fast unmittelbar an die Küche stößt, so stört mich dieser Wäschegeruch zuweilen ein wenig. Aber das hat nichts zu sagen: hat man hier erst etwas länger gelebt, wird man sich auch daran gewöhnen.
Vom frühesten Morgen an, Warinka, beginnt bei uns das Leben, da steht man auf, geht, lärmt, poltert, -- dann stehen nämlich alle auf, die einen, um in den Dienst zu gehen oder sonst wohin, manche nur so aus eigenem Antriebe: und dann beginnt das Teetrinken. Die Ssamoware gehören fast alle der Wirtin, es sind ihrer aber nur wenige, deshalb muß ein jeder aufpassen, wann die Reihe an ihn kommt; wer aus der Reihe fällt und mit seinem Teekännchen früher geht, als er darf, dem wird sogleich, und zwar tüchtig, der Kopf zurecht gerückt. Das geschah mit mir auch einmal, gleich am ersten Tage... doch was soll man davon reden! Bei der Gelegenheit wurde ich dann auch mit allen bekannt. Näher bekannt wurde ich zunächst mit dem Seemann. Der ist so ein Offenherziger, hat mir alles gleich erzählt: von seinem Vater und seiner Mutter, von der Schwester, die an einen Assessor in Tula verheiratet ist und von Kronstadt, wo er längere Zeit gelebt hat. Er versprach mir auch seinen Beistand, wenn ich seiner bedürfen sollte, und lud mich gleich zu sich zum Abendtee ein. Ich suchte ihn dann auch auf -- er war in demselben Zimmer, in dem man bei uns gewöhnlich Karten spielt. Dort wurde ich mit Tee bewirtet und dann verlangte man von mir, daß ich an ihrem Hazardspiel teilnehmen sollte. Wollten sie sich nun über mich lustig machen oder was sonst, das weiß ich nicht, jedenfalls spielten sie selbst die ganze Nacht, auch als ich eintrat, spielten sie. Überall Kreide, Karten, und ein Rauch war im Zimmer, daß es einen förmlich in die Augen biß. Nun, spielen wollte ich natürlich nicht, und da sagten sie mir, ich sei wohl ein Philosoph. Darauf beachtete mich weiter niemand und man sprach auch die ganze Zeit kein Wort mehr mit mir. Doch darüber war ich, wenn ich aufrichtig sein soll, nur sehr froh. Jetzt gehe ich nicht mehr zu ihnen: bei denen ist nichts als Hazard, der reine Hazard! Aber bei dem Beamten, der nebenbei so etwas wie ein Literat ist, kommt man abends gleichfalls zusammen. Und bei dem geht es anders her, dort ist alles bescheiden, harmlos und anständig, -- ein behaglich tüchtiges Leben.
Nun, Warinka, will ich Ihnen noch beiläufig anvertrauen, daß unsere Wirtin eine sehr schlechte Person ist, eine richtige Hexe. Sie haben doch Theresa gesehen, -- also sagen Sie selbst: was ist denn an ihr noch dran? Mager ist sie wie eine Schwindsüchtige, wie ein gerupftes Hühnchen. Und dabei hält die Wirtin nur zwei Dienstboten: diese Theresa und den Faldoni. Ich weiß nicht, wie er eigentlich heißt, vielleicht hat er auch noch einen anderen Namen, jedenfalls kommt er, wenn man ihn so ruft, und deshalb rufen ihn denn alle so. Er ist rothaarig, irgendein Finne, ein schielender Grobian mit einer aufgestülpten Nase: auf die Theresa schimpft er ununterbrochen, und viel fehlt nicht, so würde er sie einfach prügeln. Überhaupt muß ich sagen, daß das Leben hier nicht ganz so ist, daß man es gerade gut nennen könnte... Daß sich zum Beispiel abends alle zu gleicher Zeit hinlegen und einschlafen -- das kommt hier überhaupt nicht vor. Ewig wird irgendwo noch gesessen und gespielt, manchmal wird aber sogar so etwas getrieben, daß man sich schämt, es auch nur anzudeuten. Jetzt habe ich mich schon eingelebt und an vieles gewöhnt, aber ich wundere mich doch, wie sogar verheiratete Leute in einem solchen Sodom leben können. Da ist eine ganze arme Familie, die hier in einem Zimmer wohnt, aber nicht in einer Reihe mit den anderen Nummern, sondern auf der anderen Seite in einem Eckzimmer, also etwas weiter ab. Stille Leutchen! Niemand hört von ihnen was. Und sie leben alle in dem einen Zimmerchen, in dem sie nur eine kleine Scheidewand haben. Er soll ein stellenloser Beamter sein -- vor etwa sieben Jahren aus dem Dienst entlassen, man weiß nicht, weshalb. Sein Familienname ist Gorschkoff. Er ist ein kleines, graues Männchen, geht in alten, abgetragenen Kleidern, daß es ordentlich weh tut, ihn anzusehen -- viel schlechter als ich! So ein armseliges, kränkliches Kerlchen -- ich begegne ihm bisweilen auf dem Korridor. Die Kniee zittern ihm immer, auch die Hände zittern und der Kopf zittert, von einer Krankheit vielleicht, oder Gott mag wissen, wovon. Schüchtern ist er, alle fürchtet er, geht jedem scheu aus dem Wege und drückt sich ganz still und leise längs der Wand an den Menschen vorüber. Auch ich bin ja mitunter etwas schüchtern, aber mit dem ist das gar kein Vergleich! Seine Familie besteht aus seiner Frau und drei Kindern. Der älteste Knabe ist ganz nach dem Vater geraten, auch so ein kränkliches Kerlchen. Seine Frau muß einmal gut ausgesehen haben, das sieht man jetzt noch... sie geht aber in so alten, armseligen Kleidern -- oh, so alten!! Wie ich hörte, schulden sie der Wirtin bereits die Miete; wenigstens behandelt sie sie nicht gar zu freundlich. Auch hörte ich, daß Gorschkoff selbst irgendwelche Unannehmlichkeiten gehabt haben soll, weshalb er verabschiedet worden sei, -- war es nun ein Prozeß oder etwas anderes, vielleicht eine Anklage, oder ist eine Untersuchung eingeleitet worden, das weiß ich Ihnen nicht zu sagen. Arm sind sie, furchtbar arm, Gott im Himmel! Immer ist es still in ihrem Zimmer, so still, als wohnte dort keine Seele. Nicht einmal die Kinder hört man. Und daß sie mal unartig wären oder ein Spielchen spielten -- das kommt gar nicht vor, und ein schlimmeres Zeichen gibt es nicht. Einmal kam ich abends an ihrer Tür vorüber -- es war gerade ganz ungewöhnlich still bei uns -- da hörte ich ganz leises Schluchzen, dann ein Flüstern, dann wieder Schluchzen, ganz als weine dort jemand, aber so still, so hoffnungslos verzweifelt, so traurig, daß es mir das Herz zerreißen wollte -- und dann wurde ich die halbe Nacht die Gedanken an diese armen Menschen nicht los, so daß ich lange nicht einschlafen konnte.
Nun leben Sie wohl, Warinka, mein Freundchen! Da habe ich Ihnen jetzt alles beschrieben, so, wie ich es verstand. Heute habe ich den ganzen Tag nur an Sie gedacht. Mein Herz hat sich um Sie ganz müde gegrämt. Denn sehen Sie, mein Seelchen, ich weiß doch, daß Sie kein warmes Mäntelchen haben. Und ich kenne doch dieses Petersburger Frühlingswetter, diese Frühjahrswinde und den Regen, der dazwischen noch Schnee bringt, -- das ist doch der Tod, Warinka! Da gibt es doch solche Wetterumschläge, daß Gott uns behüte und bewahre! Nehmen Sie mir, Herzchen, mein Geschreibsel nicht übel; ich habe keinen Stil, Warinka, ganz und gar keinen Stil. Wenn ich doch nur irgendeinen hätte! Ich schreibe, was mir gerade einfällt, damit Sie eine kleine Zerstreuung haben, also nur so, um Sie etwas zu erheitern. Ja, wenn ich was gelernt hätte, dann wäre es etwas anderes; aber so -- was habe ich denn gelernt? Meine Erziehung hat wenig gekostet!
Ihr ewiger und treuer Freund
Makar Djewuschkin.
25. April.
Sehr geehrter Makar Alexejewitsch!
Heute bin ich meiner Kusine Ssascha begegnet! Entsetzlich! Auch sie wird zugrunde gehen, die Ärmste! Auch habe ich zufällig auf Umwegen erfahren, daß Anna Fedorowna sich überall nach mir erkundigt und natürlich alles ausforschen will. Sie wird wohl niemals aufhören, mich zu verfolgen. Sie soll gesagt haben, daß sie mir alles verzeihenwolle! Sie wolle alles Vorgefallene vergessen und werde mich unbedingt besuchen. Von Ihnen hat sie gesagt, Sie seien gar nicht mein Verwandter, nur sie selbst sei meine nächste und einzige Verwandte, und Sie hätten kein Recht, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Es sei eine Schande für mich und ich müsse mich schämen, mich von Ihnen ernähren zu lassen und auf Ihre Kosten zu leben... Sie sagt, ich hätte das Gnadenbrot, das sie uns gegeben, vergessen -- hätte vergessen, daß sie meine Mutter und mich vor dem Hungertode bewahrt, daß sie uns ernährt und gepflegt und fast zweieinhalb Jahre lang nur Unkosten durch uns gehabt, und daß sie uns außerdem eine alte Schuld geschenkt habe. Nicht einmal Mama will sie in ihrem Grabe in Ruhe lassen! Wenn meine Mutter wüßte, was sie mir angetan haben! Gott sieht es!...
Anna Fedorowna hat auch noch gesagt, daß ich nur aus Dummheit nicht verstanden habe, mein Glück festzuhalten, daß sie selbst mir das Glück zugeführt und sonst an nichts schuld sei, ich aber hätte es nur nicht verstanden -- oder vielleicht auch nicht gewollt -- für meine Ehre einzutreten. Aber wessen Schuld war es denn, großer Gott! Sie sagt, Herr Bükoff sei durchaus im Recht, man könne doch wirklich nicht eine jede heiraten, die... doch wozu das alles schreiben!
Es ist zu grausam, solche Unwahrheiten hören zu müssen, Makar Alexejewitsch!
Ich weiß nicht, was es heute mit mir ist. Ich zittere, ich weine, ich schluchze. An diesem Brief schreibe ich schon seit zwei Stunden. Und ich war schon in dem Glauben, sie werde doch wenigstens ihre Schuld eingesehen haben, das Unrecht, das sie mir zugefügt hat, -- und da redet sie so!
Bitte, regen Sie sich meinetwegen nicht auf, mein Freund, um Gottes willen nicht, mein einziger guter Freund! Fedora übertreibt ja doch immer: ich bin gar nicht krank. Ich habe mich nur gestern auf dem Wolkoff-Friedhof ein wenig erkältet, als ich die Seelenmesse für mein totes Mütterchen hörte. Warum kamen Sie nicht mit mir? -- ich hatte Sie doch so darum gebeten. Ach, meine arme, arme Mutter, wenn du aus dem Grabe stiegest, wenn du wüßtest, wenn du wüßtest, was sie mit mir getan haben!...
W. D.
20. Mai.
Mein Täubchen Warinka!
Ich sende Ihnen ein paar Weintrauben, mein Herzchen, die sind gut für Genesende, sagt man, und auch der Arzt hat sie empfohlen, gegen den Durst, -- also dann essen Sie mal die Träubchen, Warinka, wenn Sie durstig sind. Sie wollten auch gern ein Rosenstöckchen besitzen, Kind, da schicke ich Ihnen denn jetzt welche. Haben Sie aber auch Appetit, Herzchen? -- Das ist doch die Hauptsache. Gott sei Dank, daß nun alles vorüber und überstanden ist, und daß auch unser Unglück bald ein Ende nehmen wird. Danken wir dafür dem Schöpfer! Was aber nun die Bücher betrifft, so kann ich vorläufig nirgendwo welche auftreiben. Es soll hier jemand ein sehr gutes Buch haben, hörte ich, eines, das in sehr hohem Stil geschrieben sei; man sagt, es sei wirklich ein gutes Buch, ich habe es selbst nicht gelesen, aber es wird hier sehr gelobt. Ich habe gebeten, man möge es mir geben, und man wollte es mir auch verschaffen. Nur -- werden Sie es wirklich lesen? Sie sind ja so wählerisch in solchen Sachen, daß es schwer hält, für Ihren Geschmack gerade das Richtige zu finden, ich kenne Sie doch, mein Täubchen, ich weiß schon, wie Sie sind! Sie wollen wohl nur Poesie haben, die von Liebe und Sehnsucht handelt, -- deshalb werde ich Ihnen auch Gedichte verschaffen, alles, alles, was Sie nur haben wollen. Hier gibt es ein ganzes Heft mit abgeschriebenen Gedichten.
Ich lebe sehr gut. Sie müssen sich über mich beruhigen, Kind. Was Ihnen die Fedora wieder erzählt hat, ist alles gar nicht wahr, sie soll nicht immer lügen, sagen Sie ihr das. Ja, sagen Sie es ihr wirklich, der Klatschbase!... Ich habe meinen neuen Uniformrock gar nicht verkauft, ist mir nicht eingefallen! Und weshalb sollte ich ihn verkaufen, sagen Sie doch selbst? Ich habe noch vor kurzem gehört, wie man davon sprach, daß man mir eine Gratifikation von vierzig Rubeln zusprechen werde, weshalb sollte ich da verkaufen? Nein, Kind, Sie sollen sich wirklich nicht beunruhigen. Sie ist argwöhnisch, die Fedora, und mißtrauisch, das ist gar nicht gut von ihr. Warten Sie nur, auch wir werden noch mal gut leben, mein Täubchen! Nur müssen Sie erst gesund werden, mein Engelchen, das müssen Sie um Christi willen: das ist doch mein größter Kummer, damit betrüben Sie mich Alten doch am meisten. Wer hat Ihnen gesagt, daß ich abgemagert sei? Das ist auch eine Verleumdung! Ich bin ganz gesund und munter und habe sogar so zugenommen, daß ich mich schon selbst zu schämen anfange. Bin satt und zufrieden und mir fehlt nichts, -- wenn nur Sie wieder gesund wären! Nun, und jetzt leben Sie wohl, mein Engelchen; ich küsse alle Ihre Fingerchen und verbleibe
Ihr ewig treuer, unwandelbarer Freund
Makar Djewuschkin.
P. S. Ach, Herzchen, was haben Sie da nur wieder geschrieben! Daß Sie sich doch immer etwas ins Köpfchen setzen müssen! Wie soll ich denn so oft zu Ihnen kommen, Kind -- das frage ich Sie, -- wie? Etwa im Schutze der nächtlichen Dunkelheit? Aber wo die Nächte hernehmen, jetzt gibt es ja gar keine, in dieser Jahreszeit. Ich habe Sie aber auch so, Engelchen, während Ihrer Krankheit fast gar nicht verlassen, als Sie bewußtlos im Fieber lagen. Doch eigentlich weiß ich es selbst nicht mehr, wie ich meine Zeit einteilte und mit allem doch noch fertig wurde. Aber dann stellte ich meine Besuche ein, denn die Leute wurden neugierig und begannen zu fragen. Und es sind ohnehin schon Klatschgeschichten entstanden. Ich verlasse mich aber ganz auf Theresa, sie ist zum Glück nicht schwatzhaft. Aber immerhin müssen Sie es sich doch selbst sagen, Kind, wie wird denn das sein, wenn alle über uns schwatzen? Was werden sie denn von uns denken und was sagen? Deshalb beißen Sie mal die Zähnchen zusammen, Herzchen, und warten Sie, bis Sie ganz gesund geworden sind: dann werden wir uns schon irgendwo außerhalb des Hauses treffen können.
1. Juni.
Bester Makar Alexejewitsch!
Ich möchte Ihnen so gern etwas zu Liebe tun, um Ihnen meinen Dank für Ihre Mühen und die Opfer, die Sie mir gebracht, zu bezeigen, darum habe ich mich entschlossen, aus meiner Kommode mein altes Heft hervorzusuchen, das ich Ihnen hiermit zusende. Ich begann diese Aufzeichnungen noch in der glücklichen Zeit meines Lebens. Sie haben mich so oft mit Anteil nach meinem früheren Leben gefragt und mich gebeten, Ihnen von meiner Mutter, von Pokrowskij, von meinem Aufenthalt bei Anna Fedorowna und schließlich von meinen letzten Erlebnissen zu erzählen, und Sie äußerten so lebhaft den Wunsch, dieses Heft einmal zu lesen, in dem ich -- Gott weiß wozu -- einiges aus meinem Leben erzählt habe, daß ich glaube, Ihnen mit der Zusendung dieses Heftes eine Freude zu bereiten. Mich aber hat es traurig gemacht, als ich es jetzt durchlas. Es scheint mir, daß ich seit dem Augenblick, in dem ich die letzte Zeile dieser Aufzeichnungen schrieb, noch einmal so alt geworden bin, als ich war, zweimal so alt! Ich habe das Ganze zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben. Leben Sie wohl, Makar Alexejewitsch! Ich habe jetzt oft schreckliche Langeweile und nachts quält mich meine Schlaflosigkeit. Ein höchst langweiliges Genesen!
W. D.
I.
Ich war erst vierzehn Jahre alt, als mein Vater starb. Meine Kindheit war die glücklichste Zeit meines Lebens. Ich verbrachte sie nicht hier, sondern fern in der Provinz, auf dem Lande. Mein Vater war der Verwalter eines großen Gutes, das dem Fürsten P. gehörte. Und dort lebten wir -- still, einsam und glücklich... Ich war ein richtiger Wildfang: oft tat ich den ganzen Tag nichts anderes, als in Feld und Wald umherzustreifen, überall wo ich nur wollte, denn niemand kümmerte sich um mich. Mein Vater war immer beschäftigt und meine Mutter hatte in der Wirtschaft zu tun. Ich wurde nicht unterrichtet -- und darüber war ich sehr froh. So lief ich schon frühmorgens zum großen Teich oder in den Wald, oder auf die Wiese zu den Schnittern -- je nachdem --: was machte es mir aus, daß die Sonne brannte, daß ich selbst nicht mehr wußte, wo ich war und wie ich mich zurechtfinden sollte, daß das Gestrüpp mich kratzte und mein Kleid zerriß: zu Hause würde man schelten, aber was ging das mich an!
Und ich glaube, ich wäre ewig so glücklich geblieben, wenn wir auch das ganze Leben dort auf dem Lande verbracht hätten. Doch leider mußte ich schon als Kind von diesem freien Landleben Abschied nehmen und mich von all den trauten Stellen trennen. Ich war erst zwölf Jahre alt, als wir nach Petersburg übersiedelten. Ach, wie traurig war unser Aufbruch! Wie weinte ich, als ich alles, was ich so lieb hatte, verlassen mußte! Ich weiß noch, wie krampfhaft ich meinen Vater umarmte und ihn unter Tränen bat, er möge doch wenigstens noch ein Weilchen auf dem Gute bleiben, und wie mein Vater böse wurde und wie meine Mutter auch weinte. Sie sagte, es sei notwendig, es seien geschäftliche Angelegenheiten, die es verlangten. Der alte Fürst P. war nämlich gestorben und seine Erben hatten meinen Vater entlassen. So fuhren wir nach Petersburg, wo einige Privatleute lebten, denen mein Vater Geld geliehen hatte -- und da wollte er denn persönlich seine Geldangelegenheiten regeln. Das erfuhr ich alles von meiner Mutter. Hier mieteten wir auf der Petersburger Seite1 eine Wohnung, in der wir dann bis zum Tode des Vaters blieben.
Wie schwer es mir war, mich an das neue Leben zu gewöhnen! Wir kamen im Herbst nach Petersburg. Als wir das Gut verließen, war es ein sonnig heller, klarer, warmer Tag. Auf den Feldern wurden die letzten Arbeiten beendet. Auf den Tennen lag schon das Getreide in hohen Haufen, um die ganze Scharen lebhaft zwitschernder Vögel flatterten. Alles war so hell und fröhlich!
Hier aber, als wir in der Stadt anlangten, war statt dessen nichts als Regen, Herbstkälte, Unwetter, Schmutz, und viele fremde Menschen, die alle unfreundlich, unzufrieden und böse aussahen! Wir richteten uns ein, so gut es eben ging. Wieviel Schererei das gab, bis man den Haushalt endlich eingerichtet hatte! Mein Vater war fast den ganzen Tag nicht zu Hause und meine Mutter war immer beschäftigt, -- mich vergaß man ganz. Es war ein trauriges Aufstehen am nächsten Morgen -- nach der ersten Nacht in der neuen Wohnung. Vor unseren Fenstern war ein gelber Zaun. Auf der Straße sah man nichts als Schmutz! Nur wenige Menschen gingen vorüber, und alle waren so vermummt in Kleider und Tücher, und alle schienen sie zu frieren.
Bei uns zu Hause herrschten ganze Tage lang nur Kummer und entsetzliche Langeweile. Verwandte oder nahe Bekannte hatten wir hier nicht. Mit Anna Fedorowna hatte sich der Vater entzweit. (Er schuldete ihr etwas.) Es kamen aber ziemlich oft Leute zu uns, die mit dem Vater Geschäftliches zu besprechen hatten. Gewöhnlich wurde dann gestritten, gelärmt und geschrien. Und wenn sie wieder fortgegangen waren, war Papa immer so unzufrieden und böse. Stundenlang ging er dann im Zimmer auf und ab, mit gerunzelter Stirn, ohne ein Wort zu sprechen. Auch Mama wagte dann nichts zu sagen und schwieg. Und ich zog mich mit einem Buch still in einen Winkel zurück und wagte mich nicht zu rühren.
Im dritten Monat nach unserer Ankunft in Petersburg wurde ich in eine Pension gegeben. War das eine traurige Zeit, anfangs, unter den vielen fremden Menschen! Alles war so trocken, so kurz angebunden, so unfreundlich und so gar nicht anziehend: die Lehrerinnen schalten und die Mädchen spotteten, und ich war so verschüchtert -- wie ein Wildling kam ich mir vor. Diese pedantische Strenge! Alles mußte pünktlich zur bestimmten Stunde geschehen. Die Mahlzeiten an der gemeinsamen Tafel, die langweiligen Lehrer -- das machte mich anfangs haltlos! Ich konnte dort nicht einmal schlafen. So manche lange, langweilige, kalte Nacht habe ich bis zum Morgen geweint. Abends, wenn die anderen alle ihre Lektionen lernten oder wiederholten, saß ich über meinem Buch oder dem Vokabelheft und wagte nicht, mich zu rühren, doch mit meinen Gedanken war ich wieder zu Hause, dachte an den Vater und die Mutter und an meine alte gute Kinderfrau und an deren Märchen... ach, was für ein Heimweh mich da erfaßte! Jedes kleinsten Gegenstandes im Hause erinnert man sich, und selbst an den noch denkt man mit einem so eigentümlichen, wehmütigen Vergnügen. Und so denkt man und denkt man denn, -- wie gut, wie schön es doch jetzt zu Hause wäre! Da würde ich in unserem kleinen Eßzimmer am Tisch sitzen, auf dem der Ssamowar summt, und mit am Tisch säßen die Eltern: wie warm wäre es, wie traut, wie behaglich. Wie würde ich, denkt man, jetzt Mütterchen umarmen, fest, ganz fest, o, so mit aller Inbrunst umarmen! -- Und so denkt man weiter, bis man vor Heimweh leise zu weinen anfängt, und immer wieder die Tränen schluckt -- die Vokabeln aber gehen einem nicht in den Kopf. Wieder kann man die Aufgabe für den nächsten Tag nicht: die ganze Nacht sieht man nichts anderes im Traum, als den Lehrer, die Madame und die Mitschülerinnen; die ganze Nacht träumt man, daß man die Aufgaben lerne, am nächsten Tage aber weiß man natürlich nichts. Da muß man wieder im Winkel knien und erhält nur eine Speise. Ich war so unlustig, so wortkarg. Die Mädchen lachten über mich, neckten mich und lenkten meine Aufmerksamkeit ab, wenn ich die Aufgabe hersagte, oder sie kniffen mich, wenn wir in langer Reihe paarweis zu Tisch gingen, oder sie beklagten sich bei der Lehrerin über mich. Doch welche Seligkeit, wenn dann am Sonnabendabend meine alte gute Wärterin kam, um mich abzuholen! Wie ich sie umarmte -- ich wußte mich kaum zu lassen vor Freude -- mein gutes Altchen! Und dann kleidete sie mich an, immer »hübsch warm«, wie sie sagte, wenn sie mir die Tücher um den Kopf band. Unterwegs aber konnte sie mir nie schnell genug folgen und ich -- konnte doch nicht so langsam gehen wie sie! Und die ganze Zeit erzählte ich und schwatzte ich ohne Unterlaß. Ganz ausgelassen vor Freude, lief ich ins Haus und warf mich den Eltern um den Hals, als hätten wir uns seit neun Jahren nicht gesehen. Und dann begann das Erzählen und Fragen, und ich lachte und lief umher und feierte mit allem und allem Wiedersehen. Papa begann alsbald ernstere Gespräche: über die Lehrer, über Mathematik, über die französische Sprache und die Grammatik von L’Homond, -- und alle waren wir so guter Dinge und zufrieden und gesprächig. Auch jetzt noch ist mir die bloße Erinnerung an jene Stunden ein Vergnügen.
Ich gab mir die größte Mühe, gut zu lernen, um meinen Vater damit zu erfreuen. Ich sah doch, daß er das Letzte für mich ausgab, während ihm selbst die Sorgen über den Kopf wuchsen. Mit jedem Tage wurde er finsterer, unzufriedener, jähzorniger; sein Charakter veränderte sich sehr zu seinem Nachteil. Nichts gelang ihm, alles schlug fehl und die Schulden wuchsen ins Ungeheuerliche.
Die Mutter fürchtete sich, zu weinen oder auch nur ein Wort der Klage zu sagen, da der Vater sich dann nur noch mehr ärgerte. Sie wurde kränklich und schwächlich und ein böser Husten stellte sich ein. Kam ich aus der Pension, so sah ich nur traurige Gesichter: die Mutter wischte sich heimlich die Tränen aus den Augen und der Vater ärgerte sich. Und dann kamen wieder Vorwürfe und Klagen: er erlebe an mir keine Freude, ich brächte ihm auch keinen Trost, und doch gebe er für mich das Letzte hin, ich aber verstände noch immer nicht, Französisch zu sprechen. Mit einem Wort, ich war an allem schuld; alles Unglück, alle Mißerfolge, alles hatten wir zu verantworten, ich und die arme Mama. Wie war es aber nur möglich, die arme Mama noch mehr zu quälen! Wenn man sie ansah, konnte einem das Herz brechen! Ihre Wangen waren eingefallen, die Augen lagen tief in den Höhlen -- wie eine Schwindsüchtige sah sie aus.
Die größten Vorwürfe wurden mir gemacht. Gewöhnlich begann es mit irgendeiner kleinen Nebensächlichkeit und dann kam oft Gott weiß was alles zur Sprache, -- oft begriff ich nicht einmal, wovon Papa sprach. Was er da nicht alles vorbrachte!... Zuerst die französische Sprache, daß ich ein großer Dummkopf und unsere Pensionsvorsteherin eine fahrlässige, dumme Person sei, sie sorge nicht im geringsten für unsere sittliche Entwickelung; dann -- daß er noch immer keine Anstellung finden könne und daß die Grammatik von L’Homond nichts tauge, die von Sapolskij sei bedeutend besser; daß man für mich viel Geld verschwendet habe, ohne Sinn und Nutzen, daß ich ein gefühlloses, hartherziges Mädchen sei, -- kurz, ich Arme, die ich mir die größte Mühe gab, französische Vokabeln und Gespräche auswendig zu lernen, war an allem schuld und mußte alle Vorwürfe hinnehmen. Aber er tat es ja nicht etwa deshalb, weil er uns nicht liebte: im Gegenteil, er liebte uns über alle Maßen! Es war nun einmal sein Charakter ...
Oder nein: es waren die Sorgen, die Enttäuschungen und Mißerfolge, die seinen ursprünglich guten Charakter so verändert hatten: er wurde mißtrauisch, war oft ganz verbittert und der Verzweiflung nahe, begann seine Gesundheit zu vernachlässigen, erkältete sich und -- starb dann auch nach kurzem Krankenlager, so plötzlich, so unerwartet, daß wir es noch tagelang nicht fassen konnten! Wir waren wie betäubt von diesem Schlage. Mama war wie erstarrt, ich fürchtete anfänglich für ihren Verstand. Kaum aber war er gestorben, da kamen schon die Gläubiger in Scharen zu uns. Alles, was wir hatten, gaben wir ihnen hin. Unser Häuschen auf der Petersburger Seite, das Papa ein halbes Jahr nach unserer Ankunft in Petersburg gekauft hatte, mußte gleichfalls verkauft werden. Ich weiß nicht, wie es mit dem Übrigen wurde, wir blieben jedenfalls ohne Obdach, ohne Geld, schutzlos, mittellos... Mama war krank -- es war ein schleichendes Fieber, das nicht weichen wollte -- verdienen konnten wir nichts, so waren wir dem Verderben preisgegeben. Ich war erst vierzehn Jahre alt.