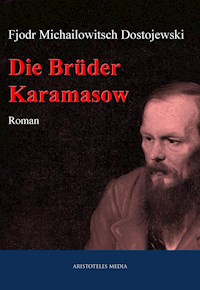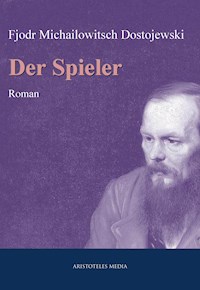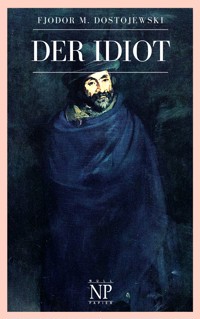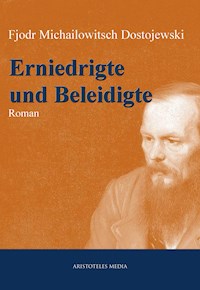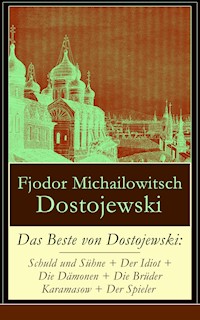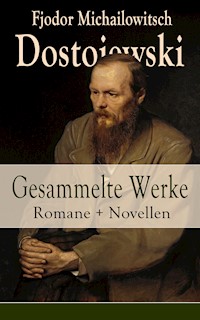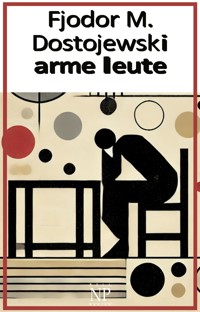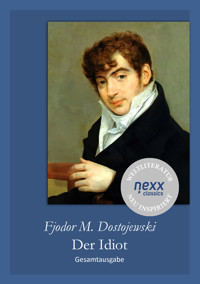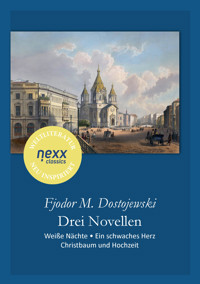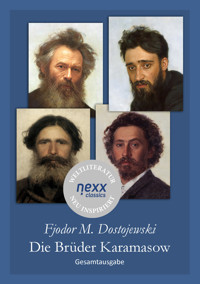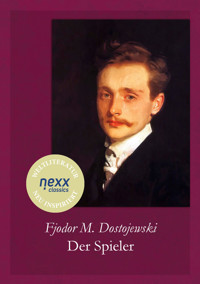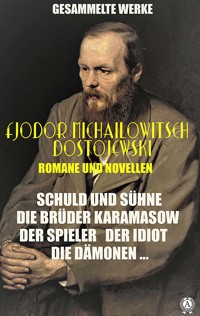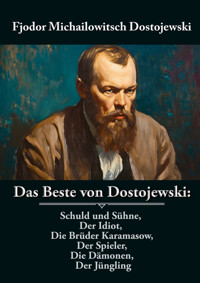Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Arkadij Dolgorukij, ein zorniger junger Mann, unehelicher Sohn eines erfolglosen Gutsbesitzers, will nach oben. Wie schon in "Der Idiot" macht Dostojewski auch in "Der Jüngling" einen gesellschaftlichen Außenseiter zur Hauptperson. Arkadij steckt voller spinnerter "Ideen", die er alle enthusiastisch versucht umzusetzen, nur um doch immer wieder zu scheitern. Seine Reise durch das verkommene, aus den Fugen geratene St. Petersburg führt zur Katastrophe. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Der Jüngling
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Der Jüngling
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Hermann Röhl EV: Berlin, 1915 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-88-3
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Autor und Werk
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Schluß
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
Arkadij Dolgorukij, ein zorniger junger Mann, unehelicher Sohn eines erfolglosen Gutsbesitzers, will nach oben.
Wie schon in »Der Idiot« macht Dostojewski auch in »Der Jüngling« einen gesellschaftlichen Außenseiter zur Hauptperson. Arkadij steckt voller spinnerter »Ideen«, die er alle enthusiastisch versucht umzusetzen, nur um doch immer wieder zu scheitern.
Seine Reise durch das verkommene, aus den Fugen geratene St. Petersburg führt zur Katastrophe.
Autor und Werk
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (geb. 11. November 1821 in Moskau; gest. 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg) gilt als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller.
Fjodor Dostojewski war das zweite Kind von Michail Andrejewitsch Dostojewski und Maria Fjodorowna Netschajewa. Er hatte zwei Brüder und drei Schwestern. Die Familie entstammte verarmtem Adel; der Vater war Arzt. Nach dem Tod seiner Mutter, 1837, ließ sich Dostojewski mit seinem Bruder Michail in St. Petersburg nieder, wo er von 1838 bis 1843 Bauingenieurwesen studierte. 1839 soll sein Vater auf dem heimischen Landgut durch Leibeigene ermordet worden sein.
Dostojewski war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe mit der Witwe Maria Dmitrijewna Isajewa endete 1864 nach sieben Jahren mit dem Tod Marias und war kinderlos. Seine zweite Frau war Anna Grigorjewna Snitkina. Aus der am 15. Februar 1867 geschlossenen Ehe, die bis zu Dostojewskis Tod andauerte, gingen vier Kinder hervor, von denen jedoch nur zwei das Erwachsenenalter erreichten.
Dostojewski begann 1844 mit den Arbeiten zu seinem 1846 veröffentlichten Erstlingswerk »Arme Leute«. Mit dessen Erscheinen wurde er schlagartig berühmt; die zeitgenössische Kritik feierte ihn als Genie. 1847 trat er dem revolutionären Zirkel bei. 1949 denunzierte man ihn, und er wurde zum Tode verurteilt. Eigentlich hätte er am 22. Dezember 3. Januar 1850 durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden sollen. Erst auf dem Richtplatz begnadigte Zar Nikolaus I. ihn zu vier Jahren Verbannung und Zwangsarbeit in Sibirien, mit anschließender Militärdienstpflicht. In der Haft in Omsk wurde bei Dostojewski zum ersten Mal Epilepsie diagnostiziert.
1854 trat er seine Militärpflicht im Rahmen seiner Verbannung in Semei (Semipalatinsk) an; 1856 wurde er zum Offizier befördert. Nach seiner Heirat 1857 und schweren epileptischen Anfällen beantragte er seine Entlassung aus der Armee, die jedoch erst 1859 bewilligt wurde, sodass Dostojewski nach St. Petersburg zurückkehren konnte.
1859, noch zur Zeit seiner sibirischen Verbannung, entstand sein Roman »Onkelchens Traum«, unmittelbar vor den »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (1860).
Gemeinsam mit seinem Bruder gründete er die Zeitschrift »Zeit« (Wremja), in der im darauf folgenden Jahr sein Roman »Erniedrigte und Beleidigte« erschien.
Bereits 1863 jedoch fiel die Zeitschrift der Zensur zum Opfer und wurde verboten. In der 1860er Jahren reist Dostojewski mehrmals durch Europa.
1863 spielte er zum ersten Mal Roulette. 1864 starben in kurzer Folge Dostojewskis erste Frau, sein Bruder und sein Freund Apollon Grigorjew; die Nachfolgezeitschrift der »Zeit«, die »Epoche«, musste er aus Geldmangel einstellen.
1865 verspielte er beim Roulette in der Spielbank in Wiesbaden seine Reisekasse. Im Mittelpunkt seines 1866 erschienenen Romans »Der Spieler« steht ein Roulettespieler. Im selben Jahr erschien der erste der großen Romane, durch die Dostojewskis Werk Teil der Weltliteratur wurde: »Schuld und Sühne« (oder auch in der Neuübersetzung: »Verbrechen und Strafe«).
Kurz nach seiner zweiten Eheschließung, 1867, nach dem Zusammenbruch der mit seinem Bruder gegründeten zweiten Zeitschrift ins Ausland, um sich dem Zugriff seiner Gläubiger zu entziehen. Er wohnte längere Zeit in Dresden.
Erst 1871 kehrte er wieder nach Russland zurück. Entgegen der weitverbreiteten Annahme, Dostojewski habe große Beträge am Roulettetisch verloren, war er ein Spieler mit geringen Einsetzen, der oft tagelang mit dem Geld eines gerade verpfändeten Kleides seiner Frau spielte.
1868 erschien sein zweites Großwerk, »Der Idiot«, die Geschichte des Fürsten Myschkin, der (wie Dostojewski selbst) unter Epilepsie leidet und aufgrund seiner Güte, Ehrlichkeit und Tugendhaftigkeit in der St. Petersburger Gesellschaft scheitert.
Zu seinem Ende hin verlief das Leben Dostojewskis in ruhigeren Bahnen. Er verfasste seine beiden letzten großen Werke, den Roman »Der Jüngling« -- in der Neuübersetzung »Ein grüner Junge« -- und schließlich den Roman »Die Brüder Karamasow«, den er in den 1860er Jahren, also in der Zeit der Entstehung von »Schuld und Sühne«, begonnen hatte und der die Entwicklung der russischen Gesellschaft bis in die 1880er Jahre behandeln sollte.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski starb am 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg an einem Lungenemphysem; an seinem Begräbnis nahmen 60.000 Menschen teil. Sein Grab befindet sich auf dem Tichwiner Friedhof des Alexander-Newski-Klosters.
Erster Teil
Erstes Kapitel
I
Ich habe dem Drange nicht widerstehen können, mich hinzusetzen und diese Geschichte meiner ersten Schritte auf der Lebensbahn aufzuzeichnen, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre. Aber eines weiß ich ganz genau: um meine ganze Lebensgeschichte zu schreiben, werde ich mich niemals mehr hinsetzen, und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte. Man muß doch gar zu sehr in sich selbst verliebt sein, um von sich selbst zu schreiben, ohne sich zu schämen. Ich entschuldige mich nur damit, daß ich nicht in der Absicht schreibe, in der es alle anderen tun, nämlich um vom Leser gelobt zu werden. Wenn ich mich plötzlich dazu entschlossen habe, alles, was mir im letzten Jahr begegnet ist, eingehend niederzuschreiben, so habe ich es infolge eines inneren Bedürfnisses getan: einen so starken Eindruck hat alles Geschehene auf mich gemacht. Ich werde nur die Ereignisse verzeichnen und alles fremde Beiwerk, namentlich schriftstellerische Finessen, möglichst vermeiden; so ein Schriftsteller schreibt dreißig Jahre lang und weiß zuletzt gar nicht, wozu er eigentlich so lange geschrieben hat. Ich aber bin kein Schriftsteller und will kein Schriftsteller sein, und ich würde es für eine Unschicklichkeit und für eine Gemeinheit halten, wenn ich das Innerste meiner Seele und meine besten Empfindungen auf den Büchermarkt schleppte. Zu meinem Verdruß ahnt mir aber, daß es doch wohl nicht ganz ohne Schilderung von Empfindungen und ohne Reflexionen (vielleicht sogar von trivialer Art) abgehen wird: so sittenverderbend wirkt auf den Menschen eine jede literarische Tätigkeit, auch wenn er sie nur für sich ausübt. Die Reflexionen aber werden vielleicht sogar einen sehr trivialen Eindruck machen, weil das, was man selbst für wertvoll hält, in den Augen eines Fremden leicht wertlos erscheint. Aber lassen wir das alles abgetan sein! Nun habe ich doch eine Vorrede geschrieben; weiter soll aber nichts mehr in diesem Genre vorkommen. Zur Sache also, obgleich nichts schwieriger ist, als zur Sache zu kommen -- vielleicht auf allen Gebieten.
II
Ich fange an, das heißt, ich möchte meine Aufzeichnungen mit dem 19. September vorigen Jahres beginnen, also genau an dem Tag meiner ersten Begegnung mit...
Aber wenn ich so gerade damit herauskäme, wem ich begegnete, ehe noch jemand irgend etwas weiß, so würde das abgeschmackt sein; ich glaube sogar, daß dieser ganze Ton abgeschmackt ist: obwohl ich mir fest vorgenommen, habe, nicht nach literarischen Finessen zu trachten, bin ich doch von der ersten Zeile an in dieses Fahrwasser hineingeraten. Außerdem ist, wie es scheint, zum vernünftig Schreiben der bloße Wunsch, es zu tun, noch nicht ausreichend. Ich bemerke ferner, daß es sich wohl in keiner europäischen Sprache so schwer schreibt wie im Russischen. Ich habe das, was ich hier soeben niedergeschrieben habe, jetzt noch einmal durchgelesen und finde, daß ich weit klüger bin, als ich in dem Geschriebenen erscheine. Woher kommt es, daß bei einem klugen Menschen das, was er sagt, weit dümmer ist als das, was unausgesprochen in ihm zurückbleibt? Ich habe das während dieses ganzen verhängnisvollen letzten Jahres an mir auch beim mündlichen Umgang mit anderen zu wiederholten Malen bemerkt und mich sehr darüber geärgert.
Obgleich ich mit dem 19. September beginnen will, möchte ich doch erst ein paar Worte darüber hersetzen, wer ich bin, wo ich vorher gelebt hatte und wie es somit an jenem Vormittag des 19. September in meinem Kopf teilweise aussah, damit die nachfolgenden Ereignisse dem Leser und vielleicht auch mir selbst verständlicher sind.
III
Ich habe das Gymnasium absolviert und stehe jetzt schon im einundzwanzigsten Lebensjahr. Mein Familienname ist Dolgorukij, und mein legitimer Vater ist Makar Iwanow Dolgorukij, ein ehemaliger Leibeigener der Herrschaft Wersilow. Auf diese Weise bin ich in legitimer Ehe geboren, obwohl ich ein entschieden illegitimer Sohn bin und meine Herkunft nicht dem geringsten Zweifel unterliegt. Das ging folgendermaßen zu:
Vor zweiundzwanzig Jahren besuchte der Gutsbesitzer Wersilow (das nämlich ist mein Vater), der damals fünfundzwanzig Jahre alt war, sein Gut im Gouvernement Tula. Ich vermute, daß er zu jener Zeit noch sehr charakterlos war. Es ist merkwürdig, daß dieser Mann, der seit meiner frühesten Kindheit einen solchen Eindruck auf mich gemacht und einen so gewaltigen Einfluß auf meine ganze seelische Entwicklung ausgeübt hat und vielleicht durch seine Persönlichkeit noch auf lange Zeit hinaus für meine Zukunft bestimmend gewesen ist, daß dieser Mann auch jetzt noch in sehr vieler Hinsicht für mich ein vollständiges Rätsel geblieben ist. Aber davon später. Das läßt sich nicht so von vornherein erzählen. Von diesem Mann werde ich ohnehin in meinem Heft fortwährend zu reden haben.
Er war damals, das heißt im Alter von fünfundzwanzig Jahren, gerade Witwer geworden. Er war mit einer Frau verheiratet gewesen, die zwar den höchsten Gesellschaftskreisen angehörte, aber nicht sehr reich war, einer geborenen Fanariotowa, und hatte von ihr einen Sohn und eine Tochter. Meine Nachrichten über diese so früh von ihm gegangene Gattin sind nur sehr unvollständig und in meinem Material nicht so ohne weiteres zu finden, und auch vieles von Wersilows privaten Lebensverhältnissen ist mir unbekannt geblieben, so stolz, hochmütig, verschlossen und geringschätzig benahm er sich fast immer gegen mich, obgleich er mich zuzeiten durch sein sozusagen demütiges Wesen mir gegenüber in Erstaunen versetzte. Ich erwähne jedoch zur Charakterisierung im voraus, daß er im Laufe seines Lebens drei Vermögen durchgebracht hat und sogar sehr beträchtliche, im ganzen über vierhunderttausend Rubel und vielleicht noch mehr. Jetzt besitzt er natürlich nicht eine Kopeke...
Er kam damals, Gott weiß warum, auf sein Gut, wenigstens drückte er sich mir gegenüber in der Folgezeit so aus. Seine kleinen Kinder hatte er, wie das so seine Gewohnheit war, nicht bei sich, sondern zu Verwandten gebracht; so behandelte er seine Kinder sein ganzes Leben lang, sowohl die legitimen als auch die illegitimen. Das Gesinde auf diesem Gut war sehr zahlreich; darunter befand sich auch der Gärtner Makar Iwanow Dolgorukij. Ich möchte hier einfügen, um es ein für allemal abzutun: selten hat sich wohl jemand über seinen Familiennamen so geärgert, wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe. Das war natürlich dumm von mir, aber ich tat es doch. Jedesmal, wenn ich in eine Schule eintrat oder mit Leuten zusammenkam, denen zu antworten, ich nach meinem Lebensalter verpflichtet war, wiederholte sich dasselbe: jeder Lehrer, jeder Erzieher, jeder Inspektor, jeder Pope, jeder, den man sich nur denken kann, hielt es, nachdem er nach meinem Familiennamen gefragt und gehört hatte, daß ich Dolgorukij heiße, für nötig hinzuzufügen:
»Fürst Dolgorukij?«
Und jedesmal mußte ich all diesen müßigen Fragern antworten:
»Nein, einfach Dolgorukij.«
Dieses einfach brachte mich schließlich beinahe um den Verstand. Ich bemerke dabei als Kuriosität, daß ich mich an keine einzige Ausnahme erinnere: alle stellten sie jene Frage. Manchen war die Sache offenbar ganz egal, und ich weiß auch in der Tat nicht, was für ein Interesse jemand daran haben konnte. Aber alle fragten sie so, alle ohne Ausnahme. Und wenn der Frager dann gehört hatte, daß ich einfach Dolgorukij sei, maß er mich gewöhnlich mit einem stumpfen, gleichgültigen Blick, welcher bekundete, daß er selbst nicht wußte, warum er gefragt hatte, und ging weg. Am beleidigendsten waren derartige Fragen von seiten der Schulkameraden. Denn wie geht es dabei zu, wenn ein Schüler einen Neuen befragt? Der ängstliche, verlegene Neue ist am ersten Tag seines Eintritts in die Schule (was für eine es auch sein mag) das allgemeine Opfer: man befiehlt ihm dies und jenes, hänselt ihn und behandelt ihn wie einen Bedienten. Da stellt sich so ein gesunder, wohlgenährter Bengel gerade vor sein Opfer hin und mustert dieses eine Weile mit strengem, hochmütigem Blick. Der Neue steht schweigend vor ihm da, sieht ihn, wenn er nicht feige ist, von der Seite an und wartet, was da kommen wird.
»Wie heißt du mit Familiennamen?«
»Dolgorukij.«
»Fürst Dolgorukij?«
»Nein, einfach Dolgorukij.«
»Soso, einfach Dolgorukij! Du Schafskopf!«
Und er hat recht: es kann nichts Dümmeres geben, als Dolgorukij zu heißen, ohne Fürst zu sein. Diese Dummheit schleppe ich ohne Schuld mit mir herum. In späterer Zeit, als ich schon anfing, mich sehr darüber zu ärgern, gab ich auf die Frage: »Bist du Fürst?« immer zur Antwort: »Nein, ich bin der Sohn eines Gutsknechts, eines ehemaligen Leibeigenen.«
Und später, als meine Wut schon den höchsten Grad erreicht hatte, antwortete ich auf die Frage: »Sind Sie Fürst?« in festem Ton: »Nein, einfach Dolgorukij, der illegitime Sohn meines ehemaligen Gutsherrn, des Herrn Wersilow.«
Ich hatte mir diese Antwort schon in der sechsten Klasse des Gymnasiums ausgedacht, und obwohl ich bald zu der festen Überzeugung gelangte, daß sie dumm war, hörte ich doch nicht gleich damit auf. Ich erinnere mich, daß ein Lehrer -- übrigens war er der einzige -- fand, ich sei »von rachsüchtigen, freiheitlichen Ideen erfüllt«. Im allgemeinen aber wurde diese schroffe Antwort mit einer für mich beleidigenden Nachdenklichkeit aufgenommen. Schließlich sagte ein mit einer besonders scharfen Zunge begabter Mitschüler, mit dem ich etwa nur einmal im Jahr ein Gespräch führte, zu mir mit erregter Miene, aber ein wenig zur Seite blickend:
»Solche Gefühle machen Ihnen natürlich Ehre, und Sie haben ohne Zweifel allen Grund, darauf stolz zu sein; aber an Ihrer Stelle würde ich mich doch meiner illegitimen Herkunft nicht zu sehr rühmen... aber Sie setzen dabei ja geradezu ein Gesicht auf, als ob Sie Namenstag feierten!«
Seitdem hörte ich auf, mich dessen zu rühmen, daß ich illegitim bin.
Ich wiederhole: es ist sehr schwer, russisch zu schreiben: da habe ich nun ganze drei Seiten darüber vollgeschrieben, wie ich mich lebenslänglich über meinen Familiennamen geärgert habe, und dabei ist der Leser sicherlich, schon zu der Schlußfolgerung gelangt, ich sei eben darüber ärgerlich, daß ich kein Fürst, sondern einfach Dolgorukij bin. Mich darüber noch einmal zu äußern und mich zu rechtfertigen, würde unter meiner Würde sein.
IV
Unter diesem zahlreichen Gutsgesinde also war auch ein Mädchen, und dieses war eben achtzehn Jahre alt, als der fünfzigjährige Makar Dolgorukij auf einmal die Absicht aussprach, es zu heiraten. Ehen des Gutsgesindes wurden zur Zeit der Leibeigenschaft bekanntlich nur mit Erlaubnis der Herrschaft geschlossen und manchmal geradezu auf Anordnung derselben. In der Nähe des Gutes wohnte damals die Tante; das heißt, sie war nicht meine Tante, sondern selbst Gutsbesitzerin; aber ich weiß nicht, warum -- nicht nur ich, alle nannten sie lebenslänglich die Tante, ganz allgemein die Tante, und so wurde sie auch in der Familie Wersilow genannt, mit der sie in Wirklichkeit kaum verwandt war. Es war dies Tatjana Pawlowna Prutkowa. Damals besaß sie noch selbst in jenem Gouvernement und Kreis fünfunddreißig Seelen. Sie verwaltete nicht eigentlich das etwa fünfhundert Seelen umfassende Gut Wersilows, sondern führte nur als Nachbarin die Aufsicht, und diese Aufsicht war, wie ich gehört habe, nicht schlechter als die eines gelernten Verwalters. Übrigens gehen mich ihre geschäftlichen Kenntnisse hier nichts an; ich will nur hinzufügen -- und ich weise dabei jeden Gedanken an Schmeichelei und Gunstbuhlerei zurück --, daß diese Tatjana Pawlowna ein edeldenkendes und sogar ein originelles Wesen war.
Und gerade sie stand den Heiratsabsichten des finsteren Makar Dolgorukij (er soll damals ein finsteres Wesen gehabt haben) nicht nur nicht entgegen, sondern redete ihm vielmehr dabei aus irgendeinem Grund noch außerordentlich zu. Sofja Andrejewna (die achtzehnjährige Gutsmagd, also meine Mutter) war schon seit einigen Jahren elternlos; ihr verstorbener Vater, ebenfalls Gutsknecht, welcher Makar Dolgorukij sehr hochschätzte und ihm irgendwie zu Dank verpflichtet war, hatte, wie man erzählte, sechs Jahre vorher auf seinem Totenbett, eine Viertelstunde vor seinem letzten Atemzug, so daß man es nötigenfalls als Irrereden hätte auffassen können, wenn er nicht ohnedies als Leibeigener rechtsunfähig gewesen wäre, Makar Dolgorukij zu sich rufen lassen und vor dem ganzen Gesinde und in Gegenwart des Geistlichen, indem er auf seine Tochter wies, laut und in eindringlichem Ton zu ihm gesagt: »Zieh sie auf und heirate sie!« Das hatten alle gehört. Was Makar Iwanow anlangt, so weiß ich nicht, in welcher Gesinnung er sie später heiratete, das heißt, ob mit großem Vergnügen oder nur, um damit eine Pflicht zu erfüllen. Das wahrscheinlichste ist, daß er den Eindruck völliger Gleichgültigkeit machte. Er war ein Mensch, der es schon damals verstand, sich zu »präsentieren«. Nicht, daß er ein großer Bibelkenner oder besonders belesen gewesen wäre (obgleich er die ganze Ordnung des Gottesdienstes auswendig kannte und namentlich mit den Lebensbeschreibungen mehrerer Heiligen Bescheid wußte, allerdings mehr vom Hörensagen); auch nicht, daß er so eine Art Klugschwätzer unter dem Gesinde gewesen wäre, sondern er legte einfach eine große Hartnäckigkeit, manchmal sogar Wagemut an den Tag, redete mit Selbstbewußtsein, nahm sein Urteil nie zurück und führte schließlich »einen achtungsvollen Lebenswandel«, wie er sich selbst wunderlicherweise ausdrückte. Von der Art war damals sein Wesen. Natürlich hatte er sich allgemeine Achtung erworben, aber doch konnte ihn, wie gesagt wird, niemand leiden. Das änderte sich, als er von dem Gesinde weggegangen war: nun erinnerte man sich seiner wie eines Heiligen, der viel zu leiden gehabt hatte. Das ist mir zuverlässig bekannt.
Was den Charakter meiner Mutter anlangt, so hatte Tatjana Pawlowna sie bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr bei sich behalten, trotz der dringenden Ratschläge des Verwalters, sie nach Moskau in die Lehre zu geben, und hatte ihr eine gewisse Bildung zukommen lassen, das heißt, sie im Nähen, im Zuschneiden, in anständigem, mädchenhaftem Benehmen und sogar ein wenig im Lesen unterwiesen. Zu schreiben hat meine Mutter niemals leidlich verstanden. In ihren Augen war die Ehe mit Makar Iwanow schon längst abgemachte Sache, und sie fand, daß alles, was damals mit ihr geschah, sehr gut und vortrefflich sei; zum Traualtar ging sie mit der ruhigsten Miene, die man in solchen Fällen überhaupt nur haben kann, so daß Tatjana Pawlowna selbst sie damals einen Fisch nannte. Alles dies über den damaligen Charakter meiner Mutter habe ich von Tatjana Pawlowna selbst gehört. Wersilow kam auf das Gut gerade ein halbes Jahr nach dieser Eheschließung.
V
Ich will nur sagen, daß ich niemals habe in Erfahrung bringen oder in befriedigender Weise kombinieren können, wie eigentlich das Verhältnis zwischen ihm und meiner Mutter begonnen hat. Ich bin durchaus bereit zu glauben, was er mir im vorigen Jahr versichert hat, und zwar unter starkem Erröten, obwohl er über alle diese Dinge mit der ungezwungenen Miene des »geistig hochstehenden« Mannes sprach: daß eine Liebschaft überhaupt nicht stattgefunden habe und alles sich so gemacht habe. Ich glaube durchaus, daß es sich so gemacht hat, und der russische Ausdruck »so« ist ein allerliebster Ausdruck, aber dennoch hätte ich immer gern gewußt, aus welchen Anfängen sich dieses Verhältnis der beiden hat herausbilden können. Ich selbst habe alle diese Gemeinheiten bisher gehaßt und werde sie lebenslänglich hassen. Das Motiv meiner Wißbegierde ist in der Tat durchaus nicht etwa schamlose Neugier. Ich bemerke noch, daß ich meine Mutter bis zum vorigen Jahr fast gar nicht gekannt habe; ich wurde zu Wersilows größerer Bequemlichkeit, wovon ich übrigens später noch sprechen werde, schon in meiner frühen Kindheit zu fremden Leuten gegeben, und daher kann ich mir gar keine Vorstellung machen, wie sie damals ausgesehen haben mag. Wenn sie nun gar nicht so besonders schön gewesen ist, wodurch konnte sich dann ein solcher Mensch, wie es Wersilow damals war, zu ihr hingezogen fühlen? Diese Frage ist für mich insofern von Wichtigkeit, als sich dieser Mensch dabei von einer sehr interessanten Seite präsentiert. Deswegen also werfe ich die Frage auf, und nicht aus moralischer Verderbtheit. Er selbst, dieser finstere, verschlossene Mensch, sagte mir einmal mit jener liebenswürdigen Treuherzigkeit, die er, sobald er es für nötig hielt, Gott weiß woher nahm (es war, als zöge er sie aus der Tasche), er selbst hat mir gesagt, er sei damals noch ein »sehr dummer junger Hund« gewesen, und zwar nicht eigentlich mit sentimentalem Einschlag, sondern einfach so; er hätte damals eben erst »Anton Goremyka« und »Polinka Sachs« gelesen, zwei Literaturprodukte, die auf die damals heranwachsende Generation eine außerordentlich erzieherische Wirkung ausgeübt hätten. Er fügte hinzu, er sei vielleicht gerade infolge der Lektüre des »Antton Goremyka« damals auf sein Gut gefahren, und sagte das in vollem Ernst. In welcher Art mochte dieser »dumme junge Hund« mit meiner Mutter angeknüpft haben? Ich habe mir soeben lebhaft vorgestellt, daß, wenn ich auch nur einen einzigen Leser haben sollte, dieser gewiß über mich lacht als über einen ganz komischen jungen Menschen, der sich seine dumme Unschuld bewahrt hat und sich auf Reflexionen und Urteile über Dinge einläßt, von denen er nichts versteht. Ja, ich verstehe in der Tat noch nichts davon, bekenne das aber ganz und gar nicht mit einem Gefühl des Stolzes, da ich weiß, wie dumm sich eine solche Unerfahrenheit bei einem zwanzigjährigen Schlaps ausnimmt. Nur möchte ich diesem Leser sagen, daß er selbst nichts versteht und ich ihm das beweisen kann. Allerdings weiß ich nichts von den Weibern und will auch nichts von ihnen wissen, weil ich zeit meines Lebens auf sie pfeifen werde und mir das fest vorgenommen habe. Aber ich weiß doch sicher, daß manche Frau den Mann durch ihre Schönheit oder durch sonst etwas in einem Augenblick bezaubert, während man eine andere ein halbes Jahr lang studieren muß, ehe man erkennt, was an ihr ist, und daß, um eine solche Frau zu durchschauen und liebzugewinnen, es nicht ausreicht, sehen zu können und einfach zu allem bereit zu sein, sondern man außerdem auch noch einer besonderen Begabung bedarf. Davon bin ich überzeugt, obwohl ich nichts weiß, und wenn das Gegenteil der Fall wäre, so müßte man alle Frauen mit einemmal auf die Stufe gewöhnlicher Haustiere hinabdrücken und sie nur in dieser Stellung bei sich halten; vielleicht würden das viele sehr gern tun.
Ich weiß durch Mitteilungen von verschiedenen Seiten her positiv, daß meine Mutter keine Schönheit war, obgleich ich ein damals angefertigtes Porträt von ihr, das irgendwo existiert, nicht gesehen habe. Sich auf den ersten Blick in sie zu verlieben, war also nicht möglich. Zum Zweck eines bloßen Amüsements könnte sich Wersilow eine andere aussuchen, und eine solche war da, noch dazu eine unverheiratete, nämlich das Stubenmädchen Antissa Konstantinowna Saposhkowa. Ein Mensch aber, der mit dem Anton Goremyka im Kopf auf sein Gut kam und der dann auf Grund seines Rechts als Gutsherr die Heiligkeit der Ehe von auch nur einem einzigen Leibeigenen verletzte, der hätte sich doch stark vor sich selbst schämen müssen, denn ich wiederhole es: von diesem Anton Goremyka hat er noch vor einigen Monaten, also zwanzig Jahre nach jenen Ereignissen, in durchaus ernstem Ton gesprochen. Und diesem Anton wurde ja nur ein Pferd weggenommen, hier aber die Ehefrau! Es muß also etwas Besonderes stattgefunden haben, weswegen denn auch Mademoiselle Saposhkowa das Spiel verlor (meiner Ansicht nach war es für sie ein Gewinn). Ich habe ihm im vorigen Jahr mit all diesen Fragen ein paarmal zugesetzt, sobald es möglich war, mit ihm ein Gespräch zu führen (denn das war nicht immer möglich), und habe bemerkt, daß er trotz seiner weltmännischen Haltung und obwohl er zwanzig Jahre älter ist als ich, doch Ausflüchte machte. Aber ich ließ nicht locker, und wenigstens murmelte er einmal mit jener Miene vornehmer Geringschätzung, die er sich oft mir gegenüber erlaubte, einen sonderbaren Gedanken vor sich hin: meine Mutter sei eine jener Schutzlosen gewesen, die man nicht eigentlich liebgewinne -- im Gegenteil, durchaus nicht --, sondern gewissermaßen bedaure; ob wegen ihrer Demut oder weshalb sonst, das wisse nie jemand; aber dieses Bedauern halte länger an, und man fühle sich dadurch gebunden... »Mit einem Wort, mein Lieber, die Sache gestaltet sich manchmal so, daß man nicht wieder loskommt.« Das hat er zu mir gesagt, und wenn es tatsächlich so zugegangen ist, so kann ich nicht glauben, daß er damals ein so dummer junger Hund gewesen ist, wie er zu jener Zeit gewesen zu sein angibt. Das mußte ich doch aussprechen.
Übrigens versicherte er mir bei demselben Gespräch, meine Mutter habe ihn aus »Unterwürfigkeit« geliebt: es fehlte nur noch, daß er behauptete, sie habe es gemäß ihrer Pflicht als Leibeigene getan! Er hat gelogen, um der Sache ein schönes Mäntelchen umzuhängen, gelogen gegen sein Gewissen und gegen Ehre und Anstand!
Alles dies habe ich natürlich zum Lob meiner Mutter gesagt, jedoch habe ich bereits erklärt, daß ich von ihrem damaligen Wesen gar keine Kenntnis habe. Wohl aber kenne ich die in ihrer Umgebung herrschenden strengen Anschauungen, in denen sie von klein auf heranwuchs und dann ihr ganzes Leben über verharrte. Und trotzdem geschah das Unglück. Bei dieser Gelegenheit muß ich mich korrigieren: ich bin in die Wolken hinauf geflogen und habe vergessen, eine Tatsache zu berichten, die ich vielmehr hätte ganz an die Spitze stellen sollen: nämlich die Sache begann bei ihnen geradeswegs mit dem Unglück. (Ich hoffe, der Leser wird sich nicht so anstellen, als verstände er nicht sogleich, wovon ich rede.) Kurz, es begann bei ihnen ganz in gutsherrlicher Manier, obwohl Mademoiselle Saposhkowa übergangen war. Aber hier will ich mich verteidigen und von vornherein bemerken, daß ich mir ganz und gar nicht widerspreche. Denn wovon in aller Welt konnte damals ein solcher Mensch wie Wersilow mit einer solchen Person wie meiner Mutter reden, sogar im Fall unbändiger Liebe? Liederliche Menschen haben mir gesagt, daß der Mann, wenn er mit einer Frau zusammenkommt, sehr oft völlig stillschweigend beginnt, was natürlich der Gipfel der Ungeheuerlichkeit und Ekelhaftigkeit ist; dennoch hätte Wersilow, auch wenn er es gewollt hätte, mit meiner Mutter wohl nicht anders anfangen können. Konnte er etwa damit beginnen, ihr Polinka Sachs zu erklären? Und überdies wird der Sinn der beiden wohl gar nicht auf die russische Literatur gerichtet gewesen sein; vielmehr haben sie nach seiner eigenen Mitteilung (er redete einmal etwas offener) sich in den Winkeln versteckt, einander auf den Treppen erwartet und sind wie Bälle mit roten Gesichtern auseinandergefahren, wenn jemand vorbeikam, und der »despotische Gutsbesitzer« hat vor der niedrigsten Scheuermagd gezittert, trotz all seiner Rechte den Leibeigenen gegenüber. Aber wenn das Verhältnis auch in der bei Gutsherren üblichen Art begonnen hatte, so gestaltete es sich doch nachher ganz anders, und es läßt sich dafür im Grunde keine Erklärung geben. Die Sache erscheint einem sogar immer dunkler. Schon allein die zeitliche Ausdehnung, die die Liebe der beiden gewonnen hat, bildet ein Rätsel, denn die erste Voraussetzung bei solchen Menschen wie Wersilow ist doch die, daß sie das betreffende Weib sofort wieder verlassen können, sobald das Ziel erreicht ist. Aber hier kam es anders. Mit einer hübschen, leichtfertigen Gutsmagd zu sündigen (aber meine Mutter war nicht leichtfertig), das war für einen liederlichen »jungen Hund« (und sie waren alle liederlich, alle ohne Ausnahme, sowohl die Fortschrittler als auch die Reaktionäre) nicht nur etwas Erlaubtes, sondern geradezu ein Ding der Notwendigkeit, besonders in Anbetracht seiner romantischen Stellung als junger Witwer und seines müßiggängerischen Lebens. Aber sich für das ganze Leben zu verlieben, das war denn doch ein starkes Stück. Daß er sie wirklich so lange geliebt hat, dafür kann ich mich nicht verbürgen, aber daß er sie sein ganzes Leben lang mit sich herumschleppte, ist sicher.
Ich habe zwar nach vielem gefragt, aber ich muß bemerken, daß ich eine Frage, die wichtigste, nicht gewagt habe, meiner Mutter geradezu vorzulegen, obwohl ich ihr im vorigen Jahre so nahe gekommen bin und überdies als plumper, undankbarer junger Hund, in der Meinung, meine Eltern hätten mir gegenüber eine Schuld auf sich geladen, mit ihr nicht die geringsten Umstände machte. Die Frage war folgende: wie hatte sie, die schon ein halbes Jahr lang verheiratet war und noch ganz, gleich einer kraftlosen Fliege, im Banne der Vorstellungen von der Heiligkeit der Ehe stand, sie, die ihren Makar Iwanowitsch wie einen Gott verehrte, wie hatte sie in ganzen vierzehn Tagen sich bis zu einer solchen Sünde verlieren können? Meine Mutter war ja doch kein liederliches Frauenzimmer! Vielmehr will ich jetzt gleich vorausschicken, daß man sich eine reinere Seele, als sie auch nachher lebenslänglich gewesen ist, nur schwer vorstellen kann. Erklären kann man sich ihr Verhalten vielleicht damit, daß sie ohne Besinnung gehandelt hat, das heißt, nicht in dem Sinne, wie es heutzutage die Advokaten von ihren Mördern und Dieben behaupten, sondern unter der Einwirkung jenes starken Gefühls, das bei einer gewissen Herzenseinfalt des Opfers in verhängnisvoller, tragischer Weise zur Herrschaft gelangt. Wie kann man es wissen; vielleicht hat sie sich sterblich verliebt in... die Fasson seines Rockes, in seinen Pariser Scheitel, in seine französische Aussprache, obwohl sie von dieser Sprache keine Silbe verstand, in eine Romanze, die er zum Klavier sang, in irgend etwas, was sie noch nie gesehen und gehört hatte (und er hatte ein sehr schönes Äußeres), und sich dann gleichzeitig bis zur Bewußtlosigkeit in den ganzen Menschen verliebt mitsamt der Rockfasson und den Romanzen. Ich habe mir sagen lassen, daß das mit den Gutsmädchen zur Zeit der Leibeigenschaft manchmal vorgekommen ist, und gerade mit den anständigsten. Ich habe dafür Verständnis, und ein Schuft ist, wer das einzig aus der Leibeigenschaft und der »Unterwürfigkeit« erklären will! Also ist es doch möglich, daß dieser junge Mensch genug Verführerisches an sich hatte, um ein bis dahin so reines Wesen, und vor allen Dingen ein Wesen, das so ganz anders geartet war als er und aus einer ganz anderen Welt, einem ganz anderen Boden stammte, zu bezaubern und ins offene Verderben zu reißen. Denn daß sie ins Verderben gerissen war, das hat meine Mutter, wie ich hoffe, ihr lebelang eingesehen; nur als sie jenen Schritt tat, wird sie gar nicht an das Verderben gedacht haben; aber so geht es immer mit diesen »Schutzlosen«: sie wissen, daß es ihr Verderben ist, und springen doch hinein.
Nachdem die beiden ihre Sünde begangen hatten, beichteten sie sie sogleich. Er hat mir in geistvoller Art erzählt, daß er an der Schulter von Makar Iwanowitsch, den er eigens aus diesem Anlaß zu sich auf sein Zimmer habe kommen lassen, geschluchzt habe, und sie -- sie lag in diesem Augenblick halb bewußtlos in ihrer ärmlichen Kammer...
VI
Aber genug von solchen Fragen und häßlichen Einzelheiten! Nachdem Wersilow meine Mutter von Makar Iwanow losgekauft hatte, fuhr er alsbald weg und schleppte sie seitdem, wie ich schon oben geschrieben habe, beinahe überall mit sich herum, mit Ausnahme der Fälle, wo er für längere Zeit wegreiste; dann überließ er sie meistens der Obhut der Tante, das heißt der oben erwähnten Tatjana Pawlowna Prutkowa, die sich in solchen Fällen immer einstellte. So wohnten die beiden zusammen in Moskau, so wohnten sie zusammen auf verschiedenen anderen Gütern und in anderen Städten, sogar im Ausland und zuletzt in Petersburg. Von alledem will ich noch später reden, oder es ist auch nicht der Mühe wert. Ich will nur sagen, daß ich ein Jahr nach der Trennung von Makar Iwanowitsch zur Welt kam, noch ein Jahr später meine Schwester, und wieder zehn oder elf Jahre später ein kränklicher Knabe, mein jüngster Bruder, der nach einigen Monaten starb. Die bei der Geburt dieses Kindes ausgestandenen Qualen machten der Schönheit meiner Mutter ein Ende; so ist mir wenigstens erzählt worden: sie begann schnell zu altern und zu kränkeln.
Aber die Beziehungen zu Makar Iwanowitsch wurden doch nicht abgebrochen. Wo Wersilow und meine Mutter sich auch befanden, mochten sie nun ein paar Jahre an einem Ort wohnen oder umherreisen, Makar Iwanowitsch ließ unter allen Umständen »der Familie« Nachricht von sich zugehen. Es bildete sich ein sonderbares Verhältnis heraus, das zum Teil einen ganz feierlich-ernsten Charakter hatte. Im Leben der Herrschaften hätte ein solches Verhältnis zweifellos einen komischen Beigeschmack gehabt, das weiß ich; aber hier war das nicht der Fall. Briefe schickte er zweimal im Jahr, nicht öfter und nicht seltener, und diese Briefe waren sich untereinander außerordentlich ähnlich. Ich habe sie gesehen; sie enthalten sehr wenig Persönliches, sondern nach Möglichkeit nur feierliche Benachrichtigungen über ganz universelle Ereignisse und feierliche Bekundungen ganz universeller Empfindungen, wenn man sich so über Empfindungen ausdrücken kann: Benachrichtigungen in erster Linie von seinem Gesundheitszustand, dann Erkundigungen nach dem Gesundheitszustand der Empfänger, darauf gute Wünsche, feierliche Empfehlungen und Segenssprüche -- das war alles. Gerade diese Allgemeinheit und Unpersönlichkeit des Inhalts scheint von den Angehörigen dieser Gesellschaftsschicht für den verständigsten Ton und für die feinste Verkehrsform gehalten zu werden. »Unserer liebwerten und verehrten Gattin Sofja Andrejewna sende ich unsere ergebenste Empfehlung«... »Unseren liebenswürdigen Kindern sende ich unsern ewig unzerstörbaren väterlichen Segen.« Die Kinder wurden sämtlich mit Namen aufgezählt, in der Reihenfolge, wie sie hinzugekommen waren; auch ich war dabei. Ich füge noch die Bemerkung hinzu, daß Makar Iwanowitsch denn doch so klug war, »Seine Hochgeboren den hochverehrten Herrn Andrej Petrowitsch« niemals seinen »Wohltäter« zu nennen, obwohl er sich ihm unfehlbar in jedem Brief ganz ergebenst empfahl, ihn um seine Huld bat und ihm den Segen Gottes wünschte. Die Antwortschreiben an Makar Iwanowitsch wurden jedesmal alsbald von meiner Mutter abgesandt und waren immer in genau derselben Art abgefaßt. Wersilow beteiligte sich an diesem Briefwechsel selbstverständlich nicht. Makar Iwanowitsch schrieb von den verschiedensten Enden Rußlands her, aus Städten und Klöstern, in denen er manchmal lange Aufenthalt nahm. Er war ein sogenannter ewiger Pilger geworden. Niemals bat er um etwas; dafür erschien er mit Sicherheit alle drei Jahre einmal zu Hause zum Besuch und kehrte dann geradeswegs bei meiner Mutter ein, die -- es traf sich immer so -- eine eigene Wohnung hatte, getrennt von der Wohnung Wersilows. Davon werde ich später noch zu sprechen haben; hier bemerke ich nur noch, daß Makar Iwanowitsch sich nicht etwa im Salon auf den Sofas herumrekelte, sondern sich bescheiden irgendwo in einem Kämmerchen einquartierte. Er blieb nicht lange, nur etwa fünf Tage oder eine Woche.
Ich habe vergessen zu sagen, daß er seinen Familiennamen Dolgorukij außerordentlich liebte und auf ihn den größten Wert legte. Selbstverständlich war das eine lächerliche Dummheit. Das dümmste dabei war, daß ihm sein Familienname gerade deswegen gefiel, weil es Fürsten Dolgorukij gibt. Eine sonderbare, ganz verdrehte Auffassung!
Wenn ich gesagt habe, die ganze Familie sei immer zusammen gewesen, so habe ich mich selbstverständlich ausgenommen. Ich war gewissermaßen ein Ausgestoßener und war schon fast unmittelbar nach meiner Geburt bei fremden Leuten untergebracht werden. Aber das war nicht in irgendeiner besonderen Absicht geschehen, sondern hatte sich einfach von selbst so ergeben. Meine Mutter war, als sie mich zur Welt gebracht hatte, noch jung und schön, und daher brauchte er sie notwendig, und ein kleiner Schreihals wäre in dieser Hinsicht hinderlich gewesen, namentlich auf Reisen. So kam es denn, daß ich bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr meine Mutter fast gar nicht zu sehen bekommen habe, nur zwei- oder dreimal flüchtig. Schuld daran war nicht etwa Mangel an Gefühl bei meiner Mutter, sondern Wersilows Hochmut anderen Menschen gegenüber.
VII
Jetzt von etwas ganz anderem.
Einen Monat vorher, das heißt einen Monat vor dem 19. September, faßte ich in Moskau den Entschluß, mich von all den Meinigen loszusagen und vollständig in meiner Idee aufzugehen. Ich schreibe absichtlich hin: »in meiner Idee aufzugehen«, weil dieser Ausdruck meinen Hauptgedanken, das Ziel, für das ich auf der Welt bin, ziemlich vollständig bezeichnet. Was das für eine Idee ist, davon wird später noch sehr viel zu sprechen sein. In der Einsamkeit meines langjährigen, träumerischen Moskauer Lebens hatte sich diese Idee schon in der sechsten Gymnasialklasse in meinem Kopf gebildet und mich seitdem wohl keinen Augenblick verlassen. Sie verschlang mein ganzes Leben. Ich hatte auch vorher mich oft Träumereien hingegeben und gleich von meiner Kindheit an in jenem bewußten Traumland gelebt; aber als diese wichtigste, alles verschlingende Idee in meinem Kopf aufgetaucht war, hatten meine Träumereien an Kraft gewonnen, eine bestimmte Form angenommen und sich aus törichten zu verständigen entwickelt. Das Gymnasium war den Träumereien nicht hinderlich gewesen; es war ebensowenig der Idee hinderlich. Ich füge jedoch hinzu, daß ich im letzten Schuljahr nur ein schlechter Schüler war, während ich bis zur siebenten Klasse immer zu den ersten gehört hatte; es war dies die Folge eben jener Idee, die Folge eines vielleicht unrichtigen Schlusses, den ich aus ihr gezogen hatte. Auf diese Weise war nicht das Gymnasium der Idee hinderlich, sondern die Idee dem Gymnasium. Sie erwies sich auch für das Universitätsstudium hinderlich. Als ich das Gymnasium absolviert hatte, nahm ich mir sogleich vor, nicht nur mit allen meinen Angehörigen vollständig zu brechen, sondern nötigenfalls auch mit der ganzen Welt, obwohl ich damals erst zwanzig Jahre alt war. So schrieb ich denn durch die angemessene Mittelsperson an die angemessene Stelle in Petersburg, man möge mich künftighin völlig in Ruhe lassen, mir kein Geld mehr zu meinem Unterhalt schicken und mich möglichst ganz vergessen (das heißt, selbstverständlich falls man sich meiner überhaupt noch erinnere), und zum Schluß teilte ich mit, daß ich »um keinen Preis« die Universität beziehen würde. Ich stand vor folgendem unausweichlichem Dilemma: entweder mußte ich mir den Besuch der Universität und den weiteren Ausbau meiner Bildung versagen, oder ich mußte die sonst sofort mögliche Umsetzung der »Idee« in die Tat noch um vier Jahre hinausschieben. Ich entschied mich, ohne zu schwanken, für die Idee, von deren Richtigkeit ich wie von der eines mathematischen Lehrsatzes überzeugt war. Wersilow, mein Vater, den ich erst ein einziges Mal in meinem Leben als zehnjähriger Knabe gesehen hatte (und der in diesem einen Augenblick einen starken Eindruck auf mich gemacht hatte), Wersilow forderte mich in Beantwortung meines Briefes, der übrigens nicht an ihn gerichtet gewesen war, selbst in einem eigenhändigen Schreiben auf, nach Petersburg zu kommen, und stellte mir eine private Anstellung in Aussicht. Diese Aufforderung von seiten eines trockenen, stolzen, mir gegenüber hochmütigen und nachlässigen Mannes, der mich in die Welt gesetzt, mich zu fremden Leuten gegeben, mich gar nicht kennengelernt und dies niemals auch nur bereut hatte (wer weiß, vielleicht hatte er von meinem Dasein überhaupt nur eine unklare, dunkle Vorstellung, da sich später herausstellte, daß auch das Geld für meinen Unterhalt in Moskau nicht von ihm, sondern von anderen gezahlt worden war), die Aufforderung von Seiten dieses Mannes, sage ich, der sich so plötzlich meiner erinnerte und mich eines eigenhändigen Schreibens würdigte, diese mir schmeichelhafte Aufforderung entschied mein Schicksal. In seinem Briefchen (es war nur eine knappe Seite kleinen Formats) gefiel mir seltsamerweise unter anderem besonders, daß er des Universitätsstudiums mit keinem Wort Erwähnung tat, mich nicht bat, meinen Entschluß zu ändern, mir keine Vorwürfe machte, weil ich nicht studieren wollte, kurz, keine väterlichen Redensarten von der üblichen Art machte, und dabei war gerade dies von seiner Seite insofern häßlich, als es seine Gleichgültigkeit mir gegenüber noch stärker zutage treten ließ. Ich entschloß mich, hinzufahren, auch deshalb, weil dies meinem Hauptplan nicht hinderlich war. ›Ich will sehen, was daraus wird‹, dachte ich, ›jedenfalls binde ich mich an sie nur für eine gewisse Zeit, vielleicht nur für ganz kurze Zeit. Sowie ich aber sehen sollte, daß dieser wenn auch nur konventionelle und unbedeutende Schritt mich doch von meinem Hauptplan entfernt, werde ich sogleich mit ihnen brechen, alles im Stich lassen und mich in mein Gehäuse zurückziehen.‹ Geradeso sagte ich zu mir: in mein Gehäuse! ›Ich werde mich wie eine Schildkröte in meinem Gehäuse verbergen‹, dieser Vergleich gefiel mir sehr. ›Ich werde nicht mehr allein sein‹, fuhr ich in meinen Überlegungen fort, während ich diese ganzen letzten Tage in Moskau wie betäubt umherging, ›ich werde jetzt nie mehr allein sein wie bisher so viele schreckliche Jahre hindurch: ich werde jetzt meine Idee haben, der ich niemals werde untreu werden, nicht einmal, wenn ich an allen Menschen dort Gefallen fände und sie mich glücklich machten und ich mit ihnen sogar zehn Jahre zusammen lebte!‹ Aber, wie ich im voraus bemerke, gerade diese Empfindung, gerade diese Zwiespältigkeit meiner schon in Moskau festgelegten Pläne und Ziele, eine Zwiespältigkeit, deren ich mir in Petersburg jederzeit bewußt blieb (denn ich weiß nicht, ob es in Petersburg einen Tag gegeben hat, den ich mir nicht als den endgültigen Termin angesetzt hätte, um mit ihnen zu brechen und davonzugehen), diese Zwiespältigkeit, sage ich, war wohl eine der Hauptursachen der vielen Unvorsichtigkeiten, Schändlichkeiten, ja Gemeinheiten und natürlich auch Dummheiten, die ich in diesem Jahr begangen habe.
Natürlich, ich bekam auf einmal einen Vater, den ich vorher noch nie gehabt hatte. Dieser Gedanke berauschte mich geradezu, sowohl während der Reisevorbereitungen in Moskau, als auch während ich dann im Zug saß. Daß er mein Vater war, schien mir dabei noch nicht das wichtigste, und von Zärtlichkeiten war ich kein Freund, aber wie war es möglich gewesen, daß dieser Mensch mich nicht hatte kennen wollen und mich gedemütigt hatte, während ich diese ganzen Jahre über mich gleichsam in Träumen an ihn angesaugt hatte (wenn man sich bei Träumen so ausdrücken kann)? In allen meinen Träumereien, von meiner Kindheit an, hatte ich mich mit ihm beschäftigt, meine Gedanken hatten sich um ihn gedreht, er war immer der definitive Endpunkt gewesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gehaßt oder geliebt habe, aber er hatte mit seiner Persönlichkeit alle meine Gedanken an die Zukunft, alle meine Spekulationen auf das Leben angefüllt -- und das war ganz von selbst gekommen, zugleich mit meinem Heranwachsen.
Zu meiner Abreise von Moskau trug auch noch ein mächtiger Umstand bei, eine Verlockung, die schon drei Monate vor der Abreise (also zu einer Zeit, wo von Petersburg noch gar nicht die Rede war) mein Herz hatte höher schlagen lassen! Ich fühlte mich nach jenem unbekannten Ozean schon deshalb hingezogen, weil ich ohne weiteres als Herrscher auf ihn hinausfahren konnte, sogar als Herr über fremde Schicksale, und über die Schicksale von was für Menschen! Aber nur großmütige, nicht despotische Gefühle wallten in meinem Innern, das schicke ich voraus, damit meine Worte nicht zu falschen Auffassungen Anlaß geben. Zudem konnte Wersilow denken (falls er mich überhaupt für wert hielt, seine Gedanken auf mich zu richten), da komme so ein junger Bursche, der eben das Gymnasium durchgemacht habe, ein Jüngling, und blicke die Welt mit erstaunten Augen an. Aber dabei kannte ich bereits sein ganzes Geheimnis und hatte ein sehr wichtiges Schriftstück in Händen, für das er (jetzt weiß ich das bereits zuverlässig) mehrere Jahre seines Lebens hingegeben haben würde, wenn ich ihm damals das Geheimnis entdeckt hätte. Ich merke übrigens, daß ich Rätsel aufgegeben habe. Ohne Tatsachen kann man Gefühle nicht schildern. Überdies wird von alledem am gegebenen Ort noch genug und übergenug die Rede sein; darum habe ich ja auch zur Feder gegriffen. Aber so zu schreiben wie jetzt eben, das nimmt sich wie Phantasterei oder Wolkennebel aus.
VIII
Um nun endlich definitiv zum 19. September zu kommen, will ich nur noch in aller Kürze und sozusagen im Vorübergehen bemerken, daß ich sie alle, das heißt Wersilow, meine Mutter und meine Schwester (die letztere sah ich zum erstenmal in meinem Leben), in sehr bedrängten Verhältnissen vorfand: sie waren fast bettelarm oder standen doch unmittelbar vor völliger Armut. Ich hatte davon schon in Moskau gehört, aber doch nicht alles geahnt, was ich nun mit eigenen Augen sah. Ich war von klein auf gewöhnt gewesen, mir diesen Menschen, diesen »meinen künftigen Vater«, beinahe mit einer Art von Glorienschein vorzustellen, und konnte ihn mir gar nicht anders denken als überall auf dem ersten Platz. Wersilow hatte bisher nie mit meiner Mutter in ein und derselben Wohnung gewohnt, sondern ihr immer eine besondere gemietet; allerdings hatte er das nur aus den in solchen Kreisen üblichen gemeinen »Anstandsrücksichten« getan. Aber jetzt wohnten sie alle zusammen in einem Holzhäuschen, in einer Seitenstraße des Semjonowskij Polk. Alle ihre Sachen waren bereits versetzt, so daß ich meiner Mutter ohne Wersilows Wissen meinen heimlichen Schatz, sechzig Rubel, gab. Ich sage: meinen heimlichen Schatz, denn diese Summe hatte ich mir von meinem Taschengeld, das mir im Betrag von fünf Rubeln monatlich verabfolgt wurde, im Laufe von zwei Jahren zusammengespart; begonnen hatte ich mit dem Sparen gleich am ersten Tag, als mir meine »Idee« gekommen war, und darum durfte Wersilow von diesem Geld keine Silbe wissen. Davor zitterte ich.
Diese Beihilfe war nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Meine Mutter arbeitete, und meine Schwester nahm gleichfalls Näharbeit an; Wersilow dagegen ging müßig, betrug sich launenhaft und hatte eine Menge seiner früheren, ziemlich kostspieligen Gewohnheiten beibehalten. Er murrte gewaltig, besonders über das Mittagessen, und sein ganzes Benehmen war völlig despotisch. Aber meine Mutter, meine Schwester, Tatjana Pawlowna und die ganze aus einer Menge von Frauenspersonen bestehende Andronikowsche Familie (Andronikow war ein drei Monate vorher verstorbener Bürovorsteher, der neben seinem Amt Wersilows Geschäftsangelegenheiten besorgt hatte) verehrten ihn andächtig wie einen Fetisch. Ich hatte mir so etwas gar nicht vorstellen können. Ich bemerke, daß er neun Jahre vorher unvergleichlich eleganter gewesen war. Ich habe bereits gesagt, daß er in meinen Träumereien mit einer Art Glorienschein umgeben war, und daher konnte ich es nicht begreifen, wie er in einer Zeit von nicht mehr als neun Jahren so hatte altern und sich zu seinem Nachteil verändern können; das stimmte mich sofort traurig und flößte mir Mitleid und Scham ein. Sein Anblick war einer der peinlichsten Eindrücke, die ich gleich nach meiner Ankunft hatte. Übrigens war er noch durchaus kein alter Mann, er war erst fünfundvierzig Jahre alt; bei genauerer Betrachtung fand ich in seiner immer noch schönen Erscheinung sogar etwas Anziehenderes, als das, was in meiner Erinnerung haftete. Es war jetzt weniger äußerer Glanz, weniger Vornehmheit als damals vorhanden, aber das Leben hatte diesem Gesicht einen viel interessanteren Ausdruck als früher aufgeprägt.
Indessen bildete die Armut nur den zehnten oder zwanzigsten Teil seines Mißgeschicks, und ich wußte das nur zu gut. Außer der Armut lag noch etwas sehr viel Ernsteres vor -- um gar nicht davon zu reden, daß er immer noch Hoffnung hatte, einen Erbschaftsprozeß zu gewinnen, den er schon vor einem Jahr gegen die Fürsten Sokolskij angestrengt hatte; es war daher nicht unmöglich, daß er in allernächster Zeit ein Gut im Werte von sechzigtausend, vielleicht sogar noch mehr Rubeln erhielt. Ich habe schon oben gesagt, daß dieser Wersilow in seinem Leben drei Erbschaften durchgebracht hatte, und da war es nun möglicherweise wieder eine Erbschaft, die ihm aus der Klemme half! Die gerichtliche Entscheidung stand unmittelbar bevor. Im Hinblick darauf war ich auch hergereist. Allerdings gab ihm auf die bloße Hoffnung hin niemand Geld, so daß er nirgends welches borgen konnte; sie mußten daher einstweilen aushalten.
Aber Wersilow ging auch zu niemandem hin, obwohl er manchmal den ganzen Tag fortblieb. Es war schon mehr als ein Jahr her, daß man ihn aus der vornehmen Gesellschaft ausgestoßen hatte. Diese Affäre war mir trotz all meiner Bemühungen in der Hauptsache unklar geblieben, obwohl ich schon einen ganzen Monat lang in Petersburg wohnte. War Wersilow schuldig oder nicht? Das war für mich eine wichtige Frage, und ebendeswegen war ich hergereist! Alle hatten sich von ihm abgewandt, unter anderen auch alle einflußreichen, vornehmen Leute, mit denen Beziehungen zu unterhalten er sein ganzes Leben lang besonders gut verstanden hatte, und zwar war dies geschehen infolge von Gerüchten über eine sehr gemeine und (was in den Augen der »vornehmen Gesellschaft« das allerschlimmste war) aufsehenerregende Handlung, die er vor mehr als einem Jahr in Deutschland begangen haben sollte; es hieß sogar, er habe damals allzu öffentlich eine Ohrfeige erhalten, und zwar gerade von einem der Fürsten Sokolskij, habe aber nicht mit einer Forderung zum Duell geantwortet. Sogar seine Kinder (die legitimen), der Sohn und die Tochter, hatten sich von ihm losgesagt und wohnten von ihm getrennt. Allerdings hatten der Sohn und die Tochter durch die Familie Fanariotow und durch den alten Fürsten Sokolskij (Wersilows ehemaligen Freund) Verkehr mit den höchsten Kreisen. Übrigens fand ich, während ich ihn diesen ganzen Monat lang aufmerksam beobachtete, in ihm einen hochmütigen Menschen, der nicht von der Gesellschaft aus ihrem Kreis ausgeschlossen war, sondern vielmehr seinerseits die Gesellschaft weggejagt hatte, -- eine so selbstbewußte Miene machte er. Aber hatte er ein Recht, eine solche Miene zu machen? Das war’s, worüber ich mich aufregte! Ich mußte unbedingt in kürzester Frist die volle Wahrheit erfahren; denn ich war hergereist, um über diesen Menschen das Urteil zu fällen. Ich hielt meine Macht noch vor ihm verborgen, aber ich mußte ihn entweder anerkennen oder ihn gänzlich von mir stoßen. Das letztere wäre mir gar zu schmerzlich gewesen, und dieser Gedanke bereitete mir Qualen. Ich will nun endlich ein volles Geständnis ablegen: dieser Mensch war mir teuer!
Vorläufig lebte ich mit ihnen in ein und derselben Wohnung, arbeitete und beherrschte mich nur mit Mühe so weit, daß ich nicht grob wurde. Ja, es gelang mir nicht einmal, mich so weit zu beherrschen. Obwohl ich schon einen Monat bei ihnen lebte, kam ich mit jedem Tag mehr zu der Überzeugung, daß ich es absolut nicht fertigbrachte, mich mit der Bitte um endgültige Aufklärung an ihn zu wenden. Der stolze Mensch stand geradezu als ein Rätsel vor mir, das mich in tiefster Seele beleidigte. Er benahm sich gegen mich sogar liebenswürdig und scherzte mit mir, aber mir wären Streit und Zank lieber gewesen als diese Scherze. Alle meine Gespräche mit ihm trugen immer den Charakter einer gewissen Zweideutigkeit, oder, einfacher gesagt, er bediente sich dabei eines eigentümlich spöttischen Tones. Er nahm mich nach meiner Ankunft aus Moskau gleich von vornherein nicht für voll. Ich konnte nicht begreifen, warum er das tat. Allerdings erreichte er dadurch, daß ich in sein Innerstes nicht hineinschauen konnte; aber ich selbst hätte mich nicht dazu erniedrigt, ihn zu bitten, daß er ernst mit mir umgehen möchte. Außerdem hatte er gewisse wunderbare, unwiderstehliche Manieren an sich, gegen die ich nicht aufkam. Kurz gesagt, er behandelte mich wie einen ganz grünen Jungen, was ich kaum ertragen konnte, obgleich ich gewußt hatte, daß es so geschehen würde. Infolgedessen hörte ich selbst auf, ernst zu sprechen, und wartete das Weitere ab; ja, ich redete überhaupt fast gar nicht mehr. Ich wartete auf jemand, dessen Ankunft in Petersburg es mir ermöglichen sollte, endgültig die Wahrheit zu erfahren; das war meine letzte Hoffnung. Jedenfalls bereitete ich mich darauf vor, endgültig mit ihnen zu brechen, und traf dazu schon alle Maßnahmen. Meine Mutter tat mir leid, aber... »entweder er oder ich« -- diese Alternative wollte ich ihr und meiner Schwester stellen. Sogar den Tag hatte ich schon festgesetzt; vorläufig aber ging ich in meinen Dienst.
Zweites Kapitel
I
An diesem 19. September sollte ich auch mein erstes Gehalt für den ersten Monat meiner Petersburger Tätigkeit in meiner »privaten« Stellung erhalten. Wegen dieser Tätigkeit hatte man mich nicht vorher gefragt, sondern mich einfach hingetan, ich glaube, gleich am ersten Tag nach meiner Ankunft. Das war sehr rücksichtslos, und es wäre fast meine Pflicht gewesen, gegen eine solche Behandlung zu protestieren. Diese Stelle war im Hause des alten Fürsten Sokolskij. Aber gleich damals zu protestieren, das hätte den sofortigen Bruch mit ihnen bedeutet, und obgleich mich das durchaus nicht schreckte, so wäre es doch der Erreichung meiner eigentlichen Ziele hinderlich gewesen, und daher hatte ich die Stelle einstweilen stillschweigend angenommen, wobei ich durch dieses Stillschweigen meine Würde wahrte. Erklärend will ich hier gleich zu Anfang bemerken, daß dieser Fürst Sokolskij, ein reicher Mann und Geheimrat, in keiner Weise mit jenen Moskauer Fürsten Sokolskij verwandt war (einer schon seit Generationen gänzlich verarmten Familie), mit denen Wersilow prozessierte. Sie führten nur den gleichen Namen. Nichtsdestoweniger interessierte sich der alte Fürst sehr für sie und mochte besonders einen von diesen Fürsten, sozusagen das Oberhaupt der Familie, einen jungen Offizier, gut leiden. Wersilow hatte noch vor kurzem auf die geschäftlichen Angelegenheiten dieses alten Mannes einen großen Einfluß ausgeübt und war sein Freund gewesen, ein sonderbarer Freund, da der bedauernswerte Fürst, wie ich wahrnahm, eine gewaltige Angst vor ihm hatte, nicht nur zu der Zeit, als ich eintrat, sondern, wie es schien, immer, während der ganzen Dauer der Freundschaft. Übrigens hatten sie einander schon lange Zeit nicht mehr gesehen; die ehrlose Handlung, deren Wersilow beschuldigt wurde, betraf gerade die Familie des Fürsten; aber da war plötzlich Tatjana Pawlowna als Helferin erschienen, und durch ihre Vermittlung war ich bei dem alten Fürsten untergebracht worden, der einen »jungen Mann« als Hilfe in seinem Arbeitszimmer wünschte. Dabei hatte sich herausgestellt, daß er den lebhaften Wunsch hatte, Wersilow einen Gefallen zu erweisen, sozusagen den ersten Schritt zur Versöhnung zu tun; und Wersilow hatte es erlaubt. Der alte Fürst hatte diese Anordnung in Abwesenheit seiner Tochter, einer verwitweten Generälin, getroffen, die ihm diesen Schritt gewiß nicht erlaubt hätte. Aber hiervon später, jetzt bemerke ich nur, daß dieses merkwürdige Benehmen gegenüber Wersilow mir einen starken und für Wersilow günstigen Eindruck machte. Mein Gedanke war dieser: wenn das Oberhaupt der beleidigten Familie immer noch vor Wersilow Achtung hegt, dann muß doch das Gerede über eine von Wersilow begangene Gemeinheit absurd oder wenigstens zweifelhaft und unsicher sein. Eben dieser Umstand hatte mich auch mit dazu veranlaßt, gegen die Übernahme dieser Stellung nicht zu protestieren; indem ich sie antrat, hoffte ich nämlich, dies alles zu überprüfen.
Jene Tatjana Pawlowna spielte damals, als ich sie in Petersburg traf, eine eigentümliche Rolle. Ich hatte sie fast ganz vergessen und in keiner Weise erwartet, daß sie eine so bedeutsame Stellung innehätte. Sie war früher drei- oder viermal während meines Aufenthaltes in Moskau mit mir in Berührung gekommen und war Gott weiß woher in irgend jemandes Auftrag jedesmal erschienen, wenn ich irgendwo untergebracht werden mußte -- bei meinem Eintritt in das schlechte Pensionat des Herrn Touchard, und dann zwei und ein halbes Jahr darauf bei meinem Übergang auf das Gymnasium und meiner Unterbringung bei dem unvergeßlichen Nikolai Semjonowitsch. Nach ihrer Ankunft beschäftigte sie sich jedesmal den ganzen Tag mit mir, revidierte meine Wäsche und meine Kleider, fuhr mit mir nach dem Kusnezkij Most und in die Stadt, kaufte mir alles Notwendige und brachte, kurz gesagt, meine gesamte Ausrüstung bis auf das letzte Schreibkästchen und Federmesserchen in Ordnung; dabei ranzte sie mich die ganze Zeit über an, schalt mich, machte mir Vorwürfe, examinierte mich und stellte mir andere Knaben aus ihrer Bekanntschaft und Verwandtschaft (für mich reine Phantasiegebilde), die alle angeblich viel besser waren als ich, als Muster hin; ja, sie kniff und puffte mich sogar gehörig, und das sogar mehrmals und so, daß es weh tat. Hatte sie mich ausgestattet und an meiner neuen Stelle untergebracht, so verschwand sie für einige Jahre spurlos. Und so war sie auch jetzt gleich nach meiner Ankunft erschienen, um mir wieder ein Unterkommen zu verschaffen. Sie war eine kleine, magere Person mit einem spitzen Vogelnäschen und scharfen Vogeläuglein. Gegenüber Wersilow war sie von einer sklavischen Dienstfertigkeit und verehrte ihn wie einen Papst, aber aus wirklicher Überzeugung. Bald aber bemerkte ich mit Erstaunen, daß sie geradezu überall und bei allen Menschen bekannt war und vor allem überall und von allen Menschen hochgeschätzt wurde. Der alte Fürst Sokolskij benahm sich gegen sie ungewöhnlich respektvoll; ebenso seine Familie; ebenso diese stolzen Kinder Wersilows; ebenso die Fanariotows, -- und dabei lebte Tatjana Pawlowna von Näharbeit und vom Waschen feiner Spitzen und machte Handarbeiten für Läden. Ich und sie gerieten gleich beim ersten Wort miteinander in Streit, weil sie sich sogleich einfallen ließ, mich wie früher, vor sechs Jahren, anzuranzen; seitdem zankten wir uns täglich; aber das hinderte uns nicht, manchmal freundschaftliche Gespräche miteinander zu führen, und ich muß gestehen, daß sie mir gegen Ende des Monats zu gefallen anfing; ich glaube, wegen ihres selbständigen Charakters. Übrigens sagte ich ihr nichts davon.
Ich durchschaute sofort, daß man mir die Stelle bei diesem alten, kranken Herrn nur deshalb übertrug, damit ich für seine Unterhaltung sorgte, und daß darin mein ganzer Dienst bestehen würde. Natürlich erschien mir das entwürdigend, und ich wollte schon sogleich die nötigen Maßnahmen ergreifen; aber sehr bald rief dieser alte Sonderling eine unerwartete Empfindung in mir hervor, eine Art Mitleid, und am Ende des Monats fühlte ich mich in merkwürdiger Weise ihm zugetan, jedenfalls hatte ich die Absicht, ihm grob zu kommen, aufgegeben. Übrigens war er nicht mehr als sechzig Jahre alt. Es war mit ihm eine aufsehenerregende Geschichte passiert. Vor anderthalb Jahren hatte er plötzlich einen Anfall gehabt; er war irgendwo hingereist und unterwegs geisteskrank geworden, so daß daraus eine Art Skandal entstanden war, über den in Petersburg viel geredet wurde. Wie es in solchen Fällen Sitte ist, wurde er sofort ins Ausland geschafft, aber fünf Monate darauf erschien er plötzlich wieder, und zwar vollständig gesund, wenn er auch den Dienst quittierte. Wersilow versicherte allen Ernstes (und mit bemerkenswertem Eifer), daß eine Geistesstörung bei ihm überhaupt nicht vorgelegen habe, sondern nur ein nervöser Anfall. Dieser Eifer Wersilows fiel mir gleich auf. Übrigens will ich bemerken, daß auch ich beinah derselben Ansicht war. Der alte Fürst zeigte höchstens manchmal einen zu seinen Jahren nicht recht stimmenden Leichtsinn, was früher, wie man sagte, nicht der Fall gewesen war. Es hieß, er habe früher irgendwo und irgendwie gute Ratschläge gegeben und sich einmal bei einem ihm erteilten Auftrag besonders ausgezeichnet. Obwohl ich ihn schon einen ganzen Monat kannte, hätte ich nicht geglaubt, daß er als Ratgeber jemals von besonderer Stärke gewesen wäre. Man hatte an ihm bemerkt (obgleich ich es nicht bemerkt hatte), daß sich bei ihm nach jenem Anfall eine besondere Neigung herausgebildet hatte, möglichst bald zu heiraten, und glaubte, daß er in diesen anderthalb Jahren schon mehrmals habe zur Ausführung dieser Idee schreiten wollen. Davon hatte man in der Gesellschaft Kenntnis, und es fanden sich auch Interessenten. Aber da diese Neigung den Interessen gewisser Personen in der Umgebung des Fürsten sehr wenig entsprach, so wurde der alte Mann von allen Seiten argwöhnisch bewacht. Seine eigene Familie war nur klein; er war schon seit zwanzig Jahren Witwer und hatte nur eine einzige Tochter, jene verwitwete Generalin, die jetzt täglich aus Moskau erwartet wurde, eine junge Person, vor deren energischem Charakter er unzweifelhaft Angst hatte. Aber er hatte eine Unmenge verschiedener entfernter Verwandter, namentlich von Seiten seiner verstorbenen Frau, die sämtlich beinahe Bettler waren, und außerdem eine Masse von Pflegesöhnen und Pflegetöchtern, die alle viele Wohltaten von ihm empfangen hatten, nun auf einen kleinen Anteil in seinem Testament hofften und daher alle die Generalin bei der Beaufsichtigung des alten Mannes unterstützten. Er hatte überdies von Jugend auf eine Sonderbarkeit an sich, ich weiß nur nicht, ob ich sie lächerlich finden soll oder nicht: arme Mädchen zu verheiraten. Er gab sich schon seit fünfundzwanzig Jahren damit ab, solche Mädchen zu verheiraten, teils entfernte Verwandte, teils Stieftöchter irgendwelcher Vettern seiner Frau, teils Patenkinder; sogar die Tochter seines Portiers hatte er verheiratet. Er nahm sie zuerst, wenn sie noch ganz klein waren, zu sich ins Haus, zog sie auf, hielt ihnen Gouvernanten und Französinnen, ließ sie dann die besten Lehranstalten besuchen und verheiratete sie schließlich, wobei er ihnen eine Mitgift gab. Dieser ganze Schwarm umdrängte ihn fortwährend. Die Pflegetöchter bekamen natürlich, nachdem sie verheiratet waren, wieder Töchter, und auch alle diese strebten danach, ebenfalls Pflegetöchter zu werden; überall mußte er Pate stehen; zu seinem Namenstag erschien diese ganze Gesellschaft, um zu gratulieren, und das alles machte ihm das größte Vergnügen.