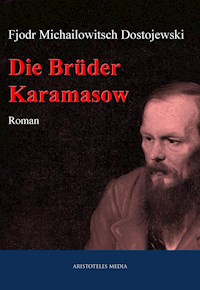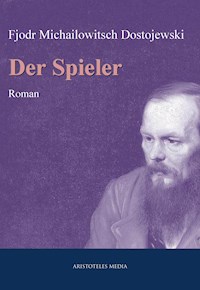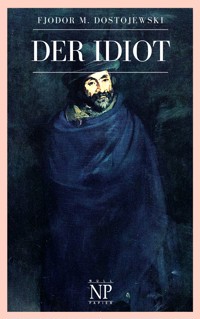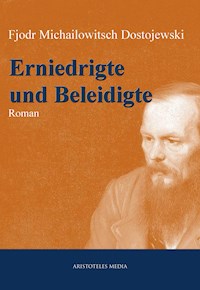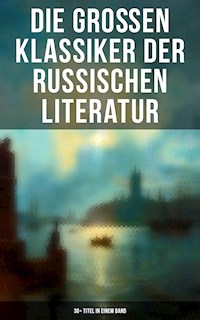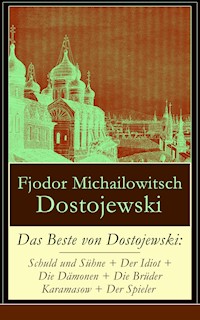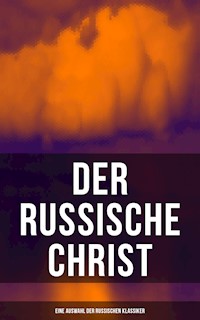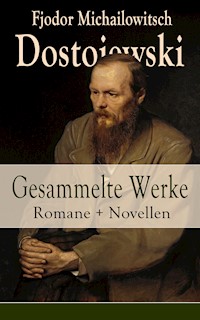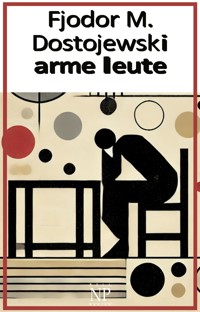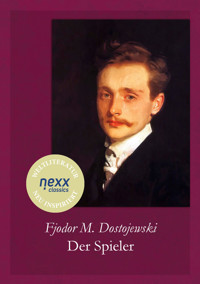Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
mit Übersetzung aller französischen Passagen Der Erzähler Sergej Alexandrowitsch reist aus St. Petersburg auf das Gut seines Onkels, Oberst Rostanew, und stellt fest, dass ein Scharlatan namens Foma Opiskin es geschafft hat, die Menschen um ihn herum glauben zu machen, dass er trotz seines aggressiven, egoistischen und boshaften Verhaltens tugendhaft sei. Foma, ein gescheiterter und untalentierter Schriftsteller mittleren Alters hat die Macht auf dem Gut an sich gerissen, alles tanzt nach seiner Pfeife: Er verpflichtet die Diener, Französisch zu lernen, und verbietet ihnen das Tanzen. Er hält Rostanews Mutter, eine einfältige und ungebildete Frau, in emotionaler Abhängigkeit – Sie himmelt ihn an und hält jedes seiner Worte für sakrosankt. Die Erzählung steigert sich zu einer Verwechslungs- und Entführungsfarce um eine zurückgebliebene Braut und einen Onkel im dritten Frühling. Und Foma muss all seine Manipulationskompetenz aufwarten, um sich schlussendlich als der geläuterte und versöhnende Erlöser feiern zu lassen. Die Geschichte war ursprünglich als Theaterstück gedacht. Erst nach Dostojewskis Tod wurde die Darstellung des Heuchlers Foma Opiskin populär. Die Kürze des Romans bietet einen erstklassigen Einstieg in Dostojewskis Werk. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Das Gut Stepantschikowo und seine Bewohner
Aus den Aufzeichnungen eines Unbekannten
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Das Gut Stepantschikowo und seine Bewohner
Aus den Aufzeichnungen eines Unbekannten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Hermann RöhlFußnoten: Jürgen Schulze 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-64-9
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
I – Der Einzug
II – Herr Bachtschejew
III – Der Onkel
IV – Beim Tee
V – Jeshewikin
VI – Vom weißen Ochsen und vom Komarinski-Tanz
VII – Foma Fomitsch
VIII – Die Liebeserklärung
IX – Seine Exzellenz
X – Misintschikow
XI – Höchstes Erstaunen
XII – Die Katastrophe
Zweiter und letzter Teil
I – Die Verfolgung
II – Neuigkeiten
III – Iljas Namenstag
IV – Aus dem Hause gejagt
V – Foma Fomitsch macht alle glücklich
VI – Schluss
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erster Teil
I – Der Einzug
Mein Onkel, der Oberst Jegor Iljitsch Rostanew, siedelte, als er den Abschied genommen hatte, nach dem Gute Stepantschikowo über, das ihm durch Erbschaft zugefallen war, und führte dort ein Leben, als wäre er von jeher Gutsbesitzer gewesen und hätte seine Besitzungen niemals verlassen. Es gibt Naturen, die schlechthin mit allen zufrieden sind und sich an alles gewöhnen; und von der Art war gerade die Natur dieses Obersten a. D. Man konnte sich schwerlich einen Menschen vorstellen, der friedlicher gewesen wäre und sich williger zu allem hätte bereit finden lassen. Wäre jemand auf den Einfall gekommen, ihn allen Ernstes zu bitten, er möchte irgendeinen Menschen ein paar Werst1 weit auf seinen Schultern tragen, so hätte er das wahrscheinlich getan: er war so gutmütig, dass es ihm nicht darauf ankam, geradezu alles auf die erste Bitte hin wegzugeben, und selbst sein letztes Hemd würde er dem ersten besten, der ihn darum ersucht hätte, geschenkt haben. In seiner äußeren Erscheinung hatte er etwas Reckenhaftes: er war groß und schlank, ebenmäßig, hatte rote Backen, Zähne von der Weiße des Elfenbeins, einen langen, dunkelblonden Schnurrbart und dazu eine laute, klangvolle Stimme sowie ein herzliches, dröhnendes Lachen; er redete in abgehackten Sätzen und sehr schnell. Er war zur Zeit seiner Übersiedelung etwa vierzig Jahre alt und seit seinem sechzehnten Lebensjahr immer Husar gewesen. Er hatte sehr jung geheiratet; seine Frau hatte er grenzenlos geliebt; aber sie war gestorben und hatte in seinem Herzen eine unauslöschliche gute Erinnerung hinterlassen. Als er dann schließlich das Gut Stepantschikowo geerbt hatte und sein Vermögen dadurch auf sechshundert Seelen gestiegen war, quittierte er den Dienst und zog wie gesagt aufs Land, und zwar mit seinen Kindern, dem achtjährigen Ilja, dessen Geburt die Mutter das Leben gekostet hatte, und der älteren Tochter, der fünfzehnjährigen Saschenka, die seit dem Tode der Mutter in einer Moskauer Pension erzogen worden war. Aber bald bekam das Haus meines Onkels eine große Ähnlichkeit mit der Arche Noah. Und das ging folgendermaßen zu.
Zu der Zeit, als er die Erbschaft machte und den Abschied nahm, wurde seine Mama, die in zweiter Ehe einen General Krachotkin geheiratet hatte, wieder Witwe. Sie hatte den General vor ungefähr sechzehn Jahren geheiratet, damals, als der Onkel noch Kornett war, sich aber auch selbst schon mit Heiratsabsichten trug. Seine Mama verweigerte ihm lange ihren Segen zu seiner Heirat, vergoss bittere Tränen und beschuldigte ihn des Egoismus, der Undankbarkeit und der Respektlosigkeit; sie suchte ihm zu beweisen, dass sein Gut, das sich auf zweihundertfünfzig Seelen belief, auch so schon kaum zum Unterhalt seiner Familie ausreichte (das heißt zum Unterhalt seiner Mama mit ihrer ganzen Suite von armen Klientinnen, Möpsen, Spitzen, chinesischen Katzen und so weiter), und mitten in diesen Vorwürfen, Scheltreden und Klageliedern ging sie selbst auf einmal ganz unerwartet noch vor der Heirat ihres Sohnes eine neue Ehe ein, obgleich sie schon zweiundvierzig Jahre alt war. Übrigens fand sie auch dabei einen Grund, meinen armen Onkel zu beschuldigen, indem sie beteuerte, sie heirate einzig und allein, um für ihre alten Tage ein Obdach zu haben; denn dieser respektlose Egoist, ihr Sohn, versage ihr ein solches, indem er auf den unverzeihlich dreisten Einfall gekommen sei, einen eigenen Hausstand zu gründen.
Ich habe nie den wahren Grund ausfindig machen können, der einen allem Anscheine nach so klugen Menschen wie den verstorbenen General Krachotkin, zu dieser Heirat mit der zweiundvierzigjährigen Witwe hat veranlassen können. Ich muss annehmen, dass er Geld bei ihr voraussetzte. Andere meinten, er habe einfach eine Pflegerin gebraucht, da er schon damals jenes ganze Heer von Krankheiten geahnt habe, das ihn später auf seine alten Tage überfiel. Nur so viel steht fest, dass der General seine Frau während ihres ganzen Zusammenlebens sehr respektlos behandelte und bei jeder geeigneten Gelegenheit über sie lachte und spottete. Er war ein eigentümlicher Mensch. Nur halbgebildet, aber durchaus nicht dumm, hegte er gegen alle und jeden eine entschiedene Geringschätzung, hatte keine Grundsätze, machte sich über alles und über alle lustig und wurde im Alter infolge der Krankheiten, die er sich durch seinen nicht sehr korrekten und redlichen Lebenswandel zugezogen hatte, boshaft, reizbar und unbarmherzig. Er hatte eine gute Karriere gemacht, sah sich aber genötigt, wegen eines unangenehmen Vorfalls in recht misslicherweise den Abschied zu nehmen, wobei er nur mit knapper Not einem gerichtlichen Verfahren entging und seine Pension verlor. Das erbitterte ihn nun endgültig. Fast ohne alle Mittel, da er nur gegen hundert wirtschaftlich ruinierte Leibeigene besaß, legte er die Hände in den Schoß und kümmerte sich während seines ganzen übrigen Lebens, das heißt ganze zwölf Jahre lang, nicht darum, wovon er lebe und wer die Kosten seines Unterhaltes bestreite; trotzdem aber beanspruchte er allen möglichen Komfort, schränkte seine Ausgaben nicht ein, hielt sich eine Equipage und so weiter. Bald danach wurde er an den Beinen gelähmt und saß die letzten zehn Jahre lang in einem bequemen Lehnstuhl, der, sobald er es, wünschte, von zwei baumlangen Lakaien geschaukelt wurde, die aber von ihm nie etwas anderes als die mannigfaltigsten Schimpfworte zu hören bekamen. Die Equipage, die Lakaien und den Lehnstuhl bezahlte der respektlose Sohn, der seiner Mutter das Letzte, was er hatte, schickte, sein Gut übermäßig mit Hypotheken belastete, sich das Notwendigste versagte und sich in Schulden stürzte, von denen kaum abzusehen war, wie er sie bei seinem damaligen Vermögen jemals werde bezahlen können; aber dennoch hafteten ihm die Bezeichnungen als Egoist und als undankbarer Sohn unverrückbar an. Aber der Onkel hatte einen solchen Charakter, dass er schließlich selbst glaubte, er sei ein Egoist, und, um sich zu bestrafen und kein Egoist zu sein, immer mehr Geld schickte. Die Generalin vergötterte ihren Mann; am meisten gefiel ihr übrigens an ihm, dass er General und sie infolgedessen Generalin war.
Im Hause hatte sie ihre eigene besondere Wohnung inne, wo sie während der ganzen Zeit der Halbexistenz ihres Mannes in der Gesellschaft ihrer schmarotzenden Klientinnen, der städtischen Neuigkeitskrämerinnen und ihrer Busenfreundinnen, ein ganz behagliches Dasein führte. In ihrem Städtchen war sie eine wichtige Persönlichkeit. Klatschereien, Einladungen zu Taufen und Hochzeiten, Préférence2 um eine Kopeke den Point und der allgemeine Respekt, den man ihrem Range als Generalin entgegenbrachte, entschädigten sie vollkommen für das häusliche Ungemach. Es stellten sich bei ihr sämtliche Klatschbasen der Stadt mit ihren Berichten ein; immer und überall überließ man ihr den ersten Platz, – kurz, sie zog aus ihrer Stellung als Generalin allen Vorteil, der sich nur daraus ziehen ließ. Der General mischte sich in all das nicht ein; aber dafür machte er sich in Gegenwart anderer Leute ungeniert über seine Frau lustig, warf zum Beispiel Fragen von dieser Art auf: wie er eigentlich dazu gekommen sei, eine »solche Betschwester« zu heiraten; und niemand wagte es, ihm zu widersprechen. Allmählich aber zogen sich alle Bekannten von ihm zurück, und dabei war ihm Gesellschaft unentbehrlich: er liebte es, zu plaudern und zu disputieren, und hatte gern ständig einen Zuhörer vor sich sitzen. Er war ein Freigeist und Atheist von altem Schlag und disputierte deshalb auch gern über höhere Gegenstände.
Aber die Einwohner des Städtchens N. fanden an höheren Gegenständen keinen Geschmack, und so wurden denn die Zuhörer des Generals immer spärlicher. Er machte den Versuch, regelmäßig Whist-3 und Préférencepartien mit seinen Hausgenossinnen einzurichten; aber das Spiel endete gewöhnlich mit solchen Wutanfällen des Generals, dass die Generalin und ihre Parasitinnen in ihrer Angst Kerzen vor dem Altar in der Kirche aufstellten, Messen lesen ließen, aus den Bohnen und den Karten die Zukunft zu erfahren suchten, Weißbrot im Gefängnis verteilten und mit Zittern und Beben der Zeit nach dem Mittagessen entgegensahen, wo sie sich wieder zum Whist- oder Préférencespielen hinsetzen und sich für jeden Fehler anschreien, ausschimpfen und beinahe prügeln lassen mussten. Denn wenn dem General etwas nicht gefiel, so legte er sich vor keinem Menschen Zwang auf: er kreischte wie ein Weib und fluchte wie ein Kutscher; ja manchmal, wenn er die Karten zerrissen und auf den Fußboden geworfen und seine Partnerinnen weggejagt hatte, weinte er sogar vor Ärger und Wut, einzig und allein um eines Buben willen, den jemand statt einer Neun abgeworfen hatte. Zuletzt bedurfte er wegen zunehmender Augenschwäche eines Vorlesers. Da erschien Foma Fomitsch Opiskin auf dem Plane.
Ich muss gestehen, nur mit einer gewissen Feierlichkeit gehe ich daran, von dieser neuen Persönlichkeit zu berichten. Sie ist unstreitig eine der wichtigsten in meiner Erzählung. Inwieweit sie Anspruch darauf hat, den Leser zu interessieren, das werde ich nicht erörtern; es wird schicklicher sein, die Entscheidung dieser Frage dem Leser selbst zu überlassen.
Foma Fomitsch übernahm seine Obliegenheiten bei dem General Krachotkin für Wohnung und Kost: er erhielt nicht mehr und nicht weniger. Woher er kam, das ist in tiefes Dunkel gehüllt. Ich habe indes besondere Nachforschungen angestellt und wenigstens etwas über das Vorleben dieses bemerkenswerten Menschen in Erfahrung gebracht. Es hieß erstens, er sei einmal irgendwo Beamter gewesen und habe in dieser Stellung zu leiden gehabt. Es verlautete ferner, er habe sich einmal in Moskau mit schriftstellerischer Tätigkeit abgegeben. Darin liegt nichts Wunderbares; die krasse Unwissenheit Foma Fomitschs konnte natürlich kein Hindernis für seine literarische Laufbahn bilden. Aber in glaubwürdiger Weise bekannt ist nur das eine, dass ihm nichts geglückt war und er sich schließlich gezwungen sah, bei dem General die Stelle als Vorleser und Märtyrer anzunehmen. Jede erdenkliche unwürdige Behandlung ertrug er, um nur vom Tische des Generals sein Essen zu erhalten. Später allerdings, nach dem Tode des Generals, als Foma selbst ganz unerwartet auf einmal eine wichtige, bedeutende Persönlichkeit geworden war, versicherte er uns zu wiederholten Malen, wenn er den Spaßmacher gespielt habe, so sei das eben nur ein großmütiges Opfer gewesen, das er der Freundschaft dargebracht habe; der General sei sein Wohltäter gewesen; dieser große, unverstandene Mann habe nur ihm, Foma, allein die verborgenen Geheimnisse seiner Seele anvertraut; und wenn schließlich er, Foma, auf Verlangen des Generals allerlei Tiere imitiert und lebende Bilder4 dargestellt habe, so habe er das nur getan, um den von seinen Krankheiten niedergedrückten Dulder und Freund zu zerstreuen und aufzuheitern. Aber Foma Fomitschs Versicherungen und Ausdeutungen unterliegen in diesem Falle starkem Zweifel; trotzdem jedoch spielte dieser selbe Foma Fomitsch, schon als er noch Spaßmacher war, in der Damenhälfte des Generalshauses eine ganz andere Rolle. Wie er das fertiggebracht hatte, davon kann sich jemand, der auf diesem Gebiet nicht Spezialist ist, nur schwer eine Vorstellung machen. Die Generalin hegte ihm gegenüber eine Art von mystischer Hochachtung; warum, das ist unbekannt. Allmählich gewann er über die gesamte Weiblichkeit im Hause des Generals eine erstaunliche Macht, ähnlich der Macht eines Iwan Jakowlewitsch oder vergleichbarer Weisen und Propheten, die in den Irrenhäusern von dafür passionierten Damen besucht werden. Er las ihnen Erbauungsbücher vor, erklärte ihnen mit beredten Worten und unter Tränen das Wesen verschiedener christlicher Tugenden, erzählte ihnen von seinem Leben und von seinen Taten, ging zum Gottesdienst und sogar zur Frühmesse, sagte mitunter die Zukunft voraus, verstand besonders gut, Träume zu deuten, und bekrittelte den Nächsten meisterhaft. Der General ahnte das, was in den hinteren Gemächern vorging, und tyrannisierte seinen Parasiten noch schonungsloser. Aber Fomas Märtyrertum verhalf ihm zu noch höherem Ansehen in den Augen der Generalin und all ihrer Hausgenossinnen.
Endlich änderte sich alles. Der General starb. Sein Tod war recht originell. Der frühere Freigeist und Atheist bekam es in unglaublichem Grade mit der Angst. Er weinte, bereute, ließ Heiligenbilder aus der Kirche holen und Geistliche rufen. Es wurden Gebete für ihn gesprochen und ihm die Letzte Ölung erteilt. Der arme Kerl schrie, er wolle nicht sterben, und bat sogar Foma Fomitsch unter Tränen um Verzeihung. Letzterer Umstand verlieh diesem in der Folge eine ganz besondere Glorie. Übrigens spielte sich, unmittelbar bevor sich die Seele des Generals von dem Körper trennte, noch ein eigenartiger Vorfall ab. Die Tochter der Generalin aus erster Ehe, meine Tante Praskowja Iljinitschna, die als alte Jungfer ständig im Hause des Generals lebte, der sie mit besonderer Vorliebe als Opfer seiner Launen benutzte und sie wegen ihrer steten Dienstleistungen während der ganzen zehn Jahre seiner Beinlähmung gar nicht entbehren konnte, da sie mit ihrer schlichten, unverdrossenen Sanftmut die einzige war, die es ihm recht zu machen verstand, – diese trat, heiße Tränen vergießend, an sein Bett und wollte das Kissen unter dem Kopfe des Dulders in Ordnung bringen; aber der Dulder packte sie schnell bei den Haaren und riss sie, beinah schäumend vor Wut, dreimal heftig daran. Zehn Minuten darauf starb er. Dem Oberst wurde Mitteilung davon gemacht, obgleich die Generalin erklärte, sie wolle ihn nicht sehen und würde lieber sterben, als ihn in einem solchen Augenblicke vor ihre Augen kommen zu lassen. Das Begräbnis war prunkvoll, selbstverständlich auf Kosten des respektlosen Sohnes, den die Mutter nicht sehen wollte.
In dem ganz heruntergekommenen Dorfe Knjasewka, welches das Eigentum mehrerer Besitzer war und in welchem dem General hundert Seelen gehörten, erhebt sich ein Mausoleum aus weißem Marmor, dessen Wände mit Inschriften bedeckt sind, die den Verstand, die Talente und das edle Herz des Entschlafenen preisen und seines Generalranges und seiner Orden Erwähnung tun. Bei der Abfassung dieser Inschriften hatte auch Foma Fomitsch stark mitgewirkt. Lange sträubte sich die Generalin, bis sie ihrem ungehorsamen Sohne Verzeihung gewährte. Von dem ganzen Schwarm ihrer Klientinnen und Möpse umgeben, erklärte sie schluchzend und kreischend, lieber wolle sie trockenes Brot essen und es selbstverständlich »mit ihren Tränen anfeuchten«, lieber wolle sie am Bettelstabe gehen und unter den Fenstern um Almosen bitten, als der Bitte des »ungehorsamen« Sohnes nachgeben und zu ihm nach Stepantschikowo ziehen; niemals, niemals werde sie ihren Fuß über die Schwelle seines Hauses setzen! Überhaupt klingt das Wort »Fuß«, in solchem Zusammenhange gebraucht, im Munde mancher Damen außerordentlich effektvoll. Die Generalin sprach es geradezu meisterhaft, mit vollendeter Kunst aus. Kurz, sie warf mit einer unglaublichen Menge schöner Redewendungen um sich. Aber es muss angemerkt werden, dass gleichzeitig mit diesen Zornesergüssen schon sachte mit dem Einpacken ihrer Sachen zum Zwecke der Übersiedelung nach Stepantschikowo begonnen wurde. Der Oberst hetzte alle seine Pferde halbtot, indem er fast täglich die vierzig Werst von Stepantschikowo nach der Stadt zurücklegte, erhielt aber erst vierzehn Tage nach dem Begräbnis des Generals die Erlaubnis, vor den Augen seiner beleidigten Mutter zu erscheinen. Bis dahin hatte Foma Fomitsch als Unterhändler gedient. Diese ganzen vierzehn Tage über hatte er dem ›ungehorsamen‹ Sohne die schmählichsten Vorwürfe wegen seines ›unmenschlichen‹ Benehmens gemacht, sodass derselbe aufrichtige Tränen vergoss und beinah in Verzweiflung geriet. Von diesem Zeitpunkte an begann die unbegreifliche, unmenschliche despotische Herrschaft Foma Fomitschs über meinen armen Onkel. Foma merkte, was für einen Menschen er vor sich hatte, und fühlte zugleich, dass seine Rolle als Spaßmacher zu Ende sei und er nun in Ermangelung eines ernstlichen Konkurrenten selbst den Edelmann spielen könne. So entschädigte er sich denn für die früheren Demütigungen.
»Wie würde Ihnen zumute sein«, sagte Foma, »wenn Ihre eigene Mutter, sozusagen die Urheberin Ihrer Tage, den Bettelstab in die Hand nähme und, mit ihren zitternden, vom Hunger ausgemergelten Händen auf ihn gestützt, wirklich anfinge um Almosen zu bitten? Wäre das nicht etwas ganz Ungeheuerliches, erstens im Hinblick auf ihren Rang als Generalin und zweitens im Hinblick auf ihre Tugenden? Wie würde Ihnen zumute sein, wenn sie auf einmal (selbstverständlich nur aus Versehen; aber es läge ja doch im Bereiche des Möglichen) unter Ihre eigenen Fenster käme und ihre Hand ausstreckte, während Sie, ihr leiblicher Sohn, vielleicht in demselben Augenblicke in einem Daunenbette und … und … nun überhaupt im Luxus versinken? Schrecklich, schrecklich! Aber das Allerschrecklichste (gestatten Sie, dass ich offenherzig mit Ihnen rede, Oberst!), das Allerschrecklichste ist doch dies, dass Sie jetzt wie ein gefühlloser Pfahl vor mir dastehen, den Mund aufsperren und mit den Augen klappern (was sogar unschicklich ist), während Sie schon bei der bloßen Vorstellung eines solchen Falles sich die Haare mit den Wurzeln aus dem Kopfe reißen und Bäche – was sage ich! – Ströme, Seen, Meere, Ozeane von Tränen vergießen müssten …«
Kurz, vor übermäßigem Eifer verstieg sich Foma zu Übertreibungen. Aber das war der gewöhnliche Ausgang seiner Schönrednerei. Selbstverständlich endete die Sache damit, dass die Generalin nebst ihren armen Klientinnen und ihren Hunden sowie nebst Foma Fomitsch und Fräulein Perepelizyna, ihrer engsten Busenfreundin, schließlich doch Stepantschikowo mit ihrer Gegenwart beglückte. Sie sagte, sie wolle nur den Versuch machen, bei ihrem Sohne zu wohnen, und ihn zunächst nur auf die Probe stellen, ob er sich auch respektvoll gegen sie benehme. Man kann sich die Situation des Obersts vorstellen, während er so auf die Probe gestellt wurde! Anfangs hielt es die Generalin in Anbetracht dessen, dass sie eben erst Witwe geworden war, für ihre Pflicht, zwei- oder dreimal in der Woche bei der Erinnerung an ihren unwiederbringlich verlorenen General in Verzweiflung zu geraten, wobei sie aus nicht recht verständlichem Grunde ausnahmslos jedes Mal den Oberst gehörig ausschalt. Manchmal, namentlich wenn Besuch da war, rief sie ihren Enkel, den kleinen Ilja, und die fünfzehnjährige Alexandra, ihre Enkelin, zu sich, setzte sie neben sich, sah sie lange, lange mit traurigen, schmerzerfüllten Blicken an, als bedauere sie die Kinder, die bei einem solchen Vater zugrunde gehen müssten, seufzte tief und schwer und brach dann, ohne ein Wort zu sagen, in geheimnisvolle Tränen aus, was mindestens eine ganze Stunde lang dauerte. Wehe dem Oberst, wenn er diese Tränen nicht zu begreifen vermochte! Und er, der Ärmste, vermochte sie fast nie zu begreifen, kam durch die Tücke des Zufalls in seiner Harmlosigkeit fast jedes Mal zu diesen Tränenergüssen hinzu und musste sich dann, er mochte wollen oder nicht, einem Examen unterwerfen. Aber das Respektvolle seines Benehmens verminderte sich nicht, sondern reichte vielmehr schließlich den denkbar höchsten Grad. Kurz, beide, sowohl die Generalin wie Foma Fomitsch, hatten vollständig die Empfindung, dass die Gewitterwolke, die so viele Jahre lang in der Gestalt des Generals Krachotkin drohend über ihnen gestanden hatte, nun vorübergezogen sei und nie mehr zurückkehren werde. Manchmal ließ sich die Generalin plötzlich ohne jeden äußeren Anlass auf das Sofa sinken und fiel in Ohnmacht. Alles rannte dann hin und her und geriet in hastige Tätigkeit. Der Oberst war ganz fassungslos und zitterte wie Espenlaub.
»Grausamer Sohn!« schrie die Generalin, wenn sie wieder zu sich kam. »Du zerreißt mein Innerstes … mes entrailles, mes entrailles!«
»Aber wodurch zerreiße ich denn Ihr Innerstes, liebe Mama?« erwiderte der Oberst schüchtern.
»Du hast es zerrissen! Du hast es zerrissen! Er will sich noch rechtfertigen! Er wird grob. Grausamer Sohn! Ich sterbe …«
Der Oberst war natürlich ganz niedergeschmettert.
Aber merkwürdigerweise wurde die Generalin, statt zu sterben, immer wieder lebendig. Eine halbe Stunde darauf sagte dann wohl der Oberst zu einem Bekannten, den er beim Knopfe fasste:
»Na, siehst du, lieber Freund, sie ist eben eine grande dame, eine Generalin! Sie ist eine herzensgute alte Dame; aber, weißt du, sie ist an all dieses feine Wesen gewöhnt … und ich Tölpel passe nicht zu ihr! Jetzt ist sie böse auf mich. Gewiss, ich habe mich schuldig gemacht. Allerdings weiß ich immer noch nicht, lieber Freund, was ich eigentlich begangen habe; aber gewiss, ich werde mich schon schuldig gemacht haben …«
Es kam auch vor, dass Fräulein Perepelizyna es für ihre Pflicht hielt, dem Oberst die Leviten zu lesen. Sie war ein schon überreifes Mädchen, das jeden Menschen anzischte, ohne Augenbrauen, mit einer falschen Haartour, mit kleinen, giftig blickenden Augen und fadendünnen Lippen; die Hände pflegte sie sich mit Gurkenlake zu waschen.
»Das kommt daher, dass Sie sich so respektlos benehmen«, sagte sie. »Das kommt daher, dass Sie ein Egoist sind, daher, dass Sie Ihre Mama beleidigen; sie ist daran nicht gewöhnt. Sie ist eine Generalin, während Sie nur Oberst sind.«
»Das ist Fräulein Perepelizyna, lieber Freund«, sagte dann wohl der Oberst erklärend zu seinem Zuhörer, »ein ganz vortreffliches Mädchen, Mamas warme Verteidigerin! Ein Mädchen, wie man es selten findet! Glaube nicht, dass sie hier nur so herumschmarotzt; nein, lieber Freund, sie ist selbst die Tochter eines Oberstleutnants. Ja, so ist das!«
Aber selbstverständlich waren das nur erst die Blüten, aus denen sich später Früchte entwickeln sollten. Dieselbe Generalin, die sich darauf verstand, ihrem Sohne so mancherlei schreckliche Szenen zu bereiten, zitterte ihrerseits wie ein Mäuschen vor dem früheren Spaßmacher des Generals. Foma Fomitsch hatte sie vollständig in seinen Bann gebracht. Sie hatte ihm gegenüber keinen eigenen Willen, hörte mit seinen Ohren, sah mit seinen Augen. Ein Vetter dritten Grades von mir, ebenfalls ein verabschiedeter Husar, ein noch junger Mensch, der aber sein ganzes Vermögen durchgebracht hatte, tief in Schulden steckte und nun eine Zeit lang bei meinem Onkel wohnte, dieser sprach sich mir gegenüber geradezu dahin aus, nach seiner festen Überzeugung stehe die Generalin mit Foma Fomitsch in unerlaubten Beziehungen. Natürlich wies ich damals diese Vermutung als gar zu grob und plump voller Entrüstung zurück. Nein, da lag etwas anderes vor, und was dies war, das kann ich nur dadurch deutlich machen, dass ich im voraus dem Leser Foma Fomitschs Charakter so klarlege, wie ich ihn selbst in der Folge erkannt habe.
Man stelle sich einen ganz unbedeutenden, kleinmütigen Menschen vor, eine Art Fehlgeburt der Gesellschaft, einen Menschen, den niemand zu etwas gebrauchen kann, der völlig unnütz und widerwärtig ist, aber ein grenzenloses Selbstbewusstsein besitzt, jedoch ohne die geringste Begabung, durch die er sein krankhaft gereiztes Selbstbewusstsein auch nur irgendwie rechtfertigen könnte. Ich sage gleich von vornherein: Foma Fomitsch ist eine Verkörperung des grenzenlosesten Selbstbewusstseins, aber zugleich eines besonderen Selbstbewusstseins, nämlich eines Selbstbewusstseins, das mit vollkommener Wertlosigkeit verbunden ist, das, wie es unter solchen Umständen gewöhnlich der Fall ist, viele Kränkungen erlitten hat, durch schwere frühere Misserfolge niedergebeugt ist, schon seit langer Zeit eitert und schwärt und seitdem bei jeder Begegnung, bei jedem fremden Erfolge, Neid und Gift heraustreten lässt. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass all dies mit einer hässlichen Empfindlichkeit, mit einem ganz verrückten Misstrauen gepaart ist. Vielleicht fragt jemand: woher stammt ein solches Selbstbewusstsein? Wie kann es bei so vollständiger Wertlosigkeit, in solch kläglichen Menschen entstehen, die schon vermöge ihrer gesellschaftlichen Stellung wissen müssten, auf welchen Platz sie gehören? Was soll man auf diese Frage antworten? Wer weiß, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, zu denen auch mein Held gehört. Und er ist tatsächlich eine Ausnahme von der Regel, wie sich das auch in der Folge herausstellen wird. Aber gestatten Sie die Frage: Sind Sie wirklich davon überzeugt, dass diejenigen, die sich schon vollständig darein ergeben haben und es als eine Ehre und ein Glück für sich ansehen, Ihre Spaßmacher, Ihre Gnadenbrotempfänger und Parasiten zu sein – sind Sie wirklich davon überzeugt, dass die schon vollständig auf jedes Selbstbewusstsein verzichtet haben? Aber der Neid, die Klatscherei, die Verleumdung, die Denunziationen, das geheime Zischeln in den Hinterzimmern Ihres eigenen Hauses, irgendwo ganz in der Nähe, an Ihrem eigenen Tisch? Wer weiß, vielleicht wird bei manchen dieser vom Schicksal erniedrigten Vagabunden, Ihrer Spaßmacher und Hansnarren, das Selbstbewusstsein durch die Erniedrigung nicht etwa ertötet, sondern vielmehr gerade durch diese Erniedrigung, durch die Stellung als Hansnarren und Spaßmacher, durch das Schmarotzertum, durch die stete notgedrungene Unterordnung und Unselbstständigkeit noch mehr entflammt. Wer weiß, vielleicht ist dieses unförmig aufgeschossene Selbstbewusstsein nichts anderes als ein falsches, von vornherein verzerrtes Gefühl der eigenen Würde, die vielleicht schon in der Kindheit zum ersten Mal durch Bedrückung, Armut, Schmutz und Geringschätzung beleidigt wurde, vielleicht schon in der Person der Eltern des zukünftigen Vagabunden, vor seinen eigenen Augen? Aber ich habe gesagt, dass Foma Fomitsch überdies auch noch eine Ausnahme von der allgemeinen Regel bilde. Und das ist richtig. Er war früher einmal Schriftsteller gewesen, hatte keine Anerkennung gefunden, und das hatte ihn verbittert; denn die Schriftstellerei ist imstande, noch ganz andere Leute als Foma Fomitsch zugrunde zu richten, selbstverständlich dadurch, dass ihnen keine Anerkennung zuteil wird. Ich weiß es zwar nicht, muss aber vermuten, dass Foma Fomitsch auch schon vor seiner schriftstellerischen Tätigkeit Missgeschick gehabt hatte; vielleicht hatte er auch auf anderen Laufbahnen statt des erhofften Lohnes nur Nasenstüber oder noch Schlimmeres erhalten. Darüber ist mir allerdings nichts Sicheres bekannt; aber ich habe später Nachforschungen angestellt und weiß zuverlässig, dass Foma tatsächlich einmal in Moskau einen kleinen Roman verfasst hat, sehr ähnlich denen, die dort in den dreißiger Jahren jährlich zu Dutzenden fabriziert wurden, in der Art wie »Die Befreiung Moskaus«, »Der Hetman Bur«, »Ein Sohn der Liebe oder ein Russe im Jahre 1104« und so weiter und so weiter, Romane, die zu ihrer Zeit dem Witz des Barons Brambäus eine willkommene Zielscheibe darboten. Das war freilich schon lange her; aber eine Verletzung des schriftstellerischen Ehrgeizes wirkt manchmal wie ein tiefer, unheilbarer Schlangenbiss, namentlich bei unbedeutenden, einfältigen Menschen. Foma Fomitsch fühlte sich gleich bei seinem ersten Schritte auf dem Gebiete der Schriftstellerei schwer gekränkt und schloss sich gleich damals an die gewaltige Schar der Verbitterten an, aus der dann alle jene Narren und Vagabunden und Pilger hervorgehen. Schon seit jener Zeit, glaube ich, entwickelte sich bei ihm diese ungeheuerliche Prahlsucht, dieser Durst nach Lob und Auszeichnungen, nach Verehrung und Bewunderung. Schon als er noch die Stellung eines Spaßmachers bekleidete, hatte er ein Häufchen von Idioten um sich gesammelt, die ihn ehrfurchtsvoll anstaunten. Irgendwo und irgendwie der Erste zu sein, den Propheten zu spielen, sich ein Air zu geben und zu prahlen, das war ihm das wichtigste Lebensbedürfnis! Wenn ihn andere nicht lobten, so lobte er sich selbst. Ich selbst habe im Hause meines Onkels in Stepantschikowo Foma zu der Zeit, als er dort schon unumschränkter Herrscher war und für einen Propheten galt, manchmal mit einer Art von geheimnisvoller Wichtigkeit sagen hören: »Ich kann hier unter euch nicht dauernd weilen! Ich sehe mir hier die Sache an, bringe euch alle in geordnete Verhältnisse, gebe euch Anweisung und Belehrung, aber dann sage ich euch Lebewohl und gehe nach Moskau, um dort ein Journal herauszugeben! Dreißigtausend Menschen werden allmonatlich meine Artikel lesen. Dann wird mein Name endlich Klang gewinnen und dann – wehe meinen Feinden!« Aber der geniale Mensch verlangte, schon während er sich noch darauf vorbereitete, berühmt zu werden, sofortige Belohnung. Vorauszahlung zu empfangen ist überhaupt angenehm, und in diesem Falle ganz besonders. Ich weiß, dass er meinem Onkel allen Ernstes versicherte, es sei ihm, Foma, beschieden, eine gewaltige Tat zu vollbringen, eine Tat, zu der er auf dieser Welt berufen sei und zu deren Ausführung ihn eine Art von menschlichem Wesen mit Flügeln oder so etwas Ähnliches antreibe, das ihm bei Nacht erscheine. Er werde nämlich zur Rettung der Menschenseelen eine tiefsinnige Schrift verfassen, von der ein allgemeines Erdbeben ausgehen und ganz Russland erzittern werde. Sobald aber ganz Russland erzittere, werde er, Foma, allen Ruhm verachtend, Mönch werden und Tag und Nacht in den Kiewer Höhlen für das Heil des Vaterlandes beten. All dies übte auf meinen Onkel eine bezaubernde Wirkung aus.
Und nun stelle man sich vor, was aus diesem Foma werden konnte, der sein ganzes Leben lang unterjocht und geknechtet und vielleicht sogar geradezu geprügelt worden war, aus diesem Foma mit seiner geheimen Sinnlichkeit und seiner Selbstsucht, aus Foma, dem verbitterten Schriftsteller, aus Foma, der um des täglichen Brotes willen die Rolle des Spaßmachers gespielt hatte, aus Foma, der trotz all seiner vorhergehenden Erniedrigung und Ohnmacht doch im Grunde seiner Seele ein Despot war, aus Foma, dem Prahler, der sofort frech wurde, wenn ihm etwas geglückt war, aus diesem Foma, der auf einmal zu Ehre und Ruhm gelangt war und gelobt und verhätschelt wurde, dank einer idiotischen Gönnerin und einem verblendeten, zu allem ja sagenden Gönner, in dessen Hause er endlich nach langen Irrfahrten eine Freistatt gefunden hatte! Natürlich muss ich auch noch über den Charakter meines Onkels Näheres mitteilen; denn ohne das würde Foma Fomitschs Erfolg doch nicht recht verständlich sein. Vorher aber möchte ich noch sagen, dass bei Foma sich das Sprichwort bestätigte: ›Wenn man ihn an den Tisch setzt, so legt er gleich die Beine darauf.‹ Ja, Foma entschädigte sich für seine Vergangenheit! Eine gemeine Seele wird, wenn sie aus dem Druck herauskommt, selbst andere bedrücken. Foma war geknechtet worden, und so empfand er denn sogleich das Bedürfnis, andere zu knechten; man hatte sich über ihn lustig gemacht, nun machte er sich über andere lustig. Er war ein Possenreißer gewesen; nun fühlte er sofort das Bedürfnis, sich eigene Possenreißer zu halten. Er prahlte in ganz absurder Weise, brüstete sich unglaublich, stellte für seine Person unsinnige Ansprüche und tyrannisierte andere maßlos. Das ging so weit, dass brave Leute, die noch nicht Zeugen dieses ganzen Treibens gewesen waren, sondern davon nur hatten erzählen hören, dies alles für Fabel und Teufelsspuk hielten, sich bekreuzigten und ausspuckten.
Ich sprach von meinem Onkel und wiederhole: ohne eine genauere Schilderung dieses merkwürdigen Charakters muss eine so unverschämte Herrschaft Foma Fomitschs in einem fremden Hause natürlich unbegreiflich erscheinen, und ebenso unbegreiflich diese Metamorphose eines Possenreißers in einen großen Herrn. Mein Onkel war nicht nur außerordentlich gutmütig, sondern er war auch ein Mensch von ausgesuchtem Zartgefühl (trotz seines etwas plumpen Äußeren!), von höchstem Edelmut und von erprobter Mannhaftigkeit. Ich sage kühn ›Mannhaftigkeit‹; von der Erfüllung einer Pflicht hätte er sich nie abhalten lassen und in solchem Falle kein Hindernis gefürchtet. Seine Seele war rein wie die eines Kindes. Er war tatsächlich ein vierzigjähriges Kind, mitteilsam im höchsten Grade und immer heiter; er hielt alle Menschen für Engel, suchte bei fremden Mängeln die Schuld in sich selbst, vergrößerte gute Eigenschaften anderer übermäßig und setzte solche selbst da voraus, wo sie gar nicht vorhanden sein konnten. Er gehörte zu den Menschen von so edler Denkungsart und so keuschem Herzen, dass sie sich geradezu schämen, bei einem anderen etwas Schlechtes vorauszusetzen, eiligst ihren Nächsten mit allen Tugenden ausstaffieren, sich über fremde Erfolge freuen und auf diese Weise beständig in einer idealen Welt leben, bei einem Missgeschick aber vor allem sich selbst die Schuld geben. Sich für die Interessen anderer aufzuopfern, das ist ihre Berufung. Mancher hätte meinen Onkel wohl kleinmütig, charakterlos und schwach genannt. Allerdings war er schwach und von gar zu weichem Charakter, aber nicht aus Mangel an Festigkeit, sondern aus Furcht, jemanden zu kränken und hart zu verfahren, aus übermäßiger Achtung vor anderen und dem Menschen im Allgemeinen. Übrigens war er nur dann charakterlos und kleinmütig, wenn es sich um seinen eigenen Vorteil handelte, den er im höchsten Grade vernachlässigte, wofür er sein ganzes Leben lang verspottet wurde und das sogar nicht selten von denjenigen, denen er seine Interessen zum Opfer gebracht hatte. Niemals glaubte er, dass er Feinde habe, und doch hatte er solche; aber er bemerkte es eben nicht. Vor Lärm und Geschrei im Hause hatte er die größte Angst, gab sofort in allem nach und fügte sich in alles. Er tat das aus einer Art von verlegener Gutmütigkeit, aus einer Art von schüchternem Zartgefühl; ›sei es drum‹, sagte er in seiner hastigen Weise, um alle Vorwürfe zurückzuweisen, die ihm von Fremden wegen seiner Nachgiebigkeit und Schwäche gemacht wurden, »sei es drum … wenn nur alle zufrieden und glücklich sind!« Es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass er sich jedem edlen Einflusse gern und willig fügte. Ja noch mehr: auch ein gewandter Schurke konnte ihn vollständig in seine Gewalt bringen und ihn sogar zu einer schlechten Handlung verleiten, natürlich nur, wenn er diese schlechte Handlung als eine edle maskierte. Mein Onkel schenkte anderen außerordentlich leicht Vertrauen und beging dabei oft arge Irrtümer. Wenn er aber nach vielen trüben Erfahrungen sich endlich dazu verstand, denjenigen, der ihn betrogen hatte, für einen ehrlosen Menschen zu halten, so schrieb er sich selbst den größten Teil der Schuld, ja nicht selten die alleinige Schuld zu. Und nun stelle man sich vor, dass in seinem friedlichen Hause auf einmal ein launenhaftes, vor Alter schon idiotisch gewordenes Weib die Herrschaft ergriff, in untrennbarem Vereine mit einem anderen Idioten, ihrem Abgott, eine Idiotin, die sich bisher nur vor ihrem General gefürchtet hatte, sich jetzt aber vor nichts mehr fürchtete und sogar das Bedürfnis verspürte, sich für alles Vergangene zu entschädigen, eine Idiotin, der gegenüber sich mein Onkel schon allein deswegen, weil sie seine Mutter war, zu Ehrerbietung und Gehorsam verpflichtet fühlte. Das erste, was die Ankömmlinge taten, war, dem Onkel zu beweisen, dass er roh, hitzig, ungebildet und vor allen Dingen im höchsten Grade egoistisch sei. Merkwürdig war, dass die idiotische Alte selbst an die Wahrheit dieser Beschuldigungen glaubte, und meiner Meinung nach tat dies sogar Foma Fomitsch, wenigstens zum Teil. Auch überzeugten sie den Onkel davon, dass Foma von Gott selbst zu ihm hernieder gesandt sei, um seine Seele zu retten und seine zügellosen Leidenschaften zu besänftigen, und dass er, der Onkel, stolz sei, mit seinem Reichtum prahle und es fertigbringe, seinem Hausgenossen Foma Fomitsch das bisschen Brot zum Vorwurf zu machen. Der arme Onkel kam sehr bald zu der Ansicht, dass er ein moralisch tief gesunkener Mensch sei, und war bereit, sich die Haare zu raufen und um Verzeihung zu bitten …
»Ich bin selbst daran schuld, lieber Freund«, sagte er manchmal, wenn er mit einem seiner Bekannten sprach; »an allem bin ich selbst schuld! Einen Menschen, dem man Gutes erweist, muss man mit verdoppeltem Zartgefühl behandeln … das heißt … was rede ich da! Dem man Gutes erweist! Da habe ich wieder einmal Unsinn geschwatzt! Ich erweise ihm überhaupt nichts Gutes; im Gegenteil, er ist es, der mir damit etwas Gutes erweist, dass er bei mir wohnt, und nicht ich ihm! Na, und doch habe ich ihm das bisschen Brot zum Vorwurf gemacht! … Das heißt, ich habe es ihm gar nicht zum Vorwurf gemacht; aber es muss mir offenbar so ein Wort unversehens über die Lippen gesprungen sein, – das passiert mir öfters … Na, aber schließlich, der Mensch hat viel gelitten, Heldenhaftes geleistet; zehn Jahre lang hat er trotz aller Kränkungen seinen kranken Freund gepflegt und gewartet: all das verlangt eine Belohnung! Na, und dann schließlich die Wissenschaft … Er ist Schriftsteller! Ein hochgebildeter Mensch. Ein durchaus edler Charakter, – mit einem Wort …«
Die Vorstellung, wie der gebildete, unglückliche Foma bei dem launenhaften, grausamen Herrn als Possenreißer fungiert hatte, erfüllte das edle Herz des Onkels mit Mitleid und Empörung. Alle Sonderbarkeiten Fomas, alle seine hässlichen Ausfälle betrachtete der Onkel stets als die natürliche Folge seiner früheren Leiden, seiner Erniedrigung und seiner Verbitterung … Bei seinem zartfühlenden, edlen Herzen sagte er sich jedes Mal sofort, man könne von jemand, der so viel gelitten hatte, nicht dasselbe verlangen wie von einem gewöhnlichen Menschen; man müsse ihm nicht nur verzeihen, sondern vielmehr mit Sanftmut seine Wunden heilen, ihn aufrichten, ihn wieder mit der Menschheit versöhnen. Nachdem er sich dies zum Ziel gesetzt hatte, war er Feuer und Flamme dafür und verlor vollständig die Fähigkeit, zu bemerken, dass sein neuer Freund ein genusssüchtiges, launenhaftes Geschöpf, ein Egoist, Taugenichts und Tagedieb und nichts anderes war. An Fomas Gelehrsamkeit und Genialität glaubte er vorbehaltlos. Ich habe vergessen zu sagen, dass der Onkel vor den Worten »Wissenschaft« und »Literatur« einen höchst naiven Respekt empfand, obgleich er selbst nie etwas gelernt hatte.
Das war eine seiner hervorragendsten, unschuldigsten Sonderbarkeiten.
»Er schreibt ein Werk!« sagte er manchmal, wenn er, noch zwei Zimmer weit von Fomas Zimmer entfernt, auf Zehenspitzen ging. »Ich weiß nicht, was er eigentlich schreibt«, fügte er mit stolzer, geheimnisvoller Miene hinzu; »aber es wird gewiss so’n Zeug sein … Das heißt, Zeug im guten Sinne. Mancher mag’s ja verstehen; aber für dich und mich, lieber Freund, sind das solche Rätsel, dass … Ich glaube, er schreibt über die Produktivkräfte, – so hat er selbst gesagt. Das ist gewiss etwas Politisches. Ja, sein Name wird einen großen Klang haben! Dann werden auch du und ich durch ihn berühmt werden. Das hat er mir selbst gesagt, lieber Freund …«
Ich weiß zuverlässig, dass der Onkel auf Fomas Befehl sich seinen schönen, dunkelblonden Backenbart abrasieren musste. Foma war der Ansicht, mit dem Backenbart sehe der Onkel wie ein Franzose aus und bekunde daher wenig Vaterlandsliebe. Nach und nach begann sich Foma auch in die Verwaltung des Gutes einzumischen und weise Ratschläge zu geben. Diese weisen Ratschläge waren fürchterlich. Die Bauern merkten bald, wie die Dinge lagen und wer der eigentliche Herr war, und kratzten sich tüchtig im Nacken. Ich habe in der Folge selbst ein Gespräch Foma Fomitschs mit den Bauern angehört; ich muss gestehen, dass ich es belauschte: Foma hatte schon früher geäußert, dass er gern mit dem verständigen russischen Bauern rede. So ging er denn einmal auf die Tenne, sprach mit den Bauern über Landwirtschaft, obgleich er selbst nicht Hafer von Weizen zu unterscheiden wusste, und setzte ihnen dann in süßem Tone die heiligen Pflichten des Bauern gegen die Herrschaft auseinander, wobei er auch die Fragen der Elektrizität und der Arbeitsteilung streifte, Dinge, von denen er natürlich keine blasse Ahnung hatte, und seinen Zuhörern erklärte, wie die Erde um die Sonne gehe; endlich kam er, ganz gerührt von seinem eigenen schönen Vortrag, auf die Minister zu sprechen. Ich hatte für sein Benehmen Verständnis. Erzählt doch auch Puschkin von einem Vater, der zu seinem vierjährigen Söhnchen sagte, er, der Papa, sei so tapfer, dass der Kaiser ihn liebhabe. Dieser Vater brauchte eben einen Zuhörer, mochte derselbe auch erst vierjährig sein. Die Bauern aber hörten immer pflichtschuldig an, was Foma Fomitsch sagte.
»Aber wie ist das, Väterchen? Hast du viel Gehalt vom Kaiser bekommen?« fragte ihn auf einmal aus der Schar der Bauern ein grauhaariger Alter, Archip, mit dem Spitznamen »der Kurze«, in der deutlichen Absicht, sich dadurch einzuschmeicheln; aber Foma Fomitsch erachtete diese Frage für zu familiär, und übermäßige Familiarität konnte er nicht leiden.
»Was geht dich das an, du Tölpel?« antwortete er und sah das arme Bäuerlein verächtlich an. »Warum hältst du mir dein Mopsgesicht hin? Soll ich dir hineinspucken?«
Foma Fomitsch redete immer in diesem Ton mit dem »verständigen russischen Bauern«.
»Väterchen«, sagte ein anderer Bauer, »wir sind ungebildete Leute. Vielleicht bist du Major oder Oberst oder gar eine Exzellenz, – wir wissen gar nicht einmal, wie wir dich anreden müssen.«
»Tölpel!« betitelte Foma Fomitsch auch diesen, wurde jedoch etwas milder. »Zwischen Gehalt und Gehalt ist ein Unterschied, du einfältiger Kerl! Manch einer hat Generalsrang, bekommt aber doch nichts, weil er es nicht verdient und dem Zaren keinen Nutzen bringt. Ich aber bekam, als ich beim Minister angestellt war, zwanzigtausend Rubel; die nahm ich jedoch nicht für mich, da ich meine Amtstätigkeit um der Ehre willen ausübte und auch genug eigenes Vermögen besaß. Ich gab mein Gehalt für Zwecke der Volksbildung im Reiche hin und für die abgebrannten Einwohner von Kasan.«
»Nun sieh mal an! Also du bist es gewesen, der Kasan wieder aufgebaut hat, Väterchen?« fuhr der Bauer erstaunt fort.
Die Bauern waren überhaupt von Bewunderung für Foma Fomitsch erfüllt.
»Na ja, auch ich habe mein Teil dazu beigetragen«, antwortete Foma, anscheinend nur ungern, als ärgere er sich über sich selbst, dass er einen solchen Menschen eines solchen Gespräches würdigte.
Von anderer Art waren seine Gespräche mit dem Onkel.
»Wer waren Sie früher?« sagte Foma zum Beispiel, während er sich nach einem guten, reichlichen Mittagessen in einem bequemen Lehnstuhl rekelte, wobei ein hinter dem Lehnstuhl stehender Diener ihm mit einem frischen Lindenzweige die Fliegen wegwedeln musste. »Was für ein Mensch waren Sie vor meiner Ankunft? Aber ich habe in Sie einen Funken jenes himmlischen Feuers hineingeworfen, das jetzt in Ihrer Seele brennt. Habe ich in Sie einen Funken des himmlischen Feuers hineingeworfen oder nicht? Antworten Sie: habe ich in Sie einen Funken hineingeworfen oder nicht?«
In Wahrheit wusste Foma Fomitsch selbst nicht, warum er diese Frage stellte. Aber das Stillschweigen und die Verlegenheit des Obersten versetzten ihn sofort in Aufregung. Er, der früher so schüchtern und geduldig gewesen war, ging jetzt bei dem geringsten Widerspruch in die Luft wie Schießpulver. Das Schweigen des Onkels schien ihm beleidigend, und nun bestand er hartnäckig auf einer Antwort.
»So antworten Sie doch: brennt der Funke in Ihnen oder nicht?«
Der Onkel krümmte und wand sich und wusste nicht, wie er reagieren sollte.
»Gestatten Sie mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass ich warte«, bemerkte Foma in gekränktem Ton.
»Mais répondez donc, Jegoruschka!«5 fiel die Generalin achselzuckend ein.
»Ich frage: brennt in Ihnen dieser Funke oder nicht?« wiederholte Foma herablassend und nahm ein Stück Konfekt aus der Bonbonniere, die auf Anordnung der Generalin immer vor ihm auf dem Tisch stehen musste.
»Ich weiß es wahrhaftig nicht, Foma«, antwortete der Onkel schließlich mit verzweifelter Miene; »es muss wohl so etwas der Fall sein … Wirklich, frage lieber nicht; sonst rede ich noch irgendwelchen Unsinn …«
»Schön! Also bin ich Ihrer Meinung nach ein so wertloses Subjekt, dass ich nicht einmal eine Antwort verdiene, – das wollten Sie doch sagen? Nun, mag es denn so sein, dann bin ich also ein Nichts!«
»Aber nein doch, Foma, ich bitte dich um alles in der Welt! Wann hätte ich denn das sagen wollen?«
»Doch! Gerade das wollten Sie sagen.«
»Aber ich schwöre dir, dass es nicht so ist!«
»Schön! Dann bin ich also ein Lügner! Dann beschuldigen Sie mich also, absichtlich einen Vorwand zum Streit zu suchen. Nun, mag zu allen bisherigen Beleidigungen auch diese noch hinzukommen; ich werde alles ertragen …«
»Mais mon fils! …« schrie die Generalin auf.
»Foma Fomitsch! Mamenka!« rief der Onkel in heller Verzweiflung. »Bei Gott, ich kann nichts dafür! Es müsste mir denn unversehens ein Wort über die Lippen gerutscht sein! … Nimm’s mit mir nicht so genau, Foma: ich bin ja nur ein dummer Kerl, ich habe selbst das Gefühl, dass ich dumm bin; ich merke das selbst, dass in mir nicht alles in Ordnung ist … Ich weiß, Foma, ich weiß alles! Du brauchst gar nichts weiter zu sagen!« fuhr er mit einer abwehrenden Handbewegung fort. »Vierzig Jahre lang habe ich gelebt und bis jetzt, bis zu der Zeit, wo ich dich kennenlernte, immer im stillen gedacht, dass ich ein Mensch sei … na, und dass alles mit mir so wäre, wie es sich gehört. Ich hatte ja bis dahin gar nicht gemerkt, dass ich ein hartnäckiger Sünder und ein Egoist erster Klasse bin und eine solche Masse Übeltaten begangen habe, dass man sich darüber wundern muss, dass mich die Erde noch trägt!«
»Ja, ein Egoist sind Sie!« bemerkte Foma Fomitsch im Tone tiefster Überzeugung.
»Das sehe ich jetzt ja auch selbst ein, dass ich ein Egoist bin! Aber ganz bestimmt: ich werde mich bessern und ein anderer Mensch werden!«
»Das gebe Gott!« schloss Foma Fomitsch das Gespräch mit einem frommen Seufzer und erhob sich von seinem Lehnstuhl, um sich zum Nachmittagsschläfchen wegzubegeben. Foma Fomitsch schlief immer nach Tisch.
Am Schluss dieses Kapitels sei es mir erlaubt, über meine persönlichen Beziehungen zu meinem Onkel einige Worte zu sagen und zu erklären, wie es zuging, dass ich auf einmal Foma Fomitsch gegenübertrat und nolens volens plötzlich in den Strudel der wichtigsten Ereignisse hineingeriet, die sich jemals in dem lieben, guten Stepantschikowo zugetragen haben. Damit beabsichtige ich meine Vorrede zu beschließen und werde dann sofort zur Erzählung übergehen.
In meiner Kindheit, als ich eine Waise geworden und allein auf der Welt zurückgeblieben war, vertrat mein Onkel an mir Vaterstelle, erzog mich auf seine Kosten und tat, kurz gesagt, für mich, was nicht immer ein leiblicher Vater für seinen Sohn tut. Gleich vom ersten Tage an, wo er mich zu sich nahm, schloss ich mich von ganzem Herzen an ihn an. Ich war damals zehn Jahre alt, und ich erinnere mich, dass wir uns bald anfreundeten und einander vollkommen verstanden. Wir spielten zusammen Brummkreisel und stahlen einer bösen alten Dame, die mit uns beiden verwandt war, eine Haube. Die Haube band ich sofort an den Schwanz eines Drachens und ließ sie mit diesem an die Wolken steigen. Viele Jahre später sah ich den Onkel auf kurze Zeit in Petersburg wieder, wo ich damals auf seine Kosten studierte. Diesmal schloss ich mich ihm mit dem ganzen Feuer der Jugend an: der Edelmut, die Milde, die Aufrichtigkeit, die Heiterkeit und die grenzenlose Naivität seines Charakters imponierten mir, wie sich denn jeder unwillkürlich davon angezogen fühlte. Nach meinem Abgang von der Universität blieb ich noch einige Zeit in Petersburg; ich hatte zunächst keine eigentliche Beschäftigung, war aber, wie das bei Grünschnäbeln häufig vorkommt, davon überzeugt, dass ich in kürzester Frist viel Bedeutsames und sogar Großartiges leisten würde. Ich mochte Petersburg nicht verlassen. Mit dem Onkel korrespondierte ich nur ziemlich selten und nur, wenn ich Geld brauchte, das er mir nie abschlug. Inzwischen kam einmal jemand von den Gutsleuten meines Onkels in Geschäften nach Petersburg, und von diesem hörte ich, dass bei ihnen in Stepantschikowo wunderliche Dinge vorgingen. Diese ersten Gerüchte erregten mein Interesse und versetzten mich in Erstaunen. Ich begann, häufiger an meinen Onkel zu schreiben. Seine Antworten klangen immer etwas dunkel und seltsam, und er bemühte sich in jedem Briefe, nur von den Wissenschaften zu reden; denn er erwartete von mir auf dem Gebiete der Gelehrsamkeit in der Zukunft außerordentlich viel und war schon im voraus auf meine künftigen Erfolge stolz. Auf einmal erhielt ich von ihm nach einem ziemlich langen Stillschweigen einen ganz wunderlichen Brief, der mit allen seinen früheren Briefen nicht die geringste Ähnlichkeit hatte. Er war mit so sonderbaren Andeutungen und mit einem solchen Sammelsurium von Widersprüchen angefüllt, dass ich anfänglich fast nichts davon verstand. Klar war nur, dass der Schreiber sich in ungewöhnlicher Aufregung befunden hatte. Eines in diesem Brief war deutlich: der Onkel machte mir allen Ernstes mit dringenden, fast flehenden Worten den Vorschlag, ich möchte so bald wie möglich seine frühere Pflegetochter heiraten; es war dies die Tochter eines ganz armen Provinzialbeamten namens Jeshewikin, die in einem Moskauer Erziehungsinstitut auf Kosten des Onkels eine vortreffliche Bildung genossen hatte und jetzt die Gouvernante seiner Kinder war. Er schrieb, sie sei unglücklich; ich könne sie glücklich machen, und es würde sogar eine hochherzige Handlung meinerseits sein; er wandte sich an den Edelmut meines Herzens und versprach, ihr eine Mitgift zu geben. Von der Mitgift sprach er übrigens nur in einer geheimnisvollen, ängstlichen Weise und schloss den Brief mit der dringenden Bitte, ich möchte über all dies tiefstes Stillschweigen bewahren. Dieser Brief setzte mich dermaßen in Erstaunen, dass mir schließlich im Kopf ganz schwindlig wurde. Und auf welchen jungen Mann, der, wie ich, eben erst von der Lehrbank aufgesprungen war, hätte ein solcher Vorschlag auch nicht einen starken Eindruck gemacht, schon allein durch das Romantische, das darin lag? Überdies hatte ich gehört, dass diese junge Gouvernante sehr hübsch sei. Ich wusste jedoch nicht, was ich für einen Entschluss fassen sollte, wiewohl ich meinem Onkel umgehend schrieb, ich würde unverzüglich nach Stepantschikowo kommen. Der Onkel hatte mir mit demselben Brief auch das Reisegeld geschickt. Dennoch zögerte ich, von Zweifeln und Unruhe erfüllt, mit der Abreise und blieb noch drei Wochen in Petersburg. Auf einmal traf ich zufällig einen früheren Kameraden meines Onkels vom Militär, der auf der Rückreise vom Kaukasus nach Petersburg unterwegs in Stepantschikowo mit herangefahren war. Es war dies ein schon älterer, verständiger Mann, ein eingefleischter Junggeselle. Voller Entrüstung erzählte er mir von Foma Fomitsch und teilte mir zugleich etwas mit, wovon ich bisher noch keine Ahnung gehabt hatte, nämlich dass Foma Fomitsch und die Generalin auf den Gedanken gekommen seien und die Absicht hätten, den Onkel mit einer sehr sonderbaren halbverdrehten alten Jungfer zu verheiraten, die eine merkwürdige Lebensgeschichte und eine Mitgift von beinah einer halben Million habe; die Generalin habe sie bereits zu der Überzeugung gebracht, dass sie mit ihr verwandt sei, und sie dadurch veranlasst, nach Stepantschikowo zu ziehen; der Onkel sei allerdings in Verzweiflung; aber allem Anschein nach werde die Sache doch damit enden, dass er die halbe Million heirate. Endlich erfuhr ich auch noch, dass die beiden Intriganten, die Generalin und Foma Fomitsch, die arme, schutzlose Gouvernante der Kinder des Onkels in einer entsetzlichen Weise peinigten und mit aller Gewalt aus dem Hause zu treiben suchten, wahrscheinlich aus Furcht, dass der Oberst sich in sie verlieben könne, möglicherweise auch, weil er sich bereits in sie verliebt habe. Diese letzten Worte waren mir auffällig. Indes auf all meine Fragen, ob der Onkel sich wirklich schon verliebt habe, konnte oder wollte der Erzähler mir keine genaue Antwort geben; überhaupt erzählte er sehr wortkarg und nur ungern und vermied es augenscheinlich, nähere Aufklärungen zu geben. Ich wurde nachdenklich; diese Nachricht stand mit dem Brief des Oheims und mit seinem Vorschlag in einem gar zu seltsamen Widerspruch … Aber länger zu zögern hatte keinen Zweck. Ich beschloss, nach Stepantschikowo zu fahren, um nicht nur meinen Onkel zur Vernunft zu bringen und zu beruhigen, sondern auch, wenn möglich, ihn zu retten, das heißt Foma aus dem Hause zu jagen, die garstige Heirat mit der alten Jungfer zu vereiteln und endlich, da nach meiner endgültigen Überzeugung die Liebe meines Onkels nur ein verrückter Einfall Foma Fomitschs war, das unglückliche, aber gewiss interessante junge Mädchen durch einen Heiratsantrag glücklich zu machen und so weiter und so weiter. Allmählich steigerte ich mich in eine solche Begeisterung hinein, dass ich infolge meiner Jugend und infolge des Mangels an ernster Beschäftigung von den Zweifeln und Bedenken zum entgegengesetzten Extrem überging: ich brannte nun vor Begierde, möglichst bald allerlei Wundertaten zu vollbringen. Es schien mir sogar, dass ich eine außerordentliche Großmut bewiese, indem ich mich edelmütig aufopferte, um ein unschuldiges, reizendes Geschöpf glücklich zu machen; kurz, ich erinnere mich, dass ich während der ganzen Fahrt sehr mit mir zufrieden war. Es war Juli, die Sonne schien hell, ringsumher dehnten sich in unabsehbarer Weite Felder mit reifem Getreide aus. Ich aber war so lange in Petersburg wie in einer Flasche eingesperrt gewesen, dass mir zumute war, als ob ich erst jetzt wirklich Gottes Welt erblickte!
Russ. Wegmaß, etwa 1 km <<<
Kartenspiel <<<
Kartenspiel mit 52 Karten <<<
Lebende Bilder – eine Mode des 18. Jahrhunderts: ein populäres Bild durch lebende Menschen mit Dekoration darstellen. Vgl. Goethes Wahlverwandtschaften. <<<
Aber antworte mir, Jegoruschka! <<<
II – Herr Bachtschejew
Ich näherte mich schon dem Ziel meiner Reise. Als ich durch das kleine Städtchen B. kam, von wo ich nur noch zehn Werst bis Stepantschikowo hatte, war ich gezwungen, bei der Schmiede dicht am Schlagbaum anzuhalten, weil die Schiene an dem einen Vorderrad meines Reisewagens gebrochen war. Sie konnte in verhältnismäßig kurzer Zeit so weit festgemacht werden, dass sie für die noch fehlenden zehn Werst vorhielt, und daher beschloss ich, nicht erst in ein Wirtshaus zu gehen, sondern bei der Schmiede zu warten, bis die Schmiedegesellen mit der Arbeit fertig sein würden. Als ich aus dem Wagen stieg, sah ich einen dicken Herrn, der, ebenso wie ich, genötigt war, wegen einer Reparatur seiner Equipage zu halten. Er stand schon eine ganze Stunde in der unerträglichen Sonnenglut da, schrie und schimpfte und trieb mit mürrischer Ungeduld die Schmiedegesellen an, die an seiner schönen Kutsche arbeiteten. Gleich beim ersten Blick machte mir dieser ärgerliche Herr den Eindruck eines ewigen Nörglers. Er war ungefähr fünfundvierzig Jahre alt, von mittlerer Größe, sehr wohlbeleibt und pockennarbig. Seine Dicke, sein Doppelkinn und die quabbligen Hängebacken zeugten von dem behäbigen Leben eines Gutsbesitzers. Etwas Weibisches lag in seiner ganzen Erscheinung und fiel einem sogleich ins Auge. Sein Anzug war weit, bequem und sauber, aber durchaus nicht modern.
Ich begriff nicht, warum er auch auf mich ärgerlich war, umso weniger, da er mich zum ersten Mal im Leben sah und noch kein Wort mit mir gesprochen hatte. Ich bemerkte das, sowie ich aus dem Wagen stieg, an seinem ungewöhnlich zornigen Blick. Ich jedoch hatte die größte Lust, seine Bekanntschaft zu machen. Denn aus den Reden seiner Diener entnahm ich, dass er eben aus Stepantschikowo von meinem Onkel kam, und ich hatte daher die Möglichkeit, mich nach vielem zu erkundigen. Ich lüftete also die Mütze und bemerkte in möglichst liebenswürdigem Tone, wie unangenehm doch manchmal ein solcher unfreiwilliger Aufenthalt unterwegs sei; aber der Dicke musterte mich nur mit einem unzufriedenen, mürrischen Blick vom Kopf bis zu den Füßen, brummte etwas vor sich hin und wandte mir schwerfällig den Rücken zu. Diese Seite seiner Person war zwar ein sehr interessanter Gegenstand für einen Beschauer; aber natürlich war ein angenehmes Gespräch von ihr nicht zu erwarten.
»Grischka! Was brummst du da vor dich hin! Ich lasse dich durchpeitschen! …« schrie er auf einmal seinen Kammerdiener an, als hätte er das, was ich über unerwünschten Aufenthalt auf der Reise gesagt hatte, gar nicht gehört.
Dieser ›Grischka‹ war ein grauhaariger, altmodischer Diener mit einem langschößigen Rock und einem sehr großen, grauen Backenbart. Nach einigen Anzeichen zu urteilen, war er ebenfalls sehr ärgerlich und murmelte verdrießlich etwas vor sich hin. Zwischen dem Herrn und dem Diener fand nun sofort eine Auseinandersetzung statt.
»Durchpeitschen willst du mich lassen! Na, schrei doch noch lauter!« brummte Grischka, anscheinend nur so für sich, aber so laut, dass alle es hörten. Dann wandte er sich entrüstet ab, um etwas im Wagen in Ordnung zu bringen.
»Was? Was hast du gesagt? ›Schrei doch noch lauter‹? Welche Unverschämtheit!« schrie der Dicke, dunkelrot im Gesicht.
»Warum fahren Sie mich denn eigentlich so an? Man darf wohl nicht einmal mehr ein Wort sagen?«