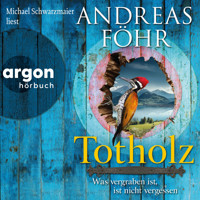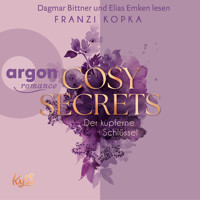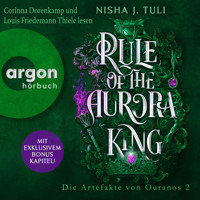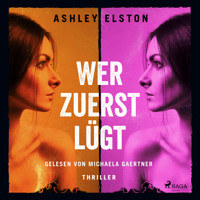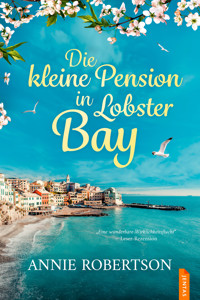Arts and Health - Österreich im internationalen Kontext E-Book
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Gesundheit, Kommunikation und Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Welche Auswirkungen hat das kulturelle Leben auf unser Wohlbefinden? Die Beitragenden des Bandes plädieren dafür, die Bedeutung von Kunst und Kultur für die individuelle und soziale Gesundheit anzuerkennen. Aktuelle Beispiele aus Forschung und Praxis geben einen Überblick über die vielfältigen Wirkungsweisen und Wechselbeziehungen der verschiedenen Bereiche. Ansätze für die Integration von Kunst und Kultur in das Gesundheits- und Sozialwesen in Großbritannien, Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Irland und Österreich dienen dabei als Vorlage für konkrete Policy-Empfehlungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Ähnliche
Edith Wolf Perez (M.A.) ist Fachjournalistin für Kultur, Tanz und Kulturpolitik sowie Praktikerin und Forscherin im Bereich kunstbasierte Interventionen im Gesundheits- und Sozialbereich.
Edith Wolf Perez (Hg.)
Arts and Health –Österreich im internationalen Kontext
ARTS for HEALTH AUSTRIA im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Österreich
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 transcript Verlag, Bielefeld
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld
Umschlagabbildung: Annykos / iStock
Lektorat: Franz Otto Hofecker, Gudrun Schweigkofler Wienerberger, Barbara Stüwe-Eßl. Englisch: Katy Geertsen, Lynn Geertsen-Rowe
Korrektorat: Jan Leichsenring
Redaktionsleitung: Edith Wolf Perez und Oliver P. Graber
https://doi.org/10.14361/9783839466087
Print-ISBN 978-3-8376-6608-3
PDF-ISBN 978-3-8394-6608-7
Buchreihen-ISSN: 2940-1828
Buchreihen-eISSN: 2940-1836
Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de
Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
Vorwort des VizekanzlersWerner Kogler
Vorwort des GesundheitsministersJohannes Rauch
EinleitungEdith Wolf Perez und Oliver Peter Graber
1.Wissenschaftliche Kontextualisierung
1.1.Was ist Arts and/for/in/within Health?Versuch einer BegriffsbestimmungEdith Wolf Perez
1.2.Arts and Health: Die Evidenzlage laut WHOEine ZusammenfassungEdith Wolf Perez, Katherine Dedich
1.3.»Arts and Health«-EvaluierungenRobuste Studienlage?Andrew McWilliams, Edith Wolf Perez
2.Arts and Health: Good Practice International
2.1.WHO Collaborating Centre for Arts and HealthEin internationales ForschungszentrumEdith Wolf Perez
2.2.Vereinigtes KönigreichDie BlaupauseAlexandra Coulter, Veronica Franklin Gould, Andrew McWilliams
2.3.FinnlandKunst und Kultur in einem sich wandelnden Sozial- und GesundheitssystemLiisa Laitinen
2.4.DänemarkMit einigen Bezügen zu Norwegen und SchwedenDorothy Conaghan
2.5.Die NiederlandeDas Beispiel der Provinz Fryslân (Westfriesland)Geke Walsma
2.6.Republik IrlandArts and Health im Sinne des SubsidiaritätsprinzipsDorothy Conaghan
2.7.Highlights aus den USAArts and Health als Thema der größten KulturinstitutionenJennifer Davison
3.Arts and Health: Österreich
3.1.Grundlagen des Gesundheitssystems in ÖsterreichEin fragmentiertes BildEdith Wolf Perez
3.2.Social PrescribingGedanken zur Umsetzung in ÖsterreichChristoph Redelsteiner
3.3.Arts for Health – auf Rezept?Ein Kommentar aus Sicht eines JuristenJohannes Gregoritsch
3.4.Kulturpolitische PrioritätenVon der klassischen Kulturförderung zu nachhaltigen KonzeptenAnke Simone Schad-Spindler
3.5.MusiktherapieDefinition und Gesetzeslage in ÖsterreichOliver Peter Graber
3.6.Arts and Health für Kinder und JugendlicheFokus: KompetenzerweiterungGudrun Schweigkofler Wienerberger
3.7.Kunst trifft WissenschaftVon STEM zu STEAMAiran Berg
3.8.Policy-EmpfehlungenVon gegenseitigem Nutzen für Kunst, Gesundheit und SozialwesenDie Redaktion
4.Anhang
4.1.Glossar der Schlüsselbegriffe
4.2.English Abstracts
5.Redaktionsteam, Autoren und Autorinnen
5.1.Herausgeberinnen und Redaktionsleitung
5.2.Autorinnen und Mitarbeiterinnen
Vorwort des Vizekanzlers
Werner Kogler
Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen nicht selbstverständlich sind. Wir haben auch deutlich gesehen, dass ein gesundes Leben weitaus mehr bedeutet als nur die Abwesenheit von Krankheit.
Dass Kunst und Kultur eine positive Wirkung auf die mentale und körperliche Gesundheit haben, belegen zahlreiche Studien und Initiativen eindrucksvoll. Die Wirkung zeigt sich sowohl bei der Unterstützung von Genesung und Rehabilitation als auch in der Prävention. Künstlerische und kulturelle Aktivitäten schaffen nicht nur situativ Emotionen, sie wirken sich auch nachhaltig positiv auf das Wohlbefinden der Menschen aus.
Länder wie Großbritannien oder Finnland setzen Künste im öffentlichen Gesundheitswesen bereits gezielt ein. Auch von anderen internationalen Good Practice-Beispielen kann Österreich vieles lernen und sich inspirieren lassen.
In diesem Buch wollen wir österreichische Initiativen an der Schnittstelle von Kunst und Gesundheit würdigen, die bereits länger existieren oder aktuell Pionierarbeit leisten. Dazu zählt auch das Engagement des Vereins »Arts for Health Austria«. Ein erfolgversprechendes Pilotprojekt ist »Social Prescribing« bzw. »Kunst auf Rezept«, das in Österreich noch in den Startlöchern steckt. Ziel ist es, mit all diesen vorbildhaften Maßnahmen im In- und Ausland den Weg für geeignete Rahmenbedingungen, Vernetzung und weitere innovative Projekte zu ebnen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen in Österreich von einer verstärkten Zusammenarbeit von Kunst und Gesundheit profitieren werden.
Dieses Buch ist ein erster Schritt auf einem gemeinsamen Weg.
Vorwort des Gesundheitsministers
Johannes Rauch
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Kunst und Kultur tun Seele, Geist und dem Körper gut. Wenn wir Kunst betrachten oder gar schaffen, werden u.a. Emotionen hervorgerufen oder ausgedrückt, der Stresslevel kann sinken und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Kunst hat also einen deutlich positiven Einfluss auf die Gesundheit.
Die Wissenschaft stützt das mit Forschungsergebnissen, die die große Bedeutung von Kunst als therapeutisches Mittel im Heilungsprozess zeigen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Kreativität mit rund 900 Studien weltweit ausgewertet. Der veröffentlichte Bericht verdeutlicht: Kreatives und Schöpferisches wie Musik, Tanzen, Theater, bildnerische Gestaltung, aber auch passiver Kunstgenuss etwa bei Museums- oder Konzertbesuchen verbessern Wohlbefinden und Gesundheit. Sie sind eine Bereicherung für die Prävention und Therapie von Erkrankungen. Kunst hilft z.B. auch der Gedächtnisleistung: Im Alter wirkt sie dem kognitiven Abbau entgegen. Kreativität hat zudem eine sozial stärkende Wirkung, wenn etwa Eltern mit ihren Kindern spielen, zeichnen, tanzen, lesen, Geschichten erfinden oder singen.
Sich künstlerisch kreativ zu betätigen, ist als Ergänzung zu medizinischen Therapien zudem auch sozial gut zugänglich: Es ist mit vergleichsweise niedrigen Kosten und geringer Gefahr von unerwünschten Nebenwirkungen verbunden. Im Rahmen des Projekts »Social Prescribing« werden daher bereits auch künstlerische Maßnahmen verschrieben (2021 waren es 4 %).
Schöpferisches Arbeiten wird im therapeutischen Bereich bei vielen Erkrankungen und für die psychische Gesundheit bereits erfolgreich eingesetzt, z.B. auch zur Stärkung von Inklusion und zum Abbau von Stigmata. In der Inklusions- und Anti-Stigma-Arbeit wird mit kreativen Mitteln Bewusstsein geschaffen, Vorurteile abgebaut, Empathie gestärkt und Erfahrungen reflektiert und ausgedrückt. Eine Studie der Gesundheit Österreich GmbH zeigt Anti-Stigma-Aktivitäten in Österreich: Vom Suchtpräventionskabarett über Film- und Lesereihen zur Psyche bis hin zu Museumsführungen oder Workshops für Menschen mit Demenz findet sich auch hier viel Kunst und Kultur. In Anbetracht der vielen Vorteile empfiehlt die Kompetenzgruppe Entstigmatisierung, eine Initiative des BMSGPK, künstlerische Projekte mit jungen Menschen zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen in ganz Österreich zu ermöglichen.
Stressabbau, gestärktes Gemeinschaftsgefühl, Prävention, als Begleitung von Therapien und für mehr Inklusion: Es tut sich hier also bereits viel – aber gerne noch mehr. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und kreativ!
Einleitung
Edith Wolf Perez und Oliver Peter Graber
Die Künste spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Dies ist spätestens seit der Antike dokumentiert und wurde inmitten einer Pandemie unvermittelt flächendeckend sichtbar, als das Singen von Balkonen, das Malen von Regenbögen, Online-Besuche von Ausstellungen und das Streaming von Performances dazu beigetragen haben, Hoffnung aufrechtzuerhalten, Einsamkeit zu verringern und die psychische Resilienz zu stärken. Der zunehmende Einsatz von Kunst im Gesundheitsangebot von immer mehr Ländern ist ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig es ist, Medizin mit Kreativität, Kultur und sozialem Zusammenhalt zu verbinden.
Dabei wird eine Trennung aufgehoben, die sich nicht zuletzt mit zunehmender Spezialisierung der Medizin entwickelte, womit gleichzeitig der Begriff der Heilkunst in den Hintergrund gerückt ist, welcher den Zusammenhang von Kunst und Medizin in sich zum Ausdruck bringt; zog sich diese immanente Verbindung doch von prähistorischen Schamanen über Apollon (als Gott aller Künste inklusive der Heilkunst) bis zu Gelehrten wie Athanasius Kircher durch die Menschheitsgeschichte. Galten auf dieser Basis Kenntnisse in den Künsten im Mittelalter noch als Voraussetzung für das Studium der Medizin, so ist die Kunst des Heilens im Laufe der darauf folgenden Jahrhunderte zur medizinischen Wissenschaft geworden. Nun ist es an der Zeit, die Kunst auf Basis exakten, evidenzbasierten Wissens wieder in die Gleichung einzubringen.
Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat die heilende Rolle von Kunst und Kultur erneut zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen, ist inzwischen doch eine umfassende Evidenzlage über deren salutogenetische Wirkung vorhanden: Der wissenschaftliche Zugang hat Kunst und Kultur im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden vom Stigma der Esoterik befreit.
In einigen Ländern wurden mittlerweile Strategien entwickelt, um sie als effektive Interventionen im öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesen anzuerkennen und einzubinden. Fallweise werden Kunstaktivitäten und ästhetisches Erleben bereits auf Rezept verschrieben.
Wichtige Fragen der öffentlichen Gesundheit, einschließlich psychischer Gesundheit, sozialer Isolation, kollektivem Trauma, Rassismus, chronischen Krankheiten und der Pandemie, erfordern Kreativität und eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Kunst und Kultur sind verfügbare, aber oft nicht (an)erkannte Ressourcen, um diese Probleme anzugehen.
In Österreich gibt es eine Reihe bemerkenswerter Projekte, von denen einige bereits auf eine jahrzehntelange Kontinuität verweisen können, doch die breitere öffentliche Diskussion über Kunst und Kultur im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden hat erst vor einiger Zeit begonnen. Die theoretische bzw. diskursive und damit politische Auseinandersetzung mit dem Thema hinkt also der Praxis hinterher.
Die Kunst- und Kultursektion im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (bis Jänner 2020 im Bundeskanzleramt) beschäftigt sich vor dem Hintergrund der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bereits seit einigen Jahren mit der Wirkung von Kunst und Kultur auf die Gesundheit. Nachdem eine EU-Expertinnengruppe zu Kultur und sozialer Inklusion (2017-2018) die Schnittstelle zu Gesundheit als eines der zentralen Handlungsfelder identifizierte, ist die Idee entstanden, eine Kooperation mit der IG Kultur Österreich im Rahmen der Publikation »Kultur als Rezept« und den Workshop »Arts for Health« im Dezember 2019 durchzuführen.
Diese Veranstaltung inspirierte uns zur Gründung des Vereins ARTS for HEALTH AUSTRIA, der seither neben eigenen Projekten auch laufend Initiativen setzt, um das öffentliche Bewusstsein für die Wirkung von Kunst und Kultur auf die Gesundheit und das Wohlbefinden zu verstärken, zum Beispiel mit der Tournee »Kunst trifft Gesundheit«1 in den Bundes- und Nachbarländern.
Die vorliegende Publikation, im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, ist ein weiterer Beitrag, das Thema Kunst und Gesundheit zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Es soll als Informationsquelle für Policy Maker, Künstlerinnen, Gesundheitsprofis und expertinnen dienen, die darin für ihren Bereich jeweils relevante Informationen finden.
»Arts and Health« ist eine evidenzbasierte Praxis. Daher widmet sich auch die Weltgesundheitsorganisation WHO seit einigen Jahren vermehrt dem Thema. Wir fassen den 2019 erschienen Report zusammen, der einen Überblick über den Stand der Forschung zu dem Thema gibt, und stellen das kürzlich gegründete WHO Collaborating Centre for Arts and Health vor.
Wir versuchen zudem eine Begriffsklärung und eine Unterscheidung zwischen künstlerischen Interventionen und Kunsttherapien zu treffen.
Die wissenschaftliche Kontextualisierung der »Arts and Health«-Praxis ist aufgrund zahlreicher Studien umfangreich. Die angewandten Methoden sind vielfältig und Ergebnisse daher oft nicht vergleichbar. Wir geben einen Überblick über gängige Forschungs- und Evaluierungsansätze und Methoden.
Berichte aus dem Vereinigten Königreich, aus Finnland, den Niederlanden, Dänemark und Irland sowie »Highlights aus den USA« illustrieren den Stellenwert von Arts and Health in diesen Staaten. Wir beleuchten die »Arts and Health«-Initiativen vor dem Hintergrund des jeweiligen politischen Systems und betten diese in einen gesundheits- und kulturpolitischen Rahmen ein.
Diese Methode wird auch auf die Darstellung der Situation in Österreich angewendet, wo wir zusätzlich einen Blick auf die Rechtslage und die kulturpolitische Praxis werfen, Initiativen für Kinder und Jugendliche und die Musiktherapie als Ausnahmeerscheinung im internationalen Vergleich vorstellen. Policy-Empfehlungen und einen Maßnahmenkatalog für eine effiziente und nachhaltige Umsetzung von »Arts and Health«-Strategien ergänzen diese Grundlagendiskussion.
In den jeweiligen Kapiteln stellen Good-Practice-Beispiele einen Zusammenhang zur gelebten Praxis dar. Die vorgestellten Organisationen und Projekte wurden durch Sekundärforschung und Mundpropaganda ermittelt und nach inhaltlichen Kriterien ausgewählt. Keinesfalls erhebt diese Publikation den Anspruch eine umfassende Bestandsaufnahme zu sein.
Arts and Health ist heute eine globale Bewegung und die Literatur dazu ist vorwiegend englischsprachig. Wir verwenden deshalb auch den englischen Begriff. Für eine leichtere Lesbarkeit haben wir uns bei Zitaten jedoch für die deutsche Version entschieden. Es handelt sich dabei um redaktionelle, nicht autorisierte Übersetzungen.
Für Personenbezeichnungen wird im gesamten Text die weibliche grammatische Form verwendet. Alle anderen Geschlechter sind natürlich mitgemeint.
Dank
Wir danken dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, insbesondere Kathrin Kneissel und Aleksandra Widhofner für ihr Vertrauen, uns mit dieser Publikation zu beauftragen. Unser Dank gilt auch unserem Redaktionsteam, den internationalen Autorinnen für die engagierte Mitarbeit in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie, ebenso den vielen Künstlerinnen und Vertreterinnen von Kultur, Sozial- und Gesundheitsorganisationen, die dafür mit uns in regem Austausch standen. Die Arbeit an diesem Buch hat bereits den Grundstein für die weitere Vernetzungsarbeit gelegt. Für die unermüdliche Arbeit für und an unseren Anliegen danken wir besonders Katy Geertsen, Barbara Stüwe-Eßl und Franz Otto Hofecker.
1https://www.artsforhealthaustria.eu/tour-2/ [26.09.2022]
1.Wissenschaftliche Kontextualisierung
1.1.Was ist Arts and/for/in/within Health?Versuch einer Begriffsbestimmung
Edith Wolf Perez
»Jeder von uns hat viele Rollen und Eigenschaften, auch Gesundheit und Krankheiten in all ihren Facetten, und niemand ist seine Erkrankung.« (Rüsch, 2021: 30)
Arts and Health ist ein Überbegriff für Kunst- und Kulturaktivitäten bzw. Initiativen im Zusammenhang mit Gesundheit und Wohlbefinden. Das Spektrum reicht von kulturellen Angeboten in und für Gesundheitsinstitutionen über partizipative künstlerische Projekte bis zu kunstbasierten Therapien. Kunst ist zunehmend für ihre salutogenetischen Wirkungen sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene, für den Erhalt des körperlichen, mentalen und sozialen Wohlbefindens bzw. für das Management von Gesundheitsproblemen anerkannt.
Gesundheit und Wohlbefinden
Bereits 1946 hat die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit als einen »Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen« definiert.1 Mit dieser Definition wird Gesundheit nicht nur auf individueller Ebene verstanden, sondern im gesellschaftlichen Kontext verankert.
Heute hat sich das Konzept erweitert und umfasst auch das Management von (chronischen) Krankheiten. Wie gut man mit damit verbundenen Beschwerden umgehen kann, hängt von der individuellen Resilienz ab und davon, inwieweit die Betroffene ihr eigenes Potential in größtmöglicher Unabhängigkeit ausschöpfen und am sozialen Leben partizipieren kann. Gesundheit ist daher ein dynamischer Prozess, der grundsätzlich von der Fähigkeit zur Selbstverwaltung bestimmt wird. (vgl. Fancourt/Finn 2019: 2)
In diesem Sinne können kunstbasierte Interventionen bei der Prävention, der Bewältigung und beim Management von Krankheiten unterstützend wirken.
Dabei ist die Wirkung auf das Wohlbefinden entscheidend. In diesem Zusammenhang versteht sich Wohlbefinden als ein individueller oder kollektiver Zustand oder Prozess, sich selbst, andere und entsprechende Lebensumstände als positiv zu erleben.
»Wohlbefinden kann man sich am besten als einen dynamischen Prozess vorstellen, der sich aus der Art und Weise ergibt, wie Menschen mit ihrer Umwelt interagieren. Aufgrund dieser Dynamik bedeutet ein hohes Maß an Wohlbefinden, dass wir besser in der Lage sind, auf schwierige Umstände zu reagieren, innovativ zu sein und uns konstruktiv mit anderen Menschen und der Welt auseinanderzusetzen.« (nef 2009: 9)
Terminologie
Sowohl in der kultur- als auch in der gesundheitsbasierten Forschung ist bekannt, dass es sich bei Kunstinterventionen um ein komplexes und daher konzeptionell schwieriges Studiengebiet handelt und um einen Bereich, der sich nicht eindeutig definieren lässt.
Die Systematisierung und wissenschaftliche Forschung über die Wirkung von Kunst auf Gesundheit und Wohlbefinden wird vorwiegend von Praktikerinnen und Akademikerinnen im anglosächsischen Raum bestimmt. Wir verwenden deshalb auch im deutschsprachigen Raum vorwiegend die englischen Bezeichnungen.
Im 2017 erschienenen Report eines parteienübergreifenden Ausschusses im britischen Parlament werden fünf Szenarien identifiziert, in denen Kunst und Gesundheit interagieren. (vgl. Creative Health 2017: 21)
•Kunst in Gesundheits- und Pflegeumgebungen, also in Krankenhäusern oder Sozialeinrichtungen.
•Partizipatorische Kunstprogramme – Einzel- oder Gruppenaktivitäten in Gesundheits, Sozial- und Community-Einrichtungen.
•Arts on prescription – die ärztliche Überweisung zur Teilnahme an kreativen Aktivitäten, sehr oft, aber nicht ausschließlich bei mentalen Gesundheitsproblemen.
•Kunsttherapien – Musik, Tanz, Theater, bildende Kunst: Meist klinische psychotherapeutische Behandlungen, ausgeübt von ausgebildeten Therapeutinnen unter Anwendung von künstlerischen Aktivitäten.
•Medizinische Ausbildung und Medical Humanities: die Einbindung von Kunst in der Ausbildung und professionellen Weiterbildung von Gesundheits- und Sozialpersonal.
Auch in Österreich finden derartige Interventionen bereits in allen Einsatzfeldern statt. Einige markante Beispiele dafür findet man in der Zeitschrift »Kultur als Rezept« der IG Kultur Österreich.
In der mittlerweile sehr umfangreichen Literatur zum Thema wird zwischen den Bezeichnungen »Arts for Health«, »Arts in Health« und »Arts and Health« nicht dezidiert unterschieden, vielmehr erschließt sich die Bedeutung aus dem Kontext. Auch zwischen künstlerischen Interventionen und Kunsttherapien wird in der internationalen Literatur nicht klar differenziert.
»Creative Health« ist eine weitere Bezeichnung, die im Kontext von Kunst und Gesundheit häufig verwendet wird. Im gleichnamigen Report wird die Unterscheidung wie folgt thematisiert:
»… während viele der Mechanismen ähnlich sind, ist eine Unterscheidung zwischen der Therapie und dem Therapeutischen aufgrund der Absicht und der Wirkungsweise zu treffen. Ersteres bezieht sich in der Regel auf eine Dienstleistung, die Patientinnen mit einem bestimmten klinischen Ziel vor Augen angeboten wird; letzteres tendiert dazu, sich auf die Stimulierung kreativer Aktivität mit einer indirekten Auswirkung auf die Gesundheit zu konzentrieren, wobei ›die Betonung auf dem intrinsischen Wert und der Qualität des kreativen Prozesses und dem, was er hervorbringt‹ liegt. Der Übergang von der Therapie zum Therapeutischen, vom Patienten zur Person, ist Teil des Heilungsprozesses.« (Creative Health 2017: 13)
Gerade im österreichischen Kontext ist eine Differenzierung jedoch geboten, da mit dem Musiktherapiegesetz (2009), dem einzigen seiner Art weltweit, eine im Gesundheitswesen klinisch anerkannte kunstbasierte Therapie vorliegt.
Im Folgenden verwenden wir die folgenden Begriffe:
•Arts and Health für das gesamte Spektrum künstlerischer Interventionen im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden.
•Arts for Health für evidenzbasierte Interventionen, die vom künstlerischen Standpunkt aus agieren und bei denen der künstlerische und kreative Prozess im Mittelpunkt steht.
•Kunsttherapie für gezielte (psycho)therapeutische Ansätze, die von ausgebildeten Therapeutinnen geleitet werden.
•Arts within health bezeichnet künstlerische Angebot für Gesundheitsprofis oder Kunst im »medizinischen Raum«.
In dieser Publikation steht die »Arts for Health«-Praxis im Vordergrund.
Arts for Health
Künstlerinnen, die im Gesundheitskontext arbeiten, behandeln (therapieren) nicht. Sie sind keine ausgebildeten Medizinerinnen, Therapeutinnen oder Pflegerinnen, können aber mit solchen zusammenarbeiten.
In diesen Partnerschaften sollten sich die Akteurinnen darüber bewusst sein, dass sie unterschiedliche Perspektiven in die Arbeit einbringen:
»Da künstlerische Interventionen oft einen anderen Schwerpunkt haben als Interventionen im Gesundheitswesen, sind auch die Bewertungsmethoden in der Regel anders. Bei der Sammlung von Nachweisen und der Vereinbarung von Erfolgsdefinitionen müssen die Partnerinnen bereit sein, die Arbeit ›durch eine andere Brille‹ zu betrachten und die Ergebnisse zu teilen.« (Amans 2017: 265)
Arts for Health erhebt keinen Anspruch, therapeutischen Charakter zu haben. Die Teilnehmenden agieren aktiv als Künstlerinnen (in the making) und treten damit aus dem passiven Patientinnen-Sein heraus. »Arts for Health«-Initiativen werden in der Regel von professionellen Künstlerinnen geleitet. Im besten Fall werden sie auch wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Sie finden in einer freudvollen, interaktiven und künstlerischen Atmosphäre statt, können das Wohlbefinden fördern, soziale Bindungen verstärken, zu einem gesünderen Lebensstil beitragen und die Resilienz der Teilnehmenden erhöhen.2
Kunst im Kontext von Gesundheit ist eine nicht invasive biopsychosoziale Intervention, die auf die körperliche, mentale und soziale Befindlichkeit wirkt. Das kreative und künstlerische Schaffen oder der Kunstgenuss kann eine therapeutische Wirkung haben, doch werden dabei weder Symptome behandelt noch Heilung versprochen. »Arts for Health«-Interventionen arbeiten mit den gesunden Anteilen des Menschen und setzen nicht bei der Krankheit an, was sich auch aus der Geschichte von Arts for Health als eine Entwicklung der Community-Arts-Bewegung ergibt.
Community Arts
In den 1960er Jahren wurde der Begriff Community Arts den Kunstaktivitäten zugeordnet, die sich an spezifische Gruppen, Communitys, richteten. Für die im angelsächsischen Sprachraum übliche Verwendung des Begriffs gibt es keine deckungsgleiche deutschsprachige Entsprechung. Eine Community kann sich auf ein geografisches Gebiet, gemeinsame Interessen oder gemeinsame Bedingungen beziehen (z.B. Behinderung, Leben im Alter, ethnische Herkunft usw.). Ursprünglich verstanden sich Community Artists als politische Akteurinnen, die das Recht auf Kunst und Kultur für alle einforderten. Unter dem Slogan »Demokratisierung der Kunst« wollten sie jene Menschen erreichen und involvieren, die keinen oder nur begrenzten Zugang zur Kunst haben. Grundlage für diesen Anspruch ist Artikel 27 der Menschendrechtskonvention.
»Jeder hat das Recht, frei am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Vorteilen teilzuhaben.«
Rasch wurden Community-Arts-Interventionen in Großbritannien von nationalen Förderinstitutionen unterstützt: »Der Arts Council sah sich gezwungen zu reagieren, nicht zuletzt, weil er es sich nicht leisten konnte, die Ankunft der Zukunft zu behindern.« (Owen 2016: 23)
Es waren auch die Fördergeberinnen, die mit Untersuchungen und Berichten den strukturellen Aufbau der Community-Arts-Bewegung unterstützten, die sich bald auf alle Kunstsparten und auf viele Regionen des Landes ausbreitete.
Im Gegensatz dazu förderte die öffentliche Kulturverwaltung in Österreich die zur gleichen Zeit entstehenden unabhängigen Gruppen und Künstlerinnen der freien Szene vor allem für »künstlerische Innovation«. Für die Erlangung von Förderungen war es eher nachteilig, soziale Themen anzusprechen oder Laien in die Kunstproduktion einzubeziehen. Der Ruf nach »Demokratisierung von Kultur«, der auch hierzulande laut wurde, manifestierte sich in der Folge in den Begriffen »Soziokultur«, »Kulturelle Bildung« und »Kulturvermittlung«, unter denen primär pädagogische und nicht künstlerische Ziele verfolgt werden. Bereits die Semantik verdeutlicht den immanenten Unterschied zum britischen Konzept: Der Begriff »vermitteln« impliziert mindestens zwei Parteien, einen Sender und einen Empfänger, oder Kultur wird als Teil von gesellschaftlichen Prozessen wie Bildung angesehen. »Community Arts« bezeichnet vorerst jedoch lediglich den künstlerischen Akt in der Gemeinschaft.
»The Planets«, Ch: Royston Maldoom, Wiener Festwocheneröffnung 2007.
© Frick & Grünauer
Am Beispiel von … Community Dance: Aus Grossbritannien über Berlin nach Wien
Royston Maldoom zählt seit den späten 1960er Jahren zu den Pionierinnen der Community-Dance-Bewegung. 2004 wurde er vom damaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker Simon Rattle eingeladen, eine Choreografie mit über 200 Kindern aus ganz Berlin zu Strawinskis »Le Sacre du Printemps« einzustudieren. Das Projekt wurde in dem Film »Rhythm is it!« dokumentiert. Darin konnte man den konsequenten, herausfordernden und disziplinierten Prozess verfolgen, den die vorwiegend aus »Brennpunkt«-Vierteln stammenden Kinder und Jugendlichen erlebten und der bei einigen von ihnen zu einem dramatischen Perspektivenwechsel führte. Der Film rüttelte im Kulturbereich Arbeitende in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf und führte zu einem regelrechten Community-Dance-Boom. In Wien sah der damalige Generalsekretär der Caritas, Werner Binnenstein-Bachstein, den Film und beschloss, Maldoom zu einem Projekt nach Wien einzuladen: Er choreografierte Gustav Holsts »The Planets« mit über 250 Kindern und Jugendlichen zur Festwocheneröffnung 2007 auf dem Wiener Rathausplatz, es spielten die Wiener Symphoniker. Doch Maldoom hatte seine Zusage an eine Bedingung geknüpft: Er wolle kein einzelnes Event realisieren, sondern eine nachhaltige Initiative setzen. Zusammen mit seiner Kollegin Tamara McLorg baute er »Tanz die Toleranz« (TdT)3 auf. Heute ist es das einzige Community-Dance-Programm mit einem laufenden Angebot im deutschsprachigen Raum. So arbeiten jedes Semester mehrere Gruppen, von Kindern bis zu Erwachsenen, an Performances, die vor Publikum präsentiert werden. Außerdem bietet TdT jeden Samstag eine Schnupperstunde in unterschiedlichsten Tanzstilen. Die Gruppen werden von professionellen Choreografinnen geleitet, darunter Absolventinnen von Tanzstudien, die bei TdT erste Arbeitserfahrungen sammeln können. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Backgrounds und so sind TdT-Aufführungen zugleich ein authentischer Spiegel der (Migrations)Gesellschaft. Durch den inklusiven Ansatz sind jeweils auch Menschen mit Behinderung sowie Seniorinnen integriert. Neben den laufenden Kursen/Performances arbeitet das Team von TdT in Sonderprojekten mit speziellen Communitys, z.B. mit Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen oder muslimischen Frauen.
Bis heute haben ca. 15.000 Personen aktiv an unterschiedlichen Projekten teilgenommen. Seit zwei Jahren besteht eine Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper im Rahmen des »Tanzlabor«, einem partizipativen Projekt mit Kindern und Jugendlichen.
KURZINFO
Als Arts and Health werden künstlerische und kulturelle Aktivitäten im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden bezeichnet. Arts for Health sind nicht-therapeutische Interventionen, in denen der künstlerische Prozess im Mittelpunkt steht, in der Regel von professionellen Künstlerinnen geleitet. Kunsttherapien sind meist klinische psychotherapeutische Behandlungen unter Einbeziehung von künstlerischen Aktivitäten unter der Leitung von ausgebildeten Therapeutinnen.
Quellen
All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (2017): Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing, https://www.artshealthresources.org.uk/docs/creative-health-the-arts-for-health-and-wellbeing/ [27.09.2022]
Amans, Diane (2017): Dance as Art in Hospitals, in: Vicky Karkou/Sue Oliver/Sophia Lycouris (Hg.): The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing, Oxford University Press.
Brown, Langley (2006): Is Art Therapy? Art for Mental Health at the Millennium, Dissertation eingereicht an der Manchester Metropolitan University for the degree of Doctor of Philosophy; https://www.artsforhealth.org/people/langley-brown-phd-thesis.pdf [27.09.2022]
Fancourt, Daisy/Saoirse Finn (2019): What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (= World Health Organization. Health Evidence Network synthesis report 67), https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf [27.09.2022]
IG Kultur Österreich (Hg.) (2019): Kultur als Rezept (= Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda 1.19), https://igkultur.at/sites/default/files/posts/downloads/2020-01-07/IG%20Kultur_Zentralorgan_2019-01_Kultur%20als%20Rezept.pdf [27.09.2022]
Kelly, Owen (1984/2016): Community, Art and the State. Storming the citadels, First hardback edition 1984 by Comedia Publishing Group. First digital edition published in 2016 by Dib Comedian Dob. https://www.academia.edu/470872/Community_art_and_the_state_Storming_the_citadels [27.09.2022]
Maldoom, Royston (2010): Tanz dein Leben, Frankfurt a.M.: S. Fischer.
New Economics Foundation (NEF) (2009): National Accounts of Well-being, https://neweconomics.org/uploads/files/2027fb05fed1554aea_uim6vd4c5.pdf [27.09.2022]
Rüsch, Nicolas (2021): Das Stigma psychischer Erkrankung: Strategien gegen Ausgrenzung und Diskriminierung, München: Elsevier.
Tanz die Toleranz/Corina Payr (Hg.) (2019): Tanz die Toleranz, 1. Auflage, Wien: Caritas der Erzdiözese Wien.
1Constitution of the World Health Organisation, signed New York, 1946: https://www.who.int/about/governance/constitution [28.10.2022]
2Brown & Langley 2006 sowie in Anlehnung an die »Dance for Health«-Definition der International Association for Dance Medicine & Science (IADMS).
3https://www.tanzdietoleranz.at [28.10.2022]
1.2.Arts and Health: Die Evidenzlage laut WHOEine Zusammenfassung
Edith Wolf Perez, Katherine Dedich
Welche medizinischen und sozialen Bereiche von »Arts and Health«-Interventionen profitieren können, wurde mittlerweile in zahlreichen Studien untersucht.
Doch trotz einer zunehmenden Anzahl an Projekten ist das Bewusstsein über die wissenschaftliche Evidenz künstlerischer Aktivitäten für die Gesundheit und das Wohlbefinden in den Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation, WHO) sehr unterschiedlich.
Der Evidenzbericht der Weltgesundheitsorganisation
Daher publizierte das Europabüro der WHO 2019 in ihrer Serie »Health Evidence Network Synthesis Report« die 67. Ausgabe zur Rolle von Kunst für Gesundheit und Wohlbefinden: In »What is the evidence on the role of the arts in improving health and wellbeing. A scoping review« untersuchen die Autorinnen Daisy Fancourt und Saoirse Finn 900 Publikationen, in denen insgesamt 3.000 Studien vorgestellt wurden. Um der Thematik gerecht zu werden, wählten sie einen inter- und transdisziplinären Ansatz und untersuchten Studien aus den Bereichen Medizin, Neurowissenschaft, Psychologie und Soziologie. Sie führten quantitative Metaanalysen, qualitative Metasynthesen und individuelle Studien zusammen. Der WHO-Report bietet den zurzeit umfassendsten Überblick von Studien über die Wirkungsweise von Kunst im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden.
In den darin gelisteten Studien wurden die klassischen Kunstkategorien wie Musik, darstellende Kunst (Tanz, Gesang, Theater), Film, Bildende Kunst, Design und Handwerk, Literatur sowie Online, digitale und elektronische Kunst berücksichtigt. Der Begriff Kultur bezieht sich auf Aktivitäten wie den Besuch von Ausstellungen, Konzerten, Theater- und Tanzaufführungen, Community Events oder Festivals. Es wurden sowohl partizipative Kunstinterventionen als auch die Rezeption von Kunst berücksichtigt:
Musik führt das Feld an, da sie bei nahezu allen Anwendungsgebieten Wirkung zeigt. Doch auch für Tanz, Theater und Bildende Kunst ist mittlerweile eine eindrucksvolle Evidenzlage vorhanden.
Der WHO-Report kommt zu dem Schluss, dass jeder der Kunstkategorien verschiedene Kombinationen von gesundheitsfördernden Komponenten immanent sind, sei es
•im täglichen Leben (also nicht für einen gesundheitlichen Zweck, sondern mit einem sekundären Nutzen für die Gesundheit),
•in maßgeschneiderten Kunstprogrammen, die gezielt für die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden entwickelt wurden, oder
•in therapeutischen Kunstprogrammen, die von ausgebildeten Kunsttherapeutinnen durchgeführt werden.
»… dies wird als Stärke von Kunstprojekten im Gesundheitsbereich angesehen: während andere Aktivitäten auch verschiedene gesundheitsfördernde Komponenten enthalten können (z.B. sportliche Aktivitäten), verbinden die Künste viele gesundheitsfördernde Faktoren mit innerer ästhetischer Schönheit und kreativem Ausdruck, die eine intrinsische Motivation für ein Engagement bieten, das über den besonderen Aspekt der Gesundheit hinausgeht … Eine weitere Stärke ist, dass die multimodale Natur von Kunstinterventionen bedeutet, dass ein Engagement mit einer Reihe von verschiedenen Auswirkungen auf die Gesundheit verbunden sein kann.« (Fancourt/Finn, 2019: 17)
Schlüsselkomponenten, von denen bekannt ist, dass sie gesundheitsfördernd sind, unterstützen die logische Verbindung zwischen Kunst und Gesundheit, zum Beispiel sensorische Aktivierung, ästhetisches Engagement, kognitive Stimulation, soziale Interaktion und die Auseinandersetzung mit Themen der Gesundheit. Die Forschung zeigt, dass sich durch Kunst die Fähigkeit verbessert, emotional und kognitiv zu reagieren. Die Auseinandersetzung mit Kunst in Bezug auf die Gesundheit hat einen großen Einfluss auf das soziale Wohlbefinden, wie Berichte über weniger Einsamkeit und Isolation bis hin zu verbesserten sozialen Unterstützungsnetzwerken belegen. Das gemeinsame, lustvolle und freudige Agieren führt zu einer deutlich geringeren Drop-out-Rate als bei vergleichbaren Aktivitäten.
Logisches Modell: Die Verbindung von Kunst und Gesundheit
Komponenten
Wirkungsfelder
Resultate
– Ästhetisches Engagement
– Einbindung der Vorstellungskraft
– Sensorische Aktivierung
– Hervorrufen von Emotionen
– Kognitive Stimulation
– Soziale Interaktion
– Auseinandersetzung mit Themen der Gesundheit
– Interaktion mit dem Umfeld des Gesundheitswesens
– Psychologisch (z.B. verbesserte Selbstwirksamkeit, Bewältigung, emotionale Regulierung)
– Physiologisch (z.B. geringere Stresshormonreaktion, verbesserte Immunfunktion, höhere kardiovaskuläre Reaktivität)
– Sozial (z.B. weniger Einsamkeit und Isolation, mehr soziale Unterstützung, besseres Sozialverhalten)
– Lebensstil (z.B. mehr Bewegung, gesündere Verhaltensweisen, Lernen und Entwicklung von Fertigkeiten)
– Prävention
– Promotion
– Management
– Behandlung
Nach Fancourt/Finn 2019: 3
Der theoretische Rahmen für den WHO-Report konzentriert sich auf den multimodalen Aspekt künstlerischer Aktivitäten. Kunstinterventionen können mehrere gesundheitsfördernde Faktoren innerhalb einer Aktivität befördern (z.B. Unterstützung körperlicher Aktivität mit Komponenten, die die psychische Gesundheit unterstützen). Sie können also für bestimmte Situationen effizienter sein als die gleichzeitige Verschreibung von körperlicher Aktivität und einer psychotherapeutischen Behandlung.
Der Report gliedert die Evidenz über den Einfluss der Kunstinterventionen, die die zahlreichen Studien liefern, in 1.) Prävention und Erhalt von Gesundheit sowie 2.) Management und Behandlung von Krankheiten. Die Fülle der Beispiele, die im WHO-Report auf 58 Seiten dokumentiert sind, lässt sich hier nur ansatzweise zusammenfassen.
Themen für den Einsatz von »Arts and Health«-Interventionen
Themen für Prävention und Gesundheitsförderung
Soziale Determinanten von Gesundheit
– Soziale Kohäsion
– Soziale Ungleichheiten
Kindesentwicklung
– Mutter-Kind-Bindung
– Sprechen und Sprache
– Bildungsabschlüsse
Pflege
– Verständnis von Gesundheit
– klinische Fähigkeiten
– Wohlbefinden
Vorbeugung von Krankheiten
– Wohlbefinden
– Mentale Gesundheit
– Trauma
– Kognitiver Abbau
– Gebrechlichkeit
– Frühsterblichkeit
Gesundheitsfördernde Verhaltensweise
– Gesund leben
– Engagement in Gesundheitspflege
– Gesundheitskommunikation
– Gesundheitsbedingte Stigmatisierung
– Engagement mit schwer erreichbaren Gruppen
Management und Behandlung
Pflege am Lebensende
– Palliativpflege
– Trauer
Psychische Erkrankungen
– Perinatale psychische Erkrankungen
– Mittelschwere psychische Erkrankung
– Schwere psychische Erkrankung
– Trauma und Missbrauch
Akute Zustände
– Frühgeborene
– stationäre Pflege
– chirurgische und invasive Eingriffe
– Intensivpflege
Neuroentwicklungs- und neurologische Störungen