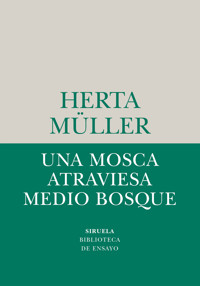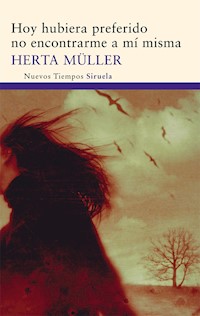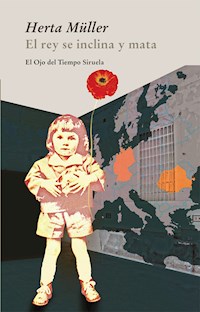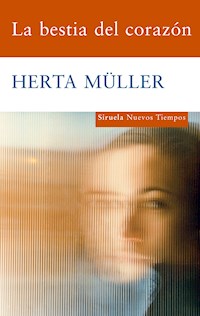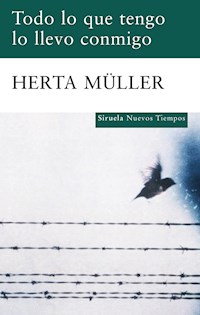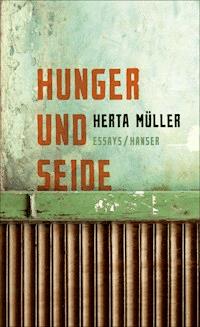Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Hanser, CarlHörbuch-Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rumänien 1945: Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Die deutsche Bevölkerung lebt in Angst. "Es war 3 Uhr in der Nacht zum 15. Januar 1945, als die Patrouille mich holte. Die Kälte zog an, es waren -15º C." So beginnt ein junger Mann den Bericht über seine Deportation in ein Lager nach Russland. Anhand seines Lebens erzählt Herta Müller von dem Schicksal der deutschen Bevölkerung in Siebenbürgen. In Gesprächen mit dem Lyriker Oskar Pastior und anderen Überlebenden hat sie den Stoff gesammelt, den sie nun zu einem großen neuen Roman geformt hat. Ihr gelingt es, die Verfolgung Rumäniendeutscher unter Stalin in einer zutiefst individuellen Geschichte sichtbar zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herta Müller
Atemschaukel
Roman
Carl Hanser Verlag
Die Robert-Bosch-Stiftung ermöglichte 2004 Oskar Pastior und Herta Müller eine Reise zu Orten ehemaliger Zwangsarbeitslager in der Ukraine. Dafür bedankt sich die Autorin, und sie dankt dem Deutschen Literaturfonds für die Unterstützung bei der Abfassung dieses Romans.
eBook ISBN 978-3-446-23457-4
© Carl Hanser Verlag München 2009
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Greiner & Reichel, Köln
www.hanser.de
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Vom Kofferpacken
Alles, was ich habe, trage ich bei mir.
Oder: Alles Meinige trage ich mit mir.
Getragen habe ich alles, was ich hatte. Das Meinige war es nicht. Es war entweder zweckentfremdet oder von jemand anderem. Der Schweinslederkoffer war ein Grammophonkistchen. Der Staubmantel war vom Vater. Der städtische Mantel mit dem Samtbündchen am Hals vom Großvater. Die Pumphose von meinem Onkel Edwin. Die ledernen Wickelgamaschen vom Nachbarn, dem Herrn Carp. Die grünen Wollhandschuhe von meiner Fini-Tante. Nur der weinrote Seidenschal und das Necessaire waren das Meinige, Geschenke von den letzten Weihnachten.
Es war noch Krieg im Januar 1945. Im Schrecken, dass ich mitten im Winter wer weiß wohin zu den Russen muss,wollte mir jeder etwas geben, das vielleicht etwas nützt, wenn es schon nichts hilft. Weil nichts auf der Welt etwas half. Weil ich unabänderlich auf der Liste der Russen stand, hat mir jeder etwas gegeben und sich sein Teil dabei gedacht. Und ich habe es genommen und mir gedacht mit meinen siebzehn Jahren, dass dieses Wegfahren zur rechten Zeit kommt. Es müsste nicht die Liste der Russen sein, aber wenn es nicht zu schlimm kommt, ist es für mich sogar gut.
Ich wollte weg aus dem Fingerhut der kleinen Stadt, wo alle Steine Augen hatten. Statt Angst hatte ich diese verheimlichte Ungeduld. Und ein schlechtes Gewissen, weil die Liste, an der meine Angehörigen verzweifelten, für mich ein annehmbarer Zustand war. Sie fürchteten, dass mir etwas zustößt in der Fremde. Ich wollte an einen Ort, der mich nicht kennt.
Mir war bereits etwas zugestoßen. Etwas Verbotenes. Es war absonderlich, dreckig, schamlos und schön. Es passierte im Erlenpark ganz hinten jenseits der Kurzgrashügel. Auf dem Heimweg bin ich in die Parkmitte, in den runden Pavillon gegangen, wo an Feiertagen die Orchester spielten. Ich blieb eine Weile darin sitzen. Das Licht stach durchs feingeschnitzte Holz. Ich sah die Angst der leeren Kreise, Quadrate und Trapeze, verbunden durch weiße Ranken mit Krallen. Es war das Muster meiner Verirrung und das Muster des Entsetzens im Gesicht meiner Mutter. In diesem Pavillon habe ich mir geschworen: Ich komme nie mehr in diesen Park.
Je mehr ich mich davon abhielt, desto schneller ging ich wieder hin – nach zwei Tagen. Zum Rendezvous, so hieß das im Park.
Ich ging zum zweiten Rendezvous mit demselben ersten Mann. Er hieß DIE SCHWALBE. Der zweite war ein neuer, er hieß DIE TANNE. Der dritte hieß DAS OHR. Danach kam DER FADEN. Dann DER PIROL und DIE MÜTZE. Später DER HASE, DIE KATZE, DIE MÖWE. Dann DIE PERLE. Nur wir wussten, welcher Name zu wem gehört. Es war Wildwechsel im Park, ich ließ mich weiterreichen. Und Sommer war es und weiße Haut an den Birken, im Jasmin- und Holundergestrüpp wuchs die grüne Wand aus undurchdringlichem Laub.
Die Liebe hat ihre Jahreszeiten. Der Herbst machte dem Park ein Ende. Das Holz wurde nackt. Die Rendezvous zogen mit uns ins Neptunbad. Neben dem Eisentor hing sein ovales Emblem mit dem Schwan. Jede Woche traf ich mich mit dem, der doppelt so alt war wie ich. Er war Rumäne. Er war verheiratet. Ich sage nicht, wie er hieß, und nicht, wie ich hieß. Wir kamen zeitversetzt, die Kassenfrau in der Bleiverglasung ihrer Loge, der spiegelnde Steinboden, die runde Mittelsäule, die Wandkacheln mit dem Seerosenmuster, die geschnitzten Holztreppen durften nicht auf den Gedanken kommen, dass wir verabredet sind. Wir gingen zum Bassin mit allen anderen schwimmen. Erst bei den Schwitzkästen trafen wir uns.
Damals, kurz vor dem Lager und genauso nach meiner Heimkehr bis 1968, als ich das Land verließ, hätte es für jedes Rendezvous Gefängnis gegeben. Mindestens fünf Jahre, wenn man mich erwischt hätte. Manche hat man erwischt. Sie kamen direkt aus dem Park oder Stadtbad nach brutalen Verhören ins Gefängnis. Von dort ins Straflager an den Kanal. Heute weiß ich, vom Kanal kehrte man nicht zurück. Wer trotzdem wiederkam, war ein wandelnder Leichnam. Vergreist und ruiniert, für keine Liebe auf der Welt mehr zu gebrauchen.
Und in der Lagerzeit – im Lager erwischt, wär ich tot gewesen.
Ich streifte nach den fünf Lagerjahren Tag für Tag durch den Tumult der Straßen und übte im Kopf die besten Sätze für den Fall meiner Verhaftung: AUF FRISCHER TAT ERTAPPT – gegen diesen Schuldspruch habe ich mir tausend Ausreden und Alibis zurechtgelegt. Ich trage stilles Gepäck. Ich habe mich so tief und so lang ins Schweigen gepackt, ich kann mich in Worten nie auspacken. Ich packe mich nur anders ein, wenn ich rede.
Im letzten Rendezvous-Sommer bin ich, um den Heimweg aus dem Erlenpark zu verlängern, auf dem Großen Ring zufällig in die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit gegangen. Dieser Zufall spielte Schicksal. Ich habe die kommende Zeit gesehen. Neben dem Seitenaltar auf einer Säule stand der Heilige im grauen Mantel und trug als Mantelkragen ein Schaf im Nacken. Dieses Schaf im Nacken ist das Schweigen. Es gibt Dinge, über die man nicht spricht. Aber ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, das Schweigen im Nacken ist etwas anderes als das Schweigen im Mund.
Vor, während und nach meiner Lagerzeit, fünfundzwanzig Jahre lang habe ich in Furcht gelebt, vor dem Staat und vor der Familie. Vor dem doppelten Absturz, dass der Staat mich als Verbrecher einsperrt und die Familie mich als Schande ausschließt. Im Gewühl der Straßen habe ich in die Spiegel der Vitrinen, Straßenbahn- und Häuserfenster, Springbrunnen und Pfützen geschaut, ungläubig, ob ich nicht doch durchsichtig bin.
Mein Vater war Zeichenlehrer. Und ich, mit dem Neptunbad im Kopf, zuckte wie von einem Fußtritt zusammen, wenn er das Wort AQUARELL benutzte. Das Wort wusste, wie weit ich schon gegangen war. Meine Mutter sagte bei Tisch: Stich die Kartoffel nicht mit der Gabel an, sie fällt auseinander, nimm den Löffel, die Gabel nimmt man fürs Fleisch. Mir pochten die Schläfen. Wieso redet sie vom Fleisch, wenn es um Kartoffel und Gabel geht. Von welchem Fleisch spricht sie. Mir hatten die Rendezvous das Fleisch umgedreht. Ich war mein eigener Dieb, die Wörter fielen unverhofft und erwischten mich.
Meine Mutter und besonders mein Vater glaubten, wie alle Deutschen in der Kleinstadt, an die Schönheit blonder Zöpfe, weißer Kniestrümpfe. An das schwarze Viereck von Hitlers Schnurrbart und an uns Siebenbürger Sachsen als arische Rasse. Mein Geheimnis war, rein körperlich betrachtet, schon höchste Abscheulichkeit. Mit einem Rumänen kam noch Rassenschande dazu.
Ich wollte weg aus der Familie und sei es ins Lager. Nur tat es mir um meine Mutter leid, die nicht wusste, wie wenig sie mich kennt. Die, wenn ich weg bin, öfter an mich denken wird als ich an sie.
Neben dem Heiligen mit dem Schaf des Schweigens im Nacken hatte ich in der Kirche die weiße Wandnische mit der Inschrift gesehen: DER HIMMEL SETZT DIE ZEIT IN GANG. Als ich meinen Koffer packte, dachte ich: Die weiße Nische hat gewirkt. Das ist jetzt die in Gang gesetzte Zeit. Ich war auch froh, dass ich nicht in den Krieg ziehen muss, in den Schnee an die Front. Ich ging dümmlichtapfer und gefügig ans Kofferpacken. Ich wehrte mich gegen nichts. Ledergamaschen mit Schnürchen, Pumphosen, Mantel mit Samtbündchen – nichts passte zu mir. Es ging um die in Gang gesetzte Zeit, nicht um Kleider. Ob mit diesen Sachen oder anderen, erwachsen wird man sowieso. Die Welt ist zwar kein Kostümball, dachte ich, aber lächerlich ist keiner, der im tiefsten Winter zu den Russen fahren muss.
Eine Patrouille aus zwei Polizisten ging mit der Liste von Haus zu Haus, ein Rumäne und ein Russe. Ich weiß nicht mehr, ob die Patrouille bei uns im Haus das Wort LAGER ausgesprochen hat. Und wenn nicht, welches andere Wort außer RUSSLAND. Und wenn ja, dann hat mich das Wort Lager nicht erschreckt. Trotz Kriegszeit und dem Schweigen meiner Rendezvous im Nacken steckte ich mit meinen siebzehn Jahren immer noch in einer hellen dummen Kindheit. Mich trafen die Wörter Aquarell und Fleisch. Für das Wort LAGER war mein Hirn taub.
Damals bei Tisch mit den Kartoffeln und der Gabel, als die Mutter mich mit dem Wort Fleisch erwischte, fiel mir auch ein, dass ich als Kind im Hof unten spielte und die Mutter aus dem Verandafenster schrie: Wenn du nicht gleich zu Tisch kommst, wenn ich jetzt noch mal rufen muss, kannst du bleiben, wo du bist. Weil ich dann noch eine Weile unten blieb, sagte sie, als ich oben ankam:
Jetzt kannst du dir den Ranzen packen und in die Welt gehen und machen was du willst. Dabei zerrte sie mich ins Zimmer, nahm den kleinen Rucksack und stopfte meine Wollkappe und Jacke hinein. Ich fragte: Aber wo soll ich hin, ich bin doch dein Kind.
Viele Leute meinen, Kofferpacken gehört zu den Übungssachen, man lernt es von selbst wie Singen oder Beten. Wir hatten keine Übung und auch keinen Koffer. Als mein Vater an die Front zu den rumänischen Soldaten musste, gab es nichts zu packen. Als Soldat kriegt man alles, es gehört zur Uniform. Außer fürs Wegfahren und gegen die Kälte wussten wir nicht, wofür wir packen. Das Richtige hat man nicht, man improvisiert. Das Falsche wird zum Notwendigen. Das Notwendige ist dann das einzig Richtige, nur weil man es hat.
Meine Mutter brachte das Grammophon aus dem Wohnzimmer und stellte es auf den Küchentisch. Ich machte mit dem Schraubenzieher aus dem Grammophonkistchen einen Koffer. Das Drehwerk und den Plattenteller habe ich zuerst ausgebaut. Dann das Loch, wo die Kurbel war, mit einem Korken zugestopft. Das Innenfutter blieb drin, fuchsroter Samt. Auch die dreieckige Plakette mit dem Hund vor dem Trichter HIS MASTERS VOICE habe ich nicht abmontiert. Auf den Kofferboden legte ich vier Bücher: den Faust in Leinen, den Zarathustra, den schmalen Weinheber und die Sammlung Lyrik aus acht Jahrhunderten. Keine Romane, denn die liest man nur einmal und nie wieder. Auf die Bücher kam das Necessaire. Darin waren: 1 Flacon Toilettenwasser, 1 Flacon Rasierwasser TARR, 1 Rasierseife, 1 Handrasierer, 1 Rasierpinsel, 1 Alaunstein, 1 Handseife, 1 Nagelschere. Neben das Necessaire legte ich 1 Paar Wollsocken (braun, schon gestopft), 1 Paar Kniestrümpfe, 1 rotweiß kariertes Flanellhemd, 2 kurze Ripsunterhosen. Ganz oben hin kam der neue Seidenschal, dass er sich nicht zerdrückt. Er war weinrot in sich selbst kariert, mal glänzend, mal matt. Da war der Koffer voll.
Dann das Bündel: 1 Tagesdecke vom Diwan (aus Wolle, hellblau und beige kariert, ein Riesengestell – aber es hielt nicht warm). Und hineingerollt: 1 Staubmantel (Pfeffer und Salz, schon sehr getragen) und 1 Paar Ledergamaschen (uralt, aus dem Ersten Weltkrieg, melonengelb mit Riemchen).
Dann der Brotbeutel mit: 1 Schinkenkonserve Marke Scandia, 4 geschmierte Brote, ein paar übriggebliebene Weihnachtskekse, 1 Feldflasche Wasser mit Trinkbecher.
Dann hat meine Großmutter den Grammophonkoffer, das Bündel und den Brotbeutel in die Nähe der Tür gestellt. Die zwei Polizisten hatten sich für Mitternacht angesagt, dann wollten sie mich holen. Das Gepäck stand fertig neben der Tür.
Dann zog ich mich an: 1 lange Unterhose, 1 Flanellhemd (beige-grün kariert), 1 Pumphose (grau, wie gesagt vom Onkel Edwin), 1 Stoffweste mit Strickärmeln, 1 Paar Wollsocken und 1 Paar Bokantschen. Die grünen Handschuhe von der Fini-Tante lagen griffbereit auf dem Tisch. Ich schnürte meine Bokantschen zu, und dabei fiel mir ein, dass meine Mutter vor Jahren in den Sommerferien auf der Wench einen selbstgenähten Matrosenanzug trug. Mitten im Spaziergang auf der Wiese ließ sie sich ins hohe Gras fallen und stellte sich tot. Ich war damals acht Jahre alt. Dieser Schrecken, der Himmel fiel ins Gras. Ich drückte die Augen zu, dass ich nicht sehe, wie er mich schluckt. Die Mutter sprang auf, schüttelte mich und sagte: Hast du mich gern, ich leb ja noch.
Die Bokantschen waren geschnürt. Ich setzte mich an den Tisch und wartete auf Mitternacht. Und Mitternacht kam, aber die Patrouille hatte Verspätung. Drei Stunden mussten vergehen, das hielt man fast nicht aus. Dann waren sie da. Die Mutter hielt mir den Mantel mit dem schwarzen Samtbündchen. Ich schlüpfte hinein. Sie weinte. Ich zog die grünen Handschuhe an. Auf dem Holzgang, genau dort, wo die Gasuhr ist, sagte die Großmutter: ICH WEISS DU KOMMST WIEDER.
Ich habe mir diesen Satz nicht absichtlich gemerkt. Ich habe ihn unachtsam mit ins Lager genommen. Ich hatte keine Ahnung, dass er mich begleitet. Aber so ein Satz ist selbständig. Er hat in mir gearbeitet, mehr als alle mitgenommenen Bücher. ICH WEISS DU KOMMST WIEDER wurde zum Komplizen der Herzschaufel und zum Kontrahenten des Hungerengels. Weil ich wiedergekommen bin, darf ich das sagen: So ein Satz hält einen am Leben.
Es war 3 Uhr in der Nacht zum 15. Januar 1945, als die Patrouille mich holte. Die Kälte zog an, es waren -15º C. Wir fuhren auf dem Lastauto mit Plane durch die leere Stadt zur Messehalle. Es war die Festhalle der Sachsen. Und jetzt das Sammellager. In der Halle drängten sich an die 300 Menschen. Auf dem Fußboden lagen Matratzen und Strohsäcke. Die ganze Nacht kamen Autos, auch von den umliegenden Dörfern, und luden eingesammelte Leute aus. Gegen Morgen waren es an die 500. Alles Zählen war in dieser Nacht umsonst, man hatte keinen Überblick. In der Messehalle brannte die ganze Nacht das Licht. Die Leute liefen herum, suchten nach Bekannten. Man erzählte, es seien Tischler am Bahnhof requiriert, die nageln Pritschen aus frischem Holz in Viehwaggons. Und andere Handwerker bauen Kanonenöfen in die Züge. Andere sägen Klolöcher in den Fußboden. Es wurde mit aufgerissenen Augen leise und viel gesprochen und mit zugedrückten Augen leise und viel geweint. Die Luft roch nach alter Wolle, verschwitzter Angst und fettigem Bratfleisch, Vanillegebäck und Schnaps. Eine Frau nahm ihr Kopftuch ab. Sie war bestimmt vom Dorf, ihr Zopf war auf dem Hinterkopf doppelt zusammengelegt und mit einem halbrunden Hornkamm auf der Kopfmitte hochgesteckt. Die Zähne des Hornkamms verschwanden im Haar, von seinem gewölbten Rand schauten nur zwei Ecken wie kleine spitze Ohren hervor. Mit den Ohren und dem dicken Zopf sah der Hinterkopf aus wie eine sitzende Katze. Ich saß wie ein Zuschauer zwischen stehenden Beinen und Gepäckhaufen. Für ein paar Minuten betäubte mich der Schlaf und ich träumte:
Meine Mutter und ich stehen auf dem Friedhof vor einem frischen Grab. Mittendrauf wächst, halb so hoch wie ich, eine Pflanze mit pelzigen Blättern. An ihrem Stengel ist eine Fruchtkapsel mit einem Ledergriff, ein kleiner Koffer. Die Kapsel steht fingerbreit offen, ausgepolstert mit fuchsrotem Samt. Wir wissen nicht, wer gestorben ist. Die Mutter sagt: Nimm die Kreide aus der Manteltasche. Ich hab doch keine, sage ich. Als ich in die Tasche greife, ist ein Stück Schneiderkreide drin. Die Mutter sagt: Wir müssen einen kurzen Namen auf den Koffer schreiben. Schreiben wir doch RUTH, so heißt niemand, den wir kennen. Ich schreibe RUHT.
Im Traum war mir klar, dass ich gestorben bin, aber das wollte ich meiner Mutter noch nicht sagen. Ich schreckte auf, weil sich ein älterer Mann mit einem Regenschirm neben mich auf den Strohsack setzte und nah an meinem Ohr sagte: Mein Schwager will noch kommen, aber die Halle ist rundum bewacht. Die lassen ihn nicht. Wir sind doch noch in der Stadt, und er kann nicht her und ich nicht nach Hause. Auf jedem Silberknopf seines Jacketts flog ein Vogel, wilde Ente oder eher Albatros. Denn das Kreuz auf seinem Brustabzeichen wurde, als ich mich weiter vorbeugte, ein Anker. Der Regenschirm stand wie ein Spazierstock zwischen mir und ihm. Ich fragte: Nehmen Sie den mit. Dort schneit es doch noch mehr als hier, sagte er.
Man hat uns nicht gesagt, wann und wie wir aus der Halle zum Bahnhof müssen. Dürfen, möchte ich sagen, weil ich endlich loswollte und sei es im Viehwaggon mit Grammophonkistchen und Samtbündchen am Hals zu den Russen. Ich weiß nicht mehr, wie wir zum Bahnhof kamen. Die Viehwaggons waren hoch. Auch die Prozedur des Einsteigens habe ich vergessen, weil wir so lange Tage und Nächte im Viehwaggon fuhren, als wären wir schon immer drin gewesen. Ich weiß auch nicht mehr, wie lang wir fuhren. Ich war der Meinung, lange fahren heißt, weit weg fahren. Solang wir fahren, kann uns nichts passieren. Solang wir fahren, ist es gut.
Männer und Frauen, junge und alte mit dem Gepäck am Kopfende der Pritsche. Reden und schweigen, essen und schlafen. Schnapsflaschen gingen reihum. Als das Fahren schon Gewohnheit war, fingen da und dort Schmuseversuche an. Man sah mit einem Auge hin und mit dem andern weg.
Ich saß neben der Trudi Pelikan und sagte: Mir kommt es vor wie beim Skiausflug in den Karpaten auf der Bulea-Hütte, wo eine halbe Lyzealklasse von einer Lawine geschluckt wurde. Uns kann das nicht passieren, sagte sie, wir haben gar kein Skizeug mitgenommen. Mit einem Grammophonkistchen kann man reiten, reiten, durch den Tag durch die Nacht durch den Tag, du kennst doch den Rilke, sagte die Trudi Pelikan in ihrem Glockenschnittmantel mit Pelzmanschetten bis hinauf zu den Ellbogen. Manschetten aus braunem Haar wie zwei halbe Hündchen. Die Trudi Pelikan schob manchmal beide Hände über Kreuz in die Ärmel, und die zwei Hundehälften wurden ein ganzes Hündchen. Damals hatte ich die Steppe noch nicht gesehen, sonst hätte ich an Erdhunde gedacht. Die Trudi Pelikan roch nach warmen Pfirsichen, sogar aus dem Mund, sogar am dritten, vierten Tag im Viehwaggon. Sie saß in ihrem Mantel wie eine Dame in der Straßenbahn auf dem Weg ins Büro und erzählte mir, sie habe sich vier Tage in einem Erdloch im Nachbargarten, hinter dem Schuppen versteckt. Doch dann kam der Schnee, jeder Schritt zwischen Haus, Schuppen und Erdloch wurde sichtbar. Ihre Mutter konnte ihr nicht mehr heimlich das Essen bringen. Man konnte im ganzen Garten die Fußstapfen lesen. Der Schnee denunzierte, sie musste freiwillig aus dem Versteck, freiwillig gezwungen vom Schnee. Das werde ich dem Schnee nie verzeihen, sagte sie. Frischgefallenen Schnee kann man nicht nachmachen, man kann Schnee nicht so arrangieren, dass er unberührt aussieht. Erde kann man arrangieren, sagte sie, auch Sand und sogar Gras, wenn man sich Mühe gibt. Und Wasser arrangiert sich von selbst, weil es alles schluckt und sich gleich wieder schließt, wenn es geschluckt hat. Und die Luft ist immer fertig arrangiert, weil man sie gar nicht sehen kann. Alles, außer dem Schnee hätte geschwiegen, sagte die Trudi Pelikan. Dass der dicke Schnee die Hauptschuld trägt. Dass er zwar in die Stadt gefallen ist, als wisse er, wo er ist, als wäre er bei sich zu Hause. Dass er aber den Russen sofort zu Diensten war. Wegen dem Schneeverrat bin ich hier, sagte die Trudi Pelikan.
Der Zug fuhr 12 Tage oder 14, unzählige Stunden, ohne zu halten. Dann hielt er unzählige Stunden, ohne zu fahren. Wo wir grad waren, wussten wir nicht. Außer wenn einer auf den oberen Pritschen ein Bahnhofsschild durch den Schlitz des Klappfensterchens vorlesen konnte: BUZǍU. Der Kanonenofen in der Waggonmitte dubberte. Die Schnapsflaschen kreisten. Alle waren angesäuselt, einige vom Getränk, andere von der Ungewissheit. Oder von beidem.
Was in den Worten VON DEN RUSSEN VERSCHLEPPT stecken könnte, ging einem zwar durch den Kopf, aber nicht aufs Gemüt. An die Wand stellen können sie uns erst, wenn wir ankommen, noch fahren wir. Dass man nicht längst an die Wand gestellt und erschossen worden war, wie man es aus der Nazipropaganda von zu Hause kannte, machte uns beinahe sorglos. Die Männer lernten im Viehwaggon, ins Blaue zu trinken. Die Frauen lernten, ins Blaue zu singen:
Im Walde blüht der Seidelbast
Im Graben liegt noch Schnee
Und das du mir geschrieben hast
Das Brieflein, tut mir weh
Immer dasselbe getragene Lied, bis man nicht mehr wusste, ob wirklich gesungen wird oder nicht, weil die Luft sang. Das Lied schwappte einem im Kopf und passte sich ans Fahren an – ein Viehwaggonblues und Kilometerlied der in Gang gesetzten Zeit. Es wurde das allerlängste Lied in meinem Leben, fünf Jahre lang haben die Frauen es gesungen und es so heimwehkrank gemacht wie wir alle waren.
Die Waggontür war von außen plombiert. Viermal wurde sie geöffnet, eine Schiebetür auf Rollen. Wir waren noch auf rumänischem Gebiet, und es wurde zweimal eine halbe, der Länge nach durchgesägte, nackte Ziege in den Waggon geschmissen. Sie war starrgefroren und polterte auf den Boden. Die erste Ziege hielten wir für Brennholz. Wir brachen ihre Stücke auseinander und verfeuerten sie. Sie war so dürr, dass sie gar nicht stank, sie brannte gut. Bei der zweiten Ziege machte das Wort PASTRAMA die Runde, luftgetrocknetes Fleisch zum Essen. Wir haben auch unsere zweite Ziege verheizt und gelacht. Sie war genau so starr und blau wie die erste, ein Schreckensgeknöch. Wir lachten zu früh, waren so überheblich, die beiden rumänischen, mildtätigen Ziegen zu verschmähen.
Die Vertrautheit wuchs mit der Länge der Zeit. In der Enge geschahen die kleinen Dinge, sich hinsetzen, aufstehen. Im Koffer wühlen, ausräumen, einräumen. Aufs Kloloch gehen hinter zwei hochgehaltene Decken. Jede Kleinigkeit zog eine andere nach sich. In einem Viehwaggon schrumpft jede Eigenart. Man ist mehr zwischen anderen vorhanden als bei sich selbst. Rücksichtnahme war gar nicht nötig. Man war füreinander da wie zu Hause. Vielleicht rede ich nur von mir, wenn ich das heute sage. Vielleicht nicht einmal von mir. Vielleicht zähmte mich die Enge im Viehwaggon, weil ich sowieso weg wollte und im Koffer noch genug zum Essen hatte. Wie sich der wilde Hunger bald über uns alle hermacht, ahnten wir nicht. Wie oft haben wir in den kommenden fünf Jahren, als uns der Hungerengel heimsuchte, diesen starren blauen Ziegen geglichen. Und ihnen nachgetrauert.
Es war schon die russische Nacht, Rumänien lag hinter uns. Wir hatten bei einem stundenlangen Halt das starke Ruckeln gespürt. An den Waggonachsen wurden die Räder auf die breitere russische Schienenspur umgestellt, auf die Steppenbreite. So viel Schnee machte die Nacht draußen hell. In dieser Nacht auf dem leeren Feld war der dritte Halt. Die russischen Wachsoldaten schrien UBORNAJA. Alle Türen aller Waggons wurden geöffnet. Wir purzelten hintereinander ins tiefer gelegene Schneeland und sanken bis zu den Kniekehlen ein. Wir begriffen, ohne zu verstehen, Ubornaja heißt gemeinschaftlicher Klogang. Oben, sehr hoch oben, der runde Mond. Vor unseren Gesichtern flog der Atem glitzrigweiß wie der Schnee unter den Füßen. Ringsherum die Maschinenpistolen im Anschlag. Und jetzt: Hosen runter.
Diese Peinlichkeit, das Schamgefühl der ganzen Welt. Wie gut, dass dieses Schneeland mit uns so allein war, dass niemand ihm zusah, wie es uns nötigte, dicht nebeneinander das Gleiche zu tun. Ich musste nicht aufs Klo, ließ aber die Hose herunter und setzte mich in die Hocke. Wie gemein und still dieses Nachtland war, wie es uns in der Notdurft blamierte. Wie die Trudi Pelikan links von mir ihren Glockenschnittmantel in die Achseln raffte und ihre Hose über die Knöchel herunterzog, wie man zwischen ihren Schuhen das Zischeln hörte. Wie hinter mir der Advokat Paul Gast beim Drücken stöhnte, wie seiner Frau Heidrun Gast das Gedärm vom Durchfall quakte. Wie der pestwarme Dampf rundherum sofort glitzrig in der Luft gefror. Wie uns dieses Schneeland eine Rosskur verpasste, uns mit blankem Hintern in den Geräuschen des Unterleibs einsam werden ließ. Wie armselig unsere Eingeweide wurden in dieser Gemeinsamkeit.
Vielleicht wurde in dieser Nacht nicht ich, aber der Schrecken in mir plötzlich erwachsen. Vielleicht wird Gemeinsamkeit nur auf diese Art wirklich. Denn alle, ausnahmslos alle setzten wir uns bei der Notdurft automatisch mit dem Gesicht in Richtung Bahndamm. Alle hatten wir den Mond im Rücken, die offene Viehwaggontür ließen wir nicht mehr aus den Augen, waren bereits auf sie angewiesen wie auf eine Zimmertür. Wir hatten schon die verrückte Angst, dass die Tür sich ohne uns schließt und der Zug ohne uns wegfährt.
Einer unter uns schrie in die weite Nacht: Da haben wirs, das scheißende Sachsenvolk, alle auf dem Haufen. Wenns den Bach runtergeht, geht nicht nur der Bach runter. Nicht wahr, ihr lebt doch alle gern. Er lachte leer wie Blech. Alle schoben sich ein Stück von ihm weg. Dann hatte er Platz und verneigte sich vor uns wie ein Schauspieler und wiederholte mit hohem und feierlichen Ton: Nicht wahr, ihr lebt doch alle gern.
In seiner Stimme hallte ein Echo. Einige fingen an zu weinen, die Luft stand glasig. Sein Gesicht war in den Wahn getaucht. Der Speichel auf seinem Jackett war glasiert. Da sah ich das Brustabzeichen, es war der Mann mit den Albatrosknöpfen. Er stand ganz allein und schluchzte mit einer Kinderstimme. Bei ihm geblieben war nur der versaute Schnee. Und hinter ihm die gefrorene Welt mit dem Mond wie ein Röntgenbild.
Die Lokomotive tutete einen einzigen dumpfen Ton. Das tiefste UUUH, das ich je gehört habe. Jeder drängte sich zu seiner Tür. Wir stiegen ein und fuhren weiter.
Den Mann hätte ich auch ohne Brustabzeichen erkannt. Ich habe ihn im Lager nie gesehen.
Meldekraut
Nichts, was wir hier im Lager bekommen hatten, hatte Knöpfe. Die Unterhemden, die langen Unterhosen hatten jeweils zwei Bändchen zum Verknoten. Das Kopfkissen hatte zweimal zwei Bändchen. In der Nacht war das Kopfkissen ein Kopfkissen. Am Tag war das Kopfkissen ein Leinwandsack, den man für alle Fälle, also fürs Stehlen und Betteln, bei sich trug.
Gestohlen haben wir vor, während und nach der Arbeit, nur nicht beim Betteln, das wir Hausieren nannten – und nicht vom Nachbar in der Baracke. Es war auch kein Stehlen, wenn wir nach der Arbeit auf dem Heimweg auf die Schutthalden ins Unkraut gingen und pflückten, bis das Kissen vollgestopft war. Schon im März hatten die Frauen vom Dorf herausgefunden, dass das Unkraut mit den gezackten Blättern LOBODǍ heißt. Dass man es im Frühjahr auch zu Hause gegessen hat wie wilden Spinat, dass es MELDEKRAUT heißt. Wir pflückten auch das Gras mit den gefiederten Blättern, es war wilder Dill. Voraussetzung war, dass man Salz hatte. Salz musste man sich auf dem Basar durch Tauschgeschäfte beschaffen. Es war grau und grob wie Schotter, man musste es noch klopfen. Salz war ein Vermögen wert. Wir hatten zwei Kochrezepte für das Meldekraut:
Die Meldekrautblätter kann man, gesalzen natürlich, roh essen, wie Feldsalat. Den wilden Dill fein zerrupfen und draufstreuen. Oder ganze Meldekrautstiele in Salzwasser kochen. Mit dem Löffel aus dem Wasser gefischt, ergeben sie einen berauschenden Falschen Spinat. Die Brühe trinkt man dazu, entweder als klare Suppe oder als grünen Tee.
Im Frühjahr ist das Meldekraut zart, die ganze Pflanze nur fingerhoch und silbergrün. Im Frühsommer ist sie kniehoch, ihre Blätter werden fingerig. Jedes Blatt kann anders aussehen, wie ein anderer Handschuh, ganz unten steht immer ein Daumen. Meldekraut so silbergrün, ist eine kühle Pflanze, ein Frühjahrsessen. Im Sommer musste man achtgeben, da wächst das Meldekraut rasch in die Höhe, wird dicht verzweigt, hartstielig und holzig. Es schmeckt bitter wie Lehmerde. Die Pflanze wird hüfthoch, um ihren dicken Mittelstiel bildet sich ein lockerer Strauch. Im Hochsommer färben sich Blätter und Stiele, fangen mit Rosa an, werden blut- und später blaurot und verdunkeln sich im Herbst bis ins tiefe Indigo. Alle Zweigspitzen kriegen Rispenketten aus Kügelchen wie bei den Brennesseln. Nur hängen die Rispen des Meldekrauts nicht, sie stehen schräg nach oben. Auch sie färben sich von Rosa zu Indigo.
Es ist seltsam, wenn sich das Meldekraut zu färben beginnt und längst ungenießbar ist, wird es erst richtig schön. Dann bleibt es geschützt von seiner Schönheit am Wegrand stehen. Die Zeit des Meldekrautessens ist vorbei. Aber nicht der Hunger, der immer größer ist als man selbst.
Was kann man sagen über den chronischen Hunger. Kann man sagen, es gibt einen Hunger, der dich krankhungrig macht. Der immer noch hungriger dazukommt, zu dem Hunger, den man schon hat. Der immer neue Hunger, der unersättlich wächst und in den ewig alten, mühsam gezähmten Hunger hineinspringt. Wie läuft man auf der Welt herum, wenn man nichts mehr über sich zu sagen weiß, als dass man Hunger hat. Wenn man an nichts anderes mehr denken kann. Der Gaumen ist größer als der Kopf, eine Kuppel, hoch und hellhörig bis hinauf in den Schädel. Wenn man den Hunger nicht mehr aushält, zieht es im Gaumen, als wäre einem eine frische Hasenhaut zum Trocknen hinters Gesicht gespannt. Die Wangen verdorren und bedecken sich mit blassem Flaum.
Ich wusste nie, soll man dem bitteren Meldekraut vorwerfen, dass man es nicht mehr essen kann, weil es verholzt und sich verweigert. Weiß das Meldekraut, dass es nicht mehr uns und dem Hunger dient, sondern dem Hungerengel. Die roten Rispenketten sind ein Geschmeide um den Hals des Hungerengels. Ab Frühherbst, wenn der erste Frost kam, schmückte sich das Meldekraut jeden Tag stärker, bis es erfror. Giftschöne Farben waren das, die im Augapfel stachen. Die Rispen, unzählige Reihen aus roten Halsketten, jeder Wegrand schmückte den Hungerengel. Er trug seinen Schmuck. Und wir trugen einen so hohen Gaumen, dass sich beim Gehen das Echo der Schritte im Mund überschlug. Eine Durchsichtigkeit im Schädel, als hätte man zu viel grelles Licht geschluckt. So ein Licht, das sich im Mund selber anschaut, sich süßlich ins Gaumenzäpfchen schleicht, bis es anschwillt und einem ins Hirn steigt. Bis man im Kopf kein Hirn, nur das Hungerecho hat.
Es gibt keine passenden Wörter fürs Hungerleiden. Ich muss dem Hunger heute noch zeigen, dass ich ihm entkommen bin. Ich esse buchstäblich das Leben selbst, seit ich nicht mehr hungern muss. Ich bin eingesperrt in den Geschmack des Essens, wenn ich esse. Ich esse seit meiner Heimkehr aus dem Lager, seit sechzig Jahren, gegen das Verhungern.
Ich sah das Meldekraut, das man nicht mehr essen konnte, und versuchte, an etwas anderes zu denken. An die letzte müde Wärme des Spätsommers, bevor der Eiswinter kam. Stattdessen dachte ich dann aber an Kartoffeln, die es nicht gab. Und an die Frauen, die auf dem Kolchos wohnten und womöglich schon neue Kartoffeln in der täglichen Krautsuppe bekamen. Sonst beneidete man sie nicht. Sie wohnten in Erdlöchern und mussten jeden Tag viel länger arbeiten, von Lichtanfang bis Lichtende.
Frühjahr im Lager, das hieß Meldekrautkochen für uns Meldegänger über die Schutthalden. Der Name MELDEKRAUT ist ein starkes Stück und besagt überhaupt nichts. MELDE war für uns ein Wort ohne Beiklang, ein Wort, das uns in Ruhe ließ. Es hieß ja nicht MELDE DICH, es war kein Appellkraut, sondern ein Wegrandwort. Auf jeden Fall war es ein Nachabendappellwort – ein Nachappellkraut, keinesfalls ein Appellkraut. Oft wartete man ungeduldig mit dem Meldekrautkochen, weil der Zählappell noch bevorstand und endlos dauerte, weil nichts stimmte.
Es gab fünf RB – RABOTSCHI BATALION in unserem Lager, fünf Arbeitsbataillone. Jedes einzelne hieß ORB – Odelna Rabotschi Batalion und bestand aus 500 bis 800 Internierten. Mein Bataillon hatte die Nummer 1009, meine Arbeitsnummer war 756.
Wir stellten uns auf in Reih und Glied – welch ein Ausdruck für diese fünf Elendsregimenter aus dicken Augen, großen Nasen, hohlen Wangen. Die Bäuche und Beine waren aufgepumpt mit dem dystrophischen Wasser. Ob Frost oder Gluthitze, ganze Abende vergingen im Stillgestanden. Nur die Läuse durften sich rühren an uns. Beim endlosen Durchzählen konnten sie sich vollsaufen und Paradegänge absolvieren über unser elendiges Fleisch, uns stundenlang vom Kopf bis in die Schamhaare kriechen. Meist hatten sich die Läuse schon satt gesoffen und in die Steppnähte der Watteanzüge schlafen gelegt, und wir standen immer noch still. Der Lagerkommandant Schischtwanjonow schrie noch immer. Seinen Vornamen kannten wir nicht. Er hieß nur Towarischtsch Schischtwanjonow. Das war lang genug, um vor Angst zu stottern, wenn man es aussprach. Mir fiel beim Namen Towarischtsch Schischtwanjonow immer das Rauschen der Deportationslokomotive ein. Und die weiße Nische zu Hause in der Kirche, DER HIMMEL SETZT DIE ZEIT IN GANG. Vielleicht mussten wir gegen die weiße Nische stundenlang stillstehen. Die Knochen wurden sperrig wie Eisen. Wenn das Fleisch am Körper verschwunden ist, wird einem das Tragen der Knochen zur Last, es zieht dich in den Boden hinein.
Ich übte beim Appell, mich beim Stillstehen zu vergessen und das Ein- und Ausatmen nicht voneinander zu trennen. Und die Augen hinaufzudrehen, ohne den Kopf zu heben. Und am Himmel eine Wolkenecke suchen, an die man seine Knochen hängen kann. Wenn ich mich vergessen und den himmlischen Haken gefunden hatte, hielt er mich fest.
Oft gab es keine Wolke, nur einerlei Blau wie offenes Wasser.
Oft gab es nur eine geschlossene Wolkendecke, einerlei Grau.
Oft liefen die Wolken, und kein Haken hielt still.
Oft brannte der Regen in den Augen und klebte mir die Kleider an die Haut.
Oft zerbiss der Frost mir die Eingeweide.
An solchen Tagen drehte mir der Himmel die Augäpfel hinauf, und der Appell zog sie hinunter – die Knochen hingen ohne Halt nur in mir allein.
Der Kapo Tur Prikulitsch stelzte zwischen uns und dem Kommandanten Schischtwanjonow herum, in seinen Fingern verrutschten die Listen, verkrumpelt vom vielen Blättern. Jedesmal, wenn er eine Nummer rief, wackelte seine Brust wie bei einem Hahn. Er hatte immer noch Kinderhände. Meine Hände waren im Lager gewachsen, viereckig, hart und flach wie zwei Bretter.
Wenn einer von uns nach dem Appell seinen ganzen Mut zusammennahm und einen der Natschalniks oder gar den Lagerkommandanten Schischtwanjonow fragte, wann wir nach Hause dürfen, sagten sie kurz: SKORO DOMOJ. Das hieß: Bald fahrt ihr.
Dieses russische BALD stahl uns die längste Zeit der Welt.
Beim Rasierer Oswald Enyeter ließ sich Tur Prikulitsch auch die Nasenhaare und die Fingernägel schneiden. Der Rasierer und Tur Prikulitsch waren Landsleute aus dem Dreiländereck der Karpato-Ukraine. Ich fragte, ob es im Dreiländereck üblich ist, dass man den besseren Kunden in der Rasierstube die Nägel schneidet. Der Rasierer sagte: Nein, so ist das nicht im Dreiländereck. Es kommt von Tur, nicht von zu Hause. Von zu Hause kommt der Fünfte nach dem Neunten. Was das heißt, fragte ich. Der Rasierer sagte: Ein bisschen Balamuk. Was das heißt, fragte ich. Er sagte: Ein bisschen Durcheinander.
Tur Prikulitsch war kein Russe wie Schischtwanjonow. Er sprach deutsch und russisch, gehörte aber zu den Russen, nicht zu uns. Er war zwar ein Internierter, aber der Adjutant der Lagerleitung. Er teilte uns ein auf dem Papier in Arbeitsbataillone und übersetzte die russischen Befehle. Und tat seine eigenen auf deutsch dazu. Auf dem Papier ordnete er zur Bataillonsnummer unsere Namen und Arbeitsnummern für die Gesamtübersicht. Jeder musste sich seine Nummern Tag und Nacht merken und wissen, dass wir Nummerierte, keine Privatleute sind.
Tur Prikulitsch schrieb in die Rubriken neben unsere Namen Kolchos, Fabrik, Schutträumen, Sandtransport, Bahnstrecke, Baustelle, Kohletransport, Garage, Koksbatterie, Schlacke, Keller. Was neben dem Namen stand, davon hing alles ab. Ob wir müde, hundsmüde oder todmüde werden. Ob wir nach der Arbeit noch Zeit und Kraft haben zum Hausieren. Ob wir unbemerkt im Küchenabfall hinter der Kantine wühlen dürfen.
Tur Prikulitsch geht nie auf Arbeit, in kein Bataillon, in keine Brigade, in keine Schicht. Er herrscht, darum ist er agil und abschätzig. Wenn er lächelt, ist es ein Hinterhalt. Wenn man sein Lächeln erwidert, was man ja muss, ist man blamiert. Er lächelt, weil er hinterm Namen in die Rubrik etwas Neues eingetragen hat, Schlimmeres. Zwischen den Baracken auf dem Lagerkorso weiche ich ihm aus, bevorzuge eine Entfernung, aus der man nicht reden kann. Er stellt die glänzenden Schuhe wie zwei Lacktäschchen von hoch oben auf den Gehweg, als falle die leere Zeit durch die Sohlen aus ihm heraus. Er merkt sich alles. Man sagt, auch was er vergisst, wird ein Befehl.
In der Rasierstube ist Tur Prikulitsch mir überlegen. Er sagt, was er will, nichts ist riskant. Es ist sogar besser, wenn er uns verletzt. Er weiß, dass er uns kleinhalten muss, damit es so bleibt. Er streckt den Hals und spricht immer nach unten. Er hat den ganzen Tag Zeit, um sich zu gefallen. Mir gefällt er auch. Er ist athletisch gebaut, hat messinggelbe Augen mit einem öligen Blick, kleine anliegende Ohren wie zwei Broschen, ein Kinn aus Porzellan, die Nasenflügel rosig wie Tabakblüten, sein Hals wie Kerzenwachs. Dass er sich nie dreckig macht, ist sein Glück. Und sein Glück macht ihn schöner als er es verdient. Wer den Hungerengel nicht kennt, kann auf dem Appellplatz kommandieren, auf dem Lagerkorso stelzen, in der Rasierstube schleichend lächeln. Aber mitreden kann er nicht. Ich weiß mehr über Tur Prikulitsch, als ihm lieb ist, weil ich Bea Zakel gut kenne. Sie ist seine Geliebte.
Die russischen Befehle hörten sich an wie der Name des Lagerkommandanten Towarischtsch Schischtwanjonow, ein Knirschen und Krächzen aus Ch, Sch, Tsch, Schtsch. Den Inhalt der Kommandos verstanden wir sowieso nicht, aber die Verachtung. An Verachtung gewöhnt man sich. Mit der Zeit klangen die Befehle nur noch wie ständiges Räuspern, Husten, Niesen, Schneuzen, Spucken – wie Schleimauswerfen. Die Trudi Pelikan sagte: Das Russische ist eine verkühlte Sprache.
Wenn alle anderen sich noch im Stillstehen beim Abendappell quälten, hatten die Schichtarbeiter, die vom Appell ausgenommen waren, schon ihr Feuerchen im Lagerwinkel hinterm Brunnen angezündet. Schon den Kochtopf drauf mit Meldekraut oder anderen seltenen Dingen, die einen Deckel brauchten, damit man sie nicht sieht. Rüben, Kartoffeln, sogar Hirse, wenn sich ein schlaues Tauschgeschäft gelohnt hatte – zehn Rübchen für eine Jacke, drei Maß Hirse für einen Pullover, ein halbes Maß Zucker oder Salz für ein Paar Schafwollsocken.
Für ein Extraessen brauchte der Topf unbedingt einen Deckel. Deckel gab es keine. Vielleicht ein Stück Blech und das vielleicht auch nur in Gedanken. Egal wie, man hat den Deckel für den Topf jedesmal aus irgendwas erfunden. Und man sagte stur: Da muss ein Deckel drauf. Obwohl es nie ein Deckel war, nur die Redensart vom Deckel war noch da. Vielleicht deckelt sich die Erinnerung, wenn man nicht mehr weiß, woraus der Deckel war und wenn es sowohl nie als auch immer, egal aus was, einen Deckel gab.
Jedenfalls flackerten im Lagerwinkel hinterm Brunnen im Abendwerden an die fünfzehn bis zwanzig Feuerchen zwischen zwei Ziegelsteinen. Alle anderen hatten nichts zum privaten Kochen neben dem Kantinenfraß. Die Kohle machte Rauch, die Topfbesitzer hielten Wache mit dem Löffel in der Hand. An Kohle gab es keinen Mangel. Die Töpfe waren aus der Kantine, miserables Essgeschirr der Lokalindustrie. Graubraun emaillierte Blechgefäße voller Blattern und Dellen. Auf dem Feuer im Hof waren es Töpfe, auf dem Kantinentisch Teller. Wenn einer sein Essen fertiggekocht hatte, warteten andere Topfbesitzer darauf, das Feuer zu übernehmen.
Wenn ich nichts zum Kochen hatte, schlängelte mir der Rauch durch den Mund. Ich zog die Zunge einwärts und kaute leer. Ich aß Speichel mit Abendrauch und dachte an Bratwurst. Wenn ich nichts zu kochen hatte, ging ich in die Nähe der Töpfe und tat so, als würde ich mir vorm Schlafengehen am Brunnen die Zähne putzen. Doch bevor ich die Zahnbürste in den Mund steckte, aß ich zweimal. Mit dem Augenhunger aß ich das gelbe Feuer und mit dem Gaumenhunger den Rauch. Während ich aß, war um mich her alles still, und vom Fabrikgelände drüben fiel durch die Dämmerung das Rumpeln der Koksbatterien. Ich wurde langsamer, je schneller ich vom Brunnen weg wollte. Ich musste mich losreißen von den Feuerchen. Im Rumpeln der Koksbatterien hörte ich das Magenknurren, das ganze Abendpanorama hatte Hunger. Der Himmel senkte sich schwarz auf die Erde, und ich wankte in die Baracke ins gelbe Dienstlicht der Glühbirne.
Das Zähneputzen ging auch ohne Zahnpasta. Die von zu Hause mitgebrachte war längst schon alle. Und Salz war viel zu wertvoll, das hätte man nicht ausgespuckt, das war ein Vermögen wert. An das Salz und seinen Wert kann ich mich erinnern. An das Zahnbürstchen überhaupt nicht. Mitgenommen im Necessaire habe ich eins. Aber das kann keine vier Jahre gehalten haben. Und eine neue Zahnbürste kaufte ich mir, wenn überhaupt, erst im fünften und letzten Jahr, als wir Geld auf die Hand kriegten, Bargeld für unsere Arbeit. Doch auch an meine neue Zahnbürste, wenn es sie gegeben hat, kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht wollte ich für mein Bargeld auch lieber neue Kleider als eine neue Zahnbürste. Meine erste sichere Zahnpasta, die ich von zu Hause mitgenommen hatte, hieß CHLORODONT. Dieser Name kann sich an mich erinnern. Die Zahnbürsten, sowohl die sichere erste als auch die mögliche zweite, haben mich vergessen. Genauso ist es mit meinem Kamm. Einen muss ich ja gehabt haben. An das Wort BAKELIT kann ich mich erinnern. Zu Kriegsende waren bei uns zu Hause alle Kämme Bakelitkämme.
Kann es sein, dass ich die von zu Hause mitgebrachten Sachen eher vergessen habe als die im Lager erworbenen. Und wenn, liegt es daran, dass sie mit mir mitgekommen waren. Dass ich sie besaß und weiter benutzte, bis sie abgenutzt waren und darüber hinaus, so als wäre ich mit ihnen nicht woanders, sondern zu Hause. Kann es sein, dass ich mich an die Gegenstände der anderen besser erinnern kann, weil ich sie ausleihen musste.