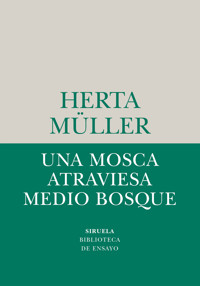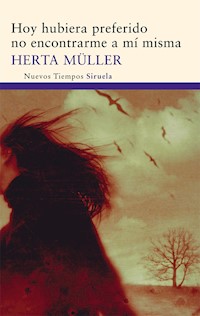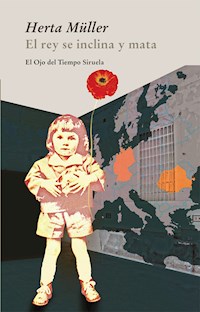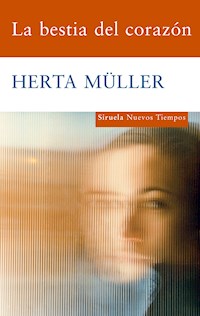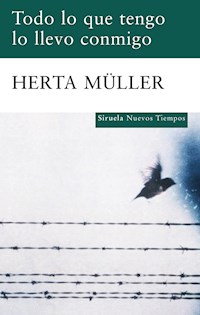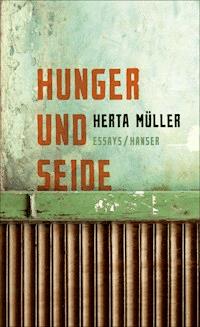Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich bin bestellt." Eine junge Frau in einer Großstadt in Rumänien auf dem Weg zum Verhör beim Geheimdienst. Sie hat diese Fahrt mit der Straßenbahn schon oft machen müssen, doch diesmal hat sie aus einer Vorahnung heraus Handtuch, Zahnpasta und Zahnbürste eingepackt. Unterwegs lässt sie ihr Leben an sich vorüberziehen: die Kindheit in der Provinz, die halberotische Gier nach dem Vater, die Deportation der Großeltern, das sporadische Glück, das ihr mit Paul gelingt, auch wenn sein Trinken für ihre Liebe eine Last ist. Außen: starre Uhrzeiten, Haltestellen, ein- und aussteigende Personen, vorbeiziehende Straßen. All dies soll ablenken und führt doch immer wieder zurück zu: "Ich bin bestellt." Doch an diesem Tag hält der Fahrer an der Station, an der sie aussteigen muss, nicht an. Und sie beschließt zum ersten Mal, nicht zum Verhör zu gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HERTA MÜLLER
Heute wär ich
mir lieber
nicht begegnet
ROMAN
CARL HANSER VERLAG
Die Erstausgabe erschien 1997 beim Rowohlt Verlag.
ISBN 978-3-446-23535-9
© Carl Hanser Verlag München 2009
Alle Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Ich bin bestellt. Donnerstag Punkt zehn.
Ich werde immer öfter bestellt: Dienstag Punkt zehn, Samstag Punkt zehn, Mittwoch oder Montag. Als wären Jahre eine Woche, mich wundert schon, daß es dabei nach dem späten Sommer bald wieder Winter ist.
Auf dem Weg zur Straßenbahn hängen wieder die Sträucher mit den weißen Beeren durch die Zäune. Wie Perlmuttknöpfe, die unten angenäht sind, vielleicht bis in die Erde hinein, oder wie Brotkugeln. Für weiße Vogelköpfe mit weggedrehten Schnäbeln sind die Beeren viel zu klein, trotzdem muß ich an weiße Vogelköpfe denken. Davon wird man schwindlig. Lieber denk ich an Schneetupfen im Gras, aber davon wird man verloren, und von Kreide schläfrig.
Die Straßenbahn hat keine festen Fahrzeiten.
Mir scheint sie rauscht, wenn es nicht die hartblättrigen Pappeln sind. Sie kommt schon angefahren, heute will sie mich gleich mitnehmen. Ich hab mir vorgenommen, den alten Mann mit dem Strohhut beim Einsteigen vorzulassen. Als ich kam, stand er schon an der Haltestelle, wer weiß wielange. Gebrechlich ist er zwar nicht, aber dünn wie sein Schatten, bucklig und matt. In der Hose ist kein Hintern, keine Hüften, nur die Knie sind ausgebeult. Aber wenn er nun ausgerechnet jetzt, wenn die Wagentür aufgeht, auf den Boden spucken muß, steig ich doch vor ihm ein. Es sind fast alle Sitze frei, und er sucht sie mit den Augen ab und bleibt dann stehen. Daß so alte Leute nicht müde sind und sich das Stehen nicht für dort aufheben, wo man nicht sitzen kann. Manchmal hört man alte Leute sagen: Auf dem Friedhof liegt man noch lang genug. Dabei denken sie gar nicht ans Sterben, und sie haben auch recht. Es ging noch nie der Reihe nach, es sterben auch Junge. Ich setz mich immer, wenn ich nicht stehen muß. Auf dem Sitz zu fahren ist, als würde man im Sitzen gehen. Der Mann mustert mich, in diesem leeren Wagen spürt man das gleich. Zum Reden habe ich den Kopf nicht frei, sonst würde ich fragen, was es an mir zu sehen gibt. Es schert ihn nicht, daß sein Geschaue mich stört. Draußen zieht die halbe Stadt vorbei, zwischen Bäumen und Häusern gibt es Abwechslung. Man sagt, so alte Leute spüren mehr als junge. Vielleicht sogar, daß ich heute ein kleines Handtuch, Zahnpasta und eine Zahnbürste in der Handtasche habe. Und kein Taschentuch, denn weinen will ich nicht. Paul hat nicht gespürt, wieviel Angst ich habe, daß Albu mich heute unter sein Büro in die Zelle führen könnte. Ich habe ihm nichts gesagt, wenn es so wird, erfährt er es noch schnell genug. Die Straßenbahn fährt langsam. Der Strohhut des Alten hat ein fleckiges Band wahrscheinlich vom Schweiß oder vom Regen. Albu wird mir, wie immer, zur Begrüßung einen Handkuß mit Spucke geben.
Major Albu hebt meine Hand an den Fingerspitzen und drückt mir die Nägel zusammen, daß ich schreien könnte. Mit der Unterlippe küßt er meine Finger, die obere hält er frei, damit er reden kann. Er gibt mir den Handkuß immer auf die gleiche Art, aber beim Reden sagt er immer etwas anderes:
Na na, deine Augen sind heute entzündet.
Mir scheint, dir wächst ein Schnurrbart, in deinem Alter ein bißchen früh.
Ach, das Händchen ist heute eiskalt, hoffentlich nicht vom Kreislauf
Oje, dein Zahnfleisch schrumpft, als wärst du deine Oma.
Meine Oma ist nicht alt geworden, sage ich, es blieb ihr keine Zeit, die Zähne zu verlieren. Was mit den Zähnen meiner Oma war, wird Albu wissen, darum erwähnt er sie.
Als Frau weiß man, wie man heute aussieht. Und daß ein Handkuß erstens nicht weh tut, zweitens nicht naß ist, drittens auf die Rückseite der Hand gehört. Wie ein Handkuß auszusehen hat, wissen Männer besser als Frauen, Albu bestimmt auch. Sein ganzer Kopf riecht nach Avril, einem französischen Parfüm, das auch mein Schwiegervater, der Parfümkommunist, benutzte. Alle anderen Leute, die ich kenne, würden es nicht kaufen. Es kostet auf dem Schwarzmarkt mehr als ein Anzug im Laden. Vielleicht heißt es auch September, den bitteren, rauchigen Geruch von brennendem Laub verwechsle ich aber nicht.
Wenn ich mich an den kleinen Tisch gesetzt habe, sieht Albu, daß ich die Finger an meinem Rock reibe, nicht nur, um sie wieder zu spüren, sondern auch, um die Spucke abzuwischen. Er dreht an seinem Siegelring und schmunzelt. Und wenn schon, Spucke kann man abwischen, sie trocknet sogar von selbst und ist nicht giftig. Spucke hat jeder im Mund. Andere spucken auf den Gehsteig und zerreiben es mit dem Schuh, weil es sich nicht einmal auf dem Gehsteig gehört. Albu spuckt bestimmt nicht auf den Gehsteig, in der Stadt, wo man ihn nicht kennt, spielt er den feinen Herrn. Meine Nägel tun weh, aber er hat sie noch nie blau gedrückt. Sie tauen wieder auf, als kämen eiskalte Hände plötzlich ins Warme. Daß ich glaub, mir rutscht das Hirn vornüber ins Gesicht, das ist das Gift. Demütigung, wie soll man es anders sagen, wenn man sich am ganzen Körper barfuß fühlt. Nur was dann, wenn sich mit dem Wort nicht viel sagen läßt, wenn das beste Wort schlecht ist.
Seit drei Uhr heute morgen hab ich gehorcht, wie der Wecker tickt: Bestellt, bestellt, bestellt... Im Schlaf tritt Paul quer durchs Bett und zuckt zurück, so schnell, daß er ohne aufzuwachen selber erschrickt. Das ist eine Angewohnheit. Mein Schlaf ist vorbei. Ich liege wach und weiß, daß ich die Augen schließen müßte, um wieder einzuschlafen. Aber ich schließe sie nicht. Ich habe das Schlafen schon öfter verlernt und wieder lernen müssen, wie es geht. Es geht ganz einfach oder gar nicht. Alles schläft gegen Morgen, auch Katzen und Hunde streifen nur die halbe Nacht um die Mülltonnen. Wenn man weiß, daß man doch nicht schlafen kann, ist es leichter, im dunklen Zimmer an etwas Helles zu denken, als vergebens die Augen zuzudrücken. An Schnee, geweißte Baumstämme, weiße Zimmer, viel Sand – damit hab ich mir öfter, als mir lieb war, bis es hell wurde, die Zeit vertrieben. Heute morgen hätte ich an Sonnenblumen denken können, und tat es auch, aber vergessen, daß ich für Punkt zehn bestellt bin, kann ich dabei nicht. Seit der Wecker bestellt, bestellt, bestellt tickte, habe ich an Major Albu denken müssen, noch bevor ich an mich und Paul gedacht habe. Heute war ich, als Paul zuckte, schon wach. Ich hatte schon, als das Fenster grau wurde, an der Zimmerdecke ganz groß Albus Mund gesehen, die rosa Zungenspitze hinter der unteren Zahnreihe, und die mokante Stimme gehört:
Warum die Nerven verlieren, wir fangen erst an.
Nur wenn ich zwei, drei Wochen nicht bestellt bin, werde ich von Pauls Beinen geweckt. Dann bin ich froh, es zeigt sich, daß ich wieder gelernt habe, wie das mit dem Schlafen geht.
Wenn ich das Schlafen wieder gelernt hab und Paul morgens frage: was hast du geträumt, kann er sich an nichts erinnern. Ich zeige ihm, wie er mit gespreizten Zehen ausschlägt, dann die Beine schnell zurücknimmt und die Zehen krümmt. Ich zieh den Stuhl vom Tisch in die Küchenmitte, setz mich hin, halte die Beine in die Luft und führe das Ganze vor. Paul kann dabei lachen, und ich sage:
Du lachst über dich.
Na ja, vielleicht bin ich im Traum Motorrad gefahren und habe dich mitgenommen, sagt er.
Das Zucken ist wie vorpreschen und mittendrin fliehen, ich bilde mir ein, es kommt vom Trinken. Das sage ich nicht. Und nicht, daß die Nacht das Torkeln aus Pauls Beinen mitnimmt. So muß es sein, sie packt es an den Knien, zieht es zuerst in die Zehen, dann ins sackdunkle Zimmer. Und gegen Morgen, wenn die Stadt ganz für sich schläft, ins Schwarze auf der Straße draußen. Wenn es nicht so wäre, könnte Paul beim Aufwachen nicht gerade stehen. Wenn die Nacht von jedem den Suff nimmt, müßte sie gegen Morgen voll sein bis zu den Sternen. Es trinken so viele in der Stadt.
Kurz nach vier sind auf der Ladenstraße unten die Lieferwagen angekommen. Sie zerreißen die Stille, brummen viel und liefern wenig, einige Kisten mit Brot, Milch und Gemüse und viele mit Schnaps. Wenn da unten das Essen ausgeht, finden Frauen und Kinder sich damit ab, die Schlangen gehen auseinander, die Wege führen nach Haus. Aber wenn die Flaschen ausgehen, verfluchen die Männer ihr Leben und ziehen das Messer. Die Verkäufer reden ihnen zu, aber das hält nur, bis sie wieder draußen sind. Sie gehen auf die Suche, streichen in der Stadt herum. Die ersten Schlägereien gibt es, weil sie keinen Schnaps finden, die nächsten, weil sie vollgesoffen sind.
Der Schnaps wächst zwischen den Karpaten und der dürren Ebene im Hügelland. Da stehen Pflaumenbäume, daß man die winzigkleinen Dörfer dazwischen kaum sieht. Ganze Wälder, im Spätsommer blau angeregnet, die Äste tragen sich krumm. Der Schnaps heißt wie das Hügelland, doch niemand benutzt den Namen auf dem Etikett. Namen bräuchte er keinen, es gibt nur einen Schnaps im Land, und die Leute nennen ihn nach dem Bild des Etiketts: «Zwei Pflaumen». Die beiden Pflaumen mit aneinander gelehnten Wangen sind den Männern so vertraut wie den Frauen die Heilige Maria mit dem Kind. Es heißt, die Pflaumen zeigen die Liebe zwischen dem Trinker und der Flasche. In meinen Augen ähneln die Pflaumen mit aneinander gelehnten Wangen mehr den Hochzeitsbildern als der Maria mit dem Kind. Auf keinem Bild in der Kirche ist der Kopf des Kindes so hoch wie der seiner Mutter. Das Kind lehnt die Stirn an die Wange der Heiligen, seine Wange an ihren Hals und sein Kinn an ihre Brust. Außerdem kommt es zwischen dem Trinker und der Flasche wie bei den Paaren auf den Hochzeitsbildern, sie machen einander zunichte und lassen einander nicht los.
Ich trage auf meinem Hochzeitsbild mit Paul keine Blumen, keinen Schleier. Mir glänzt die Liebe neu in den Augen, doch ich heirate zum zweiten Mal auf diesem Bild. Unsere Wangen lehnen wie zwei Pflaumen aneinander. Seit Paul so viel trinkt, ist unser Hochzeitsbild Wahrsagerei. Wenn Paul bis zum späten Abend auf Sauftour in der Stadt ist, hab ich Angst, daß er nie mehr nach Hause kommt und sehe das Hochzeitsbild an der Wand so lange an, bis sich der Blick verschiebt. Dann schwimmen unsere Gesichter, die Stellung unserer Wangen ändert sich, zwischen ihnen steht ein bißchen Luft. Meist schwimmt Pauls Wange von meiner Wange weg, als käme er spät nach Haus. Aber er kommt, Paul ist noch immer nach Haus gekommen, sogar nach dem Unfall.
Manchmal wird polnischer Büffelgrasvodka geliefert, der süßbittere, gelbe. Er wird zuerst verkauft. In jeder Flasche steht ein langer, ertrunkener Halm, der beim Einschenken zittert, aber nie umfällt oder herausgeschwemmt wird. Trinker sagen:
Der Grashalm bleibt in der Flasche wie die Seele im Körper, darum behütet er die Seele.
Zu dem brennenden Geschmack im Mund und dem flackernden Suff im Kopf gehört dieser Glaube. Die Trinker öffnen die Flasche, das Einschenken gluckst im Glas, der erste Schluck läuft in den Hals. Die Seele, die immer zittert, nie umfällt und den Körper nie verläßt, fängt an, behütet zu werden. Auch Paul behütet seine Seele und muß sich keinen Tag sagen, daß sein Leben nicht zu packen ist. Vielleicht wäre es gut ohne mich, doch wir sind gerne zusammen. Der Schnaps nimmt den Tag weg und die Nacht den Suff. Aus der Zeit, als ich noch frühmorgens zur Konfektionsfabrik mußte, weiß ich, daß die Arbeiter sagten: Das Laufwerk der Nähmaschinen ölt man durch die Rädchen, das Gehwerk der Menschen durch den Hals.
Damals fuhren Paul und ich jeden Tag um Punkt fünf mit dem Motorrad zur Arbeit. Wir sahen die Lieferwagen vor den Läden, die Fahrer, Kistenträger, die Verkäufer und den Mond. Jetzt höre ich nur den Lärm und gehe nicht zum Fenster, und sehe auch den Mond nicht an. Ich weiß noch, daß er wie ein Gänseei auf der einen Seite des Himmels aus der Stadt hinausgeht und auf der anderen die Sonne kommt. Daran hat sich nichts geändert, auch bevor ich Paul kannte und zu Fuß bis zur Straßenbahn ging, war es so. Es war mir auf dem Fußweg nicht geheuer, daß am Himmel oben etwas Schönes ist, und auf der Erde unten kein Gesetz, welches das Hinaufsehen verbietet. Es war also erlaubt, dem Tag etwas abzuluchsen, bevor er elend wurde in der Fabrik. Ich fror, weil ich mich nicht satt sehen konnte, nicht weil ich zu dünn angezogen war. Der Mond ist zerfressen um diese Zeit, weiß am Ende der Stadt nicht wohin. Der Himmel muß den Boden loslassen, wenn es hell wird. Die Straßen laufen steil hinunter und hinauf auf ebener Erde. Die Straßenbahnwagen fahren hin und her wie beleuchtete Zimmer.
Auch die Straßenbahnen kenne ich von innen. Wer um diese Uhrzeit einsteigt, ist kurzärmlig, trägt seine abgewetzte Ledertasche und an beiden Armen Gänsehaut. Er wird mit trägen Blicken abgeurteilt. Man ist unter sich, die Arbeiterklasse. Bessere Leute fahren mit dem Auto zur Arbeit. Und untereinander vergleicht man: Der hat es besser, der schlechter. Genau wie man selbst hat es keiner, das gibt es nicht. Man hat wenig Zeit, bald kommen die Fabriken, die Taxierten steigen nacheinander aus. Geputzte oder staubige Schuhe, schiefe oder gerade Absätze, ein frischgebügelter oder verhutzelter Kragen, Fingernägel, Uhrriemen, Gürtelschnalle, Scheitellauf, alles pocht auf Neid oder Verachtung. Vor verschlafenen Blicken kann sich nichts verbergen, nicht einmal im Gedränge. Die Arbeiterklasse sucht Unterschiede, es gibt keine Gleichheit am Morgen. Die Sonne fährt innen mit und zieht draußen die Wolken weiß und rot nach oben für die Mittagsglut. Niemand trägt eine Jacke, das Frieren am Morgen heißt frische Luft, weil am Mittag der dicke Staub und die teuflische Hitze kommen.
Wenn ich nicht bestellt bin, schlafen wir jetzt um diese Zeit noch Stunden. Statt tiefschwarz ist der Tagschlaf flach und gelb. Wir schlafen unruhig, die Sonne fällt uns aufs Kissen. Aber den Tag kann man dennoch verkürzen. Wir werden noch früh genug beobachtet, uns läuft der Tag nicht weg. Man kann uns immer etwas vorwerfen, auch wenn wir fast bis Mittag schlafen. Sowieso wirft man uns immer etwas vor, an dem nichts mehr zu ändern ist. Man schläft, aber der Tag wartet, auch ein Bett ist kein anderes Land. In Ruhe lassen wird man uns erst dann, wenn wir bei Lilli liegen.
Natürlich muß Paul auch seinen Rausch ausschlafen. Erst um die Mittagszeit sitzt sein Kopf fest im Nacken, sein Mund kann wieder reden, schlürft die Wörter nicht mit einer Stimme, die geliehen ist vom Suff. Nur sein Atem riecht noch, als müßte ich unten an der offenen Bartür vorbei, wenn Paul in die Küche kommt. Seit dem Frühjahr sind die Trinkzeiten durch ein Gesetz geregelt, erst nach elf Uhr ist das Trinken erlaubt. Aber die Bar öffnet immer noch um sechs, und bis elf steht der Schnaps in Kaffeetassen, danach gibt es Gläser.
Paul trinkt und ist nicht mehr derselbe, schläft seinen Rausch aus und ist wieder derselbe. Gegen Mittag wäre alles wieder gut und wird wieder verdorben. Paul hütet seine Seele, bis das Büffelgras auf dem Trockenen steht, und ich grüble, wer wir sind, ich und er, bis ich nichts mehr weiß. Wenn wir gegen Mittag am Küchentisch sitzen, ist es falsch, über den Rausch von gestern zu reden. Dennoch sage ich mal das eine, mal das andere:
Der Schnaps ändert nichts.
Warum machst du mir das Leben schwer.
Dein Rausch war gestern größer als die Küche hier.
Ja, die Wohnung ist klein, und ich will Paul nicht ausweichen, aber wir sitzen, wenn wir zu Hause bleiben, zu oft am Tag in der Küche. Nachmittags ist er schon betrunken und abends noch mehr. Ich schiebe das Reden auf, weil er grantig wird. Ich warte über Nacht, bis er wieder nüchtern in der Küche sitzt, mit Zwiebelaugen in der Stirn. Was ich dann sage, geht an ihm vorbei. Ich möchte, daß Paul mir einmal recht gibt. Doch bei Trinkern gibt es kein Geständnis, kein stummes für sie selber und ein abgerungenes für andere, die darauf warten, schon längst nicht. Paul denkt schon beim Aufwachen ans Trinken und leugnet es. Darum gibt es keine Wahrheit. Wenn er nicht schweigend an mir vorbei hört, sagt er mir für den ganzen Tag:
Mach dir keine Sorgen, ich trink nicht aus Verzweiflung, sondern weils mir schmeckt.
Das kann sein, sage ich, du denkst mit der Zunge.
Paul sieht durchs Küchenfenster in den Himmel, oder in die Tasse. Er tupft in die Kaffeetropfen auf dem Tisch, als müßte er sich überzeugen, daß sie naß sind und größer werden, wenn man sie verschmiert. Er nimmt meine Hand, ich sehe durchs Küchenfenster in den Himmel, in die Tasse, ich tupf auch in den einen und anderen Kaffeetropfen auf dem Tisch. Die rote Emailledose sieht uns an, ich schau zurück. Paul nicht, sonst müßte er sich heut etwas anderes vornehmen als gestern. Ist er nun stark oder schwach, wenn er schweigt, statt einmal zu sagen: Heute trinke ich nicht. Gestern sagte Paul wieder:
Mach dir keine Sorgen, dein Mensch trinkt, weil es ihm schmeckt.
Die Beine trugen ihn durch den Flur, zu schwer, zu leicht, als wären darin Sand und Luft durcheinander. Ich legte meine Hand um seinen Hals, streichelte die Stoppeln, die ich so gern morgens anfasse, weil sie im Schlaf gewachsen sind. Er zog meine Hand hinauf unter sein Auge, sie rutschte die Wange hinunter bis an sein Kinn. Ich hab die Finger nicht weggezogen, nur gedacht hab ich mir:
Man soll nichts an die Wange lehnen, wenn man das Bild der beiden Pflaumen kennt.
Ich höre es gern am späten Morgen, wenn Paul so redet, und es gefällt mir nicht. Wenn ich gerade von ihm wegrücke, lehnt er seine Liebe an, die so nackt daherkommt, daß er nichts weiter über sich zu reden braucht. Er hat auf nichts zu warten. Mein Einverständnis steht parat, ich habe keinen Vorwurf mehr auf meiner Zunge. Und der im Kopf verzieht sich rasch. Gut, daß ich mich nicht sehe, ich glaube, mein Gesicht wird dumm und hell. Auch gestern morgen schlüpfte aus Pauls Kater unerwartet eine Katzennase, die auf weichen Pfoten geht. DEIN MENSCH, so redet nur, wer flach im Kopf und an den Mundwinkeln sehr stolz ist. Obwohl die Zärtlichkeit am Mittag die Wege glatt macht für den Suff am Abend, bin ich darauf angewiesen, und es gefällt mir nicht, wie ich sie brauche.
Der Major Albu sagt: Man sieht, was du denkst, es hat keinen Sinn, zu leugnen, wir verlieren nur Zeit. Ich, nicht wir, er ist doch sowieso im Dienst. Er schiebt den Ärmel hoch und sieht nach der Uhr. Die Zeit, sie steht dort drauf, aber nicht, was ich denk. Wenn Paul nicht sieht, was ich denke, sieht er es schon längst nicht.
Paul schläft an der Wand, und ich an der Bettkante vorne, weil ich öfter nicht schlafen kann. Dennoch sagt er nach dem Aufwachen immer wieder:
Du hast in der Mitte gelegen und mich an die Wand gedrückt.
Darauf sage ich:
Das kann nicht sein, vorne mein Platz war so schmal wie die Wäscheleine, in der Mitte warst du.
Einer von uns könnte im Bett, der andere auf dem Sofa schlafen. Wir haben es probiert. Eine Nacht legte ich mich aufs Sofa und die nächste Paul. Beide Nächte habe ich mich nur hin und her gedreht. Mein Kopf hat Gedanken gemahlen und gegen Morgen im Halbschlaf schlechte Träume gehabt. Zwei Nächte voll mit schlechten Träumen, die hintereinander aufgefädelt den ganzen Tag nach mir griffen. Als ich auf dem Sofa lag, hat mein erster Mann den Koffer auf die Flußbrücke gestellt und mich am Nacken gepackt und schallend gelacht. Dann aufs Wassser geschaut und das Lied gepfiffen, in dem die Liebe zerbricht und das Flußwasser schwarz wie Tinte wird. Es war nicht wie Tinte, ich hab es gesehen und im Wasser drin sein Gesicht, steil und verkehrt bis auf den Grund, wo der Kies lag. Dann hat ein Schimmel unter dichten Bäumen Aprikosen gefressen. Bei jeder Aprikose den Kopf gehoben und den Stein ausgespuckt wie ein Mensch. Und als ich allein im Bett lag, hat mir jemand von hinten an die Schulter gefaßt und gesagt:
Schau dich nicht um, ich bin nicht da.
Ich habe den Kopf nicht gedreht, nur aus den Augenwinkeln geschielt. Lillis Finger faßten mich an, ihre Stimme war eine Männerstimme, also war sie es nicht. Ich hob meine Hand, um sie zu berühren. Da sagte die Stimme:
Was man nicht sieht, faßt man nicht an.
Die Finger habe ich gesehen, es waren ihre, nur hatte jemand anders sie genommen. Den sah ich nicht. Und in dem nächsten Traum hat mein Opa einen eingeschneiten Hortensienstrauch geschoren und mich zu sich gerufen: Komm mal her, ich hab da ein Lamm.
Der Schnee fiel ihm auf die Hose, die Schere schnitt die frostbraun gefleckten Blüten ab. Ich sagte:
Das ist doch kein Lamm.
Ein Mensch ist es auch nicht, sagte er.
Seine Finger waren klamm und konnten die Schere nur langsam öffnen und schließen. Da war ich mir nicht sicher, ob die Schere quietscht oder die Hand. Ich warf die Schere in den Schnee. Sie versank, man sah gar nicht, wohin sie gefallen war. Er suchte den ganzen Hof ab mit der Nase dicht überm Schnee. Neben dem Gartentor trat ich ihm auf die Hände, damit er die Nase hebt und nicht zum Tor hinaus, die ganze weiße Straße absucht. Ich sagte:
Hör doch auf, das Lamm ist erfroren und die Wolle im Frost verbrannt.
Am Gartenzaun stand noch eine Hortensie, die kahlgeschoren war. Ich zeigte hinüber:
Was ist mit der.
Das ist die Schlimmste, sagte er, sie kriegt im Frühjahr Junge, das geht doch nicht.
Nach der zweiten Nacht meinte Paul am Morgen: Wenn man einander stört, dann hat man jemand. Nur im Sarg schläft man allein, das kommt noch früh genug. Wir sollten in der Nacht zusammen bleiben. Wer weiß, was er geträumt und gleich vergessen hat.
Er sprach vom Schlafen, nicht vom Träumen. Heute morgen um halb fünf sah ich Paul im grauen Licht schlafen, ein verzogenes Gesicht mit Doppelkinn. Und auf der Ladenstraße unten wurde geflucht und laut gelacht in aller Frühe. Lilli sagte:
Flüche treiben das Böse aus.
Trottel, nimm den Fuß weg. Bück dich, oder hast du Scheiße in den Schuhen. Mach die Flatterohren auf, dann hörst du, aber nicht wegfliegen bei dem Wind. Laß die Frisur, noch sind wir beim Abladen. Eine Frau gluckste kurze, heisere Töne wie ein Huhn. Eine Wagentür polterte. Faß an, blöder Hund, wenn du ausruhen willst, geh ins Sanatorium.
Pauls Kleider lagen auf dem Boden. Im Spiegel der Schranktür stand der heutige Tag, und an dem bin ich bestellt. Da stand ich auf, den rechten Fuß zuerst auf den Boden, wie immer, wenn ich bestellt bin. Weiß ich, ob ich daran glaube, aber verkehrt sein kann es nicht.
Ich wüßte gern, ob bei anderen Leuten das Hirn für den Verstand und für das Glück zuständig ist. Bei mir reicht das Hirn nur, um ein Glück zu machen. Um ein Leben zu machen, reicht es nicht. Jedenfalls nicht, um meines zu machen. Mit dem Glück habe ich mich abgefunden, auch wenn Paul sagt, daß es keines ist. Alle paar Tage sage ich:
Es geht mir gut.
Pauls Kopf, still und gerade vor mir, sieht mich verwundert an, als gelte es nicht, daß wir einer den anderen haben. Er sagt:
Dir geht es gut, weil du vergessen hast, was das heißt bei anderen Leuten.
Andere Leute meinen vielleicht das Leben, wenn sie sagen: Es geht mir gut. Ich meine nur das Glück. Paul weiß, mit dem Leben habe ich mich nicht abgefunden, ich möchte auch nicht sagen, noch nicht.
Schau uns doch an, sagt Paul, und red nicht herum vom Glück.
Das Licht im Bad warf ein Gesicht in den Spiegel. Das ging so schnell, wie eine Hand voll Mehl an eine Scheibe fliegt. Dann wurde es ein Bild mit Froschfalten, da wo die Augen stehen, und glich mir. Das Wasser lief mir warm über die Hände, im Gesicht war es kalt. Es ist mir nicht neu beim Zähneputzen, die Zahnpasta schäumt aus den Augen. Es wird mir schlecht, ich spucke aus und hör auf Seitdem ich bestellt werde, trenne ich das Leben vom Glück. Wenn ich zum Verhör gehe, muß ich das Glück von vornherein zu Hause lassen. Ich laß es in Pauls Gesicht, um seine Augen, um seinen Mund, an seinen Bartstoppeln. Wenn man es sehen würde, wäre Pauls Gesicht mit etwas Durchsichtigem überzogen. Immer, wenn ich gehen muß, möcht ich in der Wohnung bleiben, wie die Angst bleibt, die ich Paul nicht nehmen kann. Wie mein dagelassenes Glück, wenn ich weg bin. Er weiß es nicht, er könnte es nicht ertragen, daß sich mein Glück auf seine Angst verläßt. Aber er weiß, was man sieht, daß ich immer die grüne Bluse anziehe und eine Nuß esse, wenn ich bestellt bin. Die Bluse ist ein Erbstück von Lilli, aber ihr Name von mir: Die Bluse, die noch wächst. Wenn ich das Glück mitnehme, habe ich zu schwache Nerven. Albu sagt:
Wozu die Nerven verlieren, wir fangen erst an.
Ich verlier die Nerven ja nicht, sie werden ja nicht weniger, sondern zu viele. Und alle summen wie die fahrende Straßenbahn.
Auf leeren Magen sollen Nüsse gut sein für die Nerven und für den Verstand. Das weiß jedes Kind, aber ich hatte es vergessen. Nicht weil ich so oft bestellt werde ist es mir wieder eingefallen, sondern nur durch Zufall. Wie heute sollte ich Punkt zehn bei Albu sein und war um halb acht schon fertig zum Gehen. Für den Weg braucht man höchstens anderthalb Stunden. Ich nehme mir zwei Stunden und streife, wenn ich zu früh dort bin, lieber noch in der Nähe herum. Ich bin noch nie zu spät gekommen, ich kann mir nicht vorstellen, daß Laxheit geduldet wird.
Zum Essen der Nuß kam ich, weil ich um halb acht fertig war. Das war auch vorher so, wenn ich bestellt war, aber an dem Morgen lag eine Nuß auf dem Küchentisch. Paul hatte sie am Tag davor im Lift gefunden und eingesteckt, weil man eine Nuß nicht liegen läßt. Sie war die erste in dem Jahr, feuchte Fäden von der grünen Schale klebten noch an ihr. Ich wog sie in der Hand, für eine neue Nuß war sie zu leicht, als ob sie innen taub wäre. Ich fand keinen Hammer und klopfte sie mit dem Stein auf, der damals im Flur, aber seither in der Küchenecke liegt. Sie hatte ein lockeres Hirn. Es schmeckte nach saurem Rahm. An diesem Tag fiel das Verhör kürzer aus als sonst, ich behielt meine Nerven und dachte mir, als ich wieder auf der Straße war:
Das verdanke ich der Nuß.
Seither glaube ich, daß Nüsse helfen. Ich glaube es nicht wirklich, doch ich will alles, was möglich ist, getan haben, alles, was helfen kann. Daher bleibe ich bei dem Stein als Werkzeug und beim Morgen als Uhrzeit. Wenn die Nuß über Nacht offen herumliegt, ist ihre Hilfe schon verbraucht. Nicht nur für die Nachbarn und Paul, auch für mich wär das Klopfen abends leichter zu ertragen, doch ich kann mir in die Zeit nicht hineinreden lassen.
Den Stein habe ich aus den Karpaten mitgebracht. Mein erster Mann war seit März beim Militär. Er schrieb mir jede Woche einen weinerlichen Brief, und ich antwortete mit einer tröstenden Karte. Es war Sommer geworden und genau auszurechnen, wieviele Briefe und Karten noch hin und her gehen müssen, bis er wiederkommt. Da mein Schwiegervater ihn ablösen und mit mir schlafen wollte, wurde es mir überdrüssig im Garten und im Haus. Ich packte den Rucksack und stellte ihn, nachdem er am frühen Morgen zur Arbeit gegangen war, ins Gebüsch vor eine Zaunlücke. Mit leeren Händen ging ich am späten Vormittag auf die Straße hinaus. Meine Schwiegermutter hängte Wäsche auf und sah mir nicht an, was ich vorhatte. Ich sagte kein Wort, nahm den Rucksack durch den Zaun und ging zum Bahnhof. Ich fuhr ins Gebirge und hielt mich an eine Absolventengruppe des Konservatoriums. Wir stolperten jeden Tag, bis es dunkel wurde, von einem Gletschersee zum nächsten. An jedem Ufer standen die Holzkreuze mit dem Todestag der Ertrunkenen zwischen den Steinbrocken. Friedhöfe unterm Wasser und Kreuze rundherum als Warnungen vor gefährlichen Tagen. Als wären die runden Seen hungrig, bräuchten jedes Jahr an den Tagen, die auf den Kreuzen stehen, Fleisch. Nach Toten tauchte hier niemand, das Wasser schnitt mit einem Griff das Leben ab, man kühlte gleich aus. Die Absolventen sangen, obwohl der See sie im Stehen mit dem Kopf nach unten spiegelte, um zu prüfen, ob sie gute Leichen wären. Beim Gehen, Rasten und Essen sangen sie im Chor. Mich hätte nicht gewundert, wenn sie beim Schlafen nachts mehrstimmig gesungen hätten wie auf den nacktesten Höhen, wo einem der Himmel in den Mund blies. Ich mußte mich an die Gruppe halten, weil der Tod keinen Wanderer, der sich allein verirrt, zurückgibt. Von den Seen wurden die Augen täglich größer, sie griffen längst in die Wangen, ich sah es in jedem Gesicht, und jeden Tag kürzer wurden die Beine. Und doch wollte ich mir am letzten Tag etwas mit nach Hause nehmen und griff in all dem Geröll nach einem Stein, der einem Kinderfuß ähnelte. Die Absolventen suchten sich kleine, flache Steine für die Hand, Kummersteine. Ihre Handsteine glichen Mantelknöpfen, von denen hatte ich in der Konfektionsfabrik täglich mehr als genug. Aber die Absolventen glaubten damals an Kummersteine, wie ich heute an Nüsse glaube.
Ich kann es nicht ändern: Ich hab die grüne Bluse, die noch wächst, angezogen und klopf zweimal mit dem Stein, in der Küche wackelt das Geschirr, dann ist die Nuß offen. Und während ich sie esse, kommt Paul, vom Klopfen aufgeschreckt, im Pyjama und trinkt ein oder zwei Glas Wasser, wenn er wie gestern stockbesoffen war, zwei. Ich muß die Wörter nicht einzeln verstehen, ich weiß auch so, was er beim Wassertrinken sagt:
Du glaubst doch nicht wirklich, daß die Nuß etwas nützt. Natürlich glaub ich es nicht wirklich, wie ich an alle Sachen, die ich mir angewöhnt habe, nicht wirklich glaube. Umso sturer bin ich.
Laß mich doch glauben, was ich will.
Dem fügt Paul nichts mehr hinzu, weil wir beide wissen, daß man vor dem Verhör den Kopf frei haben und nicht streiten soll. Die meisten Verhöre sind trotz der Nuß quälend lang. Nur woher soll ich wissen, daß sie ohne die Nuß nicht schlimmer wären. Paul versteht nicht, daß ich auf die Sachen, die ich mir angewöhnt habe, noch mehr angewiesen bin, wenn er sie geringschätzt mit seinem nassen Mund und leergetrunkenen Glas, bevor er es hinstellt.
Wenn man bestellt wird, gewöhnt man sich Sachen an, die etwas nützen. Wirklich oder nicht, darauf kommt es nicht an. Nicht man, ich habe mir diese Sachen angewöhnt, eine nach der anderen kamen sie angeschlichen.
Paul sagt:
Damit gibst du dich ab.
Stattdessen macht er sich Gedanken über die Fragen, die mich erwarten, wenn ich bestellt bin. Das ist notwendig, meint er, und was ich tue, verrückt. Notwendig wäre es, wenn mich die Fragen, auf die er mich vorbereitet, wirklich erwarten würden. Bisher wurden immer ganz andere gestellt.
Daß die Sachen, die ich mir angewöhnt habe, mir etwas nützen, wär zuviel verlangt. Sie nützen etwas, nicht mir. Etwas, das heißt höchstens dem Leben durch den Tag. Das Glück im Kopf soll man sich davon nicht versprechen. Über das Leben gibt es viel zu sagen. Über das Glück nichts, sonst ist es keines mehr. Nicht einmal das Glück, das man verpaßt hat, verträgt das Reden. Bei den Sachen, die ich mir angewöhnt habe, geht es um die Tage, nicht ums Glück.
Sicher hat Paul recht, die Nuß und die Bluse, die noch wächst, machen nur zusätzlich Angst. Na und, warum soll man sein Glück machen wollen, wenn es einem nur gelingt, seine Angst zu machen. Ich bin ungestört damit beschäftigt und werde nicht so anspruchsvoll wie andere Leute. Und niemand giert nach der Angst, die sich ein anderer macht. Mit dem Glück ist es umgekehrt, daher ist es kein gutes Ziel, für keinen Tag.
Die grüne Bluse, die noch wächst, hat einen großen Perlmuttknopf, den ich damals für Lilli in der Fabrik unter vielen Knöpfen ausgesucht und genommen habe.
Beim Verhör sitze ich an dem kleinen Tisch, dreh an dem Knopf und antworte ruhig, wenn auch alle Nerven in mir summen. Albu geht auf und ab, daß er richtig fragen muß, frißt seine Ruhe genauso, wie es meine frißt, daß ich richtig antworten muß. Solange ich gelassen bleibe, hat er etwas, vielleicht alles, falsch angepackt. Wenn ich vom Verhör nach Hause komme, ziehe ich die graue Bluse an. Sie heißt: die Bluse, die noch wartet. Sie ist von Paul. Sicher kommen mir oft Bedenken wegen dieser Namen. Aber geschadet haben sie noch nicht, nicht einmal an den Tagen, wenn ich nicht bestellt war. Die Bluse, die noch wächst, hilft mir, und die Bluse, die noch wartet, hilft vielleicht Paul. Seine Angst um mich steht bis zur Decke, so wie meine um ihn, wenn er in der Wohnung sitzt und wartet und trinkt oder in der Stadt auf Sauftour ist. Man hat es leichter, wenn man selber weg muß, die Angst wegträgt, und das Glück da läßt, und vom anderen erwartet wird. Zu Hause sitzen und warten dehnt die Zeit zum Zerreißen und treibt die Angst auf die Spitze.
Was ich den Sachen, die ich mir angewöhnt habe, zutraue, kann ein Mensch nicht tun. Albu schreit:
Siehst du, die Dinge verbinden sich.
Und ich drehe an dem großen Knopf meiner Bluse und sag: Bei Ihnen, bei mir nicht.
Der Alte