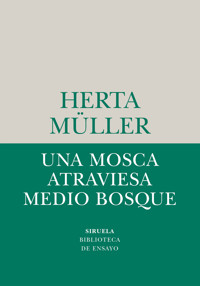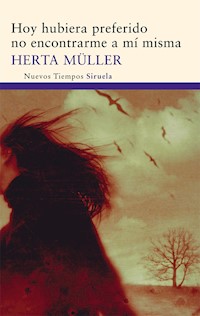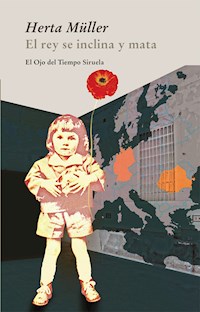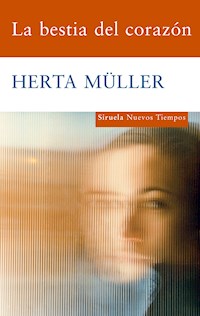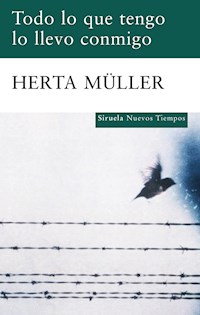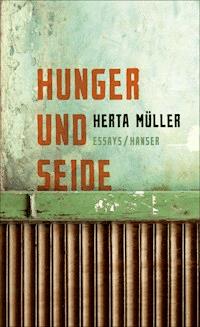Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Nobelpreisträgerin Herta Müller über Würde und Freiheit, Exil und Heimat und die subversive Kraft des Lachens
Ob Herta Müller die Werke von Böll, Liao Yiwu oder Goldschmidt liest, oder sich mit dem politischen Geschehen befasst: stets ergreift sie Partei für die Aufrichtigkeit. Sie kennt die subversive Kraft des Lachens, und sie weiß, dass Diktatoren nichts so schlecht vertragen wie die Wahrheit. Aber auch ihr Blick auf unsere Gesellschaft ist unbestechlich. Stehen wir für unsere Werte ein, wenn es um den Schutz von Minderheiten, Verfolgten und Exilsuchenden geht? Politisch-literarische Wortmeldungen der Nobelpreisträgerin aus dem letzten Jahrzehnt. Eindringlich und hochaktuell.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die Nobelpreisträgerin Herta Müller über Würde und Freiheit, Exil und Heimat und die subversive Kraft des LachensOb Herta Müller die Werke von Böll, Liao Yiwu oder Goldschmidt liest, oder sich mit dem politischen Geschehen befasst: stets ergreift sie Partei für die Aufrichtigkeit. Sie kennt die subversive Kraft des Lachens, und sie weiß, dass Diktatoren nichts so schlecht vertragen wie die Wahrheit. Aber auch ihr Blick auf unsere Gesellschaft ist unbestechlich. Stehen wir für unsere Werte ein, wenn es um den Schutz von Minderheiten, Verfolgten und Exilsuchenden geht? Politisch-literarische Wortmeldungen der Nobelpreisträgerin aus dem letzten Jahrzehnt. Eindringlich und hochaktuell.
Herta Müller
Eine Fliege kommt durch einen halben Wald
Hanser
Unsichtbares Gepäck
»Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.« So trocken formelhaft klang der Artikel 1 im Entwurf für das Grundgesetz. Am 8. Mai 1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat dann das Grundgesetz und der Artikel 1 klingt nun völlig anders — wärmer und dennoch ernster: »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.« Dem ging eine lange Debatte voraus, weil der Inhalt des Wortes »Würde« offen ist und offen bleiben muss und sich daher mit der genormten Sprache und dem nüchternen Denken von Juristen kaum vereinbaren lässt.
Heutzutage kann alles eine Würde haben. Der einzelne Augenblick und ganze Nationen. Der Begriff Würde ist heute nicht nur offen, sondern diffus. Dabei ist doch der Ausgangspunkt für Würde der Wert. Es geht um den Wert des Menschen. Lange, zu lange war der nur vom sozialen Rang bestimmt, der sichtbar sein musste. Nur wer Ornate und Talare trug, mit Samt, Seide und Spitzen, mit Schärpen, Schleppen und Orden, war ein Würdenträger. Die »Goldfasane« unter den Nazis, an erster Stelle der bizarre Feldmarschall Göring in seinen abstrusen Fantasieuniformen mit zahlreichen Orden, waren späte Verkörperungen dieser exhibitionistischen Auffassung von Würde.
Aber ein ganz anderes, ein bitteres und tragisches Beispiel für die auf dem Körper getragene Würde sind die Veteranen der Roten Armee, die heute, von der Gesellschaft vergessen, nur an Feiertagen vorgezeigt, in Armut leben — alte Menschen, die, weitab von Moskau, in ihren armseligen Gegenden sich selbst überlassen sind. Sie tragen dort als täglichen Halt ihre alten Orden, als wäre der Krieg gegen Nazideutschland gerade erst vorbei. Es ist eine Würde aus buntem Blech, eine traurige Selbsttäuschung.
Die Vorstellung der inneren Würde jedes Menschen hat sich erst im Zeitalter der Aufklärung ausgebildet. Die Würde des Einzelnen entspringe einem Gefühl eines eigenen inneren Wertes, der für keinen Preis käuflich sei und der dem Menschen eine Achtung für sich selbst schenke. Schiller nennt das Anmut und Würde. Für ihn war Anmut eine Haltung. Es ging um die innere Würde, die moralische Stärke und die geistige Unabhängigkeit.
Der Artikel 1 des Grundgesetzes verpflichtete Parlamente, die Behörden, die Polizei in den westlichen Bundesländern des geteilten Deutschlands, etwas zu achten und zu schützen, etwas, das im Nationalsozialismus lebensgefährlich war: die Geistesfreiheit des Einzelnen, seine innere Unabhängigkeit. Viele Mitglieder des Parlamentarischen Rats hatten das erlebt, andere kamen aus dem Exil zurück und fünf Mitglieder hatten sogar Konzentrationslager überlebt. Für sie alle war der Verlust der Würde eine lange persönliche Erfahrung im Alltag einer Diktatur. Die Wehrlosigkeit gegen die Schläger der SA und gegen die Verschleppung in die Lager, gegen Enteignung und Berufsverbot, gegen die Folter in den Gefängnissen der SS. Die Angst vor der Willkür der Nazis war überall und immer bei denjenigen, die keine Nazis waren und es auch nicht werden konnten, weil sie sich eine innere Anständigkeit bewahrt hatten. Man konnte nur den nächsten Menschen vertrauen, die Angst vor Spitzeln war allgegenwärtig. Es gab auch keine intellektuellen Reservate des freien Denkens, weil es sich nicht mehr artikulieren konnte. Es gab keine unabhängige Justiz mehr. Die Medien waren gleichgeschaltete Propagandainstrumente, die moderne Kunst und die zeitgenössische Literatur wurden verbrannt und Tausende Journalisten und Künstler wurden ins Exil vertrieben.
1949 stand Artikel 1 des Grundgesetzes deshalb für mehr als für den Beginn einer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft, von der man noch nicht wissen konnte, wie sie sich entwickeln wird. Den Autoren des Grundgesetzes war es wichtig mit dem Begriff der Würde die Ablehnung jeder Diktatur deutlich auszusprechen. Das Wort Würde selbst erteilte den Institutionen der neuen Demokratie den Auftrag, die Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus in der Gesetzgebung und im Alltag der Behörden zu beseitigen. Auch deshalb steht »Die Würde des Menschen ist unantastbar« an der Fassade des Gebäudes der Staatsanwaltschaft. Dort ließ ihn der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer anbringen. Bauer war schon 1933 im KZ inhaftiert und floh 1936 zuerst nach Dänemark und von dort nach Schweden ins Exil. Er kam 1949 aus dem Exil zurück und setzte in den 60er-Jahren die Frankfurter Auschwitzprozesse gegen harte Widerstände in den Reihen der Justiz durch. »Wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich Feindesland«, soll er gesagt haben. Er wusste genau, wo er war. Denn an allen Ecken und Enden scheiterte der Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Nazi-Mentalität steckte noch privat in den Köpfen und amtlich in den Behörden und die Würde des Menschen blieb antastbar.
Zum Beispiel die Würde der Sinti und Roma. Man schätzt, dass ungefähr 5000 von ihnen die Todeslager überlebten. Ihre Anträge auf Anerkennung als Verfolgte der Nazidiktatur wurden von den Behörden an die Kriminalpolizei weitergeleitet. Die holte ihrerseits Gutachten zur »Sondererfassung von Zigeunern« bei ehemaligen Nazi-Beamten ein — man könnte auch sagen bei Verbrechern —, die in der »Dienststelle für Zigeunerfragen« tätig und für die Deportation der Sinti und Roma in die Lager verantwortlich waren. In diesen Gutachten steht, dass die Antragsteller nicht aus rassischen Gründen, sondern wegen »Asozialität« inhaftiert wurden. So konnten diese Gutachter Entschädigungszahlungen genauso verhindern wie auch die strafrechtliche Einordnung ihrer Beteiligung am Völkermord. Und sie hatten damit Erfolg. In den 1955 veröffentlichten Kommentaren zum »Bundesentschädigungsgesetz« wurden alle Verfolgungsmaßnahmen der Nazis als legitime Sicherheitsmaßnahmen interpretiert, weil die »Zigeuner« durch »Asozialität, Kriminalität und Wandertrieb« ihre Bekämpfung notwendig gemacht hätten. Damit verlängerte sich die rassistische Verachtung der Nazis gegenüber den Sinti und Roma in die demokratische Gegenwart.
Auch die Würde der homosexuellen Deutschen wurde weiterhin angetastet, weil sie nicht als Opfer der Nazis akzeptiert wurden. Homosexualität blieb bis 1969 generell strafbar als »widernatürliche Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren«. Noch 30 Jahre nach 1945 verstieß nach Ansicht des Verfassungsgerichts die strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen nicht gegen das Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Erst 2002 wurden Homosexuelle als Opfer der Nazis anerkannt.
Oder die Würde der Frauen, die für die Nazis nur Mütter und Hausfrauen waren. Bis 1958 konnte der Ehemann weiterhin nach eigenem Ermessen den Arbeitsvertrag seiner Frau fristlos kündigen. Und bis 1962 durften Frauen ohne Zustimmung des Ehemannes kein Bankkonto eröffnen. Und erst nach 1969 wurde eine verheiratete Frau als geschäftsfähig angesehen.
Oder — als letztes Beispiel — die Würde der ins Exil vertriebenen Deutschen. Hunderttausende flohen aus Deutschland vor den Nazis ins Ausland. Aber Adenauer brauchte für den Aufbau der Demokratie in der Bundespublik »Leute, die von früher etwas verstehen«. Er meinte damit ehemalige Nazis und leider nicht die Lebenserfahrung der ins Exil Gejagten. Sie blieben auch nach dem Krieg in Deutschland unerwünscht. Sie störten sogar. Im Bundestagswahlkampf 1961 wurde der Heimkehrer Willy Brandt von Konrad Adenauer wegen seiner Zeit im norwegischen Exil vorgeführt, und Franz Josef Strauß krakeelte: »Eines wird man Herrn Brandt doch fragen dürfen: Was haben Sie zwölf Jahre draußen gemacht? Wir wissen, was wir drinnen gemacht haben.« Willy Brandt hat »draußen« — wie viele Emigranten — Widerstand gegen die Nazis geleistet, er hat sein Leben auf illegalen Reisen nach Deutschland riskiert und in Stockholm eine Presseagentur aufgebaut, um die Welt über die Verbrechen der Nazis zu informieren. Willy Brandt hieß eigentlich Herbert Frahm. Nach 1945 behielt er seinen Exilnamen, so wichtig war ihm dieser Name — eine Hommage an den Widerstand im Exil gegen Nazideutschland. Aber wer weiß das heute noch. Der Widerstand des Exils wurde in Deutschland noch nie gewürdigt, und er spielt bis heute überhaupt keine Rolle. Erinnert wird an den militärischen Widerstand der Offiziere, die treue Gefolgsleute Hitlers waren.
So geriet die Unantastbarkeit der Würde des Menschen zu einem leeren Begriff im Nachkriegsdeutschland. Denn zur Würde des Menschen gehört auch die Wahrheit. Und die wollte man nach 1945 mit dem sogenannten »kommunikativen Beschweigen« (H. Lübbe) in Ruhe lassen. Niemand wollte sich eingestehen, dass er von der Politik der Nazis profitiert hatte. Im Kleinen durch den billigen Kauf vom Hausrat deportierter Juden oder im Großen durch Arisierungen ganzer Firmen und Immobilien. Und man wollte nicht nachforschen, wo überall in der Politik, der Justiz, der Industrie, aber auch in den Künsten immer noch Nazis waren. Und vor allem wollte man nicht wissen, wie das Leben ging in der Zeit der großen Verfolgung, wie das Leben ging auf der Flucht aus Deutschland hinaus und danach im Exil, wie das Sterben war in den Lagern. Dazu hätte man sich für einzelne Menschen interessieren müssen, für das unvorstellbare Elend der Ängste und Einsamkeiten. Doch ohne dieses Interesse ist es unmöglich zu begreifen, wie sich der Verlust der Würde anfühlt.
Ich bin keine Historikerin. Deshalb kann ich die Abgründe zwischen den Opfern und den Tätern in der Nazizeit nicht rekonstruieren. Ich kam nach 1945 in Osteuropa zur Welt und habe die Demokratie in Westeuropa nur aus der Ferne gesehen. Sie schien unerreichbar. Aber ich habe das »kommunikative Beschweigen« der rumäniendeutschen Minderheit über ihre Verstrickung in den Nationalsozialismus miterlebt. Und als ich über die SS-Vergangenheit meines Vaters zu schreiben begann, wurde ich als Nestbeschmutzerin beschimpft und angespuckt. Mein erstes Buch wurde »Asphaltliteratur« genannt und eine Besprechung endete mit »Jedem das Seine«, der Inschrift im Tor des Lagers Buchenwald.
Und ich habe auch das Schweigen auf Rumänisch erlebt. Die Geschichtsverdrehung, das Leugnen der Antonescu-Zeit an der Seite Hitlers. Alte Faschisten mutierten zu 150-prozentigen Kommunisten. Der rote Sozialismus war braun im Kopf. Eine Diktatur verlängerte sich in die andere. Der Faschismus in den Stalinismus, nach Stalins Tod 1953 in den Post-Stalinismus, was man bis 1989 Aufbau des Sozialismus nannte.
In Osteuropa hat sich die Diktatur nicht 1945, sondern erst 1989 verabschiedet. Die Freiheit ist dort noch jung, sie stolpert und sie ist noch nicht bei sich selbst angekommen. Wie schnell sie wieder zu Fall gebracht werden kann, sieht man in Polen und in Ungarn. Man nähert sich mit abstrusen Ausreden der Diktatur an. Die Freiheit wird zur Fassade und die Würde des Menschen bleibt auf der Strecke. Wie soll man den Rückfall in alte Muster aufhalten.
Wenn ich heute zurückdenke, weiß ich: Die große Frage in der Diktatur war: Wie soll man leben. So kurz war die Frage gar nicht. Sie ging viel weiter mit Nebensätzen, die im Grunde das Hauptsächliche daran waren. Wie soll man leben mit dem, was man denkt, wenn man es nicht sagen darf, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen. Wie soll man trotzdem, da wo es darauf ankommt, in einer Sitzung oder auf einem Amt oder beim Verhör zeigen, was man denkt, ohne es zu sagen. Wie soll man leben, um so zu bleiben oder zu werden, wie man für sich selber ist. Oder wie soll man nicht so werden, wie man nicht sein will. Ich könnte auch sagen, wie behält man seine Würde.
Eigentlich wusste ich gar nicht, wie ich sein will, wer weiß das schon von sich. In einem gewissen Sinn wusste ich es dennoch, weil ich jeden Tag um mich herum sah, wie ich nicht sein will und auf keinen Fall werden darf. Wie kann man leben und sich ertragen, obwohl man nicht so ist, wie man sein will, weil man gar nicht so sein darf, wie man am liebsten wäre. Ich geriet mit dieser Grundsatzfrage, wie soll man leben, immerzu in Konflikte. Ich war gar nicht darauf aus, diese Frage zu stellen, sie stellte sich unausweichlich von selbst. Sie war immer schon dort, wo ich mit meinem Leben hinkam. Sie war vor mir da, als hätte sie auf mich gewartet.
Ich habe das damals nicht gewusst, es war die Frage nach persönlicher Freiheit und der eigenen Würde. Aus der Distanz von heute glaube ich, dass es in der Unterdrückung eine zerstörerische Fixation auf das Gegenteil gibt, auf die Freiheit, die nicht gelebt werden kann. Sie ist als Abwesenheit vorhanden, sie weiß, dass sie verkrüppelt wird. Sie wird so gestört, dass sie dort, wo sie beginnt, sofort aufhört. Das Ende frisst den Anfang vom ersten Moment an. Da sie jedoch immer, wenn auch nur als Gegenteil von sich selbst, vorhanden bleibt, ist sie im Kopf mehr als bloße Projektion. Sie ist kein stummes Kopfbild, sondern ein furchtbar genaues Gefühl. Gefühl ist das passende Wort. Denn Gefühle sind ja im Kopf. Jedenfalls entstehen sie im Kopf. Dass einem die Unterdrückung bewusst ist, heißt, dass einem das Fehlen der Freiheit bewusst ist. Es ist dieses fatale Zwillingspaar, das durchs Leben läuft. Es ist so ein Paar, wie chronischer Hunger immer ans fehlende Essen denkt.
Ich muss es mir heute eingestehen: Das meiste, was ich über Freiheit und Würde gelernt habe, habe ich aus den Mechanismen der Unterdrückung gelernt. Diese Mechanismen zu beobachten, und was anderes bleibt einem ja in der Unterdrückung nicht übrig, ist, wie die Spiegelschrift der Freiheit zu entziffern. Das Deutlichste, was ich gelernt habe, kann ich ganz einfach sagen: Freiheit und Würde sind immer konkret.
Sie sind da oder sie fehlen in jeder einzelnen Sache. Allgemein kann ich darüber gar nicht reden. Es führt mich nirgends hin, wenn ich es versuche. Das abstrakte Wort Freiheit und das Gefühl der Würde beschäftigten mich nicht als Idee, sondern als Gegenstand. Ein ganz konkreter Gegenstand. Denn Freiheit hat ihren konkreten Ort, an dem sie vorhanden ist oder fehlt. Sie hat ihren Inhalt, ihr Gewicht. In der Freiheit ist immer eine konkrete Situation. Es findet etwas statt oder es wird verhindert. Diese beiden Kategorien sind immer präsent: erlaubt und verboten. In der Diktatur war fast alles, was ich tun wollte, verboten. Und was erlaubt war, hab ich mir selbst verboten, weil ich nicht so werden wollte wie diejenigen, die es mir erlaubten. Die Freiheit ist ein Gegenstand. Aber in diesem Leben in Rumänien war sie so weit weg, man konnte sie nicht anfassen. Umso mehr fasste sie mich an.
Das war der Grund, weshalb ich in allen Situationen, wo es darauf ankam, in unvermeidliche Konflikte geriet. Wo es darauf ankam — es kam ständig darauf an.
Ich arbeitete im dritten Jahr in einer Maschinenbaufabrik als Übersetzerin und weigerte mich, meine Kollegen für den Geheimdienst zu bespitzeln.
Die darauffolgenden Schikanen gingen wochenlang. Eines Morgens wollte ich in mein Büro, aber es war ein Ingenieur eingezogen. Er sagte, ich hätte hier nichts mehr zu suchen. Die Betriebsanleitungen und meine dicken Wörterbücher lagen im Gang auf dem Fußboden. Ich ging eine Weile auf die Toilette weinen, damit mich niemand sieht. Dann ließ mich eine Freundin an eine freigeräumte Ecke ihres Schreibtischs. Es war ein Großraumbüro. Ein paar Tage später wartete sie morgens draußen vor dem Büro mit meinen Sachen im Arm. Sie sagte, ihre Kollegen wollten mich nicht mehr in ihrem Büro, schließlich sei ich ein Spitzel. Die Verleumdung war vom Geheimdienst organisiert. Es war die Rache für meine Weigerung, die Kollegen zu bespitzeln. Ich konnte gegen diese Verleumdung nichts tun. Es gab bestimmt unzählige Spitzel in der Fabrik, die niemand kannte, die mit Positionen und Geld belohnt wurden für ihre Dienste. Ich war so wehrlos in dieser Zeit, für mich war die Welt entgleist.
Trotzdem wusste ich jeden Tag, dass die Weigerung richtig war. Sie war lebenswichtig. Nach dieser Absage fühlte ich mich frei. Ich war frei davon, etwas zu tun, was man von mir verlangte. Es hätte wahrscheinlich auch mir Vorteile gebracht, es war aus der Sicht des Regimes das Normale und mehr als nur erlaubt. Es war eine erlaubte Pflicht. Ich wusste genau, dass meine Absage ernste Folgen haben wird. Trotzdem war ich erleichtert, denn die Sache war ab nun für beide Seiten geklärt: Mir war klar, dass ich mich an der Unterdrückung nicht beteilige. Und dem Geheimdienst war klar, dass er mit mir nicht zu rechnen hat. Was mir aber nicht klar war und täglich über mich kam, war die Einsamkeit danach. Diese große Verlassenheit, so monströs, als wäre jede Beziehung zu mir pures Gift. Ich wurde gemieden, die Kollegen von gestern wollten mich nicht mehr kennen.