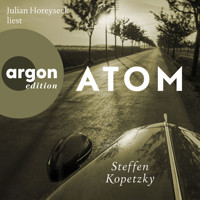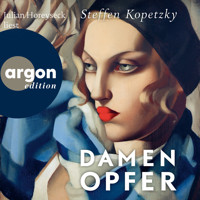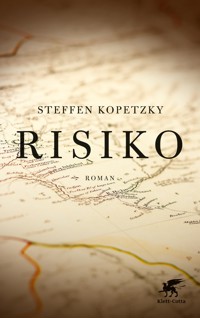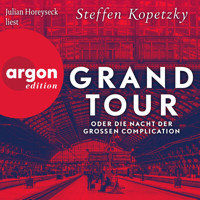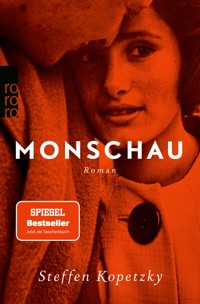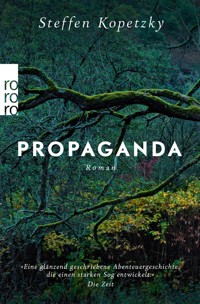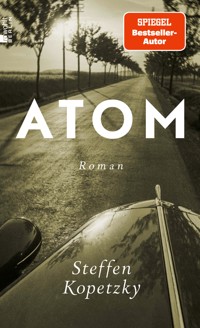
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Eigentlich will Simon Batley nie wieder mit dem britischen Geheimdienst zu tun haben. Jahre zuvor, als Physikstudent in Berlin, arbeitete er ihm zu, naiv und undercover. Das führte zu einer Katastrophe, die Batley nie ganz verstand, auch seine große Liebe zu seiner Kommilitonin Hedi von Treyden endete jäh. Doch der Krieg ändert alles. Agent Batley stößt auf die Spur einer neuen Waffe der Deutschen, von nie gekannter Zerstörungskraft. Bald darauf, instruiert von Niels Bohr und Rudolf Heß, reist er als Spion nach Lissabon – und schließlich ins Dritte Reich. Er will den mysteriösen Hans Kammler aufspüren: Der ist als Chefplaner von unterirdischen Forschungsstätten und geheimen Waffenprogrammen einer der mächtigsten Nazis. Während Batley versucht, vor den Sowjets und den USA an die deutsche Technik und an Kammler zu kommen, folgt er auch einer persönlichen Mission: Er will Hedi wiederfinden und endlich klären, was damals in Berlin geschah. Steffen Kopetzkys spannungsvoller Roman erzählt von der Jagd nach der Atomtechnik, der Spur eines Phantoms – und einem Mann, der zwischen Schuld, Liebe und Hoffnung steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Steffen Kopetzky
Atom
Roman
Über dieses Buch
London zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Eigentlich will Simon Batley nie wieder mit dem britischen Geheimdienst zu tun haben. Jahre zuvor, als Physikstudent in Berlin, arbeitete er ihm zu, naiv und undercover. Das führte zu einer Katastrophe, die Batley nie ganz verstand, auch seine große Liebe zu seiner Kommilitonin Hedi von Treyden endete jäh. Doch der Krieg ändert alles. Agent Batley stößt auf die Spur einer neuen Waffe der Deutschen, von nie gekannter Zerstörungskraft. Bald darauf, instruiert von Niels Bohr und Rudolf Heß, reist er als Spion nach Lissabon – und schließlich ins Dritte Reich. Er will den mysteriösen Hans Kammler aufspüren: Der ist als Chefplaner von unterirdischen Forschungsstätten und geheimen Waffenprogrammen einer der mächtigsten Nazis. Während Batley versucht, vor den Sowjets und den USA an die deutsche Technik und an Kammler zu kommen, folgt er auch einer persönlichen Mission: Er will Hedi wiederfinden und endlich klären, was damals in Berlin geschah.
Steffen Kopetzkys spannungsvoller Roman erzählt von der Jagd nach der Atomtechnik, der Spur eines Phantoms – und einem Mann, der zwischen Schuld, Liebe und Hoffnung steht.
Vita
Steffen Kopetzky, geboren 1971, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Hörspielen und Theaterstücken. Sein Roman «Monschau» (2021) stand monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste, ebenso wie «Risiko» (2015, Longlist Deutscher Buchpreis). «Propaganda» (2019) war für den Bayerischen Buchpreis nominiert, zuletzt erschien der Roman «Damenopfer» (2023), der gerade in mehrere Sprachen übersetzt wird. Von 2002 bis 2008 war Kopetzky künstlerischer Leiter der Theater-Biennale Bonn. Er lebt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Pfaffenhofen an der Ilm.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Dr. Paul Wolff & Tritschler, Historisches Bildarchiv, 77654 Offenburg
ISBN 978-3-644-01324-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Leopold
«Die Wissenschaft hat keine moralische Dimension, sie ist wie ein Messer. Wenn man es einem Chirurgen und einem Mörder gibt, gebraucht es jeder auf seine Weise.»
Wernher von Braun
Erster TeilVerbinder
1
Ein Barbarensport, der von Gentlemen gespielt wird. Dem Commander Scully Hamilton, einem schlanken, elegant gekleideten Mann von fünfunddreißig Jahren, mit schmalem Oberlippenbärtchen und lebendigen Augen, die stets so wirkten, als würde er seinem Gegenüber zuzwinkern, gefiel diese ironische Definition von Rugby – hätte man sie doch auch auf seine eigene Profession trefflich anwenden können. Der Commander gehörte zum einstigen Marine-Geheimdienst Seiner Majestät, welcher in der Nomenklatur als MI6 firmierte.
Nicht weit von den direkt an der Themse gelegenen Bootshäusern diverser, zur Universität Oxford gehörender Ruderclubs, in denen Scully selbst in seiner Studentenzeit vor dem Großen Krieg das eine oder andere Mal in einem schnittigen Achter gesessen hatte, befand sich der Iffley Ground. Hier begegneten sich an diesem Sommernachmittag des Jahres 1926 die Rugby-Mannschaften von Oxford und Bristol. Gastgeber Oxford in weißen Hemden, dunkelblauen Hosen und Strümpfen, Bristol mit weiß-dunkelrot gestreiften Hemden, dunkelroten Hosen und ebensolchen Kniestrümpfen.
Die fünfzehn Spieler beider Mannschaften standen wie auf einer Schnur aufgereiht zu beiden Seiten des Schiedsrichters, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, und präsentierten sich den gut dreihundert Zuschauern, die auf der hölzernen Tribüne Platz gefunden hatten. Es waren Studenten, Professoren und Rugby-Anhänger aus der Stadt Oxford selbst. Und auch jede Menge Schulkinder, die Fähnchen mit den Oxforder Farben hochhielten und dem Kick-off entgegenfieberten. Von den Angehörigen der verschiedenen Colleges waren Gesänge zu hören. Commander Hamilton erkannte den Mallard Song vom All Souls College, die erste Strophe beschwor «den Greif, die Trappe, den Truthahn und Kapaun …». Besser hätte die Stimmung nicht sein können. Alle freuten sich auf das bevorstehende Gerangel zwischen diesen beiden Traditionsmannschaften.
Nun bildeten die Teams Kreise, ihre Arme verschränkt, beugten die Köpfe und begannen, sich zu drehen, mit den Füßen aufstampfend, um sich auf den Kampf einzustimmen. Scully Hamilton hatte ein zierliches Fernglas dabei und studierte nun die Mannschaft von Bristol, um zu sehen, welcher Spieler jetzt das Wort führte. Wie erhofft, war es die Nummer zehn, ein mittelgroßer junger Mann mit kurzem Scheitel und sonnengebräuntem Teint. Ein gut aussehender Kerl, mit starkem Nacken, muskelbepackten Armen und Waden, die seine dunkelroten Kniestrümpfe ausbeulten. Der Commander war nicht besonders gut im Lippenlesen, aber er sah, wie flüssig der junge Athlet seinen Kameraden zuredete. Das musste er auch, denn die Nummer zehn war in allen Rugby-Mannschaften die Position des Fly-Halfs, des Verbinders. Das war der zentrale Spieler, der zwischen Sturm und Verteidigung vermittelte, der Spieler mit der Übersicht, das strategische Gehirn der Mannschaft, der die Spielzüge ansagte und oft derjenige, der später die Torkicks versuchte. Ein Anführer.
Der Verbinder von Bristol brachte seine Ansprache zu Ende, er rief seiner Mannschaft eine mehrfach wiederholte Formel zu. Der Commander verstand die Worte «Bei Regen und Sturm, in Schlamm und Schweiß, wir bereuen nichts, wir blicken nach vorn und holen …», worauf die anderen vierzehn ihm brüllend zustimmten, «holen den Sieg!»
Dann löste sich das Rund auf, sie klatschten einander ab und trabten auf ihre Positionen. Die Weiß-Blauen von Oxford waren schon da. Oxford hatte den Anstoß.
Scully Hamilton, der in den Protokollen seines Dienstes die schnöde Agentencodierung 003 hatte, genoss das Match. Wieder und wieder schlüpfte das ovale Leder aus den Balgereien heraus, blieb nie in Ruhe, wurde von den ächzenden Körpern der jungen Männer begraben und weitergegeben, bis schließlich, schon nah dem erstrebten Malfeld der Oxforder Hälfte, der Schiedsrichter ein Gedränge anordnete. Die Zuschauer waren begeistert und zugleich schockiert. Bristol war gut.
Während sich die Mannschaften für das erste Kräftemessen ordneten, verfolgte der Geheimagent mit dem Fernglas genau, wie sich Bristols Nummer zehn verhielt. Denn um ihn zu beobachten, war er schließlich da. Und der junge Mann tat genau das, was ein guter Verbinder leisten musste. Stellte die Stürmer auf, wies den Verteidigern ihren Platz zu, und als das Geschiebe schließlich losging, umkreiste er die wie zwei Bullenherden gegeneinanderdrückenden Gruppen leichtfüßig, rief Codes, immer auf den Ball bedacht. Dann war es so weit, der Ball kam zum Vorschein, der Bristol-Verbinder schnappte ihn, setzte sich in Bewegung, entging dem ersten Tackling der Oxforder Verteidigung, gab den Ball seitlich nach hinten werfend ab, wo ihn ein von ihm bestimmter riesiger Stürmer in Rot-Weiß in vollem Lauf fing und damit tatsächlich fast bis zur Mallinie kam. Vorher aber wurde er von zwei Verteidigern gleichzeitig attackiert, Schultern krachten zusammen, der Stürmer wurde zu Boden gerissen und schaffte es trotzdem, den Ball nach hinten abzuspielen. Fabelhaft!
Scully Hamilton hatte genug gesehen. Ganz gleich, wie das von heiligem Ernst getragene Freundschaftsspiel ausgehen würde, dieser athletische wie äußerst clever agierende Verbinder war der Richtige für ihn.
Es handelte sich um einen gerade mal einundzwanzigjährigen Studenten der Ingenieurwissenschaften, der dank eines Sportstipendiums in Bristol studierte und aus dem Industriestädtchen Rugby selbst stammte, jenem Ort, an dem diese Sportart einst erfunden worden war. Der junge Mann hatte sich für ein in England ausgeschriebenes Auslandsstipendium beworben – Zielort war die Berliner Universität –, um dort Physik zu studieren. Das Deutschland der Nachkriegszeit war ein Mekka der Naturwissenschaften. Aber keineswegs alles, was dort geforscht wurde, war harmlose Erkundung im unschuldigen Naturreich der Physik oder Chemie. Commander Hamilton und der Broadway, der tatsächlich hinter dem unverdächtig wirkenden Stipendium steckte, suchten nach einem geeigneten jungen Menschen, Mann oder Frau, um diese Person in das Spiel des Geheimdienstes einzuführen. Nach allem, was er in der Bewerbung von ihm selbst und von seinen Professoren über ihn gelesen und was er gerade auf dem Court gesehen hatte, war Simon Batley genau der Richtige. Scully war gespannt, wie er sich im baldigen Bewerbungsgespräch zeigen würde.
Beim Stand von sieben zu drei für Bristol, nach einigen spektakulären Aktionen, nach denen er Simon Batley auch noch zwei Tore hatte schießen sehen, verließ der Commander den Iffley Ground. Er ging wohlgemut über die das Rugbyfeld umgebende Laufbahn auf die von alten Eichen gesäumte Straße hinaus. Ein paar Kraniche flogen über den dunkler werdenden Abendhimmel, und Scully, der sich dabei noch einmal mit Freude an den All-Souls-Song mit Greif und Vogelkonsorten erinnerte, strebte gut gelaunt und zuversichtlich einer Einladung in ein Privathaus in der Charlbury Road entgegen. Ein alter Schulfreund hatte angekündigt, mit einigen Gentlemen Baccara spielen zu wollen.
2
Und so war Simon Batley, nachdem er eine lebenslang geltende Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben hatte, im Januar 1927 nach Berlin gekommen, hatte eine angenehme, nicht übertrieben teure Wohnung im bayerischen Viertel von Berlin-Schöneberg angemietet, in unmittelbarer Nähe der Haberland Straße, wo die Familie von Albert Einstein wohnte, und sich an der Friedrich-Wilhelms-Universität eingeschrieben, um unter anderem bei ebendiesem berühmtesten, aber auch umstrittensten Physiker zu studieren. Ein junger Engländer in Berlin, der drittgrößten Stadt der Welt, die provinziell, politisch aufgewühlt, aber auch durch und durch international war, voller Flüchtlinge, Exilanten und Weltbürger, in der jemand wie er nicht weiter auffiel. Unauffälligkeit und Zurückhaltung prägten während der ersten, kalten und schneereichen Monate in Berlin auch seine Vorgehensweise. Er besuchte Sprachkurse in einem von einer älteren Dame geführten privaten Institut, das seine Unterrichtsräume am Kurfürstendamm unterhielt, ging fleißig auf die Universität und versuchte, sich vorsichtig an sein eigentliches Ziel heranzuarbeiten.
Nun – an einem Freitag Mitte Juli – war Simon diesem ein erhebliches Stück näher gekommen. Zum ersten Mal hatte er sich mit zwei Bekannten von der Universität zu einem gemeinsamen Ausflug an den Wannsee verabredet. Simon hatte sich im Kaufhaus des Westens Tennisshorts und einen weißen Pullunder zugelegt, den er über dem kurzärmeligen Hemd trug, stellte aber am Bahnsteig der Ringbahn fest, dass ihn ein wenig fröstelte. Der Morgen war bedeckt, es ging ein lästiger Wind, und auch geregnet hatte es schon wieder. Simon zog sich seine ebenfalls neue modische Schiebermütze ins Gesicht, als ob es ihm dadurch wärmer würde. Dieser Berliner Juli war wirklich durchwachsen. Selbst für einen Engländer, oder gerade für diesen, hatte es zu viel geregnet. In der Vossischen Zeitung, die er sich an einem Kiosk vor dem Bahnhof Schöneberg gekauft hatte, um sich die Wartezeit zu verkürzen, las Simon im Wetterbericht, dass die Ausbildung des Hochdruckrückens über West- und Nordeuropa voranging, ein Schwall kalter Luft seit gestern allerdings zwischen Elbe und Oder zu Gewittern führen könne, im Westen sogar zu Unwettern. Die kleine Europakarte von Norwegen bis Spanien und zum Bosporus war mit Kreisen gespickt: schwarze bedeuteten Bewölkung, weiße Sonnenschein und viertel und halb gefüllte etwas dazwischen, von wolkig bis bedeckt. Der Berliner Kreis war ein ebensolcher, Yin-Yang-Wetter, linke Hälfte weiß, rechte Hälfte schwarz.
«Simon! Sehe ich mit Vergnügen, dass du ch’ast erworben diese Zeitung», schrie es nun hinter ihm, und wer da schrie, das war Sascha, der mit seinem zerknautschten grauen Hut und in genau denselben Kleidungsstücken aufkreuzte, die er in der Einstein-Vorlesung wie bei jeder anderen Gelegenheit trug. Sascha war das Inbild des leicht heruntergekommenen russischen Emigranten, wie es sie im Berlin dieser Tage in großer Zahl gab. Aber immerhin hatte er einen über die Schulter hängenden Beutel dabei, in dem sich vielleicht Strand- oder Badekleidung befinden mochte.
«Hallo, Sascha!» Und noch bevor Simon fragen konnte, ob dieser vielleicht die schon thematisierte Zeitung haben wollte, riss Sascha sie ihm wie selbstverständlich aus der Hand, setzte sich auf die Bank in der Mitte des Bahnsteigs und begann, das Blatt bei der Suche nach dem für ihn wichtigen Artikel beinahe zu zerpflücken. Simon drückte er nach und nach die Seiten in die Hand, die er nicht brauchen konnte.
«Ah, ist ch’ier. Deutscher Ozeanflug geplant», las er mit seinem breiten Akzent und genießerischer Diktion vor und erzählte, dass die Junkerswerke in Dessau mehrere Flugzeuge losschicken wollten, um den Beweis zu erbringen, dass Verkehrsflüge von der Alten zur Neuen Welt ohne Zwischenstopp möglich seien.
«Gewicht dreitausendsiebenhundert Kilogramm, Aktionsradius achttausend Kilometer! Ch’öchstgeschwindigkeit zweihundert Kilometer pro Stunde!» Der Treibstoff sei in hermetischen Tanks untergebracht, die nach Leerung abgeworfen würden, um die Schwimmfähigkeit der Flugapparate zu erhöhen. Sascha schmatzte genießerisch, als er das alles vorlas, gerade so, als handele es sich bei den neuen Flugapparaten um fliegende Delikatessen.
Von den Nachrichten sichtlich befriedigt, holte er eine kleine Papierschere mit gerundeten Spitzen aus seinem Sakko, die er immer mit sich trug, und schnitt, ohne eine Erlaubnis des Zeitungsbesitzers einzuholen, die eben gelesene Meldung aus und verstaute sie zwischen den Seiten seines Notizbuches. Die derart ausgeweidete Zeitung gab er mit zufriedenem Grinsen an Simon zurück und hielt sich dann auch nicht mehr damit auf, weil die nächste S-Bahn in den Bahnhof Schöneberg einfuhr, und mit dieser kam nun endlich auch die Dritte im Bunde an: Hedi.
Die Türen der rot-gelben S-Bahn gingen unter Warnsignalen auf, und beiden, Simon und Sascha, schien es, als ob sie überhaupt nur für sie gehalten hätte, denn Hedi erschien wie die Offenbarung dieses noch zögerlichen Sommertages. Sie trug eine leichte Leinenhose und Segeltuchschuhe und einen französisch wirkenden, weißen Pullover mit dunkelblauen Querstreifen, wozu auch die Baskenmütze passte, die sie auf ihre kurz geschnittenen, blonden Locken gesetzt hatte. Sie trug einen gut gefüllten Picknickkorb unter dem Arm und trat ihnen mit strahlendem Lächeln entgegen.
Sascha, der sogleich aufgestanden war, zog seinen Hut, ergriff ihre linke Hand und küsste sie inbrünstig, was Hedi wie üblich mit einem amüsierten Lachen über sich ergehen ließ, bevor sie sich Simon zuwandte, der Saschas unübersehbare Schwärmerei für seine Kommilitonin bestens kannte. In Hedis Anwesenheit schien Sascha in eine Art leichter Trance zu verfallen und alles um sich herum zu vergessen.
«Und du meinst, es ist eine gute Idee, raus zum Wannsee zu fahren? Es hat gerade vorhin sogar schon wieder getropft.»
«Seit wann haben Engländer denn ein Problem mit ein bisschen Regen?»
«Wie du meinst.»
«Erstens ist es geradezu ideal, weil wir mehr oder weniger allein sein werden, und zweitens ist am Wannsee oft viel besseres Wetter als in der Stadt. Werden schon sehen. Aber nun kommt, ihr zwei Kavaliere.»
Sascha bestand darauf, Hedis Korb zu tragen, während sie von der Ringbahn hinabgingen, um den Bahnhof der Wannseebahn ein paar Ecken weiter zu erreichen. Dort angekommen, gab Hedi Sascha am Fuß der Treppe einen kleinen, freundschaftlichen Stoß, wie man ihn vielleicht einem gutmütigen, nur ein wenig störrischen Muli geben würde, und als Sascha sich wieder in Bewegung gesetzt hatte, fasste sie Simons Hand, zog ihn zu sich heran und ging mit ihm hinter dem sich mühenden Korbträger her, ihn anlächelnd und seine Hand ein wenig länger haltend, als es nötig gewesen wäre. Simon ließ sich das gerne gefallen, denn jedes Mal, wenn er Hedi berührte, ging ein warmer Impuls von ihr aus, und die Stelle, an der sie sich berührten, fühlte sich an wie unter zarte, aber deutliche elektrische Spannung versetzt. Simon wusste nicht, ob das ganz normal war oder er sich Sorgen machen sollte.
Hedi studierte eigentlich Mathematik, besuchte die Einsteinvorlesung aber mit derselben Regelmäßigkeit wie Sascha und der neu dazugekommene Simon. Abgesehen davon, dass sie Simon schon bald durch ihre unbeschwerte Heiterkeit aufgefallen war, besaß sie die unter Physikstudenten seltene Eigenschaft, sich von den furchterregendsten Gleichungstermen nicht eingeschüchtert, sondern angezogen und sogar unterhalten zu fühlen.
«Die Mathematik beschreibt nicht die Welt, sondern analysiert logische Beziehungen, weshalb sie auch vollkommen exakt sein kann. Die Physik hingegen ist welthaltig durch und durch und daher immer nur annähernd genau. Ein Physiker schätzt doch eher, tastet sich heran und ist mit einem großen Ungefähr zufrieden. Manchmal aber, und das ist dann das Schöne, können die schlampigen Herren Physiker dann doch etwas aus dem Werkzeugkasten der exakten Mathematik gebrauchen.»
Einstein selber war das beste Beispiel dafür, er war intuitiv und alles andere als ein herausragender Mathematiker. Und so war es das eine oder andere Mal vorgekommen, dass er Hedi verschmitzt um Hilfe gebeten hatte, um einen Gedanken, der ihm gerade erst auf dem Weg zur Vorlesung gekommen war, versuchsweise in Mathematik zu fassen, denn Einstein dachte viel mehr in Bildern und Metaphern als in Formeln.
Die S-Bahn kam pünktlich auf die Minute, und das Trio fand bequem Platz. In ihrem Waggon saß nur noch ein älterer Herr mit kurzem weißen Bart, runder Brille und Strohhut, der ein Schmetterlingsnetz und einen Rucksack auf dem Nebensitz liegen hatte und ein naturkundliches Buch studierte. Simon am Fenster, neben ihm Hedi und ihnen gegenüber Sascha, der gleich damit anfing, Hedi einerseits von den zur Atlantiküberquerung bereitstehenden Juncker-Flugzeugen zu erzählen und gleichzeitig auf ein paar Seiten seines Notizbuches zu skizzieren, wie er sich die Konstruktion besagter abnehmbarer Treibstofftanks vorstellte. Simon hatte schon häufiger bemerkt, wie geschickt, mit wenigen wohlgesetzten Strichen, Sascha technische Ideen zeichnerisch darzustellen vermochte. Das waren die Momente, in denen Simon klar wurde, dass sich hinter der schrulligen Erscheinung des oft wie im Halbschlaf wirkenden russischen Privatgelehrten ein ungewöhnlich scharfer Geist verbarg. Hedi, die Saschas technischem Genius und seinen Einfällen mit einem niemals versiegenden Appetit begegnete, hörte dem Russen aufmerksam zu und drückte andererseits ihr Bein leicht gegen seines. Simon blickte nach draußen und sah, genau wie Hedi es gesagt hatte, dass das Wetter immer besser wurde, je mehr von Berlin sie hinter sich ließen. Plötzlich stand der Himmel blau zwischen dem Kieferngrün der Wälder, durch die sie fuhren. Am Bahnhof Nikolassee, einem Miniatur-Schlösschen aus rotem Stein, stiegen sie aus. Bis auf eine Familie mit vier kleinen Kindern, die sich alle gegenseitig an der Hand hielten und der Mutter wie folgten, waren sie die Einzigen hier.
Nun erbot Simon sich, Hedis Korb bis zum Strandbad zu tragen. Er ging, wie zuvor Sascha, voraus und hörte mit leichter Eifersucht, dass Sascha Hedi Schmeicheleien oder Scherze zuflüsterte, die sie zum Lachen brachten, und als er sich kurz umdrehte, sah er, dass sie sich bei dem Älteren eingehängt hatte und sehr vertraut mit ihm wirkte. Und es war ja auch so, dass Simon im letzten halben Jahr, seit er in Berlin lebte, zunächst bemüht war, Sascha näher kennenzulernen. Erst über den genialischen Privatgelehrten und Luft- und Raumfahrtschriftsteller hatte er dann Hedis Bekanntschaft gemacht.
Manchmal musste Simon sich ins Gedächtnis rufen, dass er ja etwas im Schilde führte und über die Umstände froh sein sollte, denn indem sich Sascha so auf Hedi konzentrierte, bekam Simon Spielräume. Er stellte aber immer wieder fest, dass ihn Hedis Schäkern mit Sascha deutlich mehr beschäftigte, als es sollte. Sie kannte Sascha länger, hing ihm stets an den Lippen, wenn er so souverän und vielbeschlagen über seine Raumfahrtvisionen sprach, und wenn er sie jetzt so vertraut mit ihm sah, fragte sich Simon, ob da nicht vielleicht auch mehr zwischen den beiden sein mochte … Eine Vorstellung, die ihm nicht gefiel.
Nach etwa zehn Minuten erreichten sie das Strandbad, ein gelb getünchtes Haus mit hohem, spitz zulaufendem Giebel neben einem niedrigen, hölzernen Eingangsbereich. Auch hier war kaum etwas los. Simon bezahlte kurzerhand den Eintritt für sie alle drei, worauf Hedi sich von Sascha löste und ihm einen gesitteten Kuss auf die Wange gab.
Wie sie vorausgesagt hatte, waren sie beinah alleine. Auf der Erde, die man hier am Wannsee Sand nannte, breiteten sie Hedis Decke aus; sie verteilte mitgebrachte kleine Sandwiches mit Gurke und schenkte jedem gezuckerten Tee ein. Sie hatte auch noch Kuchen dabei, aber den sollte es später geben. Dann verschwand Sascha in einer Umkleidekabine und kam sodann in einem Badetrikot heraus, wie man sie vor dem Großen Krieg getragen hatte. Er legte seine Kleidung in einem Haufen auf der Decke ab und war schon wieder unterwegs, rief ihnen zu, ein Ruderboot mieten zu wollen, er sei seit seiner Jugend ein Ruderer und wolle ihnen zeigen, wie man sich in die Riemen legte. Simon hatte nur eine Badehose dabei, und Hedi trug einen knapp sitzenden, hellblauen Zweiteiler mit kurzer Hose und einem taillierten Oberteil. Ihre von Sommersprossen bedeckte, schon leicht gebräunte Haut und ihr blondlockiges kurzes Haar kamen darin derart gut zur Geltung, dass es Simon fast wehtat. Unverhohlen ließ auch Hedi ihre Blicke über Simons Athletenkörper wandern.
«Was ist dir da passiert?», fragte sie dann und wies auf die lange Narbe, die sich über Simons rechte Schulter zog.
«Da habe ich vor ein paar Jahren einmal etwas zu heftig getackelt …»
«Was?»
«Tackeln, Rugby. Wenn du jemanden zu Fall bringst … damals ging das schief, bin unglücklich aufgekommen und habe mir die Schulter gebrochen. Musste operiert werden.» Er lachte. «Die Betäubung war das Seltsamste, was ich bis dahin erlebt habe. Mit einem Schlag weg. Wieder aufgewacht. Vorbei. Daran erinnere ich mich bis heute.»
«Darf ich?», fragte sie, Simon nickte, und so vorsichtig, als wäre die Narbe ganz frisch, fuhr sie mit der Kuppe ihres Zeigefingers unter dem rot lackierten Nagel über die Narbenwulst und verzog dabei bedauernd ihren schönen Mund.
«Du Armer …»
«Gar nicht.»
«Ch’allo! Ch’ier!», brüllte nun vom Wasser her Sascha, der sich bereits vorzüglich mit den Rudern arrangiert zu haben schien und das weiß lackierte Boot so nahe wie möglich an das Ufer herangesteuert hatte, ohne auf Grund zu laufen.
«Wir kommen schon», rief Hedi, sprang auf und wollte Simon von der Decke ziehen.
«Geh du allein, Hedi. Mag hier ein wenig faul sein, ja? Ich passe auf unsere Sachen auf.»
«Gut, du Faulpelz.»
Sie ließ von ihm ab und lief los, spritzte durch das seichte Wasser, und Simon konnte von seiner Decke aus sehen, wie erfreut Sascha zu sein schien, dass er mit Hedi alleine sein würde. Mit großen, ausholenden Bewegungen legte er sich in die Riemen, sein Körper im rot-schwarz gestreiften Badeanzug wippte vor und zurück. Hedi drehte sich zum Strand, winkte Simon lachend. Simon winkte zurück und sah mit Genugtuung, dass Sascha sich anscheinend vorgenommen hatte, Hedi bis an das gegenüberliegende Ufer zu rudern, um sie möglichst lange für sich alleine zu haben. Bestimmt erzählte er ihr gerade etwas über die Möglichkeit raketengetriebener Schiffe.
Als das Boot mit seinen beiden Freunden nur noch eine weit entfernte Miniatur war, langte Simon nach Saschas Sakko, durchsuchte die Innentasche und fand dessen Wohnungsschlüssel. Es waren drei Stück an einem lockeren Bund. Einer für die Haustür, einer für die Wohnung, und der dritte, der kleinste, gehörte womöglich zu so etwas wie einem Safe.
Schnell zog er nun aus seinem Rucksack einen Beutel mit den in stabilen Blechdöschen mitgebrachten Paraffinmatrizen heraus und machte von jedem der Schlüssel einen doppelten Abdruck, von jeder Seite einen.
Das Paraffin eignete sich dafür ganz hervorragend, die Schlüssel ließen sich perfekt abdrücken. Zum Glück für Simon war es auch nicht zu heiß, was die Abdrücke vielleicht beeinträchtigt hätte. Er verschloss die Döschen und steckte sie zurück in den schwarzen Samtbeutel, den er im Rucksack verschwinden ließ, dann legte er den Schlüsselbund in Saschas Sakko zurück. Da war auch Saschas Brieftasche, er klappte sie auf. Sein Pass, ein sowjetischer, mit allen Stempeln von deutscher Seite. Alexander Borisowitsch Scherschewsky, entzifferte er die kyrillischen Buchstaben. Weiter war da eine Abschrift seiner Aufenthaltsgenehmigung, ein paar Visitenkarten von russischen Restaurants und Teestuben, die meisten in Schöneberg. Keine Geldscheine und auch sonst kein Zeichen, dass die Person, der die Brieftasche gehörte, über Geld verfügen könnte. Schnell holte Simon die kleine Schnellkamera aus ihrem Etui, die ihm, wie das Paraffin, von Scully besorgt worden war, und fotografierte Pass und Visum. Man konnte nie wissen.
Als er auch die Brieftasche wieder ordnungsgemäß verstaut hatte und alles so unberührt aussah wie zuvor, spürte er, dass sein Herz heftig schlug. Er war zwar aufgeregt, das ja, aber er hatte kein schlechtes Gewissen, denn er hatte mit den Schlüsseln, die über Nacht nachgemacht werden würden, ja nichts wirklich Böses vor. Gut, er hinterging Sascha, aber das war nun einmal nicht zu vermeiden, das gehörte zu dem Spiel, auf das er sich eingelassen hatte. Es richtete sich nicht gegen die Person Alexander Scherschewsky, sondern diente lediglich der Aufklärung und Informationsbeschaffung mit höherem Ziel. Zum Wohle der Menschheit womöglich. Vielleicht würde er ja auch gar nichts von Bedeutung finden und hätte Sascha damit insgeheim noch einen Gefallen getan, weil dann seine absolute Unschuld bewiesen war. Und mit Hedi hatte es schon rein gar nichts zu tun, dachte er sich. Wo waren die beiden jetzt? Er sah das winzig kleine Boot, weit draußen.
Er setzte seine Kamera an und probierte aus, wie nah er Hedi und Sascha, die nun, wie es schien, gerade umgedreht hatten, damit heranholen konnte. Das Ergebnis war überzeugend. Sie saßen nebeneinander, mit dem Rücken zu ihm, hatten beide jeweils ein Ruder gefasst und bewegten es im gemeinsamen Rhythmus. Es gab Simon einen Stich, als er sah, dass sich Hedi vorbeugte, um Sascha den Arm um die Schulter zu legen und womöglich einen Kuss zu geben, was man freilich nicht genau erkennen konnte.
Da war sofort die eifersüchtige Idee oder vielmehr der Wunsch, Hedi würde ihm auch einmal den Arm um die Schulter legen oder er würde sie vielleicht sogar auf ihren sommersprossigen Hals küssen dürfen. Aber anders als bei vielen anderen fantastischen Dingen, die man vielleicht gerne berührt hätte, die aber zu weit entfernt waren – so wie das glitzernde Schneefeld unter einem berauschend schönen Alpengipfel oder der lieblich im Sonnenlicht scheinende Mondkrater der heimlichen Liebe –, war Hedwig von Treyden zumindest erreichbar, sichtbar, nah, jetzt und hier. Er sah sie ja durch das Objektiv.
Simon verstaute seine Kamera, verschnürte den Rucksack und stand auf, um den beiden entgegenzuschwimmen.
3
Ende November 1939 war Dr. Batley gerade dabei, die Spuren des nachmittäglichen Physikunterrichts zu beseitigen. Mithilfe von Brennspiritus hatte er einer neunten Klasse den Bernoulli-Effekt demonstriert und den blauen Geist in der Flasche hervorgezaubert. Das noch abgedunkelte Labor roch streng nach dem Brennstoff, doch über diesem Geruch lag plötzlich der exquisite Duft eines eigens für seinen Träger zusammengestellten Parfüms. Viel Vetiver. Batley wusste sofort, wer hinter ihm stand. Edmond «Scully» Hamilton, Marquess of Dufferin and Ava. Dieser meinte in Bezug auf seine Herkunft, dass seine Vorfahren über Jahrhunderte das Leben so genossen hätten, dass für ihn nichts übrig geblieben sei. Kein Laster, keine Praktiken und keine Beziehungsform, die noch hätten interessant sein können, weshalb nur der Geheimdienst infrage gekommen sei, um noch ein wenig Spaß und Überraschung im Dasein zu haben. Scully, stets vornehm dezent gekleidet, hatte es mit seinem Parfüm immer schon gern übertrieben.
Die drei Jahre, in denen Simon ihn nicht gesehen hatte, hatten ihn kaum verändert. Sehnig wie ein Bergsteiger. Das fein ausrasierte Oberlippenbärtchen verlieh seinem Gesicht immer noch einen Ausdruck von Heiterkeit. Vielleicht hatte er ein paar Falten mehr im Gesicht, aber das verstärkte den Eindruck eines fitten Gentlemans um die fünfzig.
«Was wollen Sie?» Simon musste sich nicht anstrengen, um unfreundlich zu klingen.
«Mit Ihnen reden, Batley», sagte Scully und machte ein heiteres Gesicht, als wäre er selber überrascht davon, dass es etwas zu erzählen gab. Den Trenchcoat über dem Arm, trug er einen grauen Savile-Row-Anzug, der genau die Mischung aus Eleganz und leichter Schäbigkeit aufwies, die es bei keinem Schneider gab, sondern die man jahrelang an sehr feinen Stoffen abtragen musste.
«Ich wüsste nicht, worüber wir reden sollten.»
«Noch nicht. Und wie sollten Sie auch? Unsere Gesprächsthemen stehen gemeinhin nicht in der Times. Oder was lesen Sie hier draußen? Den Surrey Advertiser?»
Simon warf den Schwamm, mit dem er die Tafel gereinigt hatte, mit ärgerlichem Ausdruck ins Waschbecken, sodass Spritzer die weiß gekalkte Wand beklecksten.
«Hören Sie auf, Hamilton. Was in der Zeitung steht, ist schlimm genug. Krieg in Europa. Eine Katastrophe, die mir völlig genügt. Ich bin sicher, Sie haben dem Ganzen noch weitere Dimensionen des Negativen hinzuzufügen – aber ich habe keinen Bedarf.»
«Batley», sagte Scully nun ohne jede Ironie, «die Sache hat gerade erst begonnen.»
«Ich weiß. Wir haben Deutschland den Krieg erklärt, und wenn es so weit ist, werde ich nicht weglaufen. Ich weiß, wo die Army ihre Musterungsbüros hat.»
«Das ist sehr ehrenwert von Ihnen. Aber Sie sind viel zu wichtig, um in eine Uniform gesteckt und über den Kanal geschickt zu werden.»
«Ich möchte nichts mehr mit Ihnen und dem Broadway zu tun haben. Die eine Katastrophe, in die Sie mich damals hineingezogen haben, genügt mir.»
«Was Sie eine Katastrophe nennen, war eine der glänzendsten Leistungen unseres Dienstes. Sicherlich, ungewöhnlich in Planung und Durchführung, aber mit überragendem Ergebnis. Es war ein Experiment – wir wussten selbst nicht, was dabei herauskommen würde. Das müssen gerade Sie doch verstehen. Wir haben nur unsere Pflicht getan.»
«Natürlich, Ihre Pflicht. Sie haben mich dafür benutzt. War das auch Ihre Pflicht?»
«Ich kann nur sagen, Batley, dass Sie einer meiner besten Agenten waren. Ihre persönlichen Verluste in Berlin in Ehren… das tut mir ja auch sehr leid … aber Sie müssen das Große und Ganze sehen! Es ging, so wie heute, um unser Überleben. Das bedeutendste, beste und friedlichste Imperium, das jemals von Menschen geschaffen worden ist. Wer hat den Sklavenhandel verboten? Wir.» Wieder zog er die Augenbrauen hoch, aber Simon schüttelte nur leicht den Kopf. Von all den Schandtaten Englands in Indien und anderswo in den Kolonien abgesehen, war das Empire als solches von Beginn an niemals friedlich gewesen. Und die Sklaverei hatte man aus ökonomischen Erwägungen verdammt. Was für eine Farce, Simon konnte es nicht fassen.
Scully wurde langsam mit sich selbst ungeduldig, da es ihm nicht gelang, dass dieser halsstarrige Batley ihn zumindest anhörte. Dabei musste er ihn zurückholen, unbedingt. Er brauchte seinen großartigen Verbindungsmann aus der Welt der Naturwissenschaften und speziell der Physik zurück. Denn Batley, das mochte der selber sehen, wie er wollte, hatte sich das erste Mal hervorragend bewährt. Sicher, der Verweis auf das Empire gerade war ein Fauxpas gewesen. Scully hatte sich eigens mit der Personalakte Batleys vorbereitet, aus der klar hervorging, dass man ihn eher dem kolonialkritischen Lager zurechnete. Nicht gerade radikale Labour-Partei, aber progressiv. Ärgerlicher Fehler.
Währenddessen hatte Simon die Arbeitsplatte gewischt, weiter aufgeräumt, und nun seifte er sich in dem kleinen Waschbecken die Hände ein, trocknete sich ab, krempelte die Hemdsärmel herunter, knöpfte sie zu und nahm sein Jackett von der Stuhllehne. Als Scully das bedrohte Weltreich erwähnte, lachte er einmal laut auf. Scully überhörte es geflissentlich.
«Kommen Sie, Simon, gehen wir nach draußen. Was ich Ihnen zu sagen habe, sagt man besser unter freiem Himmel.»
Simon seufzte, ließ ihn vorgehen, drehte den Stromschalter aus und sperrte sein geschätztes Physiklabor ab. Er wusste nicht, dass er es nie wieder betreten würde.
Auf dem gekiesten, streng rechtwinklig angelegten Weg rund um den auch in St. John’s heiligen Rasen war es aber keineswegs eine neu aufbrechende Sympathie für den Marquess of Dufferin and Ava, die Simon dazu brachte, kurze Zeit später in Hamiltons Bentley zu steigen, in dem dessen sportlich wirkender Chauffeur saß. Es hatte vielmehr mit einem Schriftstück zu tun, das geheimdienstintern schon bald der «Oslo-Report» genannt werden würde. Ein paar Wochen zuvor nämlich war in der britischen Botschaft in Oslo ein maschinengeschriebener, siebenseitiger Brief eingegangen, unterzeichnet mit «ein deutscher Wissenschaftler, der Ihnen wohlgesinnt ist».
Dieser Wohlgesinnte warnte die Engländer, dass die Deutschen intensiv an neuen Waffensystemen arbeiteten, manche in Vorplanung, andere schon im probeweisen Einsatz. Sieben Seiten dichter Aufzählung: Forschungsstätten der Luftwaffe und der Marine, die Verwendung der Junkers 88 als neuartiger Sturzbomber, gelenkte Torpedos und Flugabwehrsysteme. Der Wohlgesinnte hatte den Briten auch genau erklärt, warum der erste größere britische Luftangriff gegen Wilhelmshaven im September zu einer solchen Katastrophe geworden war: Neuartiges Radar hatte den Deutschen die britischen Bomberverbände schon hundertzwanzig Kilometer vor der Küste angezeigt. Wer immer der Absender war, er wusste genau, wovon er schrieb.
«Der Wohlgesinnte hat uns die Funktionsweise des deutschen Radars exakt beschrieben, sodass wir hoffen, bald etwas dagegen unternehmen zu können», schilderte Scully. «Und wenn ich wir sage, dann meine ich die neue Abteilung, die gerade aufgebaut wird.»
«Was für eine Abteilung?»
«Sehen Sie, Simon, wir hätten damals nach unserem spektakulären Erfolg in Berlin alles daransetzen müssen, Sie zu halten. Aber wir dachten, die Arbeit wäre erledigt. Ein großer Fehler, wie wir jetzt lernen müssen. Auch hat uns die deutsche Abwehr zuletzt ein paar Wirkungstreffer verpasst, da will ich ehrlich sein, die uns kalt erwischt haben. Wir sind angeknackst. Der Oslo-Report hat uns jetzt klargemacht, dass wir auch das Thema Wissenschaft sträflich vernachlässigt haben. Worauf C mit Downing Street konferierte. Die wissenschaftliche Analyse der deutschen Geheimwaffenforschung steht von nun ganz oben auf der Agenda.»
«Das leuchtet mir schon ein. Aber von Radar verstehe ich wirklich nichts.»
«Batley, der Oslo-Report spricht davon, dass die Deutschen auch an neuen Flugkörpern arbeiten. Und zwar im großen Stil. Der Wohlgesinnte erwähnt Forschungsstätten an der Ostsee, aber noch wissen wir nichts Genaues. Aber allein die Vorstellung, der Zielbereich erstreckte sich bis London … Denken Sie an das schöne St. John und Ihre Schüler. Wollen Sie das alles hier in Schutt und Asche sehen?»
An diesem Abend betrat Simon zum ersten Mal in seinem Leben das Gebäude Broadway 54. In seiner früheren Tätigkeit wäre das niemals möglich gewesen, damals war er ein informeller Mitarbeiter ohne Zugangsberechtigung. Kurz vor neun Uhr abends herrschte bei «Minimax-Feuerlöscher», so die offizielle Firmierung, ein surreal normaler Bürobetrieb. Eine ältere Dame und zwei Telefonistinnen saßen zentral in der Lobby an einem Tresen, wimmelten Anrufe ab oder stellten sie durch und registrierten genau, wer kam und ging. Und das waren nicht gerade wenige.
Beim Anblick Scullys wirkte die Empfangschefin – Simon würde sie bald als Mrs. Turner kennenlernen, was natürlich nicht ihr richtiger Name war –, als habe sie vergessen, wer hier alles verkehrte, und es sei ihr gerade eben wieder klar geworden.
«Wird dieser Gentleman hier tätig sein?», fragte sie missbilligend den Marquess, zugleich aber zwinkerte sie Simon verschmitzt zu.
«Er wird dringlichst erwartet», gab Scully ungerührt zurück, verfrachtete Simon in den Aufzug und brachte ihn in den dritten Stock, wo man die neue Abteilung «Scientific Intelligence» eingerichtet hatte. Sie bestand bisher aus einer einzigen Person: einem hochgewachsenen, schlanken Mann Ende zwanzig mit einer beeindruckenden Haartolle neben seinem Scheitel. Er war um einiges jünger als Simon und einer jener totalen Wissenschaftsfanatiker, wie Simon sie auf den ersten Blick erkannte. Er saß über einem ganzen Stapel von Dokumenten. Listen, Daten und Namen. Als sie eintraten, sprang er von seinem Stuhl auf, klemmte sich den Bleistift hinter das unter seiner eigenwilligen Frisur freiliegende rechte Ohr und ergriff strahlend Simons Hand.
«Ich bin R. V. Jones. Arvie reicht. Willkommen, Dr. Batley, die reine Freude. Ich kenne Ihre Doktorarbeit bei Prof. Kutzbach.»
«Tatsächlich?»
«‹Der Raketenantrieb als Kraftmaschine›, habe ich recht? Wir haben Ihre Arbeit in Oxford diskutiert. Bevor ich als Wissenschaftsoffizier zur Royal Air Force kam, war ich am Clarendon-Labor, Radiowellen und Funktechnik. Sind hier leider nicht richtig gut besetzt, was das Raketen-Thema angeht. Aber zum Glück haben wir jetzt Sie.»
Simon sah Scully an, der starr zu Boden blickte. Wenn man Scully kannte, konnte man nicht überrascht sein, dass er offenbar bereits verkündet hatte, Simon würde wieder für sie arbeiten. Der zögerte immer noch. Aber Arvie ließ sich nicht irritieren.
«Lassen Sie uns einen Blick auf das Material werfen, das ich in den letzten Wochen gesammelt habe, vielleicht fällt Ihnen etwas dazu ein.»
Sie traten an seinen Schreibtisch. Die Arbeit stehe ganz am Anfang, und es gebe keine Blaupause für den vor ihnen liegenden Auftrag: Einblick in die deutsche militärische, kriegsrelevante Forschung zu bekommen. Man könne nur mit dem beginnen, was man habe. Das seien im Falle der Raketentechnik zwar noch keine Zeichnungen, Karten oder gar Baupläne, aber Arvie hatte eine beeindruckende Liste von Personen, Wissenschaftlern und Technikern zusammengestellt, die in Deutschland möglicherweise mit der Raketenforschung beschäftigt sein könnten. Samt deren Forschungsschwerpunkten.
«Es sind unterschiedliche Gruppen. Alles Vermutungen. Ich habe auch ehrlich gesagt das Problem … also, ich hatte Französisch. Kann kein Deutsch. Klar ist, dass das Heereswaffenamt da eine große Rolle spielt.»
«Das wundert mich nicht. Die haben ja schon damals, als ich noch in Berlin war, versucht, alles an sich zu ziehen.»
Simon ging die Namen durch, viele Wissenschaftler arbeiteten in Berlin oder München, von manchen hatte Simon schon gehört. Natürlich war der schon damals alle überstrahlende Freiherr von Braun dabei, auch sein ähnlich wichtiger Counterpart Rolf Engel. Dann Forscher von der Technischen Hochschule Dresden. Simon selber hatte zwar in Berlin studiert und war auch immer dort wohnen geblieben, hatte aber in Dresden promoviert. Die TH Dresden war sehr gut in Antriebstechnik, das war bekannt. Nun kam Göttingen, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung. Plötzlich durchfuhr es Simon. Ein Name unter den Göttinger Strömungsforschern stand da wie in glühenden Buchstaben: «Dr. rer. nat. Hedwig von Treyden», las er. Es war wie ein Schlag. Scully sah Simons Reaktion sofort. Er blickte Jones an.
«Was haben Sie?», fragte Arvie. «Jemand, den Sie kennen?»
Simon nickte. Da war sie also, Hedi. Als Mathematikerin hatte sie in Berlin über «Eine Verallgemeinerung der regularisierten Gammafunktion» promoviert, und dann war es eigentlich logisch, dass sie schließlich zu Professor Busemann nach Göttingen gekommen war, der sich mit Hochgeschwindigkeits-Aerodynamik beschäftigte. Dass es da Verbindungen zum Raketenbau gab, war völlig einleuchtend.
Hier stand Simon nun also, im dritten Stock des Broadways, ausgerechnet, nachdem er jahrelang alles vermieden hatte, was ihn zufällig an Hedi hätte erinnern können, weshalb er zum Beispiel die deutschen Zeitschriften wie Naturwissenschaften nicht mehr gelesen hatte.
Er ließ das Blatt sinken. Sah sich in Jones’ Büro um. Etliche Schreibtische, nur einer in Benutzung, ein anderer war offensichtlich eher eine Art Ablage, Telefone, ein Funkschreiber, eine große Schiefertafel, Regale, zu einem Viertel mit Büchern und Zeitschriften gefüllt. Ein gut ausgestatteter, aber nichtssagender Ort, der in diesem Moment zu einer Kommunikationszentrale seiner tiefsten Sehnsüchte geworden war.
Er dachte nach, sah vor sich Hedis schönes, hinreißend kluges Lachen, die blauen Augen voller Lebensfreude und Wissensdurst, für die er sie so verehrt hatte. Das deutliche Gefühl, dass sie in der Lage war, die Gesetze der universellen Gravitation ein wenig außer Kraft zu setzen, wenn er mit ihr zusammen war. Niemals war er mit einem Menschen so glücklich gewesen, hatte sich so eins mit jemandem gefühlt wie mit ihr, es war unvorstellbar gewesen, nicht mehr mit ihr zusammen zu sein. Bis es plötzlich so weit war und er alles ruiniert hatte. Seitdem dachte er an sie, jeden Morgen, jeden Abend, wenn er ins Bett ging. Sie war wie ein musikalisches Thema, das ihn unentwegt umspielte. Vielleicht war es nun so, dass er eine Chance bekam, es wiedergutzumachen.
«Ich bin dabei», sagte er.
«Fantastisch, Dr. Batley, das habe ich gehofft! Dann wäre das hier ab jetzt Ihr Schreibtisch!»
«Da wir das Notwendige und nichtsdestoweniger höchst Erfreuliche geklärt haben», stellte Scully fest, «und es ja auch schon – was vorauszusehen war – etwas später geworden ist, hat C persönlich mich beauftragt, Sie beide auf der Stelle zum Strand zu bringen. Dort wartet eine einsame Witwe auf uns.»
C, das erfuhr Simon bald, war der Leiter des ganzen Dienstes. C, weil er angeblich alles unter Kontrolle hatte. Tatsächlich sah die Organisation oft genug nach dem Gegenteil aus, nach pulverisierender Entropie, sodass Simon in düsteren Momenten öfter dachte, ob das ominöse C, das als Signatur stets mit grüner Tinte zumeist unter jeden Leseumlauf eines Dokuments gesetzt war, nicht eigentlich für einen anderen Begriff stand – «Chaos». Wie das Chaos damals in Berlin.
Scullys Chauffeur Patrick bog kurz darauf in die einzige Straße im gesamten britischen Empire ein, auf der Rechtsverkehr galt. Sie betraten die Lobby des Hotel Savoy und wurden von einem Scully persönlich bekannten Portier begrüßt. Seit seiner Gründung hatte dieses Haus, inklusive seines Restaurants, noch keine einzige Stunde geschlossen gehabt. Da die Zahl deutscher Agenten, die enttarnt oder übergelaufen waren, derart drastisch angestiegen war, dass man keine Räumlichkeiten mehr hatte, nutzten verschiedene Abteilungen die diskreten Zimmer des Savoy für Verhöre. Deren Ambiente half, den deutschen Spionen eine Tätigkeit als Doppelagenten schmackhaft zu machen. Die Doublecrosser, wie man sie nannte, galten als geheimdienstliche Kostbarkeiten, konnte man durch sie doch den Deutschen falsche Geheimnisse zukommen lassen und sie dadurch in die Irre führen. So wie die Deutschen es zu Beginn des Krieges mit ihnen gemacht und sie mehrfach bitter hereingelegt hatten. Die Anwerbungsgespräche an einem so angenehmen Ort wie dem Savoy zu führen, bot daneben den Vorteil, dass man dort anschließend die beste Küche Londons genießen konnte.
An Scullys Tisch stand eine Flasche Veuve Clicquot im Eiskühler, die sogleich geöffnet wurde. Sie stießen an.
«Wie Sie wissen, Gentlemen», erzählte Scully und blickte dabei träumerisch durch das Geperle des Champagners, so als wäre er persönlich dabei gewesen, «verdankt sich der MI6 und dann der Secret Service den Bestrebungen des deutschen Kaisers, seine Flotte zu einer mit unseren Vorstellungen nicht vereinbaren Größe aufzublähen. Man fragte sich damals: Wie viele Schiffe haben die Deutschen wirklich? Wie viele wurden gerade gebaut? Wie sah ihre Bewaffnung aus? Also entschied die Regierung Seiner Majestät, ein paar ausgebuffte Marineoffiziere in geheimer Mission nach Kiel und Wilhelmshaven zu schicken. Sie tarnten sich als Hafenarbeiter, machten Fotos und bezahlten Schmiergelder an die Angestellten von Blohm & Voss und anderen Reedereien, und über die Menge an eingekauftem Stahl rechneten sie gebaute Bruttoregistertonnen hoch.»
«Wann war das?», fragte Arvie.
«1909. Das Gründungsjahr des ersten modernen Nachrichtendienstes. Zuvor, bei den Habsburgern und den Zaren, ging es vor allem um die Beobachtung der eigenen Leute. Wir aber kümmerten uns auch um unsere äußeren Hauptgegner. Mit dem Krieg kam die Russische Revolution, und ein Agent Provocateur namens Lenin brachte die Bolschewiken an die Macht – so hatten wir gleich das nächste Aufgabengebiet. Dass wir hier sitzen, meine Herren, ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Hoch auf unsere Feinde. Ihnen verdanken wir unsere Existenz, und sie bezahlen – wenn Sie mir diesen Scherz durchgehen lassen – diese eiskalte Witwe aus dem schönen Reims.»
«Wusste nicht, dass wir so einzigartig sind.»
«Aber ja. Mittlerweile gibt es in einigen Ländern Dienste, die unserem Vorbild folgen, die besten sind wohl die unglücklichen Polen. Zwischen zwei größeren, feindlichen Ländern zu stecken, hat sie erfinderisch werden lassen. Da die meisten von ihren Leuten mittlerweile in London sind, profitieren wir jetzt davon. Aber unsere amerikanischen Freunde zum Beispiel – haben bis heute noch keinen Nachrichtendienst.»
«Dafür geben sich die Deutschen jede erdenkliche Mühe, diesen Mangel wettzumachen», sagte Arvie, «wir müssen uns vorsehen. Wie die Wachhunde.»
«The watch-dogs bark», rief Scully nun vergnügt und legte sich ins Zeug, als er fortsetzte:
«Horch, horch, Wau – Wau!
Der Wachhund bellt – Wau – Wau!
Horch, horch, ich hör
Der Hahn kräht; munter krähet er:
Kriki»
«Erwischt, Scully», lachte Arvie, «was ist das?»
«‹Der Sturm›, meine Herren. Kaum ein Stück passt besser. Wie Prospero sind Sie Wissenschaftler doch auch so etwas wie Zauberer.»
Simon schwieg und grübelte darüber nach, dass an dieser Stelle, wenn er sich recht erinnerte, Ariel sprach, der Sklave des Zauberers. Wollte der Marquess damit etwas andeuten? Überhaupt – der ganze Vortrag, den Scully hier gehalten hatte … wenn er an Berlin dachte … Scully war im Zweifel weder kultiviert noch subtil, sondern jemand, der ohne Rücksicht auf Menschenleben handelte.
«Wenn eines Tages die Akten freigegeben werden, nach unserem Sieg, wird das alles Stoff für ein fabelhaftes Buch sein!», rief Scully aus.
«Davon träumen Sie wohl?», fragte Simon nicht ohne Spott. Er traute Scully auch politisch nicht ganz über den Weg, erinnerte sich an den Beginn des Jahrzehnts, als er aus Sympathien für gewisse Züge des Nationalsozialismus kein Hehl gemacht hatte.
«Ich? Nein. Nur, weil ich mich an ein paar Zeilen Shakespeare erinnere, heißt das nicht, dass ich über literarisches Talent verfügen würde. Also dann – auf die Wachhunde der Wissenschaft. Horch, horch!»
4
Scullys Wachhunde bekamen eine Sekretärin, Lydia, die den Auftrag hatte, den beiden Neulingen mütterlich und betreuend zur Seite zu stehen. Lydia war eine der vielen im Dienst und seinen Unterabteilungen beschäftigten Bürodamen. Oft waren sie es, die das Chaos, das die Agenten und Offiziere bei überhasteten Operationen anrichteten, in eine halbwegs kommunizierbare Form brachten – sodass die Führungsspitze informiert werden konnte. Sie wussten von den Schwächen und den Eigenheiten der Agenten, und sie konnten schweigen.
Lydia war eine höchst weibliche Erscheinung mit dunkelblondem Haar, Ende dreißig, deren Harfenistinnenhände über der Schreibmaschine zu tanzen schienen. Das Erste, was sie an ihrer frisch angetretenen Stelle tippte, war eine Liste möglicher neuartiger Waffen, die Arvie und Simon nach eingehender Analyse des Oslo-Reports und anderen, teilweise dubiosen bis fantastischen Berichten und Vernehmungsprotokollen zusammengestellt hatten. Manches war ihnen unmöglich erschienen, zum Beispiel die deutsche «Erdbebenmaschine», von der ein Geschäftsmann aus Ungarn zu wissen glaubte, oder ein «Explosions-Gas», das jedes Lebewesen im Umkreis platzen lasse wie einen unglückseligen Frosch, der bösartigen Kindern mit Strohhalmen in die Hände gefallen war. Schließlich kam also diese «Liste möglicher neuer Waffenarten» aus Lydias Schreibmaschine:
Bakterielle Kriegführung
Neuartige Giftgase
Flammenwaffen
Gleitbomben, Lufttorpedos und unbemannte Flugzeuge
Langstreckenartillerie und Raketen
Neuartige Torpedos, Minen und U-Boote
Todesstrahlen, motorschädigende Strahlen und Magnetwaffen
«Nehmen Sie es mir nicht übel, meine Herren», sagte Lydia, als das Dokument vorbereitet war, «ich bin ja schon einige Jahre hier, habe alles Mögliche mitbekommen, Captain Hamilton ist ja sehr umtriebig. Aber so eine Zusammenstellung von Scheußlichkeiten habe ich noch nie gesehen. Gibt es diese Todesstrahlen wirklich?»
«Es könnte sein, dass Deutschland an so etwas forscht, da man Röntgenstrahlen auch als Waffe einsetzen könnte», sagte Simon.
«Um mit diesen Scheußlichkeiten umzugehen, muss man sie zuerst erkennen. Und dafür sind wir da», erwiderte Arvie mit scheinbar unerschöpflicher Fröhlichkeit.
Zwei Tage später überraschte Lydia Simon mit der Nachricht, dass er mit einem Verbindungsoffizier auf Station X verabredet sei, dem hochgeheimen Abhör- und Decodierzentrum in Bletchley Park. Arvie sei schon damit bekannt, nun solle sich auch Simon einen Eindruck von der britischen Funkzentrale machen. Scullys Wagen stehe ihm zur Verfügung.
Bletchley Park war ein einsamer Landsitz, aber günstig in der Nähe eines Eisenbahnknotenpunktes gelegen. Scullys Chauffeur wartete geduldig zwischen zwei Schlagbäumen, während ihre Papiere überprüft wurden. Einer der Soldaten, begleitet von einem nervös wirkenden deutschen Schäferhund, blickte unter den Wagen und in den Kofferraum und ließ den Hund alles ausgiebig beschnuppern. Schließlich konnten sie passieren.
Die viktorianische Schlossanlage bestand aus vielen Gebäuden. Die riesigen Funkantennen wirkten wie Verzierungen auf einem Ensemble farbenfroher Törtchen. Ein paar hässliche Neubauten dahinter beherbergten den Maschinenpark, ausgestattet mit einer eigenen Stromversorgung. Alle Mitarbeiter bewegten sich, als gehörten sie einem speziellen, eigenen Regeln folgenden Technikorden an, der seine Ohren überall auf der Welt weit aufgesperrt hatte und gewissermaßen nicht ganz von dieser war, sondern über ihr schwebte. Hier in Bletchley Park pulsierte das kleinteilige, im Ganzen freilich riesige Kraftwerk der Informationsbeschaffung und Abschöpfung, auf das sie angewiesen sein würden. Wie bei der Taufe eines Matrosen, der zum ersten Mal den Äquator quert, wurde Simon in die Welt der Funkerfassung und der Kryptographie getaucht und einmal durch die zahllosen Empfangsstationen und die anschließenden Prozesse ihrer Dokumentation und Entschlüsselung gezogen.
Er war fasziniert vom bienenstockgleichen Surren der Funkanlagen und noch mehr von den vielen Schreibtischen, an denen die Stenotypistinnen saßen, unter ihren Kopfhörern lauschend und mitschreibend; die meisten von ihnen aus Deutschland oder Österreich vertrieben und geflohen, manche rauchend, alle jedenfalls hoch konzentriert. Sie kannten keine Müdigkeit und keine Erschöpfung, um der alten Heimat ihre Geheimnisse abzulauschen.
Simon fragte den Verbindungsoffizier, ob er einmal mithören dürfe. Der Offizier ging eine Liste durch.
«Hier, Marga, hört die SCHARNHORST ab, ein deutsches Schlachtschiff, das gerade vor Island sein Unwesen treibt.» Er führte Simon zu einer jungen Frau, die freundlich lächelnd ihre dicken Kopfhörer abnahm und sie ihm entgegenhielt.
Die Hörerpolster waren körperwarm, auch ein flüchtiger Geruch nach Seife und Flieder war auszumachen. Simon fand diese Kombination aus Duft und Wärme zusammen mit den ihn aufmerksam betrachtenden blauen Augen der jungen Frau verwirrend, geradezu intim. Marga selbst nahm einen Monohörer und schrieb mit, was zu vernehmen war: Morsesignale. Simon, der das Morsealphabet kannte, riss die Augen auf. Dem zackigen deutschen Funker im Nordatlantik zu folgen, war nicht einfach. Marga hingegen schrieb einfach nieder, was über den Äther kam:
«HJXQW PFNZA ORYTK VGBLM UDCEW KNXOP ZISHL MVCRA QWYTG BDHVF NJERP LOXKI QWTUE JZMVP RDLHG XAOYN TBWUE GKHLI SPXJM VNWQA HZXRP OLUEM»
Simon war bestürzt. Sich vorzustellen, was an den Dutzenden von Tischen an seltsamem Morse-Kauderwelsch lief, welch gewaltiger Chor von absurden, der Alltagsvernunft widersprechenden Zeichenfolgen aus allen Teilen Europas und der Welt hier eingefangen wurde! Gekrächze des Äthers, ein tosender Wahnsinn. Er setzte den Kopfhörer ab.
«Wie halten Sie das aus?», fragte er Marga auf Deutsch.
«Gewöhnt man sich daran schnell. Wird wie Fleisch und Blut. Hab schon geträumt davon und bin aufgewacht, weil ich meinen Block nicht gefunden, um zu notieren.»
«Erstaunlich. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?»
«Sie dürfen.»
«Woher kommen Sie? Aus Deutschland?»
«Warschau.»
«Was haben Sie da gemacht?»
«Na ja, habe Deutsch unterrichtet, am Gymnasium.»
«Ich habe zuletzt auch an einer Schule unterrichtet, einem Internat.»
«Die Schule fehlt mir. Hab mich jeden Morgen gefreut, wenn die Kinder mit ihren großen Augen vor mir saßen», sagte sie seufzend, «aber das kommt schon wieder.» Sie nahm die Kopfhörer entgegen, lächelte und versenkte sich wieder in den Code der SCHARNHORST, tippte mit der linken Hand den Takt mit, während sie rechts mit ihrem Bleistift schon wieder schrieb. Sie warf ihm noch einen Blick zu, der auch bedeuten mochte, dass es schön wäre, ihn wiederzusehen.
Was für eine Frau, dachte Simon, der seit dem Berliner Desaster des Abschieds von Hedi, der Katastrophe, niemanden mehr in seiner Nähe gehabt hatte, von einer diskreten Liaison in Leatherhead abgesehen. Aber beeindruckend waren die Frauen alle, die hier saßen und abhörten – starke Frauen, unermüdlich und pflichtbewusst. Geflohen, vertrieben, aus ihrer Heimat verjagt.
Beim Weitergehen dachte er an Berlin, an die Monate nach der Machtübernahme, als klar wurde, dass sich auch an den Universitäten alles ändern und die Wissenschaftslandschaft Deutschlands korrumpiert werden würde, die so einzigartig innerhalb von Jahrzehnten herangewachsen war. Als die SA die heiligen Hörsäle der Friedrich-Wilhelms-Universität stürmte, Vorlesungen unterbrach, Bücher aus den Regalen riss und schließlich einen der großen Geister und den sicherlich populärsten Vertreter der deutschen Wissenschaft, Albert Einstein, von einer Auslandsreise nicht mehr zurückkehren ließ. Und Einstein war nur der Anfang. Viele der Wissenschaftler lebten nun in Großbritannien und halfen dem Land, sich gegen Deutschland zu verteidigen.
Wie irre musste eine Regierung sein, die wegen eines absurden rassistischen Irrglaubens seine besten und gebildetsten Bürger aus dem Land stieß? Es war bekannt, dass Hitler die Relativitätstheorie nur deshalb ablehnte, weil Einstein Jude war; nicht etwa, weil er sie nicht verstand, dazu waren ohnehin nur die wenigsten in der Lage. Aber es gab keine «jüdische Physik» und keine «deutsche», die Naturgesetze waren fundamental. Woher diese Widervernunft, und auch noch in Deutschland, dem Land der Aufklärung? Dieses Rätsel verfolgte Simon seit Jahren – woher rührte diese Selbstzerstörung, die den meisten Deutschen nicht auffiel, die ganz im Gegenteil davon überzeugt waren, glorreichen Zeiten, dem Höhepunkt von tausend Jahren Geschichte entgegenzugehen?
Die Rätsel von Bletchley Park waren da von ganz anderer Art: Codes und Verschlüsselungen, und wie man sie knacken konnte. Der Verbindungsoffizier berichtete ihm dann von der härtesten Nuss, an der die Spezialisten von Station X arbeiteten: der Entschlüsselung der deutschen Enigma, der hochmodernen Chiffriermaschine.
«Echt geniale Elektroingenieurskunst, muss man sagen», bekam Simon erklärt, «der Kern besteht aus drei Rädern und einer Umkehrwalze, die miteinander über elektrische Kontakte verbunden sind. Wird ein Buchstabe gedrückt, dreht das Rad das Nachbarrad weiter, es entstehen laufend andere Verbindungen – sodass also jeder Buchstabe anders verschlüsselt wird. Die Maschine wiederholt nichts. Dabei war die Wiederholung einzelner Buchstaben früher immer der Schlüssel, um einen Code zu knacken. Genau das ist hier unmöglich.»
«Und es gibt keine Chance?», fragte Simon.
«Manche sagen das – aber wir haben ein paar junge Kryptographen, die glauben, dass es gelingen wird. Schon mal von Alan Turing gehört, einem Mathematiker? Der ist echt ein Genie. Und die Polen haben uns gerade ein paar Räder eines neuen Modells gebracht, die sie gestohlen haben. Ein Coup. Hier ist übrigens der Funkspruch, den Sie mitgehört haben, wir haben uns für Sie beeilt. Es hieß: 25. NOVEMBER 1939. SCHAR NHORS TANOK MHILF SKREU ZERRA WALPI NDIAU FPOSI TION6 3GRAD 40MIN UTENN ORD12 GRAD3 1MINU TENWE STVER SENKT 21UEB ERLEB ENDEA NBORD GNEIS ENAUO PERAT IONAB GEBRO CHENM ARSCH ALL»
Spät am Abend dann gingen sie durch weitere verschriftlichte Mitschnitte abgehörter deutscher Gespräche und Nachrichten, recht und schlecht decodiert. Die Transkribentinnen hatten sie nach Stichworten sortiert. Ob bei Soldaten, Funkern, Diplomaten, Geschäftsleuten – immer wieder gab es Anspielungen auf Geräte, Techniken und damit Hinweise auf neuartige Technologien. Wie bei einem Experiment auf der Ebene der Atome oder Elementarteile, wo es um Messungen kleinster Ströme oder Bewegungen von Elektronen ging, galt es hier zu lernen, wie man entscheidende Details aus der ungeheuren Masse erkennt und herausfiltert. Handelte es sich um den scherzhaften Namen für ein tatsächlich wichtiges Gerät, oder war etwas Unbedeutendes gemeint? Soldatenjargon, Herumgequatsche oder Wunderwaffe?
Später dann würden sie herauszufinden haben, welche Physik dahinterstand. Wie funktionierte das, was die Deutschen möglicherweise bauten? Und natürlich war auch niemals ausgeschlossen, dass die Nazis sie hereinlegen wollten und von unmöglichen Dingen fabulierten, wie etwa der Erdbebenmaschine. Man musste das Ganze als ein hochkomplexes Spiel betrachten, man musste ausblenden, dass es um Tod und Leben ging, und kühl kalkulieren. Das Gleiche tat der Fly-Half einer Rugby-Mannschaft, er sagte einen Spielzug an, ohne zu wissen, ob er zum Erfolg führte.
5
Als sie weit nach Mitternacht das schwer bewachte Schloss der tausend Stimmen verlassen hatten und zurück ins verdunkelte London fuhren, hatte Simon, auf der Rückbank des Bentleys einnickend, einen Traum. In einem kleinen Boot, das auf dem offenen Ozean der Informationen trieb, fand er sich wieder. Es war dunkle Nacht. Ein Sturm kam auf, die Stimmen von Bletchley Park wurden aus allen Richtungen herbeigeweht, ohne dass Simon etwas hätte verstehen können. Doch etwas in seinem Traum gab ihm die Idee ein, dass auch Hedis Stimme zu hören sei, verborgen hinter einem Code, verrätselt. Es gab da eine Folge von Zeichen, die in Beziehung zu ihr standen, direkt von ihr kamen. Er musste nur genau suchen. Und da! War da nicht ihr wunderbares Gesicht – das ihm allerdings entglitt, als ob es auf einem schnellen Strom treiben würde, zerklüfteter Fels und Gischt drum herum? Streckte sie ihm nicht die Hand entgegen, so als ob er sie retten, zurückreißen sollte?
Erschrocken wachte er auf. Der stark beheizte Wagen hatte schon die Vorstädte Londons erreicht. Dunkle Straßen, verhängte Fenster, eine Metropolis der Finsternis und der noch unbestimmten Furcht – wann würden die Deutschen ihre Luftwaffe schicken?
Eine dünne Spur Speichel war ihm aus dem Mund geronnen, aber etwas in ihm hatte sich verändert. Er fühlte sich wohl, der kurze Schlaf hatte ihm gutgetan und die Druckverhältnisse in seinem Inneren neu geordnet. Er wischte sich mit dem Taschentuch die Mundwinkel und glaubte mit einem Mal so etwas wie Übersicht über das zu haben, was vor ihnen lag. Die Aufgabe sah beinahe unendlich groß aus. Arvie und er waren Gefangene ihrer Arbeit, Physiker und Sisyphosnachfahren. Aber sie waren nicht allein. Und es gab einen Horizont, dem sie entgegenstrebten: den Sieg über ihre Gegner. Und für Simon vielleicht ein Wiedersehen. Ein Teil seines Verstandes wusste, dass da ein Widerspruch lauerte, aber der überwiegende Teil war hoffnungsvoll.
«Alles in Ordnung, Sir?», fragte Scullys Fahrer. Zum ersten Mal fiel Simon auf, dass Patrick einen breiten irischen Akzent hatte. Er hatte bisher kaum je etwas gesagt, ein groß gewachsener, schweigsamer Athlet, früher wohl in einer Spezialeinheit von Einzelkämpfern.
«Ja, bestens», gab Simon zurück. «Mal sehen, ob im Broadway noch Leben ist.»
«Der Broadway schläft nicht.»
Sie hielten vor dem Gebäude, Simon stieg aus. Da kam der Karren eines Lumpensammlers die Straße hoch. An den mit Sandsäcken verrammelten Hauseingängen vorbei ging ein uralt wirkender Mann mit weißen Haaren, die fettig unter einem löchrigen Zylinder hervorquollen. Er führte einen traurigen Klepper am Halfter. Der Alte grinste Simon aus zahnlosem Munde an und krähte eine Art Schüttelreim in fließend-geschmeidigem Cockney: «’n paar Blechdosen lose un’ Dachrinnenzink, und glücklich sin Old Sammy und ink.» Old Sammy musste der Gaul sein.
Simon schüttelte den Kopf: «Leider nichts für Sie zur Hand, Sir, entschuldigen Sie!», nickte ihm zu und fragte sich dabei, beinahe erschrocken, wie lange es noch dauerte, bis die Deutschen dem Mann Arbeit und Material in nie gekannter Fülle verschaffen würden, wann es Blech, Trümmer und Mörtel auf die Straßen von London regnen würde.
Als Arvie am nächsten Morgen mit einer großen gerollten Europakarte unter dem Arm auftauchte, fand er Simon übernächtigt und das Büro vollkommen verraucht vor. An der Schiefertafel standen die fünf Punkte, nach denen sie vorgehen sollten. Wie oft hatte er die Tafel gewischt und neu angefangen? Aber nun stand alles sauber da. Wie eine Mannschaftsaufstellung am Samstagmorgen, vor dem wichtigen Heimspiel:
Plan
Gewissheit über die Entwicklung neuer Waffen und die Weiterentwicklung existierender Waffen anderer Länder erlangen
Feinde über unsere Waffen täuschen
Den Feind über den Erfolg beim Einsatz seiner Waffen täuschen
Spionage und Gegenspionage (inklusive Decodierung) mit technisch-physikalischem Wissen unterstützen
Wissenschaftliche und technische Informationsbeschaffung zwischen den verschiedenen Diensten aller Gattungen koordinieren
Nach der Kriegserklärung an Deutschland, den Champion des neuartigen «Blitzkrieges», hatte man erwartet, dass London und die anderen britischen Großstädte augenblicklich angegriffen werden würden. Wer Kinder hatte und es sich leisten konnte, zog aufs Land oder in die Vorstädte. Viele Häuser und Wohnungen standen mit einem Mal leer, und so war es kein Problem für Simon, eine Unterkunft in der Nähe seiner Arbeit zu finden.
«Was zieht Sie nach London?», hatte der Vermieter gefragt, ein ältlicher Mann mit einem tiefroten Gesicht, der ein Problem mit der Passgenauigkeit seiner Zahnprothese hatte.
«Ich arbeite für die Regierung», hatte Simon geantwortet, «Schulen, Bildung.» Da es den Dienst offiziell ja nicht gab, war er jetzt ein Beamter des Schulministeriums, Abteilung für Lehrplanreform, mit hundertzwanzig Pfund im Jahr mittelmäßig bezahlt. Die Bezüge waren allerdings steuerfrei.
«Da sind Sie Lehrer?»