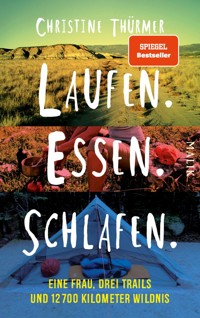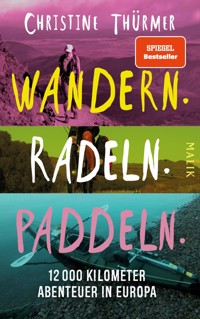13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Lieblingstouren der meistgewanderten Frau der Welt »Welchen Weg können Sie mir denn empfehlen?« Diese Frage wird Wanderexpertin und Bestsellerautorin Christine Thürmer nach über 60.000 Kilometern zu Fuß wirklich immer und überall gestellt. Eine allgemeingültige Antwort zu finden ist schwer, denn Menschen sind verschieden. Doch zum Glück ist auch jeder Trail anders! Der richtige Weg für jedermann und -frau Suchen Sie Einsamkeit? Abenteuer? Sinn? Kultur? Haben Sie ein kleines oder großes Budget? Wandern Sie allein, mit Ihrer Familie, Ihrem Hund, Ihrem Esel? Wollen Sie wissen, wo Sie das beste Bier trinken und wo die hungrigsten Insekten auf Sie warten? Was Sie tun müssen, wenn ein Alligator den Weg versperrt oder Sie in eine Militärübung geraten? Und wie auch Sie den richtigen Trail finden? 25 Trailtipps – vom Pilgerweg bis zur Abenteuerroute Amüsant und aufschlussreich erzählt die meistgewanderte Frau der Welt von Wildnisabenteuern und Pilgerwegen, von Geschichtstrips, Gourmettouren und Literaturpfaden aus ihrer Outdoorlaufbahn von Wachau bis Patagonien. Denn kein Weg passt für alle, aber einer passt ganz bestimmt zu Ihnen. »Thürmer ist der Gegenentwurf zu all den grellbunt gekleideten Hochglanzmodels der Bergsportindustrie; wer ihr zuhört, der wird endlich wieder daran erinnert, dass es sich beim Wandern um die demokratischste aller Bergsportarten handelt.« Bergwelten Sommer-Special »Unterwegs mit Legenden« »Thürmer bedient sich eines kumpelhaften Stils, leicht zu lesen und überaus unterhaltsam.« FAZ »Sie hat das Unterwegssein zu ihrem Lebensinhalt gemacht. (...) und wer ihre ehrlichen Berichte mit Hoch- und Tiefpunkten liest, wird das verstehen.« Brigitte »Motivierend, inspirierend, informativ und spannend – lesenswert selbst für dann bald ehemalige Couchpotatoes!« ARD Buffet über "Weite Wege Wandern"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Auf 25 Wegen um die Welt« an empfehlungen@piper.de, und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Mit 89 farbigen und einer Schwarz-Weiß-Abbildung sowie 27 Karten
Die im Buch dargestellten Erlebnisse, Dialoge und Personen basieren auf Erinnerungen und können von den Erinnerungen anderer Personen abweichen. Namen und Merkmale einzelner Personen wurden zum Schutz der Privatsphäre mitunter geändert.
Die Autorin lehnt Sponsoring für sich persönlich ab. Auswahl und Bewertung der vorgestellten Wege wurden daher nicht durch finanzielle Unterstützung oder Sachzuwendungen von Sponsoren beeinflusst.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildungen (von links oben nach rechts unten): Andrew Burns (Bild 6, 12), Peter von Felbert (Bild 2, 4, 10), Christian Biemann (Bild 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14 und hinten), Christine Thürmer (Bild 8, 11, 15)
Bildteilfotos: alle Fotos von Christine Thürmer, außer anders angegeben
Karten: Marlise Kunkel, München
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karte der Wanderwege (Europa)
Karte der Wanderwege (Nord- und Südamerika und Australien)
Wie es zu diesem Buch kam
Für Pilgeranfänger: Pilgerweg Berlin–Bad Wilsnack
Für Weintrinker: Welterbesteig Wachau
Für Entdecker des australischen Outbacks: Larapinta Trail
Für Esel- und Literaturliebhaber: GR70 Stevensonweg
Für Geschichtskenner und Weltkriegstouristen: GR14 Sentier de l’Ardenne
Für Englandfans und Zeichenfreunde: Wainwright’s Coast to Coast
Für Frühgeschichtler und Korngenießer: Hünenweg
Für Nordland- und Survivalfreaks: E1 Kautokeino–Nordkap
Für Skandinavisten: Südlicher Kungsleden
Für Moorenthusiasten: Oandu-Ikla-Trail
Für Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Ostpreußen: E11 durch Nordostpolen
Für Schweiz- und Bahnfans: Trans Swiss Trail
Für (seh-)behinderte und blinde Menschen: Camino Lituano
Für Griechenlandschwärmer und Strandliebhaber: E4 durch Kreta
Für Biertrinker: Frankenweg
Für Vulkanologen: GR131 über alle Kanarischen Inseln
Für Schafskäsegourmets: Bergwanderweg der Freundschaft Kom–Emine
Für fortgeschrittene Pilger: Franziskusweg
Für Wildwestromantiker: Oregon Desert Trail
Für Kakteenzüchter: Arizona Trail
Für Dracula-Begeisterte und Zeitreisende: Via Transilvanica
Für Reptilienfreunde: Florida Trail
Für Ostalgiker: Internationaler Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach–Budapest
Für Abenteurer: Greater Patagonian Trail
Für europäische Thruhiker: Sentiero Italia
Quellen und weiterführende Literatur
Bildimpressionen aus den Wanderungen
Pilgerweg Berlin – Bad Wilsnack
Welterbesteig Wachau
Larapinta Trail
GR70 Stevensonweg
GR14 Sentier de l‘Ardenne
Wainwright’s Coast to Coast
Hünenweg
E1 Kautokeino – Nordkap
Südlicher Kungsleden
Oandu - Ikla-Trail
E11 durch Nordostpolen
Trans Swiss Trail
Camino Lituano
Frankenweg
E4 durch Kreta
GR131 Kanarische Inseln
Bergwanderweg Kom – Emine
Franziskusweg
Oregon Desert Trail
Arizona Trail
Via Transilvanica
Florida Trail
Bergwanderweg Eisenach – Budapest
Greater Patagonian Trail
Sentiero Italia
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Karte der Wanderwege (Europa)
Karte der Wanderwege (Nord- und Südamerika und Australien)
Wie es zu diesem Buch kam
»Und jetzt, liebes Publikum, kommt der spannendste Teil des Abends!«, kündige ich im grellen Scheinwerferlicht auf der riesigen Bühne des Zürcher Volkshauses an. Über eine Stunde habe ich dem Publikum von meinem Weg zur meistgewanderten Frau der Welt erzählt, dabei meine Ausrüstung und meinen Alltag unterwegs beschrieben und vor allem erklärt, warum mich das auch nach mehr als 15 Jahren Outdoorleben immer noch begeistert. Jetzt sind die Fragen an der Reihe, die die Zuschauer in der Pause für mich aufgeschrieben haben. Ich lese den ersten Zettel vor: »Wie ist das mit Sex auf dem Trail?« Im Saal wird es schlagartig still.
Innerlich muss ich schmunzeln. Dieses Thema kommt auf meiner Vortragstour durch die Schweiz fast jeden Abend auf – zumindest, wenn die Fragen anonym gestellt werden können. Die Deutschen hingegen wollen eher wissen: »Zahlst du Steuern?« oder »Bist du sozialversichert?« (Die Antwort lautet in beiden Fällen »ja«.) In Österreich sorgt man sich vor allem um meine Gesundheit: »Leiden Sie unter Mangelerscheinungen?« oder »Bekommt man von der vielen Schokolade nicht Durchfall?« (Antwort jeweils »nein«.)
Nachdem ich mein Publikum über die Tücken des Liebeslebens unterwegs aufgeklärt habe, ziehe ich die nächste Frage aus der Tüte: »Was ist Ihr Lieblingsweg?« Ich lasse meine Outdoorlaufbahn vor meinem geistigen Auge Revue passieren, doch bei über 60 000 Wanderkilometern kann ich beim besten Willen keinen besten, schönsten oder liebsten Weg nennen. Stattdessen gibt es Spitzenreiter in unterschiedlichen Kategorien, was ich mit einem Beispiel erkläre: »Der abenteuerlichste Weg ist ganz bestimmt nicht der erholsamste und umgekehrt. Je nachdem, welche der beiden Eigenschaften mir gerade besonders wichtig ist, finde ich das anstrengende Wildnisabenteuer oder den technisch einfachen Wohlfühlweg besser. Oder anders ausgedrückt: Ein Weg, der mir in einer bestimmten Lebenslage besonders gefällt, kann in einer anderen zum Flop werden.«
Es folgt die Frage, die mir wirklich in jedem Land von jedem Publikum gestellt wird und die mich besonders freut – zeigt sie doch, dass die Menschen wanderbegeistert sind: »Welchen Weg können Sie denn empfehlen?« Das Scheinwerferlicht blendet mich so stark, dass ich im voll besetzten Saal nur die Zuschauer in den ersten Reihen erkennen kann: eine Gruppe Frauen im besten Alter, eine Familie mit halbwüchsigen Kindern, zwei junge Männer im Outdooroutfit. Sie befinden sich in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und bringen völlig verschiedene Erwartungen an eine Wanderung mit. Genau wie es für mich selbst keinen besten Weg gibt, kann ich auch keine pauschale Empfehlung für alle anderen geben.
Der Erfolg einer Wanderung hängt nämlich von zahlreichen individuellen Faktoren ab: dem finanziellen und zeitlichen Budget, den Komfortansprüchen, der Vorliebe für bestimmte Klimazonen oder der individuellen Wandererfahrung. Und je länger die Tour, umso mehr dieser Bedürfnisse und Voraussetzungen sollte sie erfüllen. Von den unzähligen Gesprächen am Signiertisch weiß ich allerdings, dass Wanderinteressierte vor allem zwei Ziele anstreben: einen spanischen Camino, »weil den doch so viele machen«, oder eine Alpenüberquerung »wegen der Landschaft«.
Natürlich kann man auch auf diesen beiden Trails sein Glück finden. Aber Popularität und spektakuläre Ausblicke sind nur zwei Faktoren von etlichen, und wenn der Rest nicht stimmt, können selbst beliebte Strecken zur Enttäuschung werden: Wer besinnliche Einsamkeit sucht, wird von den Pilgerscharen Richtung Santiago abgeschreckt, und für einen untrainierten Wanderanfänger kann eine Bergtour schnell zur Tortur werden.
Schwärmerische Berichte von Bekannten oder tolle Instagram-Fotos allein sind also keine guten Ratgeber. Wichtiger ist die Frage: Passt dieser Trail zu mir ganz persönlich? Aber kaum jemand hat die Zeit, das detailliert zu recherchieren. Oft lässt sich auch gar nicht erahnen, welche Abenteuer sich wo verbergen. Und so landen die meisten Wanderinteressierten doch wieder auf den populären Trails, die dadurch noch überlaufener werden. Oder sie bleiben im schlimmsten Fall einfach zu Hause. Dabei würde sich die Gruppe fünfzigjähriger Frauen auf einer neu entdeckten Pilgerroute bestimmt sehr wohlfühlen, für die Familie gäbe es einige kindertaugliche Strecken, und die beiden jungen Männer könnten sich auf herausfordernden Wildnistrails austoben.
Leider habe ich bei meinen Vorträgen nie genügend Zeit für eine ausgiebige und individuelle Antwort auf die Frage nach meiner Wanderempfehlung. Das soll sich mit diesem Buch ändern! In den folgenden Kapiteln erzähle ich Ihnen, was ich auf 25 eher unbekannten Wegen erlebt habe und worauf Sie sich beim Nachwandern freuen können. Alle Trails sind von mir begangen und so ausgewählt, dass jede Schwierigkeitsstufe, Jahreszeit, Länge, jedes Budget und zahlreiche Special Interests abgedeckt sind. Denn egal, wie fit oder erfahren Sie sind, ob Sie eine Woche oder ein Jahr unterwegs sein können oder welchem Hobby Sie dabei frönen wollen: Kein Weg passt für alle, aber ein Weg passt ganz bestimmt zu Ihnen!
Für Pilgeranfänger: Pilgerweg Berlin–Bad Wilsnack
Land: Deutschland | Länge: 120 kmSchwierigkeit: * | Budget: €€ | Jahreszeit: ganzjährigNatur: * | Kultur: ** | Special Interest: Schnupperpilgern
»Sie müssen auf dem Fußboden des Gemeindesaals schlafen, also bringen Sie besser eine Isomatte und einen Schlafsack mit!«, schnarrt die resolute Stimme von Schwester Anneliese aus meinem Handy. Ich zögere eine Sekunde, denn eigentlich will ich mit leichtem Gepäck, sprich ohne meine halbe Campingausrüstung, von einer Unterkunft zur nächsten pilgern. »Sie brauchen erst gar nicht woanders anfragen. Jetzt in der Hochsaison kommen Sie in Linum sowieso nur noch bei mir unter«, unterbricht die Diakonisse meine Überlegungen. »Okay, dann bis morgen«, reserviere ich die spartanische Schlafgelegenheit und frage mich beim Packen verwundert, warum ausgerechnet an einem stinknormalen Werktag mitten im trüben Spätherbst alles ausgebucht sein soll.
Bei meiner Ankunft in dem winzigen Dorf in der brandenburgischen Ostprignitz wird mir der Grund jedoch schlagartig klar: Hunderte von Kranichen ziehen in der Abenddämmerung majestätisch über den Himmel und jagen mir mit ihrem durchdringenden Trompeten eine Gänsehaut über den Rücken. Linum ist im Herbst der größte europäische Binnenrastplatz von Kranichen und Gänsen auf ihrem Weg nach Süden. Mitte Oktober werden hier bis zu 72 000 Kraniche gezählt – an einem einzigen Tag! Und die Vögel ziehen wiederum die 40 000 Touristen an, die den 750-Seelen-Ort jedes Jahr besuchen.
Ich pilgere aber nicht zu den Kranichen, sondern nach Bad Wilsnack, einem der populärsten Pilgerziele der westlichen Christenheit, ja sogar das wichtigste in ganz Nordeuropa! Zumindest war es das im Mittelalter. Aus aller Herren Länder strömten Hunderttausende zur Wunderblutkirche, bis der Ort mit der Reformation in Vergessenheit geriet. Erst vor wenigen Jahren hat ein Förderverein einen 120 Kilometer langen Abschnitt wiederbelebt und markiert. Auf der Website zum Weg gibt es einen Pilgerführer und ein Unterkunftsverzeichnis.
Der offizielle Startpunkt befindet sich im Zentrum meiner Wahlheimat Berlin, genauer gesagt an der mittelalterlichen Marienkirche am Alexanderplatz. Wie die meisten Pilger habe ich mir die zwanzig Kilometer lange innerstädtische Strecke gespart und bin mit der S25 bis zur Endhaltestelle in Hennigsdorf gefahren, wo die Großstadt fast übergangslos in die freie Landschaft Brandenburgs übergeht. Dort beginnt die Wegmarkierung mit den drei gelben Punkten, schon seit dem Mittelalter das Pilgerzeichen und bildliches Symbol des Blutwunders, das sich am 16. August 1383 zugetragen haben soll.
Während die Wilsnacker damals das Patronatsfest im benachbarten Havelberg feierten, zerstörte Ritter Heinrich Bülow den menschenleeren Ort und brannte sogar die Kirche bis auf die Grundmauern nieder. Dennoch befahl eine nächtliche Stimme dem wiedergekehrten Dorfpfarrer, in den Trümmern nach drei zurückgelassenen, geweihten Hostien zu suchen. Der Legende nach fand er sie nicht nur unversehrt inmitten von Schutt und Asche, sie hatten zudem noch je einen Blutstropfen ausgeschwitzt – was natürlich sofort einen Pilgerboom auslöste.
Obwohl viele kirchliche Stellen dieses Wunder schon damals skeptisch betrachteten, begann im folgenden Jahr der Bau einer großen Wallfahrtskirche, die aufgrund der stetig wachsenden Besucherzahlen ein Jahrhundert später erweitert wurde. Straftäter im Büßergewand kamen genauso nach Wilsnack wie betuchte Adlige zu Pferd, besonders begüterte Herrscher ließen gegen Bezahlung »fremdpilgern«. Ja, es kam sogar zu spontanen Massenwallfahrten, dem sogenannten Wilsnacklaufen, bei dem die halbe Einwohnerschaft ganzer Städte einfach alles stehen und liegen ließ, um zur Wunderblutkirche zu eilen.
Während ich im Nieselregen durch den einsamen Hennigsdorfer Forst nach Linum wandere, stelle ich mir die einstigen Wallfahrerströme ähnlich vor wie den aktuellen Andrang auf den spanischen Caminos. Bis zu 350 000 Pilger laufen jährlich nach Santiago, nach Wilsnack sind heutzutage nur etwa 1000 unterwegs – und an diesem regnerischen Herbsttag bin ich ganz allein.
Schwester Anneliese, deren fast schon biblisches Alter ich nicht zu schätzen wage, empfängt mich in der traditionellen schwarzen Tracht der Diakonissen einschließlich gestärkten Häubchens auf den weißen Haaren und eines riesigen Schlüsselbundes in der Hand. »Es ist noch gut geheizt im Gemeindesaal«, erklärt sie mir auf dem Weg zu meinem Nachtquartier. »Die Konfirmandengruppe ist gerade erst gegangen.« Nachdem ich es mir auf meiner Isomatte bequem gemacht habe, bringt sie mir eine evangelische Kirchenzeitung als Nachtlektüre vorbei und erzählt, warum Linum im Sommer die Störche und im Herbst die Kraniche anzieht: »Schon der Alte Fritz hat das Rhinluch, das Moorgebiet rund um den Ort, für den Torfabbau durch ein Grabensystem entwässern lassen. Später entstand auf den abgetorften Flächen eine riesige Teichlandschaft. Das knietiefe Wasser ist ein idealer Schlafplatz für die Vögel, die sich dann tagsüber auf den abgeernteten Feldern die nötigen Reserven für ihren Flug nach Süden anfressen.«
Nachdem sie sich verabschiedet hat, lege ich mich – nach 32 Kilometern rechtschaffen müde – schlafen und denke dabei noch an das berühmte Lied der bekanntesten Tochter Linums, der romantischen Dichterin Luise Hensel: »Müde bin ich, geh zur Ruh, / schließe meine Äuglein zu …« Gute Nacht!
Die Luchlandschaft der Prignitz ist brettflach, und durch die schnurgeraden Entwässerungskanäle zwischen den riesigen Feldern wirkt sie ziemlich geometrisch. Lediglich die Baum- und Heckenalleen an den Feldrainen und Gräben verhindern, dass man heute schon das Wanderziel von morgen sehen kann. Es ist fast totenstill, nur bei der Überquerung der Autobahn Hamburg–Berlin werde ich kurzzeitig daran erinnert, dass ich im 21. Jahrhundert unterwegs bin. Heinrich von Kleist nannte seine brandenburgische Heimat einen langweiligen Landstrich, bei dessen Erschaffung der liebe Gott offenbar eingeschlafen sei. Der 2020 verstorbene DDR-Schriftsteller Günter de Bruyn bringt es etwas positiver auf den Punkt. Das Besondere dieser Landschaft liege in dem, was ihr fehle: Menschen, Reize und Geräusche. Beim Wandern kann man hier nicht nur den Blick, sondern auch die Gedanken schweifen lassen, denn es gibt keinerlei technische Schwierigkeiten. Ohne nennenswerte Steigung spaziere ich über lehmige Wiesenwege, unbefestigte Forststraßen, Wirtschaftswege mit Betonplatten und manchmal verkehrsarme Nebenstraßen. Dieser Pilgerweg kann selbst von blutigen Anfängern begangen werden – und das zu jeder Jahreszeit.
Die kopfsteingepflasterten Chausseen und alten Feldsteinhäuser wirken wie aus der Zeit gefallen, sie gäben eine hervorragende Filmkulisse für einen Roman von Theodor Fontane ab. Bis auf ein paar ältere Herrschaften sind die Dörfer fast ausgestorben. Kein Wunder, hier gibt es außer ein paar landwirtschaftlichen Betrieben kaum Arbeitsplätze. Die Kirchen am Wegesrand sind zwar durchweg verschlossen, doch ist im Pilgerführer stets eine Telefonnummer oder Adresse angegeben, wo der Schlüssel abgeholt werden kann. Auch wenn es mich manchmal etwas Überwindung kostet, bei wildfremden Menschen zu klingeln, erwarten mich dabei die schönsten Erlebnisse. Manchmal wird mir der Schlüssel nur kurz angebunden herausgereicht: »Werfen Sie ihn einfach in den Briefkasten, wenn Sie fertig sind!« Doch der Brandenburger hat unter der harten Schale einen weichen Kern. Auf interessiertes Nachfragen bekomme ich meist eine persönliche Kirchenführung und eine kurze Dorfchronik obendrein. Von einer Schlüsselverwalterin werde ich angesichts der herbstlichen Temperaturen sogar mit heißem Tee und selbst gebackenen Plätzchen begrüßt!
Die kleinen Kirchen sind sicherlich keine kunsthistorische Weltklasse, warten für den neugierigen Besucher aber mit ein paar Überraschungen auf. In Tarnow steht ein anmutiger Schinkelbau, dessen Campanile man eher in der Toskana als in Brandenburg erwarten würde. In der unscheinbaren Dorfkirche von Protzen schwebt ein strahlender Barockengel über dem Taufbecken. Und in der mittelalterlichen Feldsteinkirche in Barsikow kann man seit 2012 sogar in zehn Stockbetten übernachten!
Als ich völlig durchgefroren ankomme, freue ich mich besonders über die heiße Dusche, die genauso ins Kirchengebäude integriert ist wie eine Kochnische mit Kühlschrank. »Gottesdienste finden nur noch zweimal im Monat statt«, erklärt mir Herr Grützmacher, der auf Anfrage sogar ein Frühstück serviert. Der Herbergsbetreuer steigt am nächsten Morgen mit mir in die luftigen Höhen des Kirchturms empor und zeigt mir die Pilgerzeichen an den Glocken, anhand derer die Route rekonstruiert wurde. Den Pilgersegen gibt er mir zurück auf festem Boden im Altarraum. Auch in der Kyritzer Marienkirche geht es hoch hinaus: Hier kann man in der ehemaligen Türmerwohnung übernachten.
In Barenthin kommt mir Frau Unger in der Abenddämmerung schon entgegengelaufen, denn ich bin spät dran und sie will noch mal weg. Schnell öffnet sie den Pfarrsaal und überlässt mir den riesigen Kirchenschlüssel. Nachdem ich das kleine Gotteshaus damit am nächsten Morgen besichtigt habe, treffe ich die Schlüsselverwalterin ganz zufällig auf der Straße wieder, mit einer riesigen Tüte Brötchen in der Hand.
Was nun mit einem fröhlichen »Guten Morgen!« meinerseits beginnt, endet in einem dreistündigen Gespräch über die Geschichte der DDR im Allgemeinen und des Ortes Barenthin im Speziellen. Wie ich nämlich sogleich erfahre, stehen wir vor dem ehemaligen Tante-Emma-Laden, in dem Frau Ungers Mutter die knapp 400 Einwohner seit 1949 mit Lebensmitteln versorgte. Mehr als fünfzig Jahre stand sie hinter dem Ladentisch, während Tochter Christa das Dorf verließ und Lehrerin für Mathematik und Physik wurde. Erst nach ihrer Pensionierung kehrte sie in ihre Heimat zurück und verwandelte das unrentabel gewordene Geschäft in eine »Klönstube« für die Nachbarschaft.
»Das ist jetzt zwar kein Laden mehr, aber immer noch eine Art Dienstleistungszentrale. Manchmal gebe ich dem Nachwuchs Nachhilfe, die Nachbarn treffen sich einmal im Monat zum Klönen und Spielen, und sie können auch Einkaufsbestellungen abgeben«, erklärt die ehemalige Lehrerin die Riesenmenge an Brötchen in ihrer Tüte. »Wollen Sie mal reinschauen?«
Und ob ich das will! In der Klönstube stehen Brettspiele für den Nachbarschaftstreff neben alten Registrierkassen, Waagen und Kassenbüchern aus dem früheren Lebensmittelgeschäft. Ich wundere mich über die vielen Fotografien an der Wand, auf denen ausschließlich Gebäude zu sehen sind. Frau Unger erläutert: »Für die 675-Jahr-Feier des Ortes habe ich alle Einwohner gebeten, mir Bilder ihrer Häuser zu schicken, von früher und von heute. Darauf habe ich dann die Daten zur Geschichte der einzelnen Anwesen vermerkt.«
Fasziniert betrachte ich die kleine Vorher-Nachher-Ausstellung und stelle Frage um Frage. Während Frau Unger geduldig antwortet, gerät mein Zeitplan für den Tag komplett aus den Fugen. Egal, es sind ja genau solche Gespräche, die diese Wanderung so interessant machen. Spannende Begegnungen sind fast vorprogrammiert, weil man täglich einem Herbergsbetreuer oder einer Schlüsselverwalterin begegnet. Und für die ist man nicht der hundertste Pilger, der pro Tag vorbeiläuft, sondern immer noch etwas Besonderes.
Neben den preiswerten Pilgerherbergen in Kirchen und Gemeindesälen wird die ganze Bandbreite touristischer Unterkünfte angeboten, vom Heuhotel über Ferienwohnungen bis zu Pensionen und Hotels, teilweise sogar mit Gepäcktransport. Was man in Brandenburg dagegen nicht an jeder Ecke findet, sind Bars mit Tapas oder menú del peregrino. Wenn es im Übernachtungsort keine Gaststätte gibt, muss man sich sein Abendessen eben selbst mitbringen. Dafür können Sie hier seit Neuestem sogar #Biopilgern! Unter diesem Hashtag haben sich 16 Hofläden, Bistros und Cafés zusammengeschlossen, die den Pilgern Wassernachschub und Bioproviant anbieten: Obst und Gemüse aus zertifizierter Landwirtschaft, Vollkornbrot, Biowurst und sogar Stutenmilch vom Pferdegestüt.
Als ich am vierten Tag meiner Wanderung in Bad Wilsnack ankomme, wirkt die riesige Wallfahrtskirche in dem unbedeutenden Städtchen komplett überdimensioniert. Das »Santiago des Nordens« erlebte im Zuge der Reformation einen jähen Absturz: Der neue protestantische Prediger des Ortes, Joachim Ellefeld, verbrannte die wundertätigen Hostien am 28. Mai 1552 und wurde dafür in der nahe gelegenen Plattenburg festgesetzt. Noch während die Obrigkeit über eine angemessene Strafe für seine Freveltat stritt und ihn letztendlich in die Verbannung schickte, ließ der Markgraf von Brandenburg alle Kunstschätze der Wunderblutkirche einschließlich Glocke nach Berlin schaffen. Sämtliche Hinweise auf das Blutwunder wurden getilgt, nur den bemalten Holzschrank, in dem die Hostien früher zur Anbetung ausgestellt waren, kann ich zusammen mit einer Ausstellung zur Geschichte des Wallfahrtsortes noch besichtigen.
Am Eingang der Kirche hole ich mir meinen letzten Stempel für den Pilgerpass und frage die Aufsicht, wer denn eigentlich so alles hierherkomme. »Deutlich mehr Frauen als Männer, viele sogar allein«, weiß die Dame durch die Auswertung von Pilgerfragebögen zu berichten und ergänzt stolz: »Die meisten würden sogar lieber ein zweites Mal nach Wilsnack pilgern als noch mal einen der spanischen Caminos laufen!« Das geht mir ganz genauso!
Bevor ich in den stündlichen Regionalexpress zurück nach Berlin steige, mache ich einen Abstecher zum zweiten Wunder von Wilsnack: 1906 entdeckte der Stadtförster Gustav Zimmermann eisenoxidhaltige Moorerde, was den Ort 1929 zur Kurstadt machte und ihm den Titel »Bad« einbrachte. In der Therme mit Saunalandschaft strecke ich meine müden Glieder ins solehaltige Heilwasser. Ein so würdiger Abschluss war den mittelalterlichen Pilgern wohl eher nicht vergönnt.
Für wen:
Für Weintrinker: Welterbesteig Wachau
Land: Österreich | Länge: 180 kmSchwierigkeit: * | Budget: €€ | Jahreszeit: ganzjährigNatur: ** | Kultur: *** | Special Interest: Wein und Brettljausen
Wer oder was zum Teufel sind die Welter, frage ich mich verwirrt, als ich zum ersten Mal vom österreichischen Welterbesteig lese. Spontan tippe ich auf ein alpenländisches Adelsgeschlecht oder einen ausgestorbenen Handwerksberuf. Angesichts der Vielzahl von Steigen, Pfaden und Traumschleifen in der deutschsprachigen Wanderwelt wundere ich mich auch nicht über den Begriff Besteig, sondern halte ihn für eine misslungene Marketingidee. Ein Bindestrich hätte meine Verwirrung verhindert: Hinter dem Namen Welterbe-Steig steckt nämlich die Aufnahme der niederösterreichischen Wachau in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten im Jahr 2000.
Der so geadelte Landstrich an der Donau ist zwischen den Orten Melk und Krems gerade mal 35 Kilometer lang. Der Welterbesteig, der als Rundweg auf beiden Seiten des Flusses verläuft, misst jedoch knapp 180 Kilometer. Ein Blick auf die Wanderkarte zeigt den Grund für diese wundersame Streckenvermehrung: Während der populäre Donauradweg gradlinig am Ufer entlangführt, schlägt der Welterbesteig in jeder Etappe gewaltige Schlaufen hinauf zu den Donauhängen und dann gleich wieder zurück ans Wasser. Wer bei diesem Flusswanderweg also eine gemütliche Tour ohne nennenswerte Steigungen erwartet, wird schnell eines Besseren belehrt. 7500 Höhenmeter sind insgesamt zu bewältigen, höchster Punkt ist mit 960 Metern der Jauerling, die größte Erhebung in der Wachau. Die schweißtreibenden Aufstiege werden allerdings mit traumhaften Ausblicken versüßt, die den Radlern am Ufer versagt bleiben.
Das Postkartenidyll der Wachau ist so kitschig-schön, dass mir schon auf der ersten Etappe fast die Augen schmerzen. Von den vielen Rastplätzen am Weg aus bewundere ich die akkurat gepflanzten Weinstöcke, die sich in perfekten geometrischen Linien schachbrettartig über die steilen Hänge erstrecken, dazwischen immer wieder Bildstöcke und farbenfroh blühende Rosensträucher. Unter mir liegen die engen Gassen der historischen Altstadt von Krems, am anderen Ufer thront hoch über dem Dunkelsteiner Wald das imposante Stift Göttweig, und auf dem Fluss ziehen schwer beladene Schubboote vorüber.
In diesem Wanderparadies quält mich zu Beginn allerdings eine ganz spezielle Frage: Wo soll ich in dieser intensiv genutzten Kulturlandschaft wild zelten? Die steilen Hänge sind zwar mit kunstvoll geschichteten Trockensteinmauern terrassiert und böten somit perfekte Lagerplätze zwischen den Weinstöcken, doch wären die Winzer sicher nicht begeistert, mich und mein Zelt morgens dort vorzufinden …
Während meiner einwöchigen Tour löst sich diese Sorge zum Glück schnell in Wohlgefallen auf, denn am Welterbesteig wechseln sich die unterschiedlichsten Landschaftsformen ab. Mich erwarten Weinberge, Obstgärten und wogende Getreidefelder, aber auch ausgedehnte Waldgebiete und schroffe Felsformationen, an denen ich sogar Kletterer beobachten kann; dazwischen immer wieder Rastplätze und Aussichtstürme mit Panoramablick. Mit ein wenig Geduld finde ich jede Nacht ein diskretes Plätzchen, wo mich morgens Vogelgezwitscher und kein aufgebrachter Winzer weckt. Nur einmal schreckt mich beim Abendessen eine unerklärliche Knallerei auf. Ein wild gewordener Jäger? Vogelschreck? Oder ein Feuerwerk für Touristen? Da dämmert mir, dass ich zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft unterwegs bin, und eine Internetrecherche bestätigt: Mit den Böllerschüssen wird ein Tor der österreichischen Mannschaft gefeiert.
Mit ausreichend Budget muss man natürlich nicht zelten. In der Wachau gibt es eine riesige Auswahl an Hotels, Pensionen und Privatzimmern. Der Donauradweg mit seinen jährlich über 600 000 Radlern sorgt dafür, dass Aufenthalte von bloß einer Nacht überhaupt kein Problem sind. Für Welterbesteig-Wanderer wird außerdem Gepäcktransport angeboten. Da zwischen Krems und Melk eine Buslinie im Stundentakt verkehrt und die beiden Donauufer zusätzlich zu den dortigen Brücken auch noch durch drei Fähren verbunden sind, kann man die Wanderung sogar etappenweise von einem Standquartier aus unternehmen.
Der Rundweg Welterbesteig überquert die Donau an seinem Scheitelpunkt auf der Staumauer des Wasserkraftwerks Melk. Hier verlaufen Wander- und Radroute für ein paar Hundert Meter gemeinsam, die Radreisenden passieren mich im Minutentakt. Doch kaum trennen sich die Wege wieder, bin ich stundenlang allein unterwegs. Im Gegensatz zu seinem deutschen Pendant, dem fast schon überlaufenen Rheinsteig, wird der als einer der »Best Trails of Austria« vermarktete Welterbesteig nämlich erstaunlich wenig begangen.
Dabei ist er nicht nur landschaftlich, sondern auch kulinarisch ein Juwel. Ich lasse morgens mein übliches Müsli im Zelt ausfallen und steuere stattdessen die nächste Bäckerei an für ein Nussbeugerl (Nusshörnchen) oder eine Topfengolatsche (Quarktasche). Für die berühmten Marillenknödel bin ich leider zu früh, im Juni sind die Aprikosen noch nicht reif. Dafür kann ich am Wegesrand ein paar saftige Kirschen schnabulieren, natürlich nur von herrenlosen Straßenbäumen. Ehrenwort!
Berühmt ist die Wachau allerdings für ihren Weißwein, vor allem für Riesling und Grünen Veltliner. Meist weisen Schilder an den Weinbergen auf die jeweilige Rebsorte und das Weingut hin. Manchmal sind sogar direkt am Weg Selbstbedienungskühlschränke mit Weinflaschen aufgestellt, bezahlt wird in eine »Kasse des Vertrauens«. Blöd nur, dass ich hier nicht am Abend, sondern meist zur Frühstückszeit vorbeikomme. Immerhin sind für diesen Fall Apfelschorle und Mineralwasser im Angebot.
Beim Heurigenbesuch habe ich anfangs ebenfalls das falsche Timing. Ich stoße zwar auf ein Dutzend »Buschenschenken«, doch die haben leider nicht ausgsteckt. Ein Buschen, also ein Büschel Zweige oder Reisig, zeigt an, ob die Schankwirtschaft geöffnet ist, und dabei wechseln sich die örtlichen Erzeugerbetriebe ab. Anschläge in den Ortschaften und der Heurigenkalender im Internet helfen bei der Planung. Mir weist erst an meinem letzten Wandertag ein Einheimischer den Weg zu einem ausgsteckten Heurigen mit passender Mittagsöffnungszeit und verhilft mir so zu einem kulinarischen Volltreffer. Buschenwirte dürfen ausschließlich selbst produzierten Wein und Most sowie kalte Speisen anbieten. Im Hof des Weingutes bestelle ich eine Winzerplatte und staune nicht schlecht, als die Wirtin einen Teller mit Bergen von Räucherschinken, Schweinebraten und Käse vor mich stellt. Die üppigen Portionen sind nicht nur ein Ausdruck österreichischer Gastfreundschaft, sondern außerdem umsatzfördernd. Das salzige Gselchte macht nämlich verdammt durstig! Als Durstlöscher bietet sich für Wanderer ein »Sommerspritzer« an. Dabei wird der Wein anders als beim normalen Gspritzten nicht zu gleichen Teilen mit Sodawasser gemischt, sondern im Verhältnis 1:3. Aber auch der hier produzierte Marillennektar schmeckt gspritzt hervorragend! Und wer das Weinangebot einmal zu stark in Anspruch genommen hat, dem sei versichert: Der Welterbesteig ist so gut mit dem weißen Logo markiert, dass man sich selbst im angeschickerten Zustand nicht verläuft …
Nachdem ich an einem besonders heißen Nachmittag schwitzend einen Berg hinaufgekeucht bin, leuchtet mir vor einem Haus am Ortseingang ein großer weißer Kühlschrank entgegen. Wahrscheinlich ein privater Weinverkauf, denke ich und will schon weiterlaufen. Da sticht mir ein aufgeklebter Zettel mit einem holprigen Reim ins Auge: »Lieber Wanderer, mach mal Rast und nimm dir, worauf du Lust hast!« Bin ich ausgerechnet im extrem touristischen Österreich auf kostenlose trail magic gestoßen? Neugierig öffne ich die Tür und starre ungläubig auf ein buntes Sortiment aus Softdrinks und süßen Snacks. Und es kommt noch besser: Im Gefrierfach erwarten mich gar mehrere Sorten Eis am Stiel! Wie hypnotisiert greife ich zu einer Flasche Apfelsaftschorle und leere sie mit langen Schlucken. Erst als mir das kühle Getränk die Kehle hinunterrinnt, bin ich sicher, dass ich keiner Fata Morgana aufgesessen bin. Vorsichtshalber esse ich aber noch ein Schokoladeneis … Bevor ich wieder aufbreche, nehme ich ein Weilchen auf der Bank im Schatten eines Nussbaums Platz und studiere das Gästebuch, das mitsamt Bleistift und einer Spendenbox im Kühlschrank ausliegt. »Hier muss ein Engel wohnen«, hat ein dankbarer Besucher am Vortag geschrieben. Ich muss schmunzeln, denn die US-amerikanischen Wanderer nennen solche hilfsbereiten Menschen am Wegesrand tatsächlich trail angels.
Neben all den landschaftlichen und kulinarischen Aspekten locken am Welterbesteig auch mehrere weltberühmte Sehenswürdigkeiten, allen voran Stift Melk, ein Barockjuwel von gigantischen Ausmaßen: Fast 500 Räume mit 1365 Fenstern werden von vier Hektar Dachfläche überwölbt, die Bibliothek beherbergt 100 000 Bücher aus mehreren Jahrhunderten. Eine halbe Million Gäste besuchen den Prunkbau an der Donau jährlich, für Wanderer gibt es sogar extragroße Schließfächer zur Aufbewahrung ihres Rucksacks.
Noch beeindruckender finde ich das etwas weniger bekannte Stift Göttweig, dessen Besuch ich mir durch einen steilen Anstieg auf den gleichnamigen Berg hart erarbeiten muss. Schweißgebadet oben angekommen, verschlägt mir die weitläufige Barockanlage den ohnehin schon kurzen Atem. Die imposante Kaiserstiege mit dem pompösen Deckenfresko wäre die Traumkulisse jeder festlichen Hochzeit; ich jedoch steige in verdreckten Wanderklamotten staunend die weißen Stufen ins Museum im Kaisertrakt hinauf.
Göttweig ist ein aktives Benediktinerkloster mit 37 Mönchen, Gäste können an drei täglichen Chorgebeten teilnehmen. Bei meinem Besuch am Sonntagabend erklingt die Vesper in der Stiftskirche sogar auf Latein. Anhand der ausliegenden Stundenbücher kann ich dem halbstündigen Choralgesang mit deutscher Übersetzung folgen und stelle voll Freude fest, dass vom großen Latinum meiner Schulzeit doch noch einiges hängen geblieben ist. Ich bedauere sehr, dass ich mir im Hoteltrakt des Klosters kein Zimmer mit Blick auf die Wachau reserviert habe, sondern jetzt am Abend weitere acht Kilometer bis zu meiner Unterkunft laufen muss.
Eine ganz andere, modernere Spiritualität erlebe ich im Kloster Maria Langegg, das sich an einer der vielen Schleifen des Welterbesteigs mitten im Dunkelsteinerwald befindet. Die Kirche »Maria, Heil der Kranken« war im 17. und 18. Jahrhundert eine der bedeutendsten Pestwallfahrten Österreichs und wird heute – ebenso wie die Stifte Melk und Göttweig – vom österreichischen Jakobsweg angesteuert, der allerdings deutlich geradliniger verläuft als meine Route. Für eine Nacht stehen hier günstige Zimmer für Pilger und Wanderer zur Verfügung.
»Besichtigung des Wallfahrtsmuseums möglich nach telefonischer Absprache«, lese ich auf einem Plakat an der Kirchenpforte. Doch als ich neugierig die angegebene Nummer anrufe, meldet sich die Mailbox. Enttäuscht stecke ich mein Handy gerade wieder in die Tasche, als ein Pater in weißer Kutte aus der Tür tritt. »Das Museum wird von Schwester Mirjam betreut. Falls ich sie im Kloster sehe, kann ich sie zu Ihnen schicken«, bietet er mir an, nachdem er von meinem Besuchswunsch gehört hat.
Tatsächlich treffe ich die schlanke Nonne schon zehn Minuten später am Museumseingang, wo sie trotz ihres bodenlangen Habits und Schleiers äußerst elegant unter der Verkaufstheke hindurchkrabbelt, um mir aus der Kasse Wechselgeld und Eintrittskarte zu geben. Mit meinen vom Wandern steifen Gliedern kann ich solche Akrobatik nur neidvoll bestaunen. »Ist das nun ein Mönchs- oder Nonnenkloster?«, frage ich die Schwester verwirrt, die genau wie der Pater in Weiß gekleidet ist.
»In Maria Langegg wohnen neben geweihten Brüdern und Schwestern auch mehrere Laien. Zu unserer erst 1973 gegründeten ›Gemeinschaft der Seligpreisungen‹ gehören sogar Ehepaare mit Kindern«, erklärt mir Schwester Mirjam und muss gleich noch ein paar Dutzend weitere Fragen zu ihrem ungewöhnlichen Orden beantworten.
»Besuchen Sie doch einfach unsere Mittagsmesse«, lädt sie mich ein, bevor sie mich schließlich in dem kleinen Wallfahrtsmuseum allein lässt. Neben der barocken Klosterbibliothek sind Ölgemälde des Kirchenstifters und Votivgaben aus mehreren Jahrhunderten zu besichtigen sowie eine Sammlung abgenutzter Krücken und sogar ein antiquierter Rollstuhl – zurückgelassen von den angeblich geheilten Kranken.
Obwohl ich schon jetzt deutlich hinter meinem Zeitplan herhinke, kehre ich beim Mittagsläuten in die Kirche zurück. Statt lateinischer Choräle werden zur Andacht moderne Lieder auf Deutsch, Englisch und Hebräisch gesungen, die Schwestern begleiten sie mit Gitarre und Bongo-Trommeln. Als ich tiefenentspannt wieder aufbreche, ist mir klar: Nicht nur landschaftlich und kulinarisch, sondern auch spirituell wird es auf dem Welterbesteig nie langweilig!
Für wen:
Für Entdecker des australischen Outbacks: Larapinta Trail
Land: Australien | Länge: 223 kmSchwierigkeit: *** | Budget: €€€ | Jahreszeit: WinterNatur: *** | Kultur: * | Special Interest: Outback
Als ich am frühen Morgen des 12. Juli am Stadtrand von Alice Springs meinen Daumen rausstrecke, ist es angenehm kühl, sogar ein paar Wolken zieren den ansonsten strahlend blauen Himmel. Jetzt in den Wintermonaten der südlichen Hemisphäre ist die beste Zeit für den Larapinta Trail im australischen Outback. Im Sommer liegt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur bei weit über vierzig Grad Celsius, selbst im Winter kann das Thermometer auf mehr als dreißig Grad steigen – und nachts bis auf den Gefrierpunkt fallen.
Die 223 Kilometer lange Strecke durch den West-MacDonnell-Nationalpark will ich in gut acht Tagen ohne Proviantnachschub schaffen, mein Rucksack, der vollgestopft mit Lebensmitteln neben mir auf der Straße steht, ist entsprechend schwer. Dieser ehrgeizige Zeitplan funktioniert allerdings nur, wenn ich möglichst schnell eine Mitfahrgelegenheit zum westlichen Terminus des Trails bekomme. Über die Touristenstraße Namatjira Drive ist er bloß 150 Kilometer vom östlichen Endpunkt in Alice Springs entfernt, doch leider sind kaum Fahrzeuge unterwegs. Seufzend trete ich von einem Fuß auf den anderen.
Endlich hält ein kleiner Mietwagen, eine Frau um die fünfzig kurbelt das Fenster herunter: »Du kannst bis zur Redbank Gorge mitfahren, aber ich will mir unterwegs alle Sehenswürdigkeiten anschauen!«
Ich steige ohne große Bedenken sofort ein, denn genau dort will ich hin, und das Besichtigungsprogramm der Dame kann ja wohl nicht allzu lange dauern. Denke ich … Eigentlich kann man die Fahrt in anderthalb Stunden bewältigen, wir brauchen mehr als sieben. Hier trinkt sie einen Kaffee, dort wartet sie auf das richtige Licht zum Fotografieren, am Standley Chasm nimmt sie sogar an einer geführten Tour teil – und ich damit zwangsweise auch. Normalerweise würde ich mich über dieses ausgiebige Sightseeing freuen, allerdings werde ich all diese Attraktionen ja noch einmal in umgekehrter Richtung besuchen! Vielleicht hätte ich doch den extrem teuren Shuttleservice buchen sollen, der Wanderer per Jeep direkt zu den Start- und Endpunkten der Etappen befördert …
Um vier Uhr nachmittags darf ich endlich an der Stichstraße zur Redbank Gorge aussteigen. Bis ich den offiziellen Campingplatz am westlichen Terminus zu Fuß erreiche, ist es 17 Uhr, ich habe also gerade mal eine Stunde bis Sonnenuntergang. Die erste Trailetappe ist ein mehrstündiger Abstecher auf den 1380 Meter hohen Mount Sonder, den vierthöchsten Berg des Northern Territory, benannt nach dem deutschen Botaniker Dr. Otto Wilhelm Sonder. Camping ist an dieser heiligen Stätte der Aborigines nicht erlaubt, es macht also keinen Sinn, jetzt noch aufzusteigen. Grummelnd schlage ich mein Lager auf dem Redbank-Gorge-Zeltplatz auf, der sich am südlichen Ufer des Davenport Creek befindet. Creek, zu Deutsch Bach, ist im australischen Outback ein irreführender Begriff: Die Flussbetten sind fast immer komplett ausgetrocknet, denn im heißen Zentralaustralien fällt weniger als 250 Millimeter Niederschlag pro Jahr. Dass der Bach im Moment knöcheltiefes Wasser führt, ist schon höchst ungewöhnlich.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Der El-Niño-Effekt, der mir zu Jahresbeginn Überschwemmungen auf dem Florida Trail und Rekordschneehöhen auf dem Arizona Trail bescherte, hat sich auf der Südhalbkugel zu seiner kalten Schwester La Niña gewandelt. Es wird ein Rekordjahr für Niederschläge in ganz Australien werden, im Norden des Kontinents sogar der nasseste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und die größte Sintflut wird in wenigen Stunden starten – auch wenn außer ein paar Wölkchen noch nichts darauf hindeutet.
Um 23 Uhr werde ich plötzlich von heftigen Böen geweckt. Ich reibe mir verwundert den Schlaf aus den Augen, als bereits die ersten dicken Regentropfen auf mein windumtostes Zelt platschen. Keine fünf Minuten später schüttet es wie aus Kübeln, unter meiner Isomatte bildet sich eine riesige Pfütze. Schlagartig bin ich hellwach, denn nun zählt jede Sekunde. In Windeseile verstaue ich meinen Schlafsack in seiner wasserdichten Hülle, raffe meine restliche Ausrüstung zusammen und flüchte unter den achteckigen Picknickpavillon. Hier kann ich mich auf einem langen Holztisch ausstrecken, während der Regen auf das Wellblechdach trommelt. Viel Schlaf bekomme ich bei dieser Weltuntergangsstimmung allerdings nicht mehr.
In der Dämmerung weicht meine Erleichterung über den trockenen Lagerplatz der Sorge um die nun anstehende Flussquerung. Als der Regen endlich aufhört und ich zum Ufer des Davenport Creek spaziere, traue ich meinen Augen nicht: Aus dem knöcheltiefen Bächlein ist ein reißender Strom geworden! Vorsichtig stecke ich meinen Trekkingstock in das tosende Wasser – und kann damit nicht einmal den Grund ertasten. Mitten im ausgetrockneten Outback stehe ich vor einem unpassierbaren Fluss. Trotz der Absurdität dieser Situation ist mir absolut nicht zum Lachen zumute.
Den ganzen Vormittag laufe ich stündlich zum Ufer, um den Wasserstand zu überprüfen, und jedes Mal ist der Pegel um einige Zentimeter gefallen. Bei meiner »Messung« um ein Uhr mittags entdecke ich einen Wanderer auf der anderen Seite, der eine passende Furtstelle sucht und im reißenden Strom immer wieder umdrehen muss. Ich folge seinen Versuchen angespannt und überlege fieberhaft, wie ich ihn bei einem Unfall von hier aus retten könnte. Erst nach anderthalb Stunden hat er es tatsächlich heil zu mir herübergeschafft.
»Kannst du ein Foto von mir und dem Fluss machen?«, ist seine erste Frage, denn selbst er als Einheimischer hat noch nie eine solche Sintflut erlebt. Nach einem kurzen Plausch gibt es auch für mich kein Halten mehr. Durch die Versuche meines Vorgängers kenne ich die beste Passage und erreiche daher schnell das andere Ufer.
Der Abstecher auf den Mount Sonder muss nun leider ausfallen, weil ich bereits jetzt einen ganzen Tag hinter Plan liege. Vom Hilltop Lookout im nächsten Wegabschnitt eröffnet sich mir jedoch ein grandioser Blick auf den lang gestreckten Berg mit Doppelgipfel, der wie der Kamm einer Echse emporragt. Für die Ureinwohner symbolisiert er eine schwangere Frau, die schlafend auf dem Rücken liegt. Ich verstehe nun außerdem, warum Australien der rote Kontinent genannt wird: So weit das Auge reicht, schimmert die Erde rötlich. Die im Boden enthaltenen stark eisenhaltigen Mineralien Bauxit und Laterit sind an der Luft zu rotem Rost oxidiert. Wie ein Schleier liegt darüber das Grau des überall sprießenden Spinifexgrases, seine scharfen Kanten zwingen mich trotz der Hitze in lange Hosen und Gamaschen. Gewaltige ghost gums und red gums, unterschiedliche Arten von Eukalyptusbäumen, lassen erahnen, wo zumindest temporär Flüsse verlaufen.
Albert Namatjira vom hiesigen Stamm der Arrernte hat die Landschaft der MacDonnell Ranges in über 2000 Aquarellen festgehalten. Sein Bild des Mount Sonder mit einem ghost gum ziert sogar eine australische Briefmarke, einige seiner Werke konnte ich in der Kunstgalerie von Alice Springs besichtigen. Namatjira, der heute als einer der bedeutendsten Künstler des Landes gilt, erhielt erst 1957 die vollwertige australische Staatsbürgerschaft – und das auch nur auf internationalen Druck. Die Ureinwohner wurden bis in die 1960er-Jahre lediglich als Mündel des Staates betrachtet und konnten weder Immobilien noch Alkohol erwerben oder das Wahlrecht ausüben. Ihre Kinder wurden ihnen systematisch weggenommen und bei Pflegefamilien oder in Missionsstationen für ein Leben als Farmarbeiter oder Haushaltshilfe ausgebildet, die stolen generation.
Heute stellen die Nachkommen der Aborigines nur noch gut drei Prozent der Gesamtbevölkerung des Kontinents, hier im Bundesstaat Northern Territory ist es jedoch fast ein Drittel. Sie wohnen meist in abgeschlossenen Gemeinschaften im Outback oder in Siedlungen am Rand von Alice Springs und haben eine deutlich höhere Selbstmordrate und niedrigere Lebenserwartung als die restliche Bevölkerung. Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie die damit verbundene Kriminalität sind ein riesiges Problem, viele junge Aborigines entfliehen dem selbst auferlegten Alkoholverbot in ihren Communitys, um sich in der Outback-»Metropole« Alice Springs zu betrinken. Auf dem Trail hingegen treffe ich keinen von ihnen.
Wie schwer das traditionelle Leben der Ureinwohner gewesen sein muss, erahne ich am nächsten Tag: Die rote Erde ist durch die Hitze so verhärtet, dass die gewaltige Niederschlagsmenge nicht versickern kann. »Alle Flussbetten sind normalerweise trocken«, heißt es in meinem Wanderführer, worüber ich in diesem Jahr nur lachen kann. Jeder noch so kleine Bachlauf führt im Moment Wasser, ich muss mehr Furten bewältigen als in Skandinavien – und verfehle mal wieder mein geplantes Pensum!
Der Finke River, in der Sprache der Ureinwohner »Larapinta« genannt und damit Namensgeber des Trails, hat zwar keine Strömung, doch wo immer ich hineinsteige, reicht mir das Wasser schon nach wenigen Metern bis zur Hüfte. Natürlich könnte ich das ruhige Gewässer einfach durchschwimmen, aber wie soll ich dabei meinen Rucksack trocken ans andere Ufer befördern? Meine Isomatte als Schwimmunterlage verwenden? Oder ihn lieber in einen Müllsack verpacken und hoffen, dass er dadurch ausreichenden Auftrieb bekommt?
Für einen letzten Versuch ohne Schwimmhilfe entkleide ich mich komplett und balanciere meinen Rucksack auf dem Kopf, was angesichts der großen Menge Proviant gar nicht so einfach ist. Mit jedem kleinen Schritt versinke ich tiefer, bis mir das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Halse steht. Ich muss mich schließlich sogar auf Zehenspitzen fortbewegen und kann trotzdem nicht mal mehr den Mund aufmachen, ohne dass mir die dunkelbraune Brühe hineinläuft. Das ist mit Abstand die tiefste Furt meiner gesamten Outdoorlaufbahn!
Leider werde ich mit wachsender Routine nachlässig und vergesse bei der x-ten Flussquerung das Handy in der Hosentasche. Während meine Klamotten anschließend in der Sonne schnell wieder trocknen, haucht mein Telefon – und damit auch meine Kamera – nach dem ungeplanten Bad mit einem letzten Pieps seinen Geist aus. Immerhin haben die gespeicherten Bilder überlebt, sodass ich der trödelnden Touristin nun unendlich dankbar bin, dass sie mich auf der Hinfahrt bereits ausgiebig abgelichtet hat. Glücklicherweise habe ich für die Navigation noch mein GPS-Gerät und ein Set Papierkarten.
Die Gebirgskette der MacDonnell Ranges ist über 300 Millionen Jahre alt. Durch Faltungen, Brüche und Erosion entstanden spektakuläre Schluchten wie die Ormiston und Serpentine Gorges oder das Ellery Creek Big Hole. Hier findet man zu jeder Jahreszeit ein Wasserloch, für die Aborigines sind es heilige Stätten. Die Kluft des Standley Chasm ist sogar nur drei Meter breit, die Felswände ragen achtzig Meter empor! Bei geführten Touren erklären die Arrernte sowohl Geologie, Flora und Fauna als auch traditionelle Nahrung und Medizin. Kunstinteressierte können einen Workshop in der Punktmalerei der Aborigines buchen. Mein persönlicher Favorit sind jedoch die Ochre Pits, wo das weiche Gestein in allen Ockertönen von Dunkelrot bis Gold schimmert. Früher haben die Arrernte diesen Ocker zerstoßen und mit Emufett vermischt, um sich bei Zeremonien damit zu bemalen.
An diesen Touristenattraktionen, die vom Namatjira Drive aus einfach zu erreichen sind, tummeln sich die Ausflügler, entsprechend gut ist die Infrastruktur mit Rastplätzen und Informationstafeln. Auf dem Trail selbst ist von der Touristenstraße allerdings nichts zu sehen oder zu hören, andere Wanderer treffe ich wetterbedingt kaum, außer einem australischen Freundespaar.
»Mir geht bald das Essen aus, weil ich nur so langsam vorankomme«, jammere ich den beiden vor, die für die Anfahrt zum Trail einen Shuttleanbieter genutzt haben.
»Dann schau doch mal in die Aufbewahrungsboxen an den Rastplätzen. Auf der Hinfahrt haben wir dort unsere Proviantdepots angelegt und gesehen, dass andere Wanderer überschüssige Lebensmittel zurückgelassen haben«, präsentieren sie mir die Lösung meines Problems. Und tatsächlich: Am nächsten Picknickplatz entdecke in einer der Metallkisten zwei zurückgelassene Packungen Nudelsuppe, eine Dose Erdnussbutter und eine Tüte getrocknete Mangos – genug Verpflegung für einen weiteren Tag.
Entgegen meiner sonstigen Angewohnheit habe ich auf dieser Tour keine Schokolade dabei, sondern löffle Nuss-Nugat-Creme aus einem Plastikbehälter, denn der kann selbst bei Hitze nicht auslaufen. Etwas schuldbewusst denke ich dabei an die Aussage des Aborigine-Führers am Standley Chasm: »Die Ureinwohner Australiens haben früher pro Jahr nur so viel Zucker zu sich genommen, wie sich heute in einem einzigen Schokoriegel befindet.« Kein Wunder, dass sie ein vierfach höheres Diabetesrisiko haben als die übrigen Australier. Ihr traditioneller süßer Snack sind die sogenannten Honigtopfameisen – man muss ihnen allerdings den mit Nahrung angeschwollenen Hinterleib einzeln abbeißen.
Aufgrund der anfänglichen Sintflut finde ich auf dem Larapinta Trail mehr Wasser, als mir lieb ist, aber auch in normalen Jahren kann man sich problemlos aus den Tanks der offiziellen Campingplätze mit Schutzhütten versorgen. Deren Nutzung ist mittlerweile gebührenpflichtig, während Wildzelten weiterhin fast überall erlaubt und kostenlos ist. Aufgrund des steinharten oder gar felsigen Bodens hätte ich dazu allerdings besser ein frei stehendes Zelt mitgebracht.
Selbst ohne die ständigen Furten ist der Weg technisch nicht ganz einfach. Mein Wanderführer teilt die Etappen in vier Schwierigkeitsgrade ein, die ich folgendermaßen beschreiben würde:
Sehr schwer: Es gibt weder Weg noch Markierungen, und das ist auch gar nicht nötig. Entweder folgt die Route kilometerlang einem schmalen Berggrat mit so treffenden Namen wie Razorback Ridge, also Rasiermesser-Grat. Oder einem steinigen Flussbett, das teilweise metertief unter Wasser steht und zusätzlich mit ein paar trockenen Wasserfällen garniert ist, die mit Händen und Füßen erklettert werden müssen.
Schwer: Ist eigentlich genauso anstrengend wie »sehr schwer«, allerdings kann man hier stellenweise eine Art Trail und ein paar Steinmännchen ausmachen. Immerhin ist das Wasser in den Flussbetten bloß hüfthoch …
Mittel: Hurra, ein erkennbarer Weg! Doch leider trifft das nur auf ein Drittel der Strecke zu.
Leicht: Lediglich zwölf Kilometer, also fünf Prozent der Route, sind so kategorisiert und daher nicht der Rede wert …
Als ich am westlichen Endpunkt des Trails bei Alice Springs ankomme, habe ich nur noch eine Handvoll Nüsse. Das kleine Museum an der alten Telegrafenstation besichtige ich wegen meines knurrenden Magens in Rekordzeit. Dieser Ort liegt im wahrsten Sinne in the middle of nowhere oder genauer gesagt genau in der Mitte zwischen den australischen Städten Darwin und Adelaide, beide jeweils etwa 1300 Kilometer entfernt. Um diese Küstenorte miteinander und mit dem Mutterland Großbritannien zu verbinden, wurde 1872 die Transaustralische Telegrafenleitung eingeweiht. Da die elektrische Spannung für die Überbrückung dieser gewaltigen Distanz nicht ausreichte, baute man im Abstand von gut hundert Kilometern Relaisstationen wie Alice Springs. Obwohl eine englische Expedition das Landesinnere gerade mal zehn Jahre zuvor erstmalig durchquert hatte, betrug die Bauzeit in dem unerforschten Gelände nur zwei Jahre. Eine Nachricht von Australien nach London erreichte ihr Ziel nun in fünf Stunden, statt mit dem Schiff drei bis vier Monate unterwegs zu sein!
Der Weg bis zum nächsten Supermarkt führt mich am Todd River beziehungsweise an seinem sandigen Bett entlang. Jedes Jahr im September findet hier eine weltweit einzigartige Regatta statt: Die Boote der Teilnehmer haben keinen Boden und werden getragen statt gerudert. Daher muss es als einziges Bootsrennen abgesagt werden, wenn der Fluss doch einmal Wasser führt. Zuletzt passierte das 1993, aber angesichts der derzeit heftigen Regenfälle frage ich mich, ob die Regatta wohl auch in dieser Saison im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen wird …
Für wen:
Für Esel- und Literaturliebhaber: GR70 Stevensonweg
Land: Frankreich | Länge: 275 kmSchwierigkeit: * | Budget: €€ | Jahreszeit: Frühjahr bis HerbstNatur: ** | Kultur: ** | Special Interest: Wandern mit Esel und literarischer Begleitung
Robert Louis Stevenson war ein schillernder Charakter. Wohl jeder kennt seinen Jugendbuchklassiker »Die Schatzinsel« oder den Schauerroman »Dr. Jekyll und Mr. Hyde«. Dabei war der hochgewachsene Schotte auch ein exzellenter Reiseschriftsteller und begeisterter Outdoorer. Schon im viktorianischen Zeitalter, als kaum jemand rein zum Vergnügen durch die Natur spazierte, unternahm er ausgedehnte Kanutouren und Wanderungen in der ganzen Welt. Dass ausgerechnet in Südfrankreich ein Wanderweg nach ihm benannt wurde, hat vor allem mit Liebeskummer zu tun. Und das kam so:
Stevenson wurde 1850 als Kind wohlhabender und streng religiöser Eltern in Edinburgh geboren. Der Vater war Ingenieur und Leuchtturmbauer, die Mutter litt genau wie ihr Sohn lebenslang an Atemwegserkrankungen. Schon in seiner Kindheit schrieb der hagere Junge Essays und Geschichten, doch sein Vater erlaubte eine Schriftstellerkarriere nur unter einer Bedingung: Robert sollte erst einen Universitätsabschluss machen. Wegen seiner schwächlichen Konstitution entschied sich Stevenson nicht wie sein Vater für das Ingenieurwesen, sondern für die Rechtswissenschaften und ließ es während des Studiums ordentlich krachen. Sein Markenzeichen wurde eine blaue Samtjacke, er trug lange Haare und einen auffallenden Schnurrbart. In den Debattierclubs der Universität war der Bohemien genauso zu Gast wie in den Kneipen der Stadt, er rauchte heimlich Haschisch und bändelte mit den Damen des Amüsierviertels an.
1875 bestand er trotzdem die juristische Abschlussprüfung und hatte damit formal den Willen des Vaters erfüllt. Als Anwalt wollte er aber keinesfalls arbeiten, er stürzte sich stattdessen – weiterhin auf Papas Kosten – in ein Leben aus Reisen, Schreiben und Literaturstudien. »Ich für meinen Teil reise nicht, um irgendwo hinzufahren, sondern um zu fahren. Ich reise um des Reisens willen.« Mit diesem Motto wanderte er durch Schottland, paddelte durch Belgien und lebte in einer französischen Künstlerkolonie – wo er seiner großen Liebe begegnete.
Die Amerikanerin Fanny Osbourne war zur Vertiefung ihrer Malkenntnisse mit ihrer 18-jährigen Tochter Belle und ihrem achtjährigen Sohn Lloyd nach Frankreich gekommen. Die eigenwillige Schönheit war nicht nur zehn Jahre älter als der aufstrebende Schriftsteller, vor allem war sie auch verheiratet. Das hinderte die beiden allerdings nicht, ein Paar zu werden. Stevenson träumte schon von Heirat, doch Fanny kehrte abrupt in die Vereinigten Staaten zurück.
Der sitzen gelassene Schriftsteller zog sich nun in die Cevennen zurück, den dünn besiedelten südöstlichsten Teil des französischen Zentralmassivs. Nachdem er in dem kleinen Ort Le Monastier-sur-Gazeille einen Monat lang seine Wunden geleckt hatte, brach er am 22. September 1878 zu einer gut 200 Kilometer langen Wanderung auf – zusammen mit einem Esel. Das ein Jahr später erschienene Buch »Reise mit dem Esel durch die Cevennen« ist ein höchst eloquenter Bericht dieser Tour, und die darin exakt beschriebene Route wurde zur Grundlage des Weitwanderwegs GR70, der zu Ehren des Autors auch Stevensonweg genannt wird.
Als ich diesen Trail weit über ein Jahrhundert später bewandere, bin ich im Gegensatz zu Stevenson mit meiner gerade mal fünf Kilogramm schweren Ultraleichtausrüstung unterwegs. Doch im 19. Jahrhundert gab es noch keine Outdoorläden für Campingausrüstung, deshalb entwarf der frühe MYOG-Bastler seinen Schlafsack einfach selbst: »Dieses Kind meiner Erfindung maß nahezu sechs Quadratfuß, ungerechnet zwei dreieckige Klappen, die nachts als Kopfkissen dienen sollten; (…) eine Art lange Rolle oder Wurst, grünes wasserdichtes Segeltuch außen und blaues Schaffell innen.« Vor Regen wollte er sich mit einer Art Tarp schützen, aus »meinem wasserdichten Mantel, drei Steinen und einem gebogenen Ast«.
Als moderne Wanderin ziehe ich vor solchem Einfallsreichtum meinen Hut: Make your own gear par excellence! Doch während mein Schlafsack nicht einmal ein Kilogramm wiegt, konnte Stevenson seine voluminöse »Schlafwurst« nicht mal allein tragen. Also musste ein Lasttier her, und zwar »etwas Billiges, Kleines und Zähes mit einem unerschütterlichen und friedlichen Gemüt«. Und hier kommt nun die zweite Heldin des Buchs ins Spiel, die Eselin Modestine, »nicht viel größer als ein Hund, mausgrau, mit freundlichen Augen und einem energischen Unterkiefer«. Der Autor erstand sie auf dem Marktplatz für 65 Francs und ein Glas Brandy, sein Schlafsack hatte ihn bereits achtzig Francs und zwei Bier gekostet.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: