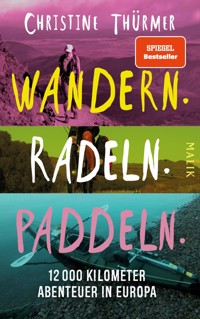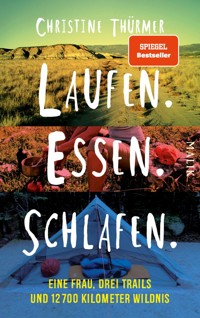
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Abenteuer Langstreckenwandern – 12.700 Kilometer zu Fuß Sie ist weiter gewandert als Hape Kerkeling und Cheryl Strayed zusammen. Unter ihrem Nickname German Tourist gilt Christine Thürmer als Legende auf dem Hiking Trail. Dies ist ihre Story. Beim Weitwandern nach dem Ultraleicht-Prinzip ist jeder Mensch auf sich gestellt. Vor allem, wenn es über die berühmtesten Wanderwege der USA geht. Der Pacific Crest Trail, der Appalachian Trail und der Continental Divide Trail führen mitten durch die Wildnis, in der nichts für Ablenkung von den eigenen Gedanken sorgt. Genau das fasziniert - an Christine Thürmers »Laufen. Essen. Schlafen.«: Der SPIEGEL-Bestseller ist gleichzeitig Reisebericht, Mutmacher und inspirierender Einblick in den Alltag einer Frau, die zu den meistgewanderten Menschen der Welt gehört und ihre berufliche Karriere gegen ein Leben auf dem Trail getauscht hat. Eine Frau beim Wandern auf Sinnsuche Vor ihrem ersten Wanderschritt war Christine Thürmer vollkommen unsportlich und nur auf ihren Alltag fixiert. Nach ihrem ersten Solotrip hatte sich alles verändert. Was Erfolgsbücher wie »Wild« als einmaligen Trip zu neuer Gelassenheit beschreiben, wird in »Laufen. Essen. Schlafen.« zur allumfassenden Lebensphilosophie, von der sich jede/r Frau- animieren lassen kann – ob mit oder ohne Wanderstiefel. Camping. Minimalismus. Jeder Tag ein Neuanfang. »Wie sie insgesamt 12 700 Kilometer zu Fuß zurücklegt und dabei Wind und Wetter, Moskitos und Bären trotzt, ist ein Abenteuer, dem man gerne folgt.« – Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
ISBN 978-3-492-97383-0April 2016© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.deCovermotiv: privat (oben und unten), iStock (Mitte) Fotos: Christine Thürmer, mit Ausnahme dieses Fotos im Bildteil: ToekDatenkonvertierung: Uhl + Massopust, Aalen
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Übersichtskarte: Triple Crown
Der Pacific Crest Trail
21. April 2004 – Mexikanische Grenze, CA
Juli 2003, zehn Monate vor dem PCT – Tuolumne Meadows Campground, Yosemite National Park, CA
19. Dezember 2003, vier Monate vor dem PCT – Berlin
Januar 2004, drei Monate vor dem PCT – Berlin
Januar bis April 2004 – Vorbereitung auf den PCT
16. April 2004 – Abflug in die USA
24. April 2004 – Lake Morena Campground, CA
28. April 2004 – Warner Springs, CA
11. Mai 2004 – Deep Creek Hot Springs, CA
13. Mai 2004 – Cajon Pass/Interstate 15, CA
20. bis 23. Mai 2004 – Agua Dulce und Green Valley, CA
23. Mai bis 3. Juni 2004 – Mojave-Wüste bis Sierra Nevada, CA
3. Juni 2004 – Kennedy Meadows Campground, CA
7. Juni 2004 – Mount Whitney, CA
8. Juni 2004 – Forester Pass, CA
9. Juni 2004 Independence, CA
23. Juni 2004 – Tuolumne Meadows Campground, CA
29. Juni 2004 – Vor South Lake Tahoe, CA
22. Juli 2004 – Dunsmuir, CA
1. August 2004 – Grenze zwischen Kalifornien und Oregon, CA/OR
3. August 2004 – Ashland, OR
24. August 2004 – Timberline Lodge, OR
26. bis 28. August 2004 – Cascade Locks, OR
13. September 2004 Skykomish, WA
20. bis 21. September 2004 – Pasayten Wilderness, WA
22. September 2004 – Pasayten Wilderness, WA
10. Oktober 2004 – Rückflug nach Deutschland
Der Continental Divide Trail
November 2004 – Berlin
Juli 2005 – Berlin
Dezember 2005 – Berlin
April 2007, zwei Monate vor dem CDT – Berlin
12. Juni 2007 – East Glacier, Glacier National Park, MT
13. Juni 2007 – Amerikanisch-kanadische Grenze, Glacier National Park, MT
14. bis 18. Juni 2007 – Glacier National Park, MT
6. bis 7. Juli 2007 – Anaconda, MT
9. Juli 2007 – Warren Lake, Anaconda-Pintler Wilderness, MT
19. bis 20. Juli 2007 – Leadore, Bitterroot Range, ID
23. Juli 2007 – Grenze zwischen Montana und Idaho nahe Deadman Lake, MT/ID
5. August 2007 – Dubois, WY
11. bis 14. August 2007 – Knapsack Col, Wind River Range, WY
15. bis 19. August 2007 – Great Divide Basin, WY
5. bis 6. September 2007 – Vasquez Peak Wilderness, CO
20. bis 30. September 2007 – San Juan Mountains, CO
1. bis 2. Oktober 2007 – Chama, NM
20. Oktober 2007 – El Malpais National Monument, NM
23. Oktober 2007 – Pie Town, NM
29. Oktober bis 5. November 2007 – Gila River und Silver City, NM
9. November 2007 – Hachita, NM
11. bis 13. November 2007 – Crazy Cook und Antelope Wells, amerikanisch-mexikanische Grenze, NM
Der Appalachian Trail
Dezember 2007 – Berlin
31. März 2008 – Berlin
16. Juni 2008 – Millinocket, ME
17. bis 18. Juni 2008 – Baxter State Park, ME
9. Juli 2008 – Mahoosuc Notch, ME
12. bis 13. Juli 2008 – Gorham, NH
24. bis 26. Juli 2008 – Montpelier, VT
28. bis 29. Juli 2008 – Rutland, VT
20. August 2008 – Unionville, NY
23. August 2008 – Auf einem Hügel vor Wind Gap, PA
5. bis 7. September 2008 – Fayetteville, PA
16. September 2008 – Shenandoah National Park, VA
10. bis 12. Oktober 2008 – The Gathering, Athens, WV
20. bis 21. Oktober 2008 – Cherokee National Forest, TN
24. Oktober 2008 – Allen Gap, TN
4. November 2008 – Nantahala Outdoor Center, NC
13. bis 14. November 2008 – Springer Mountain, GA
Epilog
Anmerkungen
Bildteil
Pacific Crest Trail
Continental Divide Trail
Appalachian Trail
Weitere Wanderimpressionen
Der Pacific Crest Trail
Beschreibung: Der Trail folgt der Sierra Nevada und dem Kaskadengebirge im Westen der USA von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze
Länge: 4277 Kilometer
Höhenmeter: 149000
Höchster Punkt: Forester Pass, Sierra Nevada, auf 4009 Metern
Niedrigster Punkt: Cascade Locks am Columbia River auf 43 Metern
Bundesstaaten: Kalifornien, Oregon, Washington
Südlicher Endpunkt: Campo, Kalifornien
Nördlicher Endpunkt: Manning Provincial Park, British Columbia
Webseite:www.pcta.org
21. April 2004Mexikanische Grenze, CA
Trailkilometer 0
Es ist stockdunkel draußen, ich bin nervös, und mir ist schlecht. Ich sitze in einem Pick-up und bin auf dem Weg von San Diego zur mexikanischen Grenze. Im Scheinwerferlicht des Wagens erkenne ich staubige Sträucher und Büsche. In der Ferne tauchen ein paar Cholla-Kakteen auf. Von San Diego, im Süden von Kalifornien, bis nach Campo sind es knapp achtzig Kilometer auf Asphalt. Von dort rumpeln wir die letzten Kilometer bis zum Grenzzaun auf einem unbefestigten und mit Schlaglöchern übersäten Feldweg entlang. Unser Ziel ist der südliche Terminus des Pacific Crest Trails, eines Wanderweges, der auf 4277 Kilometern von Mexiko nach Kanada führt.
Zusammengepfercht belege ich mit zwei anderen Langstreckenwanderern die Rückbank und werde bei jedem Schlagloch gegen einen meiner Sitznachbarn geworfen. Die staubige, trockene Luft kratzt mir im Hals, und das Gerüttel schlägt mir zusätzlich auf meinen ohnehin schon flauen Magen. Nach einer für mich sehr unruhigen Nacht sind wir bereits um 4.30 Uhr in San Diego losgefahren – ohne Frühstück.
Am Steuer unseres Wagens sitzt Robert Riess. Er ist Lehrer in San Diego, und in seiner Freizeit hilft er den Wanderern auf ihrem Weg von Mexiko nach Kanada. Heute bietet er uns einen »Shuttle-Service« zum Startpunkt des Weges an der mexikanischen Grenze. Meine Wanderkollegen könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf dem Beifahrersitz vor mir sitzt John aus England, ein hemmungsloser Raucher. Er wirkt alles andere als sportlich und bringt mindestens zehn Kilogramm Übergewicht auf die Waage. Ganz offensichtlich hat er sich seit seinem Abflug aus London auch nicht mehr rasiert. Die beiden amerikanischen College-Kids Matt und Ben auf der Rückbank neben mir scheinen dagegen dem Magazin Men's Health entsprungen zu sein. Sie sind muskulös, haben kein Gramm Fett am Körper und sind braun gebrannt wie kalifornische Surferboys.
Wir alle wollen von Mexiko nach Kanada wandern. Erst gestern haben wir uns bei Robert kennengelernt. Oder besser gesagt an Roberts Swimmingpool, neben dem wir unser Iso-matten-Camp aufschlagen durften. Dank dieses Open-Air-Lagers konnte ich nachts den Sternenhimmel betrachten, während ich verzweifelt versuchte, etwas Schlaf zu finden.
Robert spürt meine Anspannung, und als er mein blasses Gesicht sieht, versucht er, mich zu beruhigen: »Mach dir keine Sorgen! Du hast nur Panik vor dem Trail. Das legt sich bald. Spätestens wenn du die ersten Schritte gegangen bist.«
»Im Moment habe ich das Gefühl, dass die ganze Idee mit dem Trail einfach nur bescheuert ist. Ich habe realistischerweise doch keine Chance, es von Mexiko nach Kanada zu schaffen – ich hab ja kein bisschen trainiert für den Trail«, jammere ich und bemühe mich, tief in den Bauch zu atmen, um meiner Übelkeit Herr zu werden.
Robert fährt Slalom um zwei weitere große Schlaglöcher und versucht, mich auf seine Art zu trösten: »Seit fünf Jahren fahre ich Wanderer auf den Trail. Nur ein Drittel der Leute, die hier starten, wird jemals in Kanada ankommen. Aber gerade du hast statistisch gesehen die größte Chance, es bis dorthin zu schaffen: Du bist eine Frau, und du bist allein. Solo-Frauen sind am besten vorbereitet, und vor allem müssen sie niemandem etwas beweisen.«
»Frauen sollen die besseren Langstreckenwanderer sein?«, entfährt es John ungläubig, während er fröstelnd die Heizung noch ein bisschen höher dreht. Draußen hat es jetzt kurz vor Sonnenaufgang gerade mal vier Grad Celsius. Erst tagsüber wird das Thermometer hier sicherlich auf dreißig Grad Celsius klettern.
»Die meisten Männer laufen den Trail, um sich selbst und vor allem ihrer Umgebung etwas zu beweisen. Sie wollen immer mit den anderen mithalten oder am besten noch schneller sein und hören dabei nicht auf die Signale ihres Körpers. Sie laufen zu schnell und zu viel – und müssen dann verletzungsbedingt frühzeitig abbrechen. Frauen hören auf die Signale und haben eine deutlich niedrigere Verletzungsquote«, erklärt Robert und scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein.
Darauf herrscht erstauntes Schweigen im Wagen. Wir alle müssen Roberts Ansage erst einmal verdauen. Ich nehme noch ein paar tiefe Atemzüge.
Mit einem Blick auf Matt und Ben legt Robert noch eine Schippe drauf: »Der Erfolg auf dem Trail hängt zu achtzig Prozent von mentalen Faktoren ab und nur zu zwanzig Prozent von deinem körperlichen Zustand. Eine Strecke von über 4000 Kilometern musst du vor allem mit dem Kopf bewältigen – der Körper zieht dann schon nach.«
Ich merke, wie sich mein Magen etwas entspannt. Ein Fahrzeug kommt uns aus der Dunkelheit entgegen: U.S. Border Patrol. Robert hebt grüßend die Hand und lässt den Wagen langsam passieren. Die Grenzschützer winken freundlich zurück.
Auf einmal bringt Robert den Wagen zum Stehen und zieht die Handbremse an. Vor uns erblicke ich einen langen Wellblechzaun. Wir sind also an der mexikanischen Grenze angekommen. Steifbeinig und etwas benommen steigen wir aus dem Auto, und Robert hilft uns, unsere Rucksäcke aus dem Kofferraum zu hieven. Es riecht nach Salbei, ein Duft, den der Wüstenbeifuß verströmt. Und es ist noch dunkel und verdammt kalt. Als Robert mich zum Abschied umarmt, habe ich wieder weiche Knie. Nun ist es so weit. Er zwinkert mir noch einmal aufmunternd zu, für die Jungs gibt es ein kumpelhaftes Schulterklopfen, und schon bricht er auf. Er muss pünktlich vor Schulbeginn zurück in San Diego sein. Ich schaue den Rücklichtern seines Wagens hinterher und fühle mich plötzlich sehr einsam.
Als der Pick-up nicht mehr zu sehen ist, spüre ich die Stille förmlich und blicke mich erst einmal um. Das Ende der Vereinigten Staaten sieht hier nicht gerade verheißungsvoll aus: eine staubtrockene Gegend, verziert mit verdorrten Büschen und ein paar jämmerlichen Kakteen. Ein breiter Sandweg führt an dem fast drei Meter hohen Grenzzaun entlang. Mexiko lässt sich nur erahnen. Reifenspuren verraten, dass die U.S. Border Patrol hier wohl häufig unterwegs ist. Schnurgerade zieht sich der Grenzstreifen durch die hügelige Landschaft und wirkt wie eine hässliche Narbe. Am Horizont geht zaghaft die Sonne auf und taucht alles in ein surreales, orangefarbenes Licht.
Matt und Ben können vor lauter Kraft und Tatendrang nicht mehr an sich halten und rennen nach einem kurzen Startfoto sofort los. »Hey, wir sehen euch später auf dem Trail«, verabschieden sie sich und verschwinden bald als hüpfende Farbkleckse in der braunen Landschaft.
Ich stütze mich auf meine Trekkingstöcke und schaue den beiden nachdenklich hinterher. Bis jetzt war der Pacific Crest Trail für mich vor allem ein tolles Planspiel und eine faszinierende Idee gewesen. Drei Monate lang hatte ich meine Ausrüstung optimiert, Unterlagen studiert und die Logistik rund um mein Vorhaben geplant. Zahlen, Daten, Fakten – das war meine Welt. Und irgendwie war es mir dabei gelungen, die körperliche Komponente dieser Wanderung auf ein reines Rechenspiel zu reduzieren, das ich nun mantramäßig in meinem Kopf wiederhole, um meinem immer noch flauen Magen und meinen weichen Knien etwas entgegenzusetzen: Der PCT ist 4277 Kilometer lang. Die Saison dauert nur etwa fünf Monate. Ich habe also gut 150 Tage Zeit. Abzüglich eines Ruhetags pro Woche ergibt das 130 Lauftage – und einen Tagesschnitt von 32,9 Kilometern. Ich werde also jeden Tag 33 Kilometer laufen müssen, fünf Monate lang. In der kühlen Morgenluft nehme ich erneut einen tiefen Atemzug.
Hier neben dem Grenzzaun fühlt sich alles anders an als zu Hause in Deutschland. Dort waren es nur Ziffern auf dem Papier. Jetzt starre ich in die schier endlose Landschaft vor mir, und die Zahlen bekommen ein erschreckend konkretes Gesicht. Aus schöner Theorie ist knallharte Realität geworden. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob mir diese gefällt.
John scheint es ähnlich zu ergehen wie mir, und in stiller Übereinkunft zögern wir den unvermeidlichen Aufbruch noch ein wenig hinaus. Wir kramen in unseren Rucksäcken, cremen Gesicht und Hände vorsorglich mit Sonnencreme ein und schießen Dutzende von Fotos vor dem kleinen PCT-Denkmal: Fünf eher unscheinbare, weiß gestrichene Holzpfeiler mit der Aufschrift »Pacific Crest National Scenic Trail – Southern Terminus« markieren den Beginn eines der längsten Wanderwege der Welt. Ich setze mich auf den niedrigsten der fünf Pfosten und lächle tapfer in die Kamera, während John mich von allen Seiten fotografiert.
Als ich anschließend die Aufnahmen meiner Handykamera betrachte, schaue ich auf mich wie auf eine Fremde: Da stehe ich, in neuen schwarzen Turnschuhen, einer total sauberen beigen Trekkinghose und einer dunkelblauen Jacke. Um den Hals ein gelbes Bandana und auf dem Kopf eine Baseballkappe. Nur der vollgepackte schwarze Rucksack und die Trekkingstöcke weisen mich als Wanderin aus. Irgendwie wirke ich mit dieser nagelneuen Ausrüstung total fehl am Platz. John raucht neben mir seine dritte Zigarette und sieht dabei immerhin noch deplatzierter aus als ich.
Ein herannahendes Auto erlöst uns von dem drohenden Aufbruch. Es entsteigt ein quietschsauberes amerikanisches Pärchen um die zwanzig, gefolgt von einem Elternpaar.
»Na, wollt ihr auch den PCT laufen?«, fragt John die Neuankömmlinge.
Das junge Paar strahlt über das ganze Gesicht. »Ja, aber nur den Teil in Kalifornien. Dann müssen wir wieder aufs College.«
Die Eltern haben die Kids also nur hierher gefahren und fragen nun mit stolzgeschwellter Brust: »Könnt ihr vielleicht ein Foto von uns allen für das Familienalbum machen?«
John übernimmt die Kamera, stellt sich in Position und fordert die Familie zu einem freundlichen Lächeln auf. »And now you all say – SEX!«, bittet er sie höflich. Vier Gesichtszüge entgleisen angesichts seines sonnigen britischen Humors. Statt breitem Grinsen ziert ein gequältes Lächeln die vier Gesichter. Es fällt mir sehr schwer, nicht laut loszulachen.
Nachdem die Eltern bereits wieder im Auto auf dem Weg nach Hause sind und der jung-dynamische Wandernachwuchs auf dem Trail entschwunden ist, hängen John und ich immer noch unentschlossen am Grenzzaun herum.
»Wollen wir heute zusammen losgehen?«, frage ich ihn schließlich. »Ich meine, du hast es ja sicherlich auch von den anderen Wanderern und Robert gehört: So direkt an der Grenze soll es hin und wieder zu Zwischenfällen mit Schleuserbanden und Drogenschmugglern kommen. Das könnte allein gefährlich werden.«
John sieht das genauso und drückt seine vierte Zigarette aus. »Die werden wohl eher nachts im Schutz der Dunkelheit unterwegs sein. Lass uns heute bis zum Lake-Morena-Zeltplatz gehen. Dort werden so viele Camper sein, dass wir bestimmt keine Probleme haben werden.«
Er steht auf und klopft sich den Staub von den Hosen. Dann sieht er mich dreckig grinsend an: »Im Übrigen ist es mit den Schleusern und den Drogenhändlern wie mit den Bären. Ich muss nur schnell genug davonrennen.«
Verwirrt stehe ich ebenfalls auf: »Das ist doch Quatsch. Bären rennen doch viel schneller als jeder Mensch. Denen kannst du nicht davonlaufen.«
»Darum geht es ja gar nicht«, erklärt John mir freudestrahlend. »Ich muss nur schneller laufen als du. Dann frisst der Bär dich statt mich.«
Gut, dass wir das geklärt haben …
Es ist mittlerweile sieben Uhr und ziemlich warm geworden. Wir müssen nun wirklich los. Der Moment, auf den ich fast vier Monate hin geplant habe, ist gekommen: Ich schultere meinen Rucksack und betrete langsam den vierzig Zentimeter breiten Fußpfad namens Pacific Crest Trail, der für die nächsten fünf Monate mein Zuhause sein wird. Die ersten Schritte sind noch zögerlich. Alles ist ungewohnt: die Last auf dem Rücken, die neuen Schuhe, die Trekkingstöcke.
»John, wie viel Wasser hast du dabei?«, frage ich nach einer halben Stunde, während ich die Gegend nach etwas Grünem absuche. Aber so weit das Auge reicht, sehe ich nur staubiges Gestrüpp.
»Vier Liter«, antwortet John, der dicht hinter mir läuft. »Meinst du, das reicht?«
Genau dieselbe Frage stelle ich mir auch: »Ich habe auch nur vier Liter. Das muss reichen.«
Die nächste verlässliche Wasserquelle ist der Lake-Morena-Campingplatz – 32 Kilometer entfernt. Bis dahin gibt es keine Auffüllmöglichkeit, denn die kleinen saisonalen Rinnsale sind zu dieser Jahreszeit bereits ausgetrocknet.
»Das heißt, wir müssen heute Abend oder spätestens morgen Vormittag den Campingplatz erreichen«, spricht John das Unvermeidliche aus. Keiner von uns beiden will ernsthaft über die Alternative nachdenken. Was, wenn wir uns verletzen oder uns verlaufen? Die nächsten Minuten sagt keiner ein Wort. Der kühle Swimmingpool in Roberts Haus in San Diego scheint plötzlich Lichtjahre entfernt.
Schritt für Schritt entfernen wir uns von der mexikanischen Grenze und dringen immer tiefer in die staubige Ungewissheit vor. Der schmale Weg wird zu einer überdimensionalen Nabelschnur, und ich frage mich besorgt, was wir tun sollen, wenn er einfach endet – so mitten im Nichts. Hier gibt es keine Wegmarkierungen. Die niedrigen Büsche und Sträucher haben vor allem eines gemeinsam: Sie haben Stacheln, Dornen oder Nadeln, die erbarmungslos kratzen oder stechen. Bald schon bin ich froh um meine schützenden Gamaschen, und ich bleibe tunlichst in der Mitte des schmalen Pfads.
Wir laufen Stunde um Stunde, und die Sonne steigt erbarmungslos immer höher. Sie treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Langsam komme ich in der Wirklichkeit an: Ich bin tatsächlich unterwegs auf dem PCT! Ich bin hier nicht im Urlaub, sondern werde die nächsten Monate auf diesem Trail verbringen. Mein Magen hat sich inzwischen entspannt, meine Schritte werden sicherer, und ich finde mein Tempo. Wie Robert Riess es vorausgesagt hat: Meine Zuversicht wächst mit jedem Schritt. Ich genieße die fremdartige Landschaft, die Luft, sogar Johns Gesellschaft. Ich komme innerlich zur Ruhe und füge mich ins Unvermeidliche: Jetzt muss ich laufen, laufen, laufen.
Um zwei Uhr nachmittags erreichen wir unser erstes Ziel: Hauser Creek. Erwartungsgemäß ist das Flüsschen ausgetrocknet, da es lange nicht geregnet hat. Dennoch kommt mir dieses kleine Tal wie eine Oase in der Wüste vor: Ein paar schattige Bäume laden zu einer ausgedehnten Rast ein. Im Hintergrund zwitschern einige Vögel, während wir unter einer knorrigen Eiche unser Mittagessen verzehren. John isst Tortillas mit Erdnussbutter, ich habe noch ein paar Donuts und Muffins aus San Diego. Ich bin froh, diese ersten Stunden nicht allein gegangen zu sein. Nach dem Essen zieht John genussvoll an seiner Zigarette, ich entledige mich meiner Schuhe und Socken, um meine geschwollenen Füße auszulüften. Vor uns liegen noch acht Kilometer, aber vor allem ein Anstieg von 400 Höhenmetern. Dafür ist es jetzt in der Mittagshitze viel zu heiß. Wir haben also genug Zeit für eine lange Siesta.
»Warum bist du eigentlich hier?« Endlich traue ich mich, die Frage zu stellen, die ich eigentlich schon an Roberts Pool stellen wollte, als John seine Isomatte neben mir ausbreitete.
»Daran sind vor allem die Frauen schuld«, verblüfft er mich. »Sie haben mich regelrecht verfolgt!« Ausführlich erklärt er mir – nicht ohne ein bisschen Stolz – sein kompliziertes Liebesleben, sodass ich bald den Überblick verliere über Johns Freundinnen, Affären und Verehrerinnen der letzten Jahre. Als vierzigjähriger Junggeselle wurde er von den vielen heiratswütigen Damen so sehr bedrängt, dass er sich in einem Anfall von Midlife-Crisis in die USA geflüchtet hat – behauptet er zumindest. Angesichts von Johns Figur hege ich zwar gewisse Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Version, behalte diese aber vorsichtshalber für mich. Vielleicht herrscht in Großbritannien ja ein etwas anderes männliches Schönheitsideal vor als in Deutschland. Vorsichtig lenke ich das Gespräch auf ein anderes Thema: »Was hast du denn beruflich gemacht?«
»Ich bin Journalist und schreibe für ein englisches Outdoormagazin. Denen konnte ich die Wanderung gut verkaufen, denn ich werde danach in der Zeitschrift über den Trail schreiben. Ich verbinde hier also quasi das Angenehme mit dem Nützlichen. Wandern und gleichzeitig Material für die Artikelserie sammeln. Und wenn ich in einem halben Jahr nach England zurückkomme, haben sich die Frauen hoffentlich wieder beruhigt. Und du?«
Ich strecke mich auf meiner Isomatte aus und schiebe mir meine Baseballkappe ins Gesicht. In meinem Wanderoutfit faul im Schatten einer kalifornischen Eiche liegend, fühle ich mich sehr weit weg von meinem früheren Leben, das erst ein paar Monate zurückliegt. »Bis vor Kurzem war ich kaufmännische Leiterin eines mittelständischen Betriebes. Zwei Jahre lang habe ich das Unternehmen saniert. Ein sauguter Job – und verdient habe ich auch ganz ausgezeichnet.«
John sieht mich skeptisch an und schiebt sich ein Snickers zum Nachtisch in den Mund. Ganz offensichtlich nimmt er mir meine Karriere genauso wenig ab wie ich ihm seine Frauen.
»Ich war auch sonst sehr zufrieden mit meinem Leben: Ich hatte einen großen Freundeskreis, bin viel gereist, habe ständig Museen und Theater besucht und das Nachtleben in vollen Zügen genossen«, füge ich hinzu.
»Männer?«, fragt John neugierig.
»Zum Glück keinerlei Dramen, eigentlich war ich sogar ganz glücklich mit meinem Liebesleben.«
John nickt verständnisvoll: »Du bist also ein klassischer SINK: single income, no kids.«
»Genau. Ein SINK. Und daran will ich auch gar nichts ändern«, ergänze ich hastig, damit John mich nicht ebenfalls für eine heiratswütige Frau mit tickender biologischer Uhr hält. »Ehe und Kinder, das ist eh nicht mein Ding.«
John ist allmählich verwirrt: »Klingt nach einem rundherum perfekten Leben. Was hat dich denn dann auf den Trail verschlagen?«
Genau diese Frage habe ich mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gestellt. »Eigentlich hat alles vor etwa zehn Monaten begonnen – mit einem puren Zufall. Wenn es so etwas gibt.«
Juli 2003, zehn Monate vor dem PCT Tuolumne Meadows Campground, Yosemite National Park, CA
Ich sitze auf einer Bank vor meinem Zelt und betrachte im Licht der langsam untergehenden Sonne die riesigen Kiefern, die meinen Zeltplatz beschirmen. Im Hintergrund höre ich den Tuolumne River, dessen Wasser aufgrund der Schneeschmelze für eine gewaltige, aber gleichzeitig beruhigende Geräuschkulisse sorgt. Entspannt lehne ich mich auf der Bank zurück und atme den würzigen Duft der Nadelbäume ein. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Fast zwei Wochen lang bin ich durch den spektakulären Yosemite National Park gelaufen, habe gewaltige Berge, reißende Flüsse und sogar Bären gesehen. Meinen 36. Geburtstag habe ich unter blauem Himmel an einem glasklaren Gebirgssee wie aus dem Bilderbuch verbracht. Ganz allein – wenn man mal von den zwei Millionen Moskitos absieht, die mich heimgesucht haben. Dieser Urlaub war ein wirklich schönes, wenn auch teures Geburtstagsgeschenk für mich selbst. Aber ich verdiene ja gut …
Der Duft saftiger Steaks wabert von den Zeltplatznachbarn zu meiner Linken, die sich gerade auf dem Lagerfeuergrill ein opulentes Abendessen zubereiten, zu mir herüber. Ich bin bereits beim Nachtisch angelangt und schiebe mir entspannt ein großes Stück Schokolade in den Mund.
Doch plötzlich werde ich in meiner beschaulichen Abendbetrachtung gestört. Die bisher noch unbesetzte Campingparzelle zu meiner Rechten wird nun von einigen wilden Gestalten okkupiert. Sechs Jungs, alle wohl so zwischen zwanzig und dreißig, mit Vollbärten und völlig verdreckter Kleidung, bauen in Windeseile ihre minimalistischen Behausungen auf. Jeder Handgriff sitzt, und in wenigen Minuten sind die Isomatten ausgerollt und die Schlafsäcke aufgeschüttelt. Während ich in einem nagelneuen Expeditionszelt auf einer bequemen aufblasbaren Matte nächtige, scheinen meine neuen Nachbarn unter winzigen Tarps, also einfachen Zeltplanen ohne Boden, auf dünnen Schaumstoffmatten zu schlafen. Ihr Aufzug ist abenteuerlich: Alle tragen statt Wanderstiefeln alte Turnschuhe, die teilweise schon so abgetragen sind, dass sie nur noch von herumgewickeltem Isolierband zusammengehalten werden. Ich sehe löchrige Socken und zerrissene Hosen. Dennoch verströmen sie eine solche Lebendigkeit und gute Laune, dass ich mich unwiderstehlich zu ihnen hingezogen fühle.
Als sie ein Lagerfeuer anzünden, schlendere ich hinüber und geselle mich zu ihnen. »Hi, ich bin Christine aus Deutschland und eure Nachbarin hier auf dem Zeltplatz«, begrüße ich sie.
»Läufst du den PCT oder den JMT?«, kommt es gleich zurück – und diese Frage wirft mich erst mal völlig aus der Bahn. PCT? JMT? Was soll das denn sein?
»Nein, ich wandere einfach nur so …«, stottere ich verwirrt und ernte eine gewisse herablassende Heiterkeit. Aber das Eis ist erst mal gebrochen.
»PCT ist die Abkürzung für Pacific Crest Trail. Das ist ein Weitwanderweg, der auf 4277 Kilometern von Mexiko nach Kanada führt. Und JMT steht für John Muir Trail. Der ist nur 340 Kilometer lang und führt durch den Yosemite National Park«, erklärt mir einer der Jungs jetzt geduldig und schmeißt ein paar Würstchen aus dem Campingplatzladen auf den Grill.
»Und ihr lauft wohl den PCT?«, frage ich ungläubig.
»Ja, klar! Wir sind schon über zwei Monate unterwegs und haben bereits 1500 Kilometer geschafft auf dem Weg nach Kanada. Wir sind thruhiker.«
»Thruhiker?«, frage ich schon wieder total verwirrt zurück.
»Ja, thruhiker! Wir wandern den kompletten Trail DURCH, sind also DURCHwanderer oder kurz halt thruhiker.«
Nun verstehe ich die abgetragene Kleidung, die kaputten Schuhe und vor allem die unglaubliche Effizienz der Truppe.
Und während die Jungs Würstchen um Würstchen in sich hineinstopfen, stelle ich Frage um Frage über den Trail und ihr Leben unterwegs.
»Wie lange dauert es, von Mexiko nach Kanada zu laufen?« – »Ungefähr fünf Monate, von Mitte April bis Ende September.«
»Wie viel Kilometer lauft ihr am Tag?« – »Etwa 33 Kilometer. In der Wüste mehr, hier im Hochgebirge weniger.«
»Wie schwer sind eure Rucksäcke?« – »Fünf bis sechs Kilo ohne Wasser und Verpflegung, denn wir haben alles gewichtsoptimiert.«
Leider hat meine Fragestunde schon bald ein Ende. Um 21 Uhr ziehen sich meine Nachbarn bereits zum Schlafen zurück. »Es ist schon thruhiker midnight«, verabschieden sie sich lächelnd von mir. Im Schein meiner Stirnlampe stolpere ich zurück zu meinem Zelt. Und trotz meiner bequemen weichen Isomatte schlafe ich nur sehr unruhig in dieser Nacht, denn mir schwirren noch hunderttausend Fragen durch den Kopf.
Als ich am nächsten Morgen aufwache, bin ich wild entschlossen, die Jungs weiter zu löchern. Energisch strecke ich den Kopf aus meinem Zelt, um zu sehen, was meine Nachbarn jetzt wohl treiben – und sehe nichts als einen leeren Zeltplatz. Die thruhiker sind um neun Uhr morgens bereits spurlos verschwunden wie eine Fata Morgana. Wie mir meine Zeltplatznachbarn zur Linken später berichten, sind sie bereits um sechs Uhr bei Sonnenaufgang losgelaufen – während ich in Urlaubermanier faul bis weit in den Morgen hinein geschlafen habe.
Doch die Idee des PCT lässt mich jetzt nicht mehr los. Sie verfolgt mich die verbleibenden Tage meines Urlaubs und will auch nach meiner Rückkehr nach Deutschland nicht aus meinem Kopf verschwinden. Dabei frage ich mich die ganze Zeit, was mich denn nun genau am Thema thruhike so fasziniert. Die Freiheit auf dem Trail? Die Radikalität dieses reduzierten Lebensstils? Die große Energie, die die Wanderer so offensichtlich aus ihrem Outdoorleben ziehen? Mein spannender und lukrativer Job in der Unternehmenssanierung erscheint mir plötzlich im Vergleich fade und langweilig. Ich sehe meine nächsten Jahre bereits vor mir als eine einzige frustrierende und sich ständig wiederholende Abfolge von Budgetplanungen und Jahresabschlussberichten, Arbeitsgerichtsprozessen und Kundengesprächen, Streitereien mit Geschäftsführern und Betriebsräten.
Immer wieder spiele ich in den nächsten Monaten das Szenario eines Jobausstiegs und einer PCT-Wanderung durch – aber letztendlich bleibt es immer nur bei diesem Gedankenspiel. Zu verrückt und weit hergeholt erscheint mir die Idee des PCT. Mir fehlt ganz einfach der Mut, meinen sicheren und gut bezahlten Job zu kündigen. Und so bleibe ich weiterhin die dynamische Geschäftsfrau – bis es zum großen Knall kommt …
19. Dezember 2003, vier Monate vor dem PCT Berlin
»Kommen Sie doch bitte mal in mein Büro!« Mein Chef steht in der Tür zu meinem Zimmer und sieht mich kalt lächelnd an. Ich habe das Gefühl, dass mir innerhalb von Sekunden jegliche Farbe aus dem Gesicht weicht. Kalter Schweiß bricht mir am ganzen Körper aus. Mit tiefen Atemzügen versuche ich, die aufsteigende Panik zu bekämpfen. Dann zwinge ich mir ein verkrampftes Lächeln aufs Gesicht, greife zu meinem Montblanc-Füller und einem Notizblock und erhebe mich etwas wackelig von meinem Bürostuhl.
»Gerne. Ich komme sofort!«, antworte ich mit belegter Stimme. Ich weiß, was mir jetzt bevorsteht: meine Kündigung – und ich bin fest entschlossen, den Akt erhobenen Hauptes durchzustehen.
Der Geschäftsführer eskortiert mich in sein Büro und weist mir einen Platz am Besprechungstisch zu, wo mich bereits ein Mitarbeiter der Personalabteilung als Zeuge erwartet. Nervös spiele ich mit meinem Füller und bemühe mich um einen unbeteiligten Gesichtsausdruck. Mein Chef kommt schnell zur Sache. Er entnimmt seiner Ledermappe einen Bogen Papier und legt ihn vor mich hin: das Kündigungsschreiben. »Leider sind wir aus betrieblichen Gründen gezwungen, Sie zu kündigen. Sie sind ab sofort von der Arbeit freigestellt«, erklärt er mir – und kann mir dabei nicht in die Augen schauen. »Haben Sie noch Fragen?«
»Nein, keine Fragen«, antworte ich gepresst und versuche, meine professionelle Miene beizubehalten. Mir ist klar, dass von nun an sowieso die Anwälte alles regeln werden.
»Sie haben zehn Minuten Zeit, Ihre persönlichen Sachen zu packen. Ein Mitarbeiter wird Sie dann hinausbegleiten«, kündigt mein Vorgesetzter an und erhebt sich. Während mir tausend Gedanken durch den Kopf schießen, packe ich langsam das Kündigungsschreiben ein und stehe ebenfalls auf. Verlegen stehen wir uns gegenüber und keiner weiß, was jetzt noch zu sagen ist. »Alles Gute für Sie!«, ringt sich der Geschäftsführer noch ab, als er mich zurück in mein Büro begleitet. Wir geben uns nicht mehr die Hand zum Abschied.
In meinem Büro erwartet mich einer meiner Mitarbeiter, dem die Situation offensichtlich ebenso peinlich ist wie mir. Er steigt von einem Bein aufs andere, während ich meine Schreibtischschubladen durchsuche und meine wenigen persönlichen Gegenstände mit zitternden Händen in eine Plastiktüte packe: mein Schreibset, einige Visitenkarten, ein paar Fachbücher. Zum Schluss schweift mein Blick noch einmal durch mein großzügiges Büro, über den ausladenden Schreibtisch voller Unterlagen, die jetzt wohl jemand anders bearbeiten wird, und den Besprechungstisch, an dem ich so viele Gespräche mit Mitarbeitern und Lieferanten geführt habe. Entschlossen wende ich mich ab und teile meiner Begleitung mit: »Ich bin fertig. Gehen wir.«
Ein letztes Mal laufe ich durch die Gänge der Firma und sehe aus den Augenwinkeln, wie meine ehemaligen Mitarbeiter mir aus ihren Büros verwirrt nachschauen. Zwei Minuten später rolle ich in meinem Auto vom Hof. Neben mir auf dem Beifahrersitz steht die Plastiktüte mit meinen wenigen Bürohabseligkeiten. Ich winke dem verdutzten Pförtner nochmals zu – und fahre direkt zu meinem Anwalt, um Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einzureichen.
Erst als ich bei mir zu Hause ankomme, weicht die Schockstarre von mir. Bisher bin ich im Überlebensmodus gefahren und habe alles erhobenen Hauptes und mit Professionalität durchgestanden. Aber jetzt bin ich mit meiner Kraft am Ende. Ich lasse mich auf meine Matratze fallen und starre minutenlang an die Decke, bevor mich ein heftiger Weinkrampf überfällt. Schluchzend wälze ich mich hin und her und kann den Selbstzweifeln nicht mehr länger ausweichen: Warum ich? Warum jetzt? Warum so?
Die Kündigung hatte mich nicht unerwartet erwischt, denn wohlmeinende Kollegen hatten mich gewarnt. Ich war in meinem Job zwar ausgesprochen erfolgreich gewesen, jedoch hatte meine harte Sanierungsstrategie Geschäftsführer, Betriebsrat und auch viele Mitarbeiter gegen mich aufgebracht. Und nun hatte ich für meinen Konfrontationskurs die Quittung erhalten. Unter Tränen muss ich bitter auflachen, als mir die Ironie des Schicksals bewusst wird. Als Sanierungsspezialistin habe ich selbst schon Dutzende von Mitarbeitern gekündigt. Eigentlich ist es da ja nur ausgleichende Gerechtigkeit, dass ich das Ganze jetzt mal aus der anderen Perspektive erlebe.
Mit verheultem Gesicht stehe ich endlich auf und stolpere ins Bad, um mir mit kaltem Wasser das Gesicht zu waschen. Ich putze mir kräftig die Nase und atme tief durch. Dann erkläre ich meinem Gegenüber im Badezimmerspiegel: »Selbstmitleid bringt dich nicht weiter. Reiß dich zusammen und überlege, wie es jetzt weitergehen soll.« Die Hände auf das kühle Waschbecken gestützt, gehe ich im Geist meine Optionen durch.
Zurück in meinen alten Job? Ich habe selbst zu viele Arbeitsgerichtsprozesse durchgefochten, um mir diesbezüglich irgendwelche Hoffnungen zu machen. Meine Klage wird mir zwar hoffentlich eine kleine Abfindung bescheren, aber mein bisheriger Job ist weg.
Also gleich eine neue Stelle suchen? Bewerbungen schreiben, Vorstellungsgespräche führen? Ich kann auf mehrere erfolgreiche Sanierungsfälle verweisen, verfüge über eine gute Reputation und ein weites berufliches Netzwerk. Es wird mir also sicherlich nicht schwerfallen, bald wieder eine gleichwertige Position oder sogar etwas Besseres zu finden. Aber will ich das wirklich?
Fragend betrachte ich mein Spiegelbild, denn da kommt sie wieder hoch, die verschüttete, verrückte Idee: Ich könnte jetzt ja den PCT laufen. Blitzschnell überschlage ich den Zeitplan. Das Timing ist geradezu perfekt. Saisonstart für den PCT ist Mitte April. Ich hätte jetzt also knapp vier Monate Zeit, um mich auf die Wanderung vorzubereiten. Im Oktober wäre ich wieder zurück aus den USA und könnte mir dann immer noch einen neuen Job suchen. Ich sehe im Spiegel, wie der Gedanke an den PCT meine Augen strahlen lässt und sich meine Gesichtszüge straffen. Das Abenteuer ruft.
Der Gedanke an den PCT ist verführerisch, doch noch bin ich nicht endgültig überzeugt. Zu tief sitzen der Schock und die Schmach der Kündigung. Die nächsten Wochen verbringe ich hin- und hergerissen zwischen Selbstzweifeln und Karrierelust, Sicherheitsdenken und Abenteuerdrang. Zur endgültigen Entscheidung brauche ich noch ein überzeugendes Argument, das mir das Schicksal bereits einen Monat später liefert …
Januar 2004, drei Monate vor dem PCT Berlin
Als ich das Pflegeheim betrete, überwältigt mich sogleich dieser typische Geruch von Desinfektionsmittel, Urin und aufgewärmtem Kartoffelbrei. Oder ist es Rosenkohl? Ich steuere die Rezeption an und frage nach Bernd.
»5. Stock, Zimmer 511. Aber schauen Sie doch vorher auch mal in den Gemeinschaftsraum. Dort sitzen die Patienten oft tagsüber.«
Beklommen steige ich in den Fahrstuhl und frage mich, was mich wohl erwartet. Bernd ist ein alter Bekannter von mir. 46 Jahre alt, schwul, erfolgreicher Architekt und Yuppie, wie er im Buche steht: Penthouse-Wohnung, großer Firmenwagen, Armani-Anzug – das volle Programm eben. Jedenfalls bis vor wenigen Wochen, als er einen Schlaganfall erlitt. In der Notaufnahme wurde er zwar reanimiert, doch er hat schwere Gehirnschäden davongetragen. Nach Intensivstation und Krankenhaus ist er jetzt als aussichtsloser Fall im Pflegeheim gelandet.
Die Aufzugtür öffnet sich mit einem leisen »Pling«. Ich steige aus und sehe mich suchend um. Aus einer Ecke plärrt ein Fernseher. Das muss wohl der Aufenthaltsraum sein. Langsam laufe ich in diese Richtung, vorbei an abgestellten Krankenhausbetten und Essenstabletts. An einem kleinen Tisch sehe ich Bernd sitzen, im Rollstuhl. Er trägt einen blauen Trainingsanzug und dicke Wollsocken. Teilnahmslos starrt er in die Ferne, am Fernseher vorbei. Neben ihm mehrere Achtzigjährige, ganz offensichtlich dement.
Vorsichtig trete ich näher. »Hallo, Bernd!«, spreche ich ihn an. Langsam wendet er sich mir zu, doch seine Augen blicken mich verständnislos an. Aus seinem Mund kommt nur ein leises Gurgeln. Verlegen stehe ich vor ihm und weiß nicht weiter, als plötzlich hinter mir laut Geschirr scheppert. Erschrocken drehe ich mich um und blicke in die freundlichen Augen einer Pflegerin.
»Das ist ja schön, dass Sie Bernd besuchen. Und genau zur richtigen Zeit. Es gibt jetzt Mittagessen, und Sie können mir helfen, ihn zu füttern.«
»Wie meinen Sie das? Ihn füttern?«, frage ich überrascht.
»Ach, Sie sind wohl zum ersten Mal bei ihm. Er kann nicht mehr richtig schlucken und auch nicht mehr sprechen. Da dauert das Füttern immer sehr lange. Warten Sie, ich zeige Ihnen, wie Sie das am besten machen.«
Bevor ich irgendetwas erwidern kann, bindet sie Bernd ein Lätzchen um, stellt ein Tablett mit Brei vor ihn hin und drückt mir einen Löffel und ein kleines Tuch in die Hand. »Mit dem Tuch können Sie ihm den Mund abwischen. Lassen Sie sich Zeit. Ich komme wieder, wenn ich das Essen an alle verteilt habe«, sagt sie und entschwindet geschäftig zum nächsten Patienten.
Bei unserem letzten Treffen war ich mit Bernd in einem schicken Berliner Szenelokal essen – und jetzt füttere ich ihn mit Schonkost. Vorsichtig nehme ich einen Löffel Brei auf und schiebe ihn Bernd behutsam in den Mund. Bernd kann kaum schlucken. Er würgt und sabbert. Jeder Löffel Brei ist eine Qual. Speichel tropft ihm aus dem Mund auf das Lätzchen. Nach zehn Löffeln weigert er sich, weiter den Mund aufzumachen und gestikuliert spastisch mit der linken Hand. Die rechte Seite ist fast vollständig gelähmt. Tapfer lächelnd versuche ich, Bernd etwas Schönes zu erzählen, doch er kann nicht antworten. Ich weiß nicht einmal, ob er mich überhaupt erkennt. Und so sitze ich einfach neben ihm und streichle seine Hand, während im Hintergrund eine Quizsendung aus dem Fernseher dröhnt. Als ich nach einer halben Stunde gehen will, umkrallt er meinen Arm und will mich nicht ziehen lassen. Die Pflegerin eilt mir zu Hilfe und bedankt sich: »Danke für das Füttern. Und kommen Sie bald wieder. Ich glaube, Bernd hat sich sehr gefreut, Sie zu sehen.«
Und ich komme auch bald wieder. Als frischgebackene Arbeitslose habe ich ja viel Zeit, und so besuche ich Bernd jeden zweiten Tag. Mittlerweile geht seine Firma in die Insolvenz, sein schicker Mercedes wird versteigert und sein Penthouse ausgeräumt und neu vermietet. Bernd interessiert das alles nicht mehr. Ich füttere ihn mittags mit Brei, spiele mit ihm »Fang-den-Tennisball« und schaue mit ihm Quizsendungen im Vormittagsprogramm an. Bernd gibt mir eine neue Perspektive. Was ist schon meine Kündigung im Verhältnis zu seinem Schicksal? Ich lerne hautnah zu verstehen, dass es Wichtigeres gibt als Karriere und Geld.
Es ist 21 Uhr, und ich mache mich gerade ausgehfertig, als das Telefon in meiner Wohnung klingelt. Ich überlege kurz, ob ich überhaupt rangehen soll. In einer halben Stunde habe ich eine Verabredung in einem angesagten Club der Stadt. Doch was soll’s. »Ja, hallo!«, melde ich mich und höre eine mir unbekannte Stimme am anderen Ende: »Entschuldigen Sie die späte Störung. Sie kennen mich noch nicht persönlich. Ich bin die Mutter von Bernd – ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.«
Ich verliere sofort jegliche Ausgehlaune und frage fast schon panisch: »Ist etwas mit Bernd?«
»Ja, er hatte einen weiteren Schlaganfall und liegt in der Notaufnahme. Ich bin im Moment in Lübeck und kann frühestens in fünf Stunden da sein. Bernds Freund kann ich nicht erreichen, und mir fällt sonst niemand mehr ein in Berlin. Können Sie schnell in die Notaufnahme fahren und ihm beistehen? Ich möchte nicht, dass er jetzt allein ist.«
»Natürlich«, antworte ich, und tausend Gedanken schwirren mir durch den Kopf. »Ich fahre gleich los und rufe Sie an, wenn ich ihn gesehen habe.«
Eine halbe Stunde frage ich mich in der Notaufnahme des Krankenhauses nach Bernd durch. Eine Schwester führt mich endlich an sein Bett. Der Anblick erschüttert mich zutiefst. Bernd liegt da in einem weißen Krankenhaushemd. Er wirkt unglaublich zerbrechlich. Schläuche führen in seine Nase und Arme. Seine Haut sieht wächsern aus im künstlichen Krankenhauslicht. Er öffnet nicht einmal mehr die Augen, als ich sanft seine Hand ergreife und die knochigen Finger streichle. »Er hatte einen Schlaganfall«, teilt mir die Schwester mit. »Und das war wohl nicht der erste, oder?«, fragt sie nach.
»Der zweite!«, bestätige ich ihr. Wir sehen uns an, und ich kann an ihrem Gesicht ablesen, dass Bernd einen dritten Anfall wohl nicht überleben wird.
»Ich lasse Sie dann mal allein«, verabschiedet sich die Schwester, nachdem ich an Bernds Seite Platz genommen habe.
Die nächsten Stunden halte ich seine Hand. Bernd bewegt sich keinen Millimeter. Seinen Atem kann ich kaum hören – nur das Ticken der Wanduhr und die Hektik auf dem Krankenhausflur der Notaufnahme. Ich denke viel nach in dieser Nacht. Bernd ist 46 Jahre alt, genau zehn Jahre älter als ich. Mit 46 stirbt man nicht, habe ich bisher immer geglaubt. Aber Bernd führt mir die Endlichkeit meines Seins vor Augen. Wenn ich wüsste, dass ich in zehn Jahren sterben werde, was würde ich in der mir verbleibenden Zeit machen? Arbeiten, Geld verdienen, Karriere? Nein, sicherlich nicht. Ich würde die Zeit nutzen, um meine Träume zu leben, etwas Ungewöhnliches zu tun.
Als ich Bernd um Mitternacht verlasse, ist meine Entscheidung endgültig gefallen: Ich werde den PCT laufen.
Januar bis April 2004 Vorbereitung auf den PCT
Am nächsten Morgen buche ich zuerst meinen Flug in die USA – mit den Bonusmeilen, die ich mir auf den vielen Geschäftsreisen erworben habe. Ich betrachte dies als ein letztes Geschenk meiner Arbeitgeber. Dann rufe ich meinen Anwalt an und teile ihm mit, dass er mich bei meinem Arbeitsgerichtsprozess vertreten soll. Ich will nicht mehr selbst teilnehmen, denn ich habe jetzt Besseres zu tun.
Den Rest des Tages verbringe ich im Internet und recherchiere alles über den PCT. Eine meiner ersten Erkenntnisse ist bereits sehr ernüchternd: Pro Jahr starten etwa 300 hoffnungsfrohe thruhiker an der mexikanischen Grenze – aber nur um die hundert kommen fünf Monate später auch in Kanada an. Abbruchquote 65 Prozent. Warum sollte ausgerechnet ich es schaffen?
Besorgt sehe ich an mir hinunter, wie ich in Jogginghosen und Schlabber-Shirt an meinem Schreibtisch lümmle: Ich bin 36 Jahre alt und gänzlich untrainiert. Ich habe etwa fünf Kilogramm zu viel auf den Rippen und noch nie ein Fitness-Studio von innen gesehen. Schon in der Schule war ich in Sport die absolute Niete. Ansonsten eine Einser-Schülerin und Klassenbeste, war ich in Sport schon froh über eine Vier. Beschämende Erinnerungen an den Unterricht steigen in mir hoch: Wenn die Teams für den Mannschaftssport gewählt wurden, wurde ich immer zuletzt aufgerufen – wenn keine andere mehr übrig war außer einem Mädchen, das blind war wie ein Maulwurf und Gleichgewichtsstörungen hatte. Mein Horror-Sportgerät war der Schwebebalken – ich habe es tatsächlich geschafft, mehrfach herunterzufallen, was alles andere als graziös aussah. Und beim Felgaufschwung am Reck traten die Mitschülerinnen, die Hilfestellung leisteten, immer diskret zur Seite, wenn ich an der Reihe war. Niemand wollte mich überdimensionierten schlaffen Kartoffelsack über das Reck hieven müssen. Und so habe ich dann nach Beendigung der Schule auch jegliche sportliche Betätigung eingestellt – außer ein bisschen Radfahren und Wandern.
Frustriert hole ich mir erst mal eine Tafel Schokolade aus dem Kühlschrank. Bei fünf Kilo Übergewicht kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an. Während ich mir Rippe um Rippe in den Mund schiebe, denke ich über meine bisherige Wandererfahrung nach.
Als Kind habe ich Wandern immer gehasst, weil meine Eltern glaubten, dabei ihre lokalpatriotischen Gefühle ausleben zu müssen. Es war mir unsäglich peinlich, mit meinem Vater in Strickjacke, Kniebundhosen, Wadenstrümpfen und Haferlschuhen gesehen zu werden – gekrönt von einem original Gamsbarthut. Dabei sollte ich dann vorzugsweise Dirndl tragen – nein danke!
Und so habe ich das Wandern erst im späten Alter von 32 Jahren wiederentdeckt, sozusagen als Stressausgleich zum Karrierejob. Weil ich es mir nun leisten konnte, trabte ich allerdings nicht mehr durch das deutsche Mittelgebirge, sondern wanderte durch Neuseeland, Patagonien und zuletzt Kalifornien. Man gönnt sich ja sonst nichts … Leider war ich dabei unter sportlichen Gesichtspunkten auch nicht wirklich erfolgreich. In Neuseeland watschelte ich mit einem viel zu schweren Rucksack auf meinen Senk-Spreiz-Füßen von Hütte zu Hütte und kam dabei fast immer als Letzte an. Mehrfach liefen mir am Abend bereits die Hüttenwarte entgegen, weil man mich so kurz vor Sonnenuntergang schon verloren gegangen glaubte. In Patagonien verbot mir der Ranger gar eine komplette Wanderung, weil ich die seiner Ansicht nach eh nicht schaffen würde – und er hatte keine Lust, mich suchen zu müssen. Er hatte mich kurz zuvor bäuchlings über einen Baumstamm robben sehen – weil ich mich nicht traute, wie alle anderen Wanderer aufrecht auf dieser Naturbrücke über einen Fluss zu balancieren. Ich bin trotzdem ins Wasser gefallen … In Kalifornien hatte ich mich im Yosemite National Park zwar ganz tapfer geschlagen, aber Geschwindigkeits- oder Ausdauerrekorde habe ich dabei sicherlich nicht gebrochen. Kurzum: alles prima Voraussetzungen, um aus dem Stand heraus einen 4277 Kilometer langen Trail zu laufen!
Entmutigt schiebe ich mir das letzte Stück Schokolade in den Mund und strecke mich auf meinem Bürostuhl aus. Mein Blick fällt auf ein paar übrig gebliebene Arbeitsunterlagen aus dem letzten Job: jede Menge Ausdrucke von Excel-Tabellen, ein paar Arbeitsanweisungen und ein betriebswirtschaftliches Fachbuch. All dies erinnert mich wieder daran, worin ich eigentlich wirklich gut bin: Kostenreduktion, Einkaufspotenzialerschließung, Logistikkonzepte. Das sind wohl meine Kernkompetenzen. Budgetplanung natürlich auch. Und in Excel bin ich ein echter Crack.
Ich seufze leise und erwäge, mir noch mehr Schokolade aus dem Kühlschrank zu holen. Denn selbstkritisch muss ich zugeben, dass diese Fähigkeiten wohl nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine Langstreckenwanderung sind. Ich verkneife mir die zweite Tafel und starre wieder auf meinen Bildschirm, diesmal auf der Suche nach Ausrüstungstipps.
In einem einschlägigen Wanderforum beschreibt ein erfahrener thruhiker, dass der Schlüssel zum Erfolg das Rucksackgewicht ist. Je leichter der Rucksack, desto schneller kann man unterwegs sein, desto weniger anstrengend ist das Laufen, desto mehr Proviant kann man mitnehmen. »Ultraleicht« ist das Credo der Langstreckenwanderer. Um ein genaues Gefühl für das Rucksackgewicht und seine Zusammensetzung zu bekommen, schlägt er vor, jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand auf das Gramm genau abzuwiegen und das Gewicht in eine Excel-Tabelle einzutragen.
Ich stutze. Excel-Tabelle? Das ist doch endlich mal was, in dem ich richtig gut bin. Außerdem werde ich dann wohl eine fast komplett neue »Ultraleicht«-Ausrüstung kaufen müssen. Und das schreit förmlich nach Kostenreduktion und Einkaufspotenzialerschließung. Da das ganze Zeug aus den USA kommt, werde ich wohl auch ein vernünftiges Logistikkonzept brauchen … Jetzt fällt es mir endlich wie Schuppen von den Augen: Die Vorbereitung auf den PCT ist auch nicht viel anders als die Planung eines Business-Projektes.
Mit meiner gewohnten Effizienz verfolge ich in den nächsten Tagen und Wochen meine neue strategische Zielsetzung: Mein voller Rucksack – ohne Proviant und Wasser – darf am Ende nicht mehr als sechs Kilogramm wiegen. Und das ist nicht mal best case! Die echten Freaks unter den thruhikern tragen gerade mal drei bis vier Kilogramm auf dem Rücken – und das beinhaltet die komplette Ausrüstung einschließlich Rucksack. Ich kaufe eine Digital-Küchenwaage und wiege akribisch jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand. Bald schon säge ich Zahnbürsten ab und trenne Herstelleretiketten aus meiner Outdoorbekleidung. Schließlich läppern sich die einzelnen Gramm ja irgendwie zusammen.
Durch meine diversen Internet-Einkäufe in den USA lerne ich schnell das Hauptzollamt in Berlin persönlich kennen, wo ich mit erstaunten Beamten auch schon mal hartnäckig um einen günstigeren Zolltarif für meine neue Outdoorausrüstung streite. Als ehemalige Logistikexpertin fällt mir das auch nicht schwer.
Meine neue Behausung wiegt gerade mal 800 Gramm: ein Einwandzelt, das ich statt mit Zeltstangen mit meinem Trekkingstock aufstellen kann. Mein Daunenschlafsack bringt 870 Gramm auf die Waage und soll mich bis minus neun Grad Celsius warm halten. Schlafen werde ich auf einer 340 Gramm leichten aufblasbaren Isomatte. Sie ist nur 1,19 Meter lang, denn für die Beine brauche ich keine Isolation – oder ich lege einfach meinen Rucksack drunter. Der wiederum ist ein einfacher Sack ohne schweres Tragesystem und wird mir in einem größeren Briefumschlag aus den USA zugeschickt. Schließlich wiegt er auch nur 600 Gramm. Das geht locker noch als Maxibrief bei der Deutschen Post durch.
Auch die Bekleidung ist minimalistisch: eine Trekkinghose mit abnehmbaren Beinen, ein T-Shirt, ein Hemd und dann nur noch ein Funktionspullover und eine dünne Jacke als wärmende Schicht. Schlafen werde ich in einem Satz langer Unterwäsche. Nur bei den Socken habe ich ein Wechselpaar – ansonsten nehme ich nichts doppelt mit. Am schwersten fällt mir der Umstieg auf das Ultraleicht-Prinzip bei den Schuhen. Bisher hatte ich immer geglaubt, dass ich zum Wandern feste, hohe Stiefel benötige, doch die thruhiker sind allesamt in trail runnern unterwegs, also in flexiblen leichten Turnschuhen. Deren Mesh-Gewebe trocknet schneller, ihr geringes Gewicht ermüdet die Beine weniger, und ihre Biegsamkeit verhindert eine einseitige Belastung der Füße.
Zwischen Küchenwaage und Excel-Tabellen vergeht die Zeit wie im Flug. Daneben gibt es noch Hunderte von anderen Dingen zu erledigen. Ich beantrage ein Visum für die USA, telefoniere oder maile mit anderen thruhikern. Ich mache sogar ein Testament. Wegen der Klapperschlangen und Bären auf dem PCT. Das sage ich aber niemandem, weil es mir zu peinlich ist.
Dazwischen besuche ich immer wieder Bernd im Pflegeheim – bis er am 12. März nach einem dritten Schlaganfall stirbt. Fünf Wochen vor meinem Start auf dem PCT.