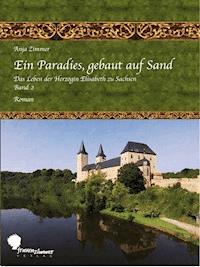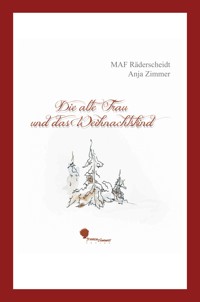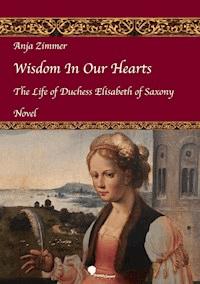Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frauenzimmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Leben der Herzogin Elisabeth zu Sachsen
- Sprache: Deutsch
Sachsen zur Zeit der Reformation, der streng katholische Fürstenhof zu Dresden und eine rebellische Schwiegertochter Herzogin Elisabeth zu Sachsen bekennt sich offen zu den Lehren Martin Luthers, obwohl ihr streng katholischer Schwiegervater äußerst hart gegen Protestanten vorgeht. Im Ränkespiel des Hofes hat Elisabeth mächtige Feinde, die ihr Spionage und sogar Ehebruch unterstellen. Herzog Georg sieht sich gezwungen zu handeln und spielt nicht nur mit dem Gedanken, sie einmauern zu lassen... Dieser Roman ist ein Plädoyer für religiöse Toleranz, das auch heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Die Autorin schildert ein bewegtes Frauenleben in einer Zeit voller Gegensätze und Abgründe, wobei sie immer den großen Kontext deutscher Geschichte im Blick behält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja Zimmer
Auf dass wir klug werden
Das Leben der Herzogin Elisabeth zu Sachsen
Roman
© Anja Zimmer, Frauenzimmer Verlag, Laubach - Lauter, 2011.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, Verwertung in anderen Medien
und anderen Sprachen, elektronische Speicherung,
Bearbeitung oder Aufbereitung - auch in Auszügen - nur mit
Genehmigung der Autorin.
Umschlagbild: Umkreis Joos van Cleve,
Tryptichon rechter Flügel mit Heiliger Barbara.
© LVR - Landesmuseum Bonn.
Mit freundlicher Genehmigung des LVR - Landesmuseums Bonn.
Umschlaggestaltung, Satz und Layout: Anja Zimmer
ISBN: 978-3-937013-10-7
www.FRAUENZIMMER-VERLAG.DE
Inhalt
Auf dass wir klug werden
Personenregister
Bibliographie
Verlagsprogramm mit Leseproben
Hinweis:
Auf der Webseite des Frauenzimmer Verlags
(www.Frauenzimmer-Verlag.de) gibt es Bilder der Schauplätze,weitere Informationen zur Recherche und Hintergründe.
Für Frank,
den besten Ehemann des gesamten Universums.
Meißen, im Mai 1526
„Euer Gnaden! Euer Gnaden!“
Der Angesprochene - Herzog Georg von Sachsen - sah schon wieder Ärger auf sich zukommen. Kein Zweifel, die Hofmeisterin war aufgebracht. Aufgebracht war gar kein Ausdruck. Sie war offensichtlich in höchstem Maße empört.
Die Hofgesellschaft hatte sich nach Meißen begeben, um den blühenden Mai zu genießen. Majestätisch thronte die Albrechtsburg auf ihrem Fesen über der Elbe, Sonnenschein lag auf den Weinbergen, von überallher dufteten Blumen und Obstbäume, doch dieses idyllische Bild wurde nun empfindlich gestört von der Hofmeisterin, die mit wehenden Gewändern auf dem Spazierweg am Fluss heranrauschte. Bei genauerem Hinsehen konnte man sogar erkennen, dass sie Staub aufwirbelte. Sie musste vollkommen außer sich sein, denn sonst hätte diese Frau, die der Herzog zur Erziehung seiner Schwiegertochter Elisabeth eingesetzt hatte, nicht selbst allen Anstand außer Acht gelassen und ihn schon von weitem angerufen.
Was mochte Elisabeth nun wieder angestellt haben? Herzog Georg war gespannt, ob diese Hofmeisterin ihn auch gleich bitten würde, die schwere Bürde, die er ihr in Form seiner kleinen, dünnen Schwiegertochter zugemutet hatte, wieder von ihr zu nehmen. Irgendwann hatte er aufgehört zu zählen, wie viele Hofmeisterinnen Elisabeth schon verschlissen hatte. Elisabeth war ungewöhnlich. In vielerlei Hinsicht. Sie war ungewöhnlich klug, selbstbewusst, stark und frei. Ihr Bruder Philipp hatte ihr Dinge beigebracht, die man bei wohlerzogenen Mädchen nicht vermuten durfte. Elisabeth konnte Steine übers Wasser springen lassen, was an sich noch harmlos war. Sie konnte aber auch Hofmeisterinnen zu Tode erschrecken, indem sie gellend auf ihren Fingern pfiff. Darüber hinaus musste sie außer ihrem Bruder noch andere Lehrmeister gehabt haben, denn sie gab bisweilen höchst unfeine Sprüche zum Besten, die sie als „alte hessische Weisheiten“ deklarierte. Damit nicht genug, konnte sie auch fluchen, als habe sie drei Heere zu führen, wie irgendeine Hofmeisterin sich ausgedrückt hatte.
Derlei Gedanken beschäftigten den Herzog, als er die aufgelöste Hofmeisterin auf sich zueilen sah.
„Euer Gnaden!“ rief sie noch einmal.
Herzog Georg wandte sich zu seinen beiden Begleitern um und entließ sie mit einem Kopfnicken. Hans von Schönberg und Heinrich von Schleinitz zogen sich zwar gehorsam zurück, blieben aber doch in sicherer Entfernung stehen, um noch genau hören zu können, was die werte Hofmeisterin vorzutragen hatte, die nun vollkommen außer Atem bei dem Herzog angekommen war.
„Ja, Frau von...“
„Köstritz. Gräfin Eleonore von Köstritz, wenn es Euer Gnaden beliebt.“
„Ja, ja, es beliebt. Erhebt Euch!“ forderte er ungeduldig die nicht mehr ganz junge Frau auf, die vor ihm in einen tiefen Hofknicks gefallen war. Da Herzog Georg fürchten musste, sie könne sich nicht mehr allein erheben, bot er ihr seine Hand, die sie äußerst dankbar ergriff.
„Nun, verehrte Gräfin Köstritz, Eure Angelegenheit scheint sehr dringend zu sein.“
„Allerdings, Euer Gnaden. Euer Gnaden haben mir vor kurzem die Güte erwiesen, mich zur Hofmeisterin Eurer Schwiegertochter zu berufen. Dafür bin ich Euer Gnaden auch sehr dankbar...“
„Das freut Uns wirklich sehr, Gräfin Köstritz. Dann ist ja alles in Ordnung. Wir befürchteten schon, Ihr wäret nicht zufrieden mit der Euch übertragenen Aufgabe.“
Nun schaute Herzog Georg in ein Gesicht, das innerhalb kürzester Zeit die mannigfaltigsten Schattierungen annahm. In der Köstritzschen Mimik kämpften untertänigster Respekt, Verzweiflung, Hoffnung auf Gnade und deutlicher Überlebenswille miteinander. In Bezug auf Elisabeth ging es der armen Frau offensichtlich um Leben und Tod.
„Euer Gnaden sind zu gütig“, brachte Frau von Köstritz schließlich stammelnd hervor, „doch fürchte ich, der mir übertragenen Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein.“ Fast sah sie erleichtert aus, dass ihr diese Worte gegenüber dem Herzog tatsächlich über die Lippen gekommen waren. Die Herren Schönberg und Schleinitz nickten einander befriedigt zu. Das waren wieder einmal gute Neuigkeiten.
„Nicht mehr? Aber Ihr seid doch erst seit drei Monaten Hofmeisterin“, sagte der Herzog in gespieltem Erstaunen.
„Euer Gnaden mögen mir gnädig sein, es sind genau zwei Monate, drei Wochen und fünf Tage. Die junge Herzogin ist zu viel für mich. Gerade eben hat sie mich in eine Situation gebracht. Eine Situation!“ Erschüttert legte die Gräfin eine Hand an ihre Stirne und seufzte.
Glücklicherweise hatte sie dabei die Augen geschlossen, denn so entging ihr, dass sich die Augenbrauen des Herzogs bedrohlich zusammengezurrt hatten.
„Was für eine Situation?“ fragte der Herzog, der es nicht liebte, wenn man sich ihm gegenüber nicht klar und deutlich ausdrückte. Die Gräfin, der sofort bewusst wurde, dass sie sich nun beherrschen musste, wollte sie den Herzog nicht verärgern, stand nun geradezu stramm vor ihrem Herrn.
„Euer Gnaden mögen mir vergeben, aber das kann ich Euer Gnaden beim besten Willen nicht sagen.“
„Wir werden keineswegs gnädig oder gütig sein oder Euch vergeben, wenn Ihr nicht augenblicklich erzählt, was vorgefallen ist.“ Der Herzog war mit seiner Geduld am Ende.
Schleinitz und Schönberg wagten kaum zu atmen und neigten sich vor, um jedes Wort aufzunehmen, denn nun berichtete Gräfin Köstritz stockend, dass sie mit Elisabeth am Fluss entlang gegangen sei. Wieder einmal habe sie vergeblich versucht, ihr beizubringen, wie man fürstlich einherschreite. Elisabeth habe nur geantwortet, dass sie kein Gaul sei, dem man Gangarten beibringen könne, und als sie dann in die Weinberge hinaufgestiegen seien, habe sie gerade ihr zum Trotz zwei Treppenstufen auf einmal genommen. Dort zwischen den Reben habe ein Mann gestanden und etwas getan... etwas ganz und gar unaussprechliches getan. Die Gräfin habe Elisabeth entsetzt gebeten, sich abzuwenden und wollte einen anderen Weg einschlagen, nur fort von diesem schamlosen Menschen. Doch Elisabeth habe ihm etwas zugerufen, einen Reim, nein, also das komme einer Gräfin von Köstritz beim besten Willen nicht über die Lippen.
Herzog Georg folgerte, dass ein Spaziergänger, der sich unbeobachtet geglaubt, sein Wasser abgeschlagen und Elisabeth eine ihrer alten hessischen Weisheiten zum Besten gegeben hatte.
Der Herzog seufzte. Er hatte Elisabeths Mutter Anna und ihren Vater Wilhelm gut gekannt. Er hatte gemeinsam mit Elisabeth, ihrem Bruder Philipp und Anna am Sterbebett Wilhelms gestanden und Anna getröstet. Er hatte Anna unterstützt, als die hessische Ritterschaft das Testament Wilhelms nicht anerkennen und Anna sogar den Sohn wegnehmen wollte. Anna war eine starke Frau gewesen, klug und schön. Davon hatte sie viel an ihre Tochter weitergegeben. Aber Elisabeths Jugend war gekennzeichnet gewesen vom Kampf ihrer Mutter um den Sohn und um die Herrschaft. Auch von Entbehrungen, denn die Regenten und Vormünder hatten sich geweigert, Anna und Elisabeth angemessen auszustatten. Viel zu oft war Anna unterwegs gewesen auf Reichstagen und Landtagen. Elisabeth war bei ihrer Amme in Marburg, Spangenberg und Felsberg aufgewachsen. Der Umgang dort war offensichtlich alles andere als fürstlich gewesen. Sicher hatte sie dort all die Dinge gelernt, die ihr am Hofe zu Dresden nicht gerade weiterhalfen.
Immer hatten sich Mutter und Tochter sehr nahe gestanden. Es war nun genau ein Jahr her, dass Anna gestorben war. Elisabeth hatte den Tod ihrer Mutter noch nicht verwunden. Auch wenn sie in Gesellschaft ein fröhliches Gesicht zeigte, wusste Herzog Georg doch, dass der Tod ihrer Mutter nur ein Leid unter vielen war.
Der Herzog atmete tief durch und schaute die Gräfin an, die schnell ihren Blick senkte.
„Es ist gut, Gräfin Köstritz. Ihr dürft Euch zurückziehen. Ihr seid fortan beurlaubt.“
Die Gräfin verneigte sich tief und eilte davon.
Herzog Georg wandte sich zu seinen beiden Räten um. Sofort schnellten sie aus ihrer vorgeneigten Haltung empor und Schleinitz nahm hastig seine Hand, die er hinter eine seiner großen Ohrmuscheln gelegt hatte, auf den Rücken. Vergeblich bemühte man sich, so unbeteiligt wie möglich auszusehen.
„Wir möchten Herzogin Elisabeth sprechen. - Oder nein, wartet! Herzog Hans! Bringt Uns Herzog Hans! Wir werden dort drüben in der Laube auf ihn warten.“
Wortlos verneigten sich die beiden und verschwanden. Schleinitz machte sich geflissentlich auf die Suche nach dem jungen Herzog, während Schönberg mit freudig federnden Schritten der guten Gräfin Köstritz auf den Fersen war, um vielleicht doch noch zu erfahren, was Elisabeth gesagt hatte.
Der Herzog ließ seinen Blick über den Fluss schweifen. Nicht nur sein Hofstaat hatte sich bunt über die Flussaue verteilt, auch die Meißner Bürger nutzten das schöne Wetter, um ihre Familien auszuführen. Kein Schleppkahn war an diesem Sonntag unterwegs, nur kleine Boote, in denen die Meißner Jugend den Sonntag genoss. Burschen in Hemdsärmeln versuchten wohl, die Mädchen mit ihren Ruderkünsten zu beeindrucken. Ob es gelang, war auf die Entfernung nicht auszumachen. Langsam ging Herzog Georg hinüber zu der Laube, die seine Gemahlin Barbara besonders liebte. Die wenigen Stunden, die er mit ihr gemeinsam verbringen konnte, genoss sie immer sehr. Auch mit Elisabeth hatte er schon oft hier gesessen und geredet. Sie war eine gute Gesprächspartnerin, wie man sie selten unter den jungen Frauen fand.
Es dauerte nicht lange und Herzog Johann erschien. Es hatte ihn einige Mühen gekostet, Herrn von Schleinitz davon zu überzeugen, dass er durchaus in der Lage sei, die Laube am Fluss allein zu finden. Er eilte und als er nahe genug war, um die Miene seines Vaters zu deuten, beschleunigte er seinen Schritt noch, bis er etwas außer Atem in der Laube stand, in der sein Vater sich auf einer Bank niedergelassen hatte.
„Mein Herr Vater, Ihr habt mich rufen lassen.“ Johann verneigte sich tief.
Dann blickte der Herzog schweigend hinaus auf den Fluss, ohne seinem Sohn zu erlauben, sich zu setzen. Johann wurde leicht unruhig und begann, von einem Bein aufs andere zu treten. Er konnte sich denken, über welches Thema sein Vater mit ihm sprechen wollte. Das Schweigen des Herzogs wurde Johann unangenehm. Er wollte nicht einmal von der Seite ins Gesicht seines Vaters schauen und begann stattdessen, die Malereien im Inneren der Laube zu betrachten. Irgendwo zirpte eine Grille.
„Die Hofmeisterin Ihrer Gemahlin war gerade bei Uns.“ Johann holte tief Luft, doch ehe er etwas erwidern konnte, fuhr sein Vater fort: „Sie hat Uns geradezu angefleht, sie von ihrer Aufgabe zu entbinden.“
„Das tut mir sehr leid, Vater!“ sagte Johann leise und schaute seinen Vater von unten herauf an, obwohl sein Vater doch saß und er selber stand. Johann fragte sich immer wieder, wie sein Vater es bewerkstelligte, dass man immer zu ihm aufsehen musste, ganz gleich in welcher Position man gerade war. Johann spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte.
„Elisabeth hat eine ihrer alten hessischen Weisheiten von sich gegeben. Die Hofmeisterin hat sich strikt geweigert, Elisabeths Worte zu wiederholen.“
Johann schwieg und sah betreten auf seine Schuhe. Er war ein Mann von beinahe achtundzwanzig Jahren, er war seit zehn Jahren verheiratet, wurde von seinem Vater wie in Kindertagen mit Hans angesprochen und bekam Herzklopfen, wenn sein Vater ihn tadelte.
„Ich werde mit ihr sprechen“, brachte er schließlich heraus und hoffte, sein Vater werde ihn damit entlassen.
„Das haben Sie Uns nach jeder Hofmeisterin, die Elisabeth innerhalb der letzten acht Jahre1 in die Flucht geschlagen hat, gesagt. Es wird nicht genügen, nur mit ihr zu sprechen. Sie müssen auf sie einwirken. Es muss etwas geschehen. So geht das nicht weiter.“
Johanns Herzklopfen steigerte sich. Seine Eltern hatten Elisabeth für ihn ausgesucht. Ergeben hatte er sich damals in die längst verabredete Ehe gefügt. Nun machte diese Frau nichts als Scherereien und er saß auf der Anklagebank, ganz so, als hätte er sie sich ausgesucht. Wieder einmal kochte Groll in Johann auf. Doch anstatt sich zu verteidigen, schwieg er. Zu seiner Erleichterung kam sein Vater nun selbst darauf, dass Johann an dieser Verbindung die allerwenigste Schuld traf, denn der Herzog sagte: „Mit Hessen besteht nun einmal eine Erbverbrüderung. Da muss geheiratet werden. Vielleicht hätten Wir Elisabeth zu Uns nehmen und hier erziehen sollen.“ Nach einem kurzen Nachdenken fügte er hinzu: „Aber das hätte ihre Mutter niemals geduldet. Wir wissen, dass sie auch ihre guten Seiten hat. Ja, sie ist schon eine gute Frau. Wir schätzen die Gespräche mit ihr. Sie ist klug. Sie stellt Fragen, denen nicht jeder gewachsen ist. Wir unterhalten Uns ausgesprochen gerne mit ihr. Auch mit Uns spricht sie vollkommen unbefangen, ganz so als seien Wir ein alter Bekannter und nicht der Herzog von Sachsen.“ Er strich sich dabei über den kurzen, immer ordentlich gestutzten Bart, wie er es immer tat, wenn er leicht verärgert war. Hier wurde Herzog Johann unruhig. „Ich bitte Euer Gnaden, dies nicht als Respektlosigkeit auszulegen. Mit Gott spricht sie ganz genau so“, sagte er und als sein Vater fragend die Augenbrauen hob, fügte er hinzu: „Sie spricht ihre Gebete immer laut. Und mit Gott redet sie so unbefangen und freimütig wie mit Euch.“
„Ach! Mit dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde steht Ihre Gemahlin also auch auf vertrautem Fuß. Da dürfen Wir Uns wohl geschmeichelt fühlen!“ stellte der Herzog fest.
Johann, der weit davon entfernt war, Scherze seines Vaters zu bemerken, hob zustimmend die Schultern und machte ein ernstes Gesicht dazu. Zu groß war die Gefahr, dass man etwas als Scherz auslegte, das nicht so gemeint war. Und wenn man dann lachte, waren die Folgen gar nicht mehr lustig.
„Gott!“ murmelte der alte Herzog und sagte dann laut: „Aber warum erhört Gott nicht ihre Gebete? Oder betet sie nicht inständig genug um einen Sohn?“
Johann schwieg noch immer und betrachtete nun eingehend einen Käfer, der neben seinem Schuh spazierte. Der Käfer hatte lange Fühler und einen grün schillernden Panzer.
„Bemühen Sie sich denn ausreichend?“ Die Stimme des Vaters klang scharf.
„Ja, Vater, das tun wir“, erwiderte Johann gequält. Der Käfer hatte mittlerweile seinen Schuh erklommen. Modische Kuhmaulschuhe mit Schlitzen. Diese Schlitze steuerte der Käfer zielstrebig an.
„Ich bitte Euer Gnaden mir zu glauben, dass es nichts gibt, was wir uns sehnlicher wünschen.“ Die Fühler waren mitsamt dem grün schillernden Panzer in einem der Schlitze verschwunden.
„Sie dürfen sich zurückziehen, Hans.“ Das ließ Johann sich nicht zweimal sagen. Nach einer eifrigen Verbeugung eilte er davon.
Der Herzog sah seinem Sohn nach, der - warum auch immer - seinen linken Fuß sonderbar schlenkerte, und seufzte. Im Grunde schätzte Herzog Georg seine Schwiegertochter sehr. Sie war ausgesprochen volksnah und wurde von den Sachsen sehr geliebt. Sie war eine hübsche junge Frau, vierundzwanzig Jahre alt, fast so schön wie ihre Mutter Anna. Bei ihrer Schwiegermutter und deren Hofdamen war Elisabeth weit weniger beliebt. Vielleicht lag es an ihrer Jugend und Schönheit, vielleicht an ihrem Verstand, der sie den meisten Frauen am Hof überlegen machte und den sie ab und an benutzte, um sich für die ewigen Sticheleien bezüglich ihrer Kinderlosigkeit zu rächen. Vielleicht lag es daran, dass sie die einzige am Hof war, die ihm, dem regierenden Herzog, mit Unbefangenheit begegnete. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem.
Allerdings war zu befürchten, dass Elisabeth sich bei ihrem Bruder mit der martinischen2 Krankheit angesteckt hatte. Philipp von Hessen bekannte sich bereits offen zu Martin Luther. Das war der Grund, weshalb Herzog Georg ein Treffen der Geschwister zu verhindern wusste, denn wenn sich die beiden erst einmal wiedersahen, würde Philipp seine Schwester sicher vollends von dieser neuen, lästerlichen Lehre überzeugen und damit ihr Seelenheil gefährden. Dass die jungen Leute so leichtfertig damit umgingen! Sie dachten nicht daran, dass sie eines Tages sterben und vor Gott Rechenschaft ablegen mussten. Dann wäre es zu spät, sich noch zur rechten Lehre zu bekennen, um die Ewigkeit im himmlischen Frieden zu verbringen. Nicht auszudenken, was geschähe, wenn Elisabeth am Hofe zu Dresden dann ihrerseits begänne, diesen gefährlichen Unsinn zu verbreiten. Aber so weit sollte es nicht kommen. Dafür würde er schon sorgen.
Herzog Georg sah die lange dürre Gestalt des Herrn von Schleinitz durch den Garten heraneilen. In angemessener Entfernung blieb dieser stehen, verneigte sich servil, während er ein Tablett mit einem Brief dem Herzog entgegenhielt. Der Herzog winkte ihn heran und nahm den Brief.
„Ihr dürft Euch zurückziehen.“ Mit sichtlich enttäuschter Miene entfernte sich Herr von Schleinitz.
Der Herzog betrachtete das Siegel. Es war das Siegel des Kurprinzen Johann Friedrich, des Vetters seiner Schwiegertochter. Das Siegel war schnell zerbrochen und die Pergamentstreifen, mit denen der Brief geschlossen war, gelöst. Der Inhalt des Briefes veranlasste den Herzog nun doch, sich höchst selbst auf die Suche nach Elisabeth zu begeben.
Er hörte ihr Lachen schon von weitem. Das war Elisabeth. Es kam von dem geschützten Platz, etwas unterhalb der Burg, wo die Hofdamen so gerne beieinander saßen. Als der Herzog auf Hörweite herangekommen war, hielt er inne.
„Was denkt Ihr Euch?“ rief eine der Damen empört. „Der Türke steht seit Jahren vor den Toren. Das ist eine ernste Angelegenheit. Darüber macht man keine Scherze!“
„Ach! Da steht der Türke?“ Das war offensichtlich Elisabeth, die nun sprach. Aus ihrer Stimme sprach mehr als nur Belustigung. Man musste es schon als unverhohlenen Spott bezeichnen. „Ihr meint doch wohl nicht etwa diesen einen Türken, der ganz alleine das riesige osmanische Reich bevölkert. Und der steht da ganz alleine? Seit Jahren? Der Mann hat Ausdauer!“
„Hört auf zu spotten, Euer Gnaden! Das sind Dinge, die uns Frauen nicht das Geringste angehen. Das sind Angelegenheiten der Männer.“
„Sie soll lieber zusehen, dass sie einen Stammhalter zur Welt bringt!“ zischte eine andere nun, doch laut genug, dass es alle hören konnten, was mehr oder minder offenes Gelächter zur Folge hatte.
Herzog Georgs Kiefer knirschten aufeinander.
„Aber sicher doch! Nur Geduld!“ flötete Elisabeth.
„Vielleicht sollten wir den Türken hereinlassen. Ein Mann mit so viel Ausdauer könnte vielleicht sogar Euch zu einem Kind verhelfen!“ keifte eine andere.
„Oder Euch das Lesen und Schreiben beibringen“, konterte Elisabeth und brachte in Bruchteilen eines Augenblicks ihre gesamte verbale Artillerie in Stellung. Doch bevor sie noch mehr Geschütze abfeuern konnte, hatte Herzog Georg beschlossen, einzuschreiten. Er trat einen Schritt nach vorn. Die erste Dame, die seiner ansichtig wurde, erhob sich mit einem überraschten „Oh!“ von ihrem Stuhl, um sofort in einen tiefen Knicks zu fallen. Alle anderen taten es ihr eifrig nach und verharrten. Nur Elisabeth hatte sich rasch wieder erhoben und ging auf ihren Schwiegervater zu.
„Einen schönen guten Tag wünsche ich Euch, Herr Vater.“
„Wir danken Ihnen, Elisabeth. Wir möchten Sie gerne sprechen.“ Und zu den Damen gewandt: „Ihr dürft Euch erheben!“
Elisabeth hatte sofort den Brief in der Hand ihres Schwiegervaters gesehen. „Ihr habt hoffentlich gute Neuigkeiten für mich“, sagte sie und hakte sich bei ihm unter, was von den Damen, die sich aus ihrer unbequemen Haltung erhoben hatten, und den beiden nachsahen, mit erschrecktem Kopfschütteln bedacht wurde.
„Nun, wie man es nimmt. Zunächst haben Wir Fragen an Sie. Gräfin Köstritz war vorhin bei Uns. Sie weigert sich, weiterhin Ihre Hofmeisterin zu sein.“ Er hörte, wie Elisabeth geräuschvoll ausatmete.
„Was haben Sie zu dem Spaziergänger in dem Weinberg gesagt? - Aber nein, Wir wollen es lieber gar nicht wissen“, fügte er schnell hinzu und machte eine abwehrende Handbewegung. Ihm fiel ein, dass die Hofmeisterin auch Elisabeths Gang getadelt hatte. In der Tat schritt seine Schwiegertochter forsch neben ihm aus. Ihre Schritte standen seinen in nichts nach. Es war angenehm, mit ihr zu gehen. Anders als mit seiner Gemahlin, deren Getrippel mit seinem Schritt nicht mithalten konnte. Sie hatten die Treppe erreicht, die hinauf zur Burg führte; der Herzog war gespannt, ob sie auch in seiner Gegenwart zwei Treppenstufen auf einmal nehmen würde, aber sie stieg ganz artig neben ihm die Treppe hinauf.
„Elisabeth! So geht das nicht weiter. Sie müssen sich irgendwann einer Hofmeisterin beugen und Dinge von ihr annehmen, die Sie noch zu lernen haben.“
„Ich lerne ja. Ja, tatsächlich. Ich lerne wirklich viel. Allerdings lerne ich lieber beim Lesen. Apropos Lesen: Habt Ihr da nicht einen Brief für mich?“Er hielt inne und sah seine Schwiegertochter an, die aus ihren blauen Augen zu ihm auflächelte und ihn dabei so freundlich ansah, dass es ihn viel Mühe kostete, seine Strenge zu bewahren.
„Ich habe Sie heute früh in der Messe beobachtet. Ihr Gemahl versicherte mir, Sie seien sehr fromm. Aber Ihr Benehmen im Dom scheint seine Worte Lügen zu strafen.“
„Aber ich habe doch ganz fromm gebetet!“ Eine Nonne hätte kaum unschuldiger dreinblicken können. „Und Sie haben zwischendurch gegessen, getrunken und geschlafen! Das ist nicht fromm!“ „Aber die Messe dauert so ewig lange, da kriege ich zwischendurch Hunger. Ich will nur vermeiden, dass mein knurrender Magen die Messe stört. Außerdem war es nur ein ganz leises Butterbrot. Ich würde niemals wagen, Karotten oder Selleriestangen zu essen. Da bin ich ganz gewissenhaft.“ Herzog Georg traute seinen Ohren kaum. Einsicht sah anders aus. Er setzte zu einem zweiten Versuch an: „Zu Hause in Dresden vermisse ich Sie oft bei der Frühmesse. Ich muss darauf bestehen, dass meine Familie vollständig daran teilnimmt. Die fürstliche Familie muss ein Vorbild sein für die Dienerschaft und für die Untertanen. Ich bestehe darauf, dass Sie in Zukunft die Frühmesse besuchen.“ „Ach, mein lieber Herr Vater, wisst Ihr, in der Nacht liege ich so oft wach und kann nicht einschlafen. Ich bin unendlich müde und kann und kann nicht schlafen. Erst in den frühen Morgenstunden, wenn es schon zu dämmern anfängt, schlafe ich endlich ein. Dann muss ich natürlich nachholen, was ich in der Nacht an Schlaf versäumt habe. Und da ist der Schlaf in meinem eigenen Bett doch viel erquickender als der Schlaf auf einer harten Kirchenbank.“
„Elisabeth!“ sagte Herzog Georg nun mit einer Schärfe, die Elisabeth nicht von ihm gewohnt war.
„Vergebt mir, Herr Vater. Ich habe das nicht unschicklich gemeint. Es steht nicht zum Besten mit meiner Gesundheit.“ Sie schwieg.
„Genug davon. Wir wollen davon nicht mehr reden. - Ich habe etwas, das Sie aufheitern könnte.“
„Ihr meint den Brief. Habt Ihr gute Neuigkeiten? Wird mein Bruder uns endlich besuchen?“
„Zwar nicht Ihr Bruder, aber jemand, den Sie so sehr mögen, dass Sie ihn auch Bruder nennen, und der geradewegs von Ihrem Bruder Philipp kommt. Lesen Sie selbst. Der Brief ist zwar nicht an Sie gerichtet, aber Sie dürfen ihn trotzdem lesen.“
„Danke, Herr Vater. Das ist sehr liebenswürdig von Euch!“ Sie nahm den Brief, entfaltete ihn und überflog die Zeilen.
„Das sind schöne Neuigkeiten! In wenigen Tagen wird der Kurprinz hier sein. Aber wir werden ihn doch in Dresden empfangen, nicht?“
„Sicher. Morgen werden wir gleich ins Schloss zurückkehren, um alles vorzubereiten. Wir hoffen nur, er kommt nicht schon vor uns an.“
„Werden wir ein Fest feiern ihm zu Ehren? Das wäre doch eine schöne Idee, Herr Vater!“
Hier sah sich der sparsame Herzog Georg doch genötigt, einzuschreiten. Ein rauschendes Fest nach Elisabeths Geschmack wollte er sich doch nicht aus der Tasche ziehen lassen.
„Wir werden schöne Tage mit ihm haben“, sagte er in einem Ton, der deutlich genug zeigen sollte, dass man vor allem ruhige Tage haben werde. „Wir werden wie immer gut essen und trinken und Sie werden Zeit haben, sich mit Ihrem Vetter zu unterhalten. Ein Mann, der auf Brautschau war, wird sicher viel zu erzählen haben. Er ist weit gefahren.“
„Ja! Bis nach Jülich. Das ist noch hinter Köln, nicht wahr? Ein wirklich weiter Weg. Ich hoffe, er hat sich gelohnt. Ich würde mich so sehr für ihn freuen. Der Kurprinz tat gut daran, bei meinem Bruder in Marburg eine Rast von ein paar Tagen einzulegen. Wenn man allzu viele Wochen in der Kutsche hockt, ist kein Knochen mehr da wo er hingehört. - Dann werde ich meinen Jungfrauen gleich sagen, dass sie packen können.“ Mit einem flüchtigen Knicks verabschiedete sie sich und sprang leichtfüßig die Treppe hinauf.
Der Herzog sah seiner Schwiegertochter nach. Elisabeth war nicht die Frau, die sich nur nach dem Wohlergehen ihres Bruders erkundigen würde. Der Herzog wusste, dass sie darauf brannte, zu erfahren, was in der Welt vor sich ging. Hoffentlich hatte Philipp nicht auch schon den Kurprinzen Johann Friedrich angesteckt mit der martinischen Pest. Seit der Leipziger Disputation vor sieben Jahren war Herzog Georg klar geworden, dass dieser Mönch - der im letzten Jahr auch noch eine entlaufene Nonne geheiratet hatte - eine ernste Gefahr für die Kirche war. Dieser infame Mensch war nicht gewillt, die Autorität des Papstes und der Konzilien anzuerkennen und rüttelte damit an den Fundamenten der Welt. Wenn einer die gottgegebene Ordnung zerschlug, blieb nur noch Chaos übrig. Die Aufstände der Bauern hatten hinlänglich gezeigt, an welchen Abgrund dieser Luther die Welt führte.
Die Knechte waren schon seit Stunden mit dem Bepacken der Schiffe auf der Elbe beschäftigt, als der Hofstaat in etlichen Kutschen am Ufer erschien. In bunten Wellen schwappten nun Hofdamen und Kammerfrauen, Dienerschaft und schließlich auch die herzogliche Familie mit all ihren Mitgliedern ans Ufer. Für die Damen waren Baldachine in der Mitte der Schiffe gespannt, unter die sie sich sogleich vor der Sonne flüchteten.
Elisabeth hatte eine Weile am Ufer gewartet bis die herzogliche Familie mit dem Hofstaat auf dem ersten Schiff glücklich verstaut war. Herzogin Barbara tat wie immer so ängstlich auf dem Steg als ginge sie zum allerersten Mal auf ein Schiff. Herzog Georg, der als erster aufs Schiff gegangen war, empfing seine Frau an Bord, es folgten Johann und sein jüngerer Bruder Friedrich. Erst nachdem die Familie unter dem prächtigen Baldachin Platz genommen hatte, ergoss sich der restliche Hofstaat auf die fünf Schiffe. Elisabeth hatte es vorgezogen, das letzte Schiff zu nehmen und war behände über den schwankenden Steg gelaufen. Sie hatte sich im Heck des Schiffes ein Plätzchen gesucht, wo sie in aller Ruhe dem geschäftigen Treiben zuschauen konnte.
Der letzte Winter hatte viel Schnee gebracht und die Schneeschmelze war entsprechend ergiebig ausgefallen. Die Schiffer auf der Elbe hatten in diesem Frühjahr ihre liebe Not gehabt mit den braunen Wassermassen, die Geröll und ganze Bäume mit sich gewälzt hatten. Mittlerweile hatte sich die Elbe wieder beruhigt und das Wasser lag da in einer stillen, schwarzen Tiefe. „Möchtet Ihr Euch nicht zu Eurer Familie setzen?“
Es war Magister Alexius Chrosner, der Hofprediger, der zu ihr getreten war. „Danke Pater Alexius, das ist sehr freundlich von Euch, aber ich möchte lieber hier hinten sein.“
„Zu viel Trubel?“
Elisabeth lächelte und sah hinüber ans Ufer, wo die Pferde auf den Treidelpfaden bereitstanden. Die Seile, die einer der Schiffer in einem weiten Schwung über den Bug des Schiffes geworfen hatte, waren schon am engen Geschirr der Kaltblüter befestigt. Knechte prüften die Vertäuungen, schlugen den stampfenden Pferden aufmunternd auf die Kruppen oder hatten sich, wenn ihre Arbeit schon getan war, ins Gras niedergelassen und genossen einige wenige Augenblicke der Ruhe, bevor die mühselige Arbeit des Treidelns losging.
„Ich hoffe nur, wir haben keine ernsthaften Zwischenfälle“, sagte Elisabeth. „Ich denke, der Herzog hat dafür gesorgt, dass die Treidelpfade alle frei sind und keine großen Hindernisse auf uns warten. Außerdem vermute ich, dass wir ohnehin früher in Dresden ankommen werden als der Kurprinz, denn er pflegt mit so großem Gefolge zu reisen, dass er kaum vorwärts kommt. Wie Ihr ja wisst, hatte ich die große Ehre und auch das Vergnügen, der Lehrer des Kurprinzen zu sein. Er war ein guter Schüler, doch auch damals schon ein Mann, der die leiblichen Genüsse schätzte. Ich bin wahrhaftig gespannt zu sehen, ob er noch stattlicher geworden ist. Stellt Euch vor, er hat sogar immer seinen Koch und viel Küchenpersonal bei sich. Als er nämlich als ganz junger Mensch auf Reisen gewesen ist, da hat man ihm wohl etwas vorgesetzt, was ihm vollkommen ungenießbar erschien. Seitdem ist er vollkommen unabhängig von Gastwirten.“
„Ich freue mich auf ihn. Ich bin gespannt, was er von meinem Bruder Philipp aus Hessen zu berichten hat.“
Endlich ging es los. Die Schiffe legten ab, die Taue, die zwischen den Schiffen und den Pferden gespannt waren, spannten sich und langsam, Schritt für Schritt, ging es die Elbe hinauf Richtung Dresden. Elisabeth schaute in das dunkle Wasser unter ihr, wo direkt am Bauch des Schiffes Luftblasen an die Oberfläche quirlten. Es war noch kühl. Elisabeth zog sich ihren Mantel fester um die Schulter und lehnte sich auf die Reling, dem weiten Fluss zugewandt, auf dessen anderer Seite sich das Ufer im morgendlichen Dunst verlor. Ein Lastkahn fuhr zügig stromabwärts.
„Man kommt in der Mitte des Flusses stromabwärts so schnell vorwärts. Oft schneller als einem lieb ist. Aber hier, in der Nähe des Ufers stromaufwärts da glaubt man kaum, dass man jemals sein Ziel erreichen wird.“
Elisabeth schwieg und schaute wieder ins Wasser, wo jetzt die Wellen, die der Lastkahn verursacht hatte, an den Schiffsrumpf plätscherten. Die Elbe hatte einen eigentümlichen Duft. Elisabeth mochte diesen Duft nach klarem, tiefen Wasser und sog ihn ein.
„Welche Ziele habt Ihr?“ fragte der Pater leise.
Elisabeth schaute auf, als die Kaltblüter aufwieherten. Irgendetwas musste die Tiere erschreckt haben, denn die Knechte versuchten, die sich aufbäumenden Tiere zu beruhigen. Dies gelang ihnen bald und die Seile spannten sich wieder. Die Pferde zogen wieder mit aller Kraft, Peitschen knallten, kaum hatte man die Verzögerung wahrnehmen können.
„Ich habe nur ein Ziel und das ist wohl allgemein bekannt. Und die Tatsache, dass ich dieses Ziel wohl niemals erreichen werde, ist offensichtlich. Zu Beginn meiner Ehe hat meine Mutter noch versucht, mich zu trösten, schließlich hat sie auch zwei Jahre lang warten müssen, bis ich kam. Aber bei mir sind es nun schon acht Jahre, die ich hier in Dresden mit meinem Gemahl verbringe. Da schwindet die Hoffnung langsam aber sicher.“
„Verzeiht mir. Das habe ich nicht gemeint. Vielleicht habt Ihr auch noch ein Ziel, das nichts mit Eurem Stand, den Euch von Menschen vorbestimmten Aufgaben zu tun hat?“
„Ich kann kaum an etwas anderes denken“, flüsterte Elisabeth. „Natürlich weiß ich, dass ich meine Pflicht erfüllen muss. Ich beneide meine Schwägerin Magdalene, die schon einen gesunden Sohn zur Welt gebracht hat, aber mir geht es nicht nur um einen Stammhalter. Es geht mir darum, ein Kind zu haben. Ein Mädchen oder einen Jungen, das ist mir völlig gleich. Ich will ein KIND in meinen Armen halten. Ich will seinen Kinderduft riechen, ihm über sein Köpfchen streicheln und den zarten Flaum spüren, ich will seine winzigen Händchen und Füßchen streicheln. Ich möchte spüren, wie es meinen Finger mit seiner kleinen Hand ergreift und festhält. Es ist so ungerecht. Ich habe doch nichts verbrochen, dass Gott mich so strafen müsste!“ Pater Alexius sah sie von der Seite an. Er konnte deutlich erkennen, wie sie tapfer ihre Tränen niederkämpfte, wobei sie starr zum anderen Ufer hinüber sah.
„Vielleicht solltet Ihr es in Gottes Hände legen. Ihr wisst doch, wie wir immer beten: Dein Wille geschehe! Ich bin sicher, dass Gott Euch liebt und nicht strafen will. Ich bin sicher, dass Ihr später - und das kann bedeuten sehr viel später - erkennen könnt, dass es so besser war. Habt Geduld! Und haltet fest an Eurem Glauben, dass Ihr Gottes bedingungslos geliebtes Kind seid. Daran dürft Ihr niemals zweifeln. Das ist die wichtigste Erkenntnis Martin Luthers.“
„Ihr habt recht, lieber Chrosner. Gott wird’s wohl machen.“
1 Elisabeth kam erst zwei Jahre nach der Hochzeit nach Dresden.
2 Martinisch nannte man damals die Anhänger Martin Luthers. Die Bezeichnung Protestanten kam erst im Jahre 1529 auf, als die martinischen Fürsten auf einem Reichstag gegen die Reichsacht über Luther protestierten.
Dresden im Mai 1526
Kurprinz Johann Friedrich war noch nicht eingetroffen und dieser Umstand erlaubte es dem Herzog, in aller Ruhe seine Vorbereitungen zu treffen. Vor allem musste Wein aus den Kellern heraufgeholt werden, denn der Kurprinz war dafür bekannt, dass er gerne und viel trank.
Am darauf folgenden Tag kündigten die Türmer das Herannahen des Kurprinzen Johann Friedrich von Sachsen an. Und nach etwa drei Stunden traf tatsächlich der lange Zug von Wagen und Berittenen am Dresdner Schloss ein. Der Zug von Wagen war so lang, dass Herzog Georg schon glaubte, Johann Friedrich habe die Braut mitsamt ihrer Aussteuer gleich mitgebracht, aber dem war nicht so.
Pater Alexius hatte nicht übertrieben: Der Zug, der dem prächtigen Wagen des Kurprinzen folgte, wollte gar nicht mehr enden. Es ritten über zweihundert bewaffnete Soldaten zum Schutz des Wagens mit, außerdem etliche Wagen, auf denen der Herzog seine Kleidung, Geschenke, Küchengerät, Vorräte, wichtige Räte und Schreiberlinge verstaut hatte. Außer den Schreibern und Räten, die wie ihr Herr unter einem Baldachin sitzen durften, war alles andere unter gewachsten Planen festgezurrt. Den Wagen folgte schließlich noch ein Heer von Knechten, die immer für einen reibungslosen Ablauf der Reise zu sorgen hatten, aber oft genug durch höhere Gewalt an der Ausführung ihrer Aufgabe gehindert wurden, denn Gewitter und Hagelstürme konnten auch sie nicht bannen.
Elisabeth beobachtete, wie sich der junge Mann bedächtig von seinem Sitz erhob, um endlich wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Obwohl er im Juni erst seinen dreiundzwanzigsten Geburtstag feiern würde, hatte er etwas Behäbiges an sich. Man sah ihm sofort an, dass er ein den leiblichen Genüssen zugetaner Mensch war. Sein Genießen beschränkte sich aber offenbar auf kulinarische Genüsse, denn seine Kleider waren schlicht und einfach und entbehrten aller Schleifen, Verzierungen und Bänder, die jetzt so sehr in Mode waren. Ein Diener stellte ein kleines Treppchen vor den Wagen des Kurprinzen, damit seine Gnaden so elegant wie möglich dem Wagen entsteigen konnten. Endlich hatte er seinen umfangreichen Körper auf den Hof gestellt und schaute Herzog Georg und Herzogin Barbara an, die mit ihrem ganzen Hofstaat bereitstanden, um den hohen Gast zu empfangen.
„Wir sind froh, Euch wohlbehalten in unserem Schloss begrüßen zu können. Wir hoffen, Ihr hattet eine angenehme Reise“, sagte Herzog Georg, als er sich aus seiner knappen Verbeugung wieder aufgerichtet hatte. Auch Herzogin Barbara erhob sich wieder aus ihrem tiefen Hofknicks, worauf sich der Hofstaat gleichfalls erhob.
„Ja, das hatten wir“, sagte der Kurprinz und lachte. „Aber das Ankommen ist noch das Angenehmste an einer Reise.“ Sein ganzes Wesen hatte etwas fröhlich Dröhnendes, das in krassem Gegensatz zur Strenge und Steifheit des Herzogs stand.
„Dann dürfen Wir Euch bitten einzutreten. Fühlt Euch ganz wie zu Hause. Wir sind wahrhaftig froh, dass Ihr Uns die Ehre erweist, auch Uns einen Besuch abzustatten.“
Die Herzogliche Familie ging ins Schloss, die Hofgesellschaft folgte.
„Es gibt hier in Dresden übrigens jemanden, der darauf brennt, zu erfahren, wie es in Hessen steht“, versuchte es der Herzog nun im Plauderton.
„Ja, ich habe viele herzliche Grüße auszurichten und ein schönes Geschenk abzuliefern“, rief der Kurprinz. Elisabeth trat vor und knickste tief, wie es sich gehörte. Als sie sich erhob, strahlte sie den ihn an. „Euer Gnaden haben Neuigkeiten von meinem Bruder?“
„Ja, und nur die besten! Wir werden Euch ausführlich berichten. Bei einem Glas Wein und Braten könnt Ihr uns alles fragen, was Ihr nur wissen wollt.“ „Ich danke Euer Gnaden.“
„Wenn es Euer Gemahl erlaubt, würde ich Euch gerne zu Tisch führen. Herzog Johann? Erlaubt Ihr?“
„Selbstverständlich,“ sagte Johann mit einer tiefen Verbeugung.
„Dann sehen wir uns beim Essen. Ich hoffe, Ihr habt ein Bad gerichtet. Ich fühle mich, als hätte ich den Staub von hunderten von Meilen an mir kleben.“
„Aber sicher doch. Es ist alles bereit. Ich bin sicher, Eure Kurfürstlichen Gnaden werden alles zufriedenstellend finden“, versicherte die Herzogin.
Nur die engsten Bediensteten und Räte des Kurfürsten waren der Hofgesellschaft durch den Vordereingang ins Schloss gefolgt. Die Soldaten, von denen sich schon viele im Dresdner Schloss auskannten, brachten ihre Pferde in die Stallungen und bezogen ihre Unterkünfte.
Die Kutsche war gleich weitergefahren zu einem Hintereingang, wo die Diener fürs Grobe bereits das Reisegepäck des Kurprinzen abgeladen und in die für ihn vorgesehenen Gemächer geschleppt hatten. Dort war tatsächlich schon ein riesiger Bottich heißen Wassers vorbereitet, damit der hohe Gast gleich baden konnte. Ein Diener des Herzogs, der den Kurprinzen schon einmal gesehen hatte, hatte dafür gesorgt, dass die Mägde den Bottich nicht allzu voll gemacht hatten. Der umfangreiche Leib des jungen Herrn füllte den Bottich ohnehin fast aus. Außerdem hatte er schon einen kleinen Imbiss bereitgestellt, damit der Gast bis zum Abendessen nicht verhungert und verdurstet war.
Der Kurprinz wusste diese Aufmerksamkeiten sehr zu schätzen und genoss sein Bad essend und trinkend, bevor er sein Festkleid anlegte.
Es war schon fast dunkel, als man zu Tisch schritt und sich an einer festlich gedeckten Tafel niederließ. Der Herzog hatte offensichtlich die gesamte Silberkammer gelehrt und alles verfügbare Tischgerät, das auch nur annähernd glänzte, auf der Tafel platzieren lassen. Silberne Leuchter verströmten ihr duftendes Licht, in kostbaren Schalen waren Frühlingsblumen und blühende Zweige zu sehen und auch die Menschen hatten sich allesamt für ihren hohen Besuch herausgeputzt. Einzig und allein der Kurprinz trug ein schlichtes Gewand. Niemand hätte gewagt, ihn darauf anzusprechen, doch schließlich fühlte er sich wohl selbst genötigt, sich zu erklären. „Die modernen Kleider sind ja alle ganz schön, aber ich trage lieber meine schlichten Gewänder. Wisst Ihr, Elisabeth, mit diesen Schlaufen und Schleifchen, die selbst einen Söldner in einen Harlekin verwandeln, bleibt man überall hängen. Und außerdem bin ich auch so stattlich genug. Ich muss mich doch nicht aufplustern wie ein Amselhahn auf Brautschau.“ Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, der daraufhin bedenklich knarzte und strich sich über den dicken Bauch.
Elisabeth lachte. „Ich schätze, Ihr wart auch ohne Aufplustern erfolgreich auf Brautschau.“ Der Kurprinz neigte sich etwas zu ihr und sagte: „Sie ist jung und schön, wie es sich für eine Braut gehört. Und sie ist sanftmütig, wie man sich ein Eheweib nur wünschen kann.“
„Da habt Ihr richtig Glück gehabt!“ Elisabeth freute sich mit ihm. „An einer solchen Braut gibt es nichts auszusetzen.“
Der Kurprinz fügte leise hinzu: „Ja - und ihre wirklich überaus stattliche Mitgift werde ich ihr auch nicht zum Vorwurf machen.“ Er lachte und zwinkerte ihr zu.
„Ihr seid ein wirklich herzensguter Mensch. Auch Eure Braut hat nichts zu klagen!“
„Ja, und ich habe geradezu tollkühne Ideen, wie ich unser schönes Torgauer Schloss noch komfortabler machen kann. Wenn alles fertig ist, müsst Ihr unbedingt kommen. Euch werden die Augen übergehen.“
„Und was genau ist so tollkühn?“
„Ich werde bis in meine obersten Gemächer reiten können und dort wird man mir den Wein von Zauberhand servieren.“
Elisabeth lachte laut auf. „Wie soll das denn gehen? Bis in die obersten Gemächer reiten! Ihr habt sonderbare Einfälle. Wird Euer Vater davon begeistert sein?“
„Ihn werde ich schon überzeugen. Was ich vorhabe, ist ganz und gar außergewöhnlich. Das wird unsere Gäste beeindrucken. Von Zauberhand, sage ich Euch, wird bei mir der Wein serviert werden.“
„Oh, seht, hier wird zwar nicht von Zauberhand serviert, doch was dort kommt, kann sich sehen lassen“.
Die Tische waren in einem Halbkreis aufgebaut, so dass in der Mitte die Bediensteten genügend Platz hatten, Schüsseln und Platten, beladen mit Köstlichkeiten, auf die Tische zu stellen. Zufrieden bemerkte der Kurprinz, dass zwei Diener, die zwischen sich eine Platte mit einem riesigen Spanferkel trugen, direkt auf ihn zusteuerten.
„Lasst es Euch schmecken. Wohl bekomm’s!“ sagte Herzog Georg und hob seinen Pokal dem Gast entgegen. Alle taten es ihm nach. Auch Kurprinz Johann Friedrich hob seinen Pokal. „Wir danken Euch für die Gastfreundschaft. Selten hatten Wir eine so angenehme Reise.“ Er leerte den Pokal in einem Zug. Nicht allen gelang es, ihm dies nachzutun. Elisabeth nippte nur an ihrem Wein, wie die meisten Frauen.
„Und an dieser Stelle möchten Wir auch verkünden, dass Wir uns im September mit einem schönen jungen Fräulein verloben werden.“
Hier stellten alle ihre Gläser und Pokale ab und applaudierten. Glückwünsche und Vivat-Rufe wurden laut. Zu Elisabeth gewandt fügte er hinzu: „Aber nun lasst uns endlich essen, sonst sind Wir bis September vom Fleisch gefallen.“
Er ließ sich vom Küchenmeister Fleisch auftun, griff bei Brot und Gemüse deutlich weniger zu und aß mit einem Appetit, der Seinesgleichen suchte.
„Wäret Ihr so freundlich, uns von Eurer Braut zu erzählen?“ wandte sich Herzog Georg an seinen Gast.
„Aber sicher“, entgegnete Kurprinz Johann Friedrich, bei dem Elisabeth schon beobachten konnte, wie ihm der Bratensaft in den Bart lief.
„Sie heißt Sibylle und ist die älteste Tochter des Herzogs Johann von Kleve. Auf Schloss Burg in der Nähe von Wuppertal werden Wir Uns im September mit ihr verloben. Heiraten werden Wir im kommenden Jahr in Torgau. Und Ihr seid alle eingeladen!“ dröhnte er. Wieder applaudierte man.
„Zum Glück ist es nicht so weit von Dresden nach Torgau. Die Reise war beschwerlich, das können Wir Euch sagen. Einmal mussten Wir sogar LAUFEN! WIR mussten LAUFEN! Weil die Wege so katastrophal schlecht waren, von einem Weg konnte gar nicht mehr die Rede sein. Alles war aufgeweicht. Die Straße glich vielmehr einem elenden Sumpf. Es hat Tage gedauert, bis wir wieder weiter konnten. Dann brach noch eine Achse an einem der Versorgungswagen. Aber immerhin hat Unser guter Koch ein ordentliches Essen gekocht. Dieser Mann ist kaum mit Gold aufzuwiegen. Wir haben ihn immer mit dabei auf Unseren Reisen. Schließlich haben Wir keine Lust, Uns von irgendeinem Gauner von Wirt in einer schmutzigen Heckenwirtschaft mit einem gesottenen Maulwurf vergiften zu lassen.“ Wieder lachte er laut und fröhlich.
Elisabeth warf ihrer Schwiegermutter einen verstohlenen Blick zu. Herzogin Barbara musste sich um ein Lächeln sichtlich bemühen. Man konnte diesen Menschen nicht tadeln, schließlich war er ein Kurprinz, aber offensichtlich konnte Frau Barbara das kurprinzliche Benehmen nicht gutheißen. Die alte Herzogin war sehr auf Etikette und Benehmen bedacht, weshalb Elisabeth zu Beginn ihrer Zeit in Dresden mehr als einmal mit ihr aneinander geraten war. Als Elisabeth sich dann hatte rechtfertigen wollen und gesagt hatte, dass man in Felsberg und Spangenberg durchaus mit den Dienstboten plaudern, lachen und an heißen Sommertagen die Arme in einer Pferdetränke kühlen konnte, hatte ihre Schwiegermutter ihr strikt verboten, Sätze zu sagen, die mit „In Spangenberg“ oder „In Felsberg“ anfingen.
Elisabeth bereitete es eine geheime Freude, dass sie mit dem Gast reden und lachen durfte, ohne dass ihre Schwiegermutter einschreiten konnte.
Nun, da die Gäste mit dem Notwendigsten versorgt waren und die Diener nur noch schauen mussten, wessen Pokal leer war und wo leere Schüsseln durch volle ersetzt werden mussten, traten drei Musiker in den Kreis. Herzog Georg hatte doch mehr Geld ausgegeben als er ursprünglich geplant hatte. Da hatte sicher Herzogin Barbara angedeutet, dass man bei einem solchen Gast nicht auf Musik verzichten könne.
Die bunt gekleideten Männer, die immer wieder am Hof spielen durften, ohne fest von dem Herzog eingestellt zu werden, waren Meister ihres Faches. Es gab einen großen, der Flöte spielte, von den beiden kleinen spielte der dünne die Drehleier und der dicke schlug sehr sachte eine kleine Trommel. Nur leise spielten sie, weil sie die Gespräche der Herrschaften nicht stören wollten, doch waren ohnehin bald alle Gespräche verstummt, denn Musik war etwas zu Seltenes an diesem Hof. Die drei Männer in der Mitte woben einen Teppich aus Tönen, der bunt und farbenprächtig im honigfarbenen Licht der Kerzen schwebte.
„Meine Braut liebt auch die Musik. Sie spielt sogar mehrere Instrumente. Bewundernswert. Wirklich wahrhaft meisterlich“, flüsterte der Kurprinz, ohne den Blick von den Musikern zu wenden. Elisabeth lächelte. Johann Friedrich war wirklich begeistert von seiner zukünftigen Frau. Sie hoffte nur, dass dies auf Gegenseitigkeit beruhte. Sie selbst haderte noch immer damit, dass man sie im Säuglingsalter schon versprochen und alle Verträge ausgehandelt hatte, ohne dass sie hätte mitbestimmen können. Zwischen ihr und Johann hatte sich mittlerweile gegenseitiger Respekt entwickelt. Immerhin. Das war mehr als man gemeinhin erwarten konnte. Liebe? War nicht vorgesehen. Elisabeth seufzte und griff nach den süßen Kuchen. Sie musste noch eine ganze Weile warten, bis die Tafel endlich aufgehoben wurde und man sich in der Mitte zum Tanzen traf, umherflanierte oder sich in kleinen Grüppchen zusammenfand, um zu plaudern. Elisabeth liebte das Tanzen und hatte auch an diesem Abend vor, es ausgiebig zu tun. Mit dem Kurprinzen und ihrem Schwager Friedrich, dem einzigen am Hof noch lebenden Bruder Johanns. Die anderen Brüder waren alle schon gestorben, die Schwestern, wenn sie nicht gestorben waren, hatten geheiratet und waren ihren Ehemännern gefolgt. Elisabeth mochte Friedrich sehr gerne. Er war ihr innerhalb kürzester Zeit ans Herz gewachsen und erschien ihr wie ein blasses Abbild ihres Gemahl, denn Friedrich war dem Vater gegenüber noch ehrfürchtiger, noch furchtsamer als Johann. Wenn sie sich in freundlicher Vertrautheit mit ihrem Schwiegervater unterhielt und sogar mit ihm lachte, sah sie immer wieder eine offene Bewunderung in seinen Augen, wie man vielleicht einen tollkühnen Menschen bewundert, der ein unberechenbares, wildes Tier zu zähmen weiß. Vielleicht würde sie auch mit ihrem Gemahl tanzen, wenn er nicht allzu erschöpft war. Er war schon in seiner Jugend von schwacher Konstitution gewesen. Daran hatte sich leider nichts geändert.
Die Musiker begannen mit einer Pavane, einem langsamen Tanz, der den älteren Herrschaften sehr entgegenkam, da man nur würdevolle Schritte zu machen, ab und an die Fersen zu heben brauchte und garantiert nicht ins Schwitzen kam. Der Kurprinz bat Herzogin Barbara um den ersten Tanz, worauf Herzog Georg seiner Schwiegertochter die Hand bot.
„Es wird mir eine Ehre sein, Herr Vater!“ sagte sie und nahm die ihr dargebotene Hand.
Johann glaubte offensichtlich, etwas gutmachen zu müssen, denn er hatte Gräfin Köstritz zum Tanz aufgefordert. Sie nahm seine Hand etwas steif und warf Elisabeth einen kurzen, aber noch immer sehr verärgerten Blick zu, worauf Johann die Hoffnung aufgab, sie zu einer Wiederaufnahme ihres Amtes als Elisabeths Hofmeisterin zu bewegen. Johann war die Liebenswürdigkeit selbst, neigte sich mit einem besonders freundlichen Lächeln seiner Tanzpartnerin zu, passte seine Schrittlänge genau der ihren an, was die Gesichtszüge der älteren Dame schließlich doch ein wenig aufweichte. Elisabeth sah man an, dass eine Pavane sie nicht auslastete und sie sich schon auf die anschließende Gaillarde freute. Sie hob nicht nur die Fersen, sondern sprang und war erleichtert, als das Schreiten endlich ein Ende gefunden hatte. Herzog Georg brachte sie zurück auf ihren Platz, doch gleich war Albrecht, ein junger Höfling, zur Stelle und forderte sie auf zur Gaillarde. Albrecht war ein Diener Herzog Johanns; ein kleiner Adliger, dessen Herkunft den jungen Herzog nicht weiter interessiert hatte - bis zu dem Punkt, als offensichtlich seiner Gemahlin Elisabeth aufgefallen war, dass dieser junge Mann ausnehmend gut tanzte.
Weitere Paare fanden sich zusammen und nahmen Aufstellung, während die Musikanten ihre Instrumente neu stimmten. Herzog Georg und Herzogin Barbara zogen sich wie viele der Älteren auf ihre Sitzplätze zurück und beobachteten nun, wie Elisabeth und dieser Höfling, dessen Namen sie sich nicht einmal gemerkt hatten, die temperamentvollen Sprünge der Gaillarde ausführten. Johann stand am Fenster und versuchte so unbeteiligt wie möglich auszusehen. Gräfin Köstritz war Elisabeths Tanzen natürlich nicht entgangen, ebenso wenig wie den Herren Schönberg und Schleinitz, die sich nur kopfschüttelnd ansahen. (Schönberg war verärgert, dass die Hofmeisterin sich auch ihm gegenüber strikt geweigert hatte, Elisabeths Reim preiszugeben.) So viel Übermut konnte nur mit der martinischen Lehre zusammenhängen. Wenn der Bruder Philipp sich schon offen zu den Lehren Luthers bekannte, dann war diese Elisabeth sicher auch nicht weit davon entfernt. Da konnte man sehen, wohin es führte, wenn Menschen sich von der alten Ordnung abwandten: Es begann mit wilden Tänzen und führte unweigerlich zu Bauernaufständen.
Doch auch die anderen jungen Paare hatten sehr offensichtlich ihre Freude an dem Tanz, der eher ihrem jugendlichen Naturell entsprach. Der Kerzenschein verlieh den seidenen Gewändern einen geheimnisvollen Schimmer, der Schmuck blitzte auf, und der Flöter spielte nun die Sackpfeife, um den Lärm der vielen springenden Füße zu übertönen.
Um den Tanzenden eine kleine Pause zu gönnen, spielten die Musikanten nach der Gaillarde eine etwas langsamere Allemande. Elisabeth tanzte nun mit ihrem Gemahl. Das tat sie betont freundlich, um ihren Widersachern die Mäuler zu stopfen. Mit einem besonders liebevollen Lächeln strahlte sie bei jedem Knicksen und Verneigen ihren Gemahl an, um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wem ihr ganzes Herz gehöre, doch auch dies wurde ihr wieder zum Schlechten ausgelegt. Dem eigenen Gemahl so schöne Augen zu machen, als sei man frisch verliebt, das gehörte sich einfach nicht, wie die Köstritzsche mit immer fester verkniffenen Lippen feststellte!
Danach tanzte Elisabeth mit dem Kurprinzen und Johann hatte eine der Hofdamen aufgefordert. Elisabeth spürte den heftigen Atem des Kurprinzen bei jedem Schritt und jedem Sprung. Der Schweiß rann ihm über die Stirne und die Wangen in seinen Kragen.
„Sollen wir für eine Weile pausieren?“ fragte sie.
„Nein, nein. Es geht schon“, erwiderte er keuchend.
„Ich würde liebend gerne etwas trinken und frische Luft schöpfen“, beharrte Elisabeth und sah, dass Johann Friedrich geradezu erleichtert war, als der Tanz zu Ende war und er die Tanzfläche verlassen konnte.
Die beiden gingen zu einem der offenen Fenster, wo ein Diener ihnen ein Tablett mit vollen Kelchen reichte. Elisabeth fühlte sich nun sicher vor Lauschern. Die Musik war laut genug, um ihr Gespräch nicht allzu weit dringen zu lassen.
„Nun berichtet mir aus Hessen! Wie geht es meinem Bruder und seiner Frau? Ich habe sie Ewigkeiten nicht sehen dürfen!“ fragte Elisabeth und nahm einen Schluck aus ihrem Pokal.
„Wie? Ihr durftet sie nicht sehen? Verbietet es Euch der Herzog?“ Kurprinz Johann Friedrich war sichtlich überrascht.
„Er verbietet es nicht gerade, aber er erlaubt es auch nicht. Immer kommt irgendetwas dazwischen. Mal ist Krieg, dann ist Pest. Das sehe ich noch ein. Aber dann ist schlechtes Wetter, wogegen ich mich ohne weiteres wappnen könnte. Oder der absolut einzige Kutscher, der im ganzen Herzogtum Sachsen aufzutreiben ist, hat Zahnweh oder die Frau des Kutschers hat gerade ihren Waschtag oder die Gäule haben eingewachsene Fußnägel. Immer ist irgendwas. Alles Bitten und Flehen nützt nichts. Aber nun! Berichtet mir!“
Der Kurprinz lachte schallend. Als er sich schließlich beruhigt hatte, erwiderte er: „Eurem Bruder und seiner Gemahlin geht es ausgesprochen gut. Sie sind beide wohlauf. Und ich habe Euch etwas mitgebracht von Eurem Bruder. Ein Geschenk.“
„Ein Geschenk für mich?“ fragte Elisabeth überrascht.
„Ja, und es ist etwas ganz Besonderes“, flüsterte Kurprinz Johann Friedrich.
„Eine Kiste aus Holz. Aber diese Kiste hat es in sich.“
„Wollt Ihr mir nicht erklären, was es damit auf sich hat?“
„Die Kiste, die sehr kostbar gearbeitet ist, hat einen doppelten Boden. Unter diesem hat Euer Bruder etwas versteckt, das Euch entzücken wird.“
„Dann bin ich gespannt! Werden sie denn bald Nachwuchs haben?“ fügte sie leise hinzu.
„Nein, soweit ich das erkennen konnte, ist Eure Schwägerin nicht in gesegneten Umständen.“
Elisabeth schwieg und sah zu Boden. Der Kurprinz war etwas unsicher. Kinder waren ein heikles Thema bei Elisabeth.
„Euer Bruder hat große Pläne“, versuchte Johann Friedrich sie nun abzulenken. „Er will die Reformation einführen und hofft, dass der Kaiser bald die Voraussetzungen dafür schaffen muss, auch wenn er es gar nicht will.“
„Ich störe hoffentlich nicht!“ sagte jemand, den die beiden gar nicht bemerkt hatten.
„Pater Alexius!“ rief der Kurprinz erfreut. „Ich hatte gehofft, Euch hier anzutreffen. Ich habe mit Freuden gehört, dass Herzog Georg Euch zum Hofprediger ernannt hat, trotz Eurer martinischen Gesinnung.“
„Der Herzog lauscht meinen Predigten zwar mit interessiertem Wohlwollen, aber mit demselben interessierten Wohlwollen würden seine Gnaden sicher auch einen Regentanz der Wilden in der neuen Welt anschauen. Ich muss mir also nicht zu viel einbilden. Immerhin - so darf ich wohl hoffen - würde er sich eher von mir überzeugen lassen, als bei den Wilden mitzutanzen.“ Elisabeth und der Kurprinz lachten. „Ich denke, Herzog Georg würde sich überzeugen lassen, wenn da nicht seine Räte wären, die ihm immer wieder diesen altgläubigen Unsinn einblasen.3“
„Elisabeth, Ihr wisst sicher, dass Pater Alexius mein Lehrer war. Er hatte seine liebe Not mit mir, das kann ich Euch sagen!“
„Nun, ganz so schlimm waren Eure kurfürstlichen Gnaden nicht. Ich habe mich nach Kräften bemüht, Euch etwas mehr als das Nötigste beizubringen“, sagte der Pater und verneigte sich.
„Ich glaube, das ist Euch gelungen“, erwiderte Elisabeth. „Wir sind gerade bei einem Thema, das auch Euch interessieren wird. Kaiser Karl steckt in Schwierigkeiten“, sagte Elisabeth und Johann Friedrich fügte hinzu: „Ja, der Kaiser ist nicht allmächtig. Und immer mehr Fürsten werden martinisch. Der Kaiser könnte in eine Situation kommen, in der er auf die martinischen Fürsten angewiesen ist.“ Pater Alexius schaute sich um. Eine Vertraute der alten Herzogin war in ihre Nähe gekommen. Die drei verstummten und sahen nun, wie ein Gaukler in die Mitte des Saales trat und sich tief verneigte. Plötzlich hatte er bunte Bälle in den Händen, die er einer Hofdame hinter den Ohren hervorgeholt zu haben schien und begann zu jonglieren.
Elisabeth sah den Gaukler an, schaute auf seine Hände, die so sicher mit den Bällen umgingen, als gehorchten sie ihm aufs Wort. Sie sah seinen unrasierten Hals, seinen Adamsapfel auf und niedergehen; wie er mit den Augen dem Flug seiner Bälle folgte und dabei seine Späße machte.
Elisabeth merkte kaum, wie ihre Hand nach dem Veilchen-Medaillon griff, das sie um ihren Hals trug. Sie schüttelte die Erinnerungen und die Sehnsucht ab und sah gemeinsam mit Johann Friedrich dem Gaukler zu. Die beiden lachten über seine Späße und machten ganz den Eindruck, als interessiere sie nichts mehr, als die Flugbahnen der bunten Bälle. Pater Alexius schaute zwar auch zu, beschränkte sich aber auf ein wohlwollendes Lächeln. Als die Hofdame weitergegangen war und sie sich wieder sicher fühlen konnten, sagte der Pater: „Dann gehe ich recht in der Annahme, dass diese Schwierigkeiten unserer martinischen Sache zugute kommen könnten.“
„Ganz recht. Der Kaiser kann seit geraumer Zeit seine Truppen nicht mehr bezahlen. Er liegt mit dem französischen König Franz I. im Krieg. Es geht um Gebiete in Oberitalien, die jeder für sich beansprucht. Vor zwei Jahren hat Karl Marseille belagert - ohne Erfolg. Sie mussten die Belagerung schließlich aufgeben und sich zurückziehen. Dann wurden sie von französischen Truppen angegriffen und bis nach Pavia zurückgedrängt. Dort wendete sich das Blatt. Karl gelang es, die Franzosen zu schlagen und ihren König gefangen zu nehmen. Er zwang Franz I. zu einem Friedensvertrag, in dem dieser ihm die Gebiete in Oberitalien überlassen sollte. Und dann entließ er ihn aus der Gefangenschaft.“
„Was für ein Schachzug!“ sagte Elisabeth und verdrehte die Augen. „Und der freigelassene Franz hatte natürlich nichts Eiligeres zu tun, als den Vertrag für nichtig zu erklären, nicht wahr?“
„Natürlich. Und dabei wurde er vom Papst unterstützt. Karls Berater hatten ihm abgeraten, den König laufen zu lassen. Sie trauten dem Franzosen nicht, doch Karl hatte wohl an das Ehrgefühl des Königs appelliert.“ Der Kurprinz klang fast ein wenig mitleidig.
„Der Kaiser scheint noch aus einer anderen Welt zu stammen. Das ist so gestrig! Den Kampf um die Gebiete in Oberitalien - den hat doch sein Großvater, Kaiser Maximilian, schon geführt.“
„Ja, und Maximilian hat sich dort auch schon aufgerieben“, sagte Pater Alexius.
„Aber wenn der Kaiser die Gebiete in Oberitalien jetzt nicht hat, müsste er weiter um sie kämpfen. Und dafür fehlt ihm das Geld, oder?“ vermutete Elisabeth.
„So ist es. Er hätte diese Kriegsbeute dringend gebraucht, um seine Truppen zu bezahlen.“
In diesem Moment näherten sich die Herren Schönberg und Schleinitz. Elisabeth hatte sie aus den Augenwinkeln gesehen und rief nun: „Was Euer Kurfürstliche Gnaden nicht sagen! Über und über mit Schleifchen bedeckt? Das sieht sicher ganz entzückend aus. Ich werde morgen gleich ein solches Kleid in Auftrag geben. Aber berichtet mir doch, was trägt man denn im großen Köln auf dem Kopf?“
„Bestickte Hauben. Und damit sie auch zu den Kleidern passen, sind auch die Hauben über und über mit bestickten Schleifchen besetzt“, ging der Kurprinz auf ihr Ablenkungsmanöver ein.
„Ich weiß nicht, ob ich so viele Schleifchen gutheißen kann!“ sagte Pater Alexius laut und in deutlich pikiertem Ton.
Schönberg und Schleinitz konnten keinen Grund finden, noch langsamer zu gehen und waren schließlich an den dreien, die dazu übergingen, sich über schleifchenbestückte Schuhe auszulassen, vorbei und außer Hörweite.
Elisabeth lachte in sich hinein. „Schleifchen! Gut! Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Karl. Was sind das für Männer, die für ihn kämpfen?“
„Sein Heer besteht aus deutschen Landsknechten, spanischen Söldnern und Italienern. Diese Männer kämpfen allein für Sold. Den haben sie schon seit zwei Jahren nicht mehr regelmäßig bekommen“, berichtete Johann Friedrich.
„Wie stark ist dieses Heer?“ fragte Elisabeth.
„Die Schätzungen bewegen sich zwischen zwanzig- und dreißigtausend Mann. Dann werden es wohl um die fünfundzwanzigtausend sein.“
Chrosners Gesicht wurde sehr ernst. „Fünfundzwanzigtausend unbezahlte Söldner. Ein solches Heer ist wie ein tollwütiger Hund, den kein Herr mehr bändigen kann. Und dieses Heer versorgt sich selbst, nicht wahr?“ Der Kurprinz nickte düster.
„Man kann sich kaum vorstellen, was das für die Bevölkerung heißt. In einem solchen Krieg sind nicht nur die Schlachtfelder Orte der Verwüstung, sondern überall, wo sich dieses Heer hindurchwälzt, schlägt es eine Schneise der Verwüstung, des Elends und des Todes.“ Für eine Weile schwieg Alexius Chrosner. Seine Augen bekamen eine Tiefe, die Kurprinz Johann Friedrich bei ihm nur sehr selten gesehen hatte. Er schien in eine andere Zeit zu schauen.
„Habt Ihr selbst schon solche Verwüstung erlebt?“ fragte er leise.
„Ich denke, ich habe nur eine winzige Ahnung dessen erlebt, was die Menschen in Frankreich, Italien und in anderen Teilen Deutschlands schon seit Jahren erleben. Aber wie dem auch sei, Karl steckt in der Klemme. Er muss seine Männer bezahlen oder sie werden ihm - bestenfalls - alle davonlaufen. Er braucht die deutschen Fürsten. Alle. Er kann sich nicht nur auf die katholischen stützen. Er braucht auch die martinischen.“
„Schon im nächsten Monat soll in Speyer ein Reichstag stattfinden. Dort wird er Zugeständnisse machen müssen.“
„Meint Ihr, er wird das Wormser Edikt4 aufheben?“ Pater Alexius klang hoffnungsvoll.
„Das wäre nicht nur zu schön um wahr zu sein, sondern auch das Naheliegendste. Wenn er tatsächlich die Reichsacht über Luther aufheben würde...“
„Dann könnte mein Bruder im Handumdrehen Hessen martinisch machen.“
„Das könnte er tatsächlich!“ pflichtete der Pater ihr bei.
„Darauf trinken wir noch einen!“ sagte der Kurprinz und hob seinen Pokal. Viele Kerzen waren schon heruntergebrannt und längst nicht alle wurden durch neue ersetzt. Im Zwielicht des Saales hatten sich die Musikanten wieder ihren Platz zurückerobert und spielten eine Volta.
„Ich muss Euch noch etwas sagen“, begann der Kurprinz, doch Elisabeths Augen hatten schon den Saal nach einem gewissen Albrecht abgesucht und sie hörte die Worte des Kurprinzen nicht mehr.
„Vergebt mir, ich bin sofort zurück!“ sagte sie und stellte ihren Pokal ab, um auf Albrecht zuzueilen, der sich bereitwillig mit ihr in den Tanz einreihte.
Der Höfling lächelte sie an und hob sie im Takt der Musik, dass ihre Röcke flogen. Selbst nach Stunden geriet er weder außer Atem, noch geriet sein langes Haar in Unordnung, noch zeigte seine modische Kleidung Schweißflecken. Mit einem Wort: Der Kerl war unverwüstlich. Wen wunderte es, dass der gesamte Hof darüber nachdachte, bei welchen Tätigkeiten dieser Mann noch unverwüstlich war?
Elisabeth war wohl die Einzige, die darüber nicht nachdachte, denn sie tanzte und lachte mit ihm so unbefangen, als sei es das Natürlichste der Welt, dass die Herzogin von Sachsen mit einem Diener ihres Mannes tanzte. Lediglich Pater Alexius Chrosner und der Kurprinz schauten den beiden mit einem Lächeln zu. Die beiden sahen den Tanzenden zu wie einem Karussell, das sich immer schneller dreht. Der dämmrige Schein der Kerzen ließ die Seidenkleider aufleuchten, und manchmal schien es sogar, als züngelten Flammen über die immer wilder schwingenden Röcke. Sie sahen, wie die Damen die Hände auf die Schultern der Herren legten, die Herren ihre Damen um die Taille fassten, um sie hoch zu heben in einem kräftigen Schwung, dass die Röcke weit schwangen und die hellen Unterkleider aufleuchteten. Johann Friedrichs Augen wanderten zu Herzog Georg und Herzog Johann hinüber, die das wilde Treiben mit versteinerter Miene beobachteten. Gleich neben dem Herzog standen Schleinitz und Schönberg, die gehässige Blicke austauschten und miteinander tuschelten. Höchstwahrscheinlich kommentierten sie Elisabeths Unterröcke, die man bei diesem Tanz sehen konnte. Die Gräfin Köstritz saß im Kreise anderer Hofdamen und sah aus, als habe sie einen schlechten Geschmack im Mund, während sie Elisabeth beobachtete und dabei ihren Hals recken musste, wenn Elisabeth und Albrecht von einem der anderen Tanzpaare verdeckt wurden. Pater Alexius’ Blick war dem des Kurprinzen gefolgt.
„Sie ahnen nicht, dass sie alle auf einem Vulkan tanzen. Möge Gott verhüten, dass er ausbricht!“ flüsterte er.
„Elisabeth weiß es nur zu gut. Ich glaube sie spürt das Feuer schon durch ihre Schuhsohlen“, erwiderte Johann Friedrich und stürzte seinen Kelch hinunter. Da trat die Köstritzsche zu ihnen: „Ich wüsste doch zu gerne, was die Männer an dieser Herzogin finden, dass sie beständig mit ihr reden müssen.“