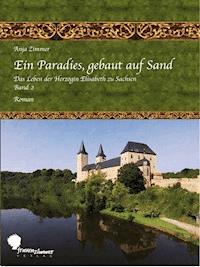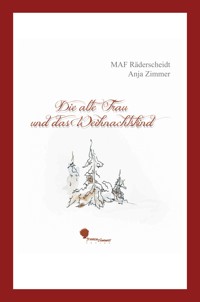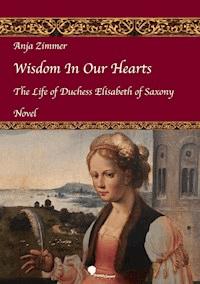Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frauenzimmer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Das Kind ist mein und geht mir zu Herzen." Hinter diesem Satz verbirgt sich der hartnäckige Kampf einer Mutter um ihren Sohn. Anna von Mecklenburg ist fünfzehn Jahre alt, als sie im Oktober des Jahres 1500 mit Wilhelm II. von Hessen verheiratet wird. Die Hoffnungen, mit denen das temperamentvolle Mädchen diese politische Ehe eingeht, sind bald zerstört. Mit ihrem Mann, den sie mit "Sie" und "Herr" ansprechen muss, verbindet sie wenig. Als Wilhelm stirbt, ist Annas Sohn - der zukünftige Landesherr - vier Jahre alt. Wilhelm übergibt in seinem Testament Anna und ihre beiden Kinder der Vormundschaft Ludwigs von Boyneburg - Annas ärgstem Feind. Anna fürchtet um das Leben ihres Sohnes und beginnt einen Kampf, in dessen dunklen Stunden sie zu ihrer Stärke findet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja Zimmer
Mitternachtsblüten
Das Leben der Anna von Hessen
Roman
Inhalt
Mitternachtsblüten
Anmerkungen
Personenregister
Leseproben
Für meinen Großvater,den Schreinermeister Otto Reinhard Tröllerund für Sanne Findeis, die Gewandschneiderin
Prolog
„Ich bin wie der Ritter.“
„Verzeiht, Euer Gnaden. Welcher Ritter?“ Der Priester hatte sich vorgebeugt, um die leisen Worte der Kranken besser zu verstehen. Es war der 13. Mai des Jahres 1525. Durch das geöffnete Fenster drang lautes Vogelzwitschern, Rufe von Kindern, das Dengeln einer Sense.
„Der Ritter in dem alten Lied. Kennt Ihr es nicht?“ Sie versuchte, eine Melodie zu summen, wurde aber von einem erneuten Hustenanfall geschüttelt. Ihre Lungenentzündung war schon zu weit fortgeschritten. Als der Hustenanfall vorüber und nur noch ihr röchelnder Atem zu hören war, schüttelte der Priester den Kopf. „Nein, ich kenne das Lied nicht.“
„Ich habe es als Kind oft gehört.“ Obwohl ihr das Sprechen schwer fiel, fuhr sie fort. Es schien ihr wichtig zu sein, denn unter Mühe erzählte sie nun langsam.
„Ich habe mich mit meinen Geschwistern oft abends in die Küche geschlichen, wenn die Mägde und Diener noch zusammen saßen. Mein Gott, wie lange ist das her. Damals in Schwerin. Und eine der Mägde konnte wunderbar singen. Sie sang die schönsten Geschichten. Am meisten liebte ich das Lied von dem Ritter.“ Sie summte noch einmal die Melodie, aber der Priester hatte das Lied nie gehört. Schwerin war fern. Die Rödelheimer Mägde sangen andere Lieder.
„Ich kann mich an die Strophen nicht mehr erinnern. Nur noch an die Geschichte. Von dem Ritter, der so tapfer ist, dass er den Krieg für seinen König gewinnt und sich in die Prinzessin verliebt. Eine mutige, starke Prinzessin. Als Kind dachte ich immer, ich wäre gern die Prinzessin. Aber ich bin der Ritter.“
Der Priester lächelte. Die Kranke, der er bereits die Beichte abgenommen und die letzte Ölung verabreicht hatte, blickte in der Tat auf ein kämpferisches Leben zurück. Er hatte sie vor einigen Jahren kennen gelernt, lange bevor sie so krank geworden war, dass man ihn an ihr Sterbebett gerufen hatte. Sie war noch jung. Viel zu jung um zu sterben. Noch keine vierzig Jahre alt. Und noch immer eine schöne Frau. Frau Venus hatte man sie hinter vorgehaltener Hand genannt. Aber er konnte sie sich auch in einer Ritterrüstung vorstellen, mit erhobenem Schwert, ihre Widersacher mit einem Streich bezwingend.
„Wenn es Euer Gnaden Freude macht, werde ich Eure Mägde hier fragen, ob sie das Lied kennen. Aber jetzt sollten Euer Gnaden sich ausruhen.“
Aber sie hörte nicht auf ihn. Stattdessen richtete sie sich ein wenig auf und sah ihn forschend an. „Sagt, hat man drüben in der neuen Welt wirklich eine Blume gefunden, die nur um Mitternacht ihre Blüten entfaltet und wunderbar süß duftet? Habt Ihr davon gehört?“
„Nein, Euer Gnaden, davon habe ich nicht gehört.“
„Dachte ich es mir doch! Dieser Pater, der alte Gauner!“ sagte sie leise, wie zu sich selbst. Erschöpft sank sie zurück in die Kissen.
„Aber das heißt noch lange nicht, dass es sie nicht wirklich gibt“, sagte der Priester, der auf ihrem Gesicht Enttäuschung und Bitternis erkannte. „Vielleicht ist sie nur noch nicht entdeckt worden. Die Wälder in der neuen Welt müssen noch größer sein als unsere heimischen. Wer kann schon sagen, welche Wunder Gott der Herr in diesen Wäldern verborgen hat. Und selbst wenn es diese Blume nicht gibt, so ist sie doch immerhin ein schöner Gedanke.“
War je ein Neujahrsmorgen heraufgedämmert, der mehr versprochen hatte? Man schrieb den ersten Tag des Jahres 1500. Unruhige Zeiten waren es, nicht nur für die hessischen Lande. Doch einem Mann war es gelungen, das Land zu einen und zu befrieden. Des Kaisers war sein Schwert. An dessen Seite hatte er gekämpft, sein Leben für ihn riskiert, und der Kaiser hatte ihn fürstlich belohnt.
Wilhelm lehnte sich zurück in seinem Sessel, wärmte die großen Hände, die so vieles vollbracht hatten, an dem kostbaren Becher und sah hinaus in die Ferne. Der Winter hielt das Land in eisiger Umklammerung. Die Nacht hatte neuen Schnee und Frost gebracht. Die Welt lag wie unter einem sauberen Leintuch, unter dem alle Not und Sorge verborgen schien. Doch für Wilhelm war die ganze Welt wie neu. Erhaben war er nun über hämische Gesichter und spitze Bemerkungen, die ihn mehr verletzt hatten als jemand ahnte. Das Leben selbst erschien ihm wie ein Füllhorn, das allein ihn reich beschenkte. In diesem Jahr würde er stolz die Früchte seiner Arbeit ernten können. Niemand sollte sie ihm streitig machen.
Der Diener legte Holz im Kamin nach, erkundigte sich nach weiteren Wünschen seines Herrn und wurde ohne neuen Auftrag entlassen. Er zog sich an die Tür zurück, wo er schweigend verharrte. Nein, Landgraf Wilhelm wollte diesen Augenblick ungestört genießen. Selbst das aufgetragene Frühstück rührte er nicht an, versunken in den Anblick der Stadt, die eben erwachte. Marburg lag noch ganz im Schatten seiner bewaldeten Berge, eng geschmiegt an den Schlossberg. Wilhelm sah nichts von dem Leben, das sich auf den Straßen und engen Gassen wohl schon regen mochte. Er sah nur den Rauch, der schnurgerade aus den Häusern aufstieg. Sein Lächeln war grimmig und triumphierend zugleich, als er an die Wettiner dachte, die sich schon als die neuen Fürsten des Landes gesehen hatten. Die sächsischen Wettiner hatten die politische Entwicklung freudig begrüßt, weitaus freudiger jedoch Wilhelms Kinderlosigkeit, da sie selbst die nächsten Erben waren. Offenbar hielten die Wettiner auch Wilhelm den Jüngeren nicht für fähig, die entsprechende Nachkommenschaft zu zeugen, da dessen Ehe nun schon ins dritte kinderlose Jahr ging. Und nach dem schweren Jagdunfall, der ihm vor einem Jahr zugestoßen war, musste er sich ohnehin schonen.
Die Sonne goss ihre ersten Strahlen über die Lahnberge und ließ die Giebel der Häuser aufblitzen wie Diademe. Das Tal lag nun in rotgoldenem Morgenduft. Darüber wölbte sich ein Himmel in den sanften Farben, die nur ein eisiger Wintermorgen hervorzubringen vermag. In wenigen Stunden schon war der Himmel sicher tief blau. Doch diese frühe Stunde war die Zeit der leisen Farben und Klänge. Das sanfte Licht verwandelte das Lächeln des Landgrafen. Es wurde milde, nicht zuletzt, weil er auf dem Gang die Schritte seiner Frau Jolanthe hörte. Er sah auf den leeren Stuhl auf der anderen Seite des Tisches, das Gedeck, das sie gleich mit ihren schmalen, weißen Händen berühren würde. Gleich würde sie erscheinen, die Urheberin all seiner Freude.
Der Diener öffnete die Tür und die Landgräfin trat ein. Ihre Schritte waren leicht und federnd, seit sie eine kostbare Last verborgen trug. Wilhelm erhob sich und trat ihr entgegen. Er küsste ihre Hand und begrüßte sie mit lieben Worten, während er sie behutsam an sich drückte. Andächtig ließ er dabei seine Hand über ihren gewölbten Leib gleiten.
„Es wird ein Sohn, Jolanthe“, flüsterte er sanft. Doch mischte sich auch eine leise Angst in seine Stimme, so zart und zerbrechlich schien ihm Jolanthe.
„Es wird ein Sohn“, erwiderte seine Gattin mit einem Lächeln. Sie konnte wieder lächeln, seit der übermenschliche Druck von ihr gewichen war. Sie hatte Freudentränen vergossen, als sie ihm endlich die Nachricht, die eine Nachricht, auf die er lange Jahre vergeblich gehofft, überbracht hatte. An Weihnachten hatte Jolanthe die ersten Regungen ihres Kindes verspürt und hatte damit die Gewissheit dessen, was sie in den vergangenen Monaten kaum zu hoffen gewagt hatte. Im Mai würde das Kind zur Welt kommen. Wenn nun Gott noch so gnädig sein wollte, ihr einen Sohn zu schenken. Dem galten all ihre Gebete. Mit bangem Zittern sah sie dem Tag entgegen, an dem sich entscheiden würde, ob sie nun hocherhobenen Hauptes der Welt gegenübertreten könne oder ob sie mit einem entschuldigenden Lächeln die Geburt einer Tochter verkünden müsse. Nun, wenn dies geschehen sollte, war immer noch Wilhelm der Jüngere da, der dafür sorgen würde, dass das Land nicht an die Wettiner fiel. Diese Tatsache war für Jolanthe wie eine kleine Hintertür, durch die sie sich flüchtete, wenn ihre Gedanken allzu quälend kreisten. Der Landgraf ließ es sich nicht nehmen, seiner Gattin eigenhändig den Lehnstuhl zurechtzurücken, damit sie bequem Platz nehmen konnte. Fürsorglich zog er ihr den pelzverbrämten Mantel noch etwas höher über die Schultern. Normalerweise gab es für Damen in gesegneten Umständen Kleider, die den Segen mehr zur Schau stellten als dass sie ihn kaschierten. Doch Jolanthe trug lieber ihre Kleider mit offener Schnürung und darüber einen Mantel. Ganz im Verborgenen wollte sie ihr Kind austragen. Niemand sollte auch nur etwas ahnen. Jolanthe ging selten aus. Sie hielt sich - wie es von ihr erwartet wurde - in ihren Gemächern auf, widmete sich Stickarbeiten oder spielte die Laute. In ihren ersten Ehemonaten hätte sie lieber die Stadt angeschaut, doch alles, was sie von Marburg gesehen hatte, war der Weg zur Kirche gewesen. Daran hatte sich kaum etwas geändert. Sie lugte bei dieser Gelegenheit immer zwischen den ledernen Vorhängen der Kutsche hervor, bewunderte die schmucken Häuser der Bürger und Kaufleute und beneidete insgeheim die Bürgersfrauen, die im Sonntagsstaat über die Straßen flanierten, von gutgekleideten Herren höflich gegrüßt. Doch dann hatte Jolanthe sich immer mehr freiwillig zurückgezogen. Sie hasste die Blicke wildfremder Menschen, die mitleidig auf ihrem flachen Bauch ruhten. Einmal, als sie vor der Kirche gestanden hatte, war eine Frau, sicher fünf Jahre jünger als sie selbst, mit vier Kindern vorbeistolziert und hatte es sich nicht nehmen lassen, sie hämisch anzugrinsen. Von da an waren ihre Gemächer ihr Reich, in dem sie regierte, fern von allen Sorgen und Zwängen. Ihr Gatte war rücksichtsvoll, machte ihr Geschenke, um sie aufzuheitern und nahm sich zuweilen auch tagsüber Zeit für sie. Das war weit mehr als eine Frau ihres Standes von ihrem Gatten erwarten konnte. Obwohl auch ihre Ehe unter politischen Gesichtspunkten geschlossen worden war, hatte sich doch eine tiefe Zuneigung zwischen ihnen entwickelt. Manchmal wunderte sich Jolanthe über ihren Gemahl. Sie hatte einmal erlebt, wie unerbittlich und hart Wilhelm sein konnte, wenn es darum ging, seine Macht zu sichern. Sie hatte ihn auf dem Turnierplatz gesehen, wo sich kaum ein Ritter mit ihm messen konnte. Und sie wollte sich lieber nicht vorstellen, wie gnadenlos er auf dem Schlachtfeld war. Aber bei ihr wurde er sanft und mild, zärtlich und liebevoll. Zuweilen sah sie seine Hände an, die so hart und voller Schwielen waren von Schwert und Lanze und die schon Blut vergossen hatten, die sich aber so behutsam ihrem Gesicht näherten, als sei es aus feinem Glas. Sie liebte es, in seinen Armen zu ruhen. In ihrer ersten gemeinsamen Nacht hatte seine kriegerische Gestalt sie zutiefst erschreckt. Sie hatte sich so klein und schwach gefühlt. Das tat sie noch immer, wenn sie in seinen Armen lag, doch fühlte sie sich nicht mehr ausgeliefert. Sie vertraute ihm und wusste, dass er sie niemals verletzen würde. Doch nichts, nichts hatte Jolanthe darüber hinwegtäuschen können, dass sie den Zweck ihres Lebens verfehlte. Nun saß Jolanthe da, etwas bleich, aber ruhig und wie es schien, glücklich. Wilhelm betrachtete seine Frau. Ihr langes, braunes Haar war züchtig unter einer Haube verborgen. Ein feines Tuch bedeckte den Ausschnitt, der kalten Witterung angemessen. Die langen Wimpern hatte sie über die Augen gesenkt. Sie tat einen großen Löffel Honig in ihren Hirsebrei. Auch sie wärmte die Hände an dem warmen Dünnbier, das der Diener ihr eingeschenkt hatte. Sie aß mit freudigem Appetit – ein Anblick, der Wilhelm immer wieder vergnügt stimmte. Die beiden sprachen nicht viel. Sie genossen dieses kleine, intime Frühstück zu früher Stunde, denn lange würde die Stille nicht mehr währen. Wilhelm hatte nach wie vor für viel zu sorgen. Die Stände mussten niedergehalten werden, wollte er seinem Erben ein geordnetes Land hinterlassen. Ja, es war allein an ihm, das Haus Hessen zu erhalten. Von seinem Oheim, dem Erzbischof von Köln, konnte man beileibe keine legitimen Erben erwarten. Er war in Ehren ergraut und sah gelassen einem nahen Ende entgegen. Zunächst wäre es an Wilhelm dem Älteren gewesen, das Land zu regieren, doch da sich sein Geist verflüchtigt hatte wie Schnee unter Julisonne und er somit den Beinamen „der Blöde“ führte, lag das Wohl der hessischen Lande in der Hand Wilhelms des Mittleren. Doch nicht genug, dass der Ältere schwachsinnig war, hatte ihn der Herr auch noch mit vier Töchtern geschlagen, die für die Erbfolge nicht in Frage kamen. Zumindest eine davon hatte Gott schon nach wenigen Wochen wieder zu sich genommen, nur um eine neue Tochter zu schicken, der man den Namen ihrer verstorbenen Schwester – Mechthild - gegeben hatte. Die Tatsache, dass Gott der Herr die tote Tochter lediglich durch eine neue ersetzt hatte, riss den Blöden zu den wüstesten Ketzereien hin, indem er Gott beschuldigte, eine seltsame Art von Humor zu haben. Sein Wahnsinn tobte sich auf einem entlegenen, vergessenen Schloss aus. Mechthild die Jüngere und die folgende Schwester Anna waren gut in Klöstern untergebracht. Die vierte Tochter lebte bei ihrer Mutter auf dem Sensenstein.
Wilhelms graue Augen schweiften noch einmal über die Stadt und trafen sich dann mit dem Blick seiner Frau. Boyneburgs Schritte waren auf dem Gang zu hören. Im selben Moment trat der Landvogt auch schon in das Zimmer ein. Er verneigte sich ehrfürchtig vor seiner Fürstin. Auch ihm war ihre sachte Veränderung aufgefallen. Man ahnte nicht, was hinter der kantigen Stirn des Landvogtes vorging; wie glücklich es ihn machte, wenn die Fürstin seinen Gruß huldvoll erwiderte. Mehr als einmal schon hatte er eine galante Bemerkung hinuntergeschluckt. Er wandte sich an Wilhelm, um die Geschäfte des Tages zu besprechen.
Der Frühling kam ungewöhnlich früh und mild. Längst war all der Schnee getaut. Die Vögel kamen aus ihren Winterquartieren zurück. Dieses Grün, das es nur im Frühling gibt, wagte sich hier und dort hervor. Die fahlen Wiesen, die dunklen Äste der Bäume, alles sah unter dem Licht der Frühlingssonne freundlich aus und verhieß neues Leben.
Da traf eine Nachricht ein, die all dies in ein grausames Gegenteil verkehrte: Wilhelm der Jüngere war bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen. Als der Bote diese Nachricht brachte, legte Jolanthe unwillkürlich die Hand auf ihren Leib. Neben der Tragik dieses frühen Todes schmerzte sie auch die Tatsache, dass nun diese Hintertür verschlossen war. Sie musste, musste einen Sohn gebären. Durch den Tod seines Vetters waren die Grafschaften Ziegenhain, Nidda und Katzenelnbogen in Wilhelms Besitz übergegangen, der diesen Umstand als weitere Gunst des Himmels ansah. Er war sich nun sicher, dass seine Frau ihm einen Sohn gebären würde. Warum sonst sollte Gott ihn so reich mit Land und Macht beschenken, wenn er dies alles nicht an seinen direkten Erben weitergeben würde?
Der Februar wich dem März. Jolanthe trug nun sichtbar an ihrer Last. Im Mai sollte der Knabe zur Welt kommen. Eine Hebamme war beständig in der Nähe der Fürstin. Die Frau war mit ihrer kleinen Tochter ins Schloss gezogen, um jederzeit der Fürstin beistehen zu können. Sie hieß Marie, blickte auf lange Jahre der Erfahrung zurück und hatte sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch einmal über ein kleines Mädchen freuen können, das mittlerweile sieben Jahre alt war. Die kleine Marthe begleitete ihre Mutter überall hin und hatte bereits den Entschluss gefasst, auch Hebamme zu werden.
Marthe genoss ihr Leben auf dem Schloss. Es war so ganz anders als in den Gassen, in denen ihre Mutter sonst für wenig Geld zu Hilfe eilte. Aber die Kunst ihrer Mutter war groß und so hatte man sie auch immer wieder in die sogenannten guten Häuser gerufen und schließlich auch ins Schloss. Marthe hatte schon viel mit ansehen müssen, und manchmal hatte sich ihre Mutter Marie gefragt, ob es nicht zu viel sei für das Kind, die düstere Seite dieses Berufes so deutlich kennen zu lernen. Sicher, es gab die schönen Seiten, wenn Mutter und Kind gesund waren, wenn sich der Vater über einen strammen Sohn freute oder die Mutter von vier Söhnen endlich ein kleines Mädchen in den Armen hielt. Aber oft genug war Marie auch hilflos wenn das Kind falsch lag, im Schoß feststeckte oder die Mutter nicht aufhörte zu bluten. Dann sah Marie in den Augen ihrer Tochter auch Angst. Und auch sie selbst hatte Angst, Angst vor mehr als nur dem Leid der Mutter. Angst vor mehr als einer ausbleibenden Bezahlung, wenn das Kind starb und die Mutter sich wochenlang nicht erholte. Als Hebamme stand sie immer mit einem Bein auf dem Scheiterhaufen. Alles war gut, wenn der Priester mit ihr zufrieden war. Aber wehe, es ging etwas schief. Dann war man schnell bei der Hand mit Beschuldigungen. Dann hatte die Hebamme schwarze Magie angewandt, um die Mutter oder das Kind oder beide zu töten.
Aber hier im Schloss hatten sie zunächst ein sorgloses Leben. Die Landgräfin war zwar sehr zart, doch war sie nicht unterernährt, wie so viele arme Frauen. Wenn Gott ihr gnädig war, würde sie das Wochenbett gut überstehen. Marthe bewunderte die Landgräfin. Nicht nur, dass sie wunderschöne Kleider trug, sie war auch eine ausgesprochen schöne Frau. Fast kam sie Marthe vor wie eine lebendige Puppe, so klein und zierlich war sie, so hell war ihr Teint unter dem dunklen Haar. Die Bediensteten bemühten sich, alle Aufregung von ihr fern zu halten. Das war nicht immer leicht, denn die Landgräfin war eine außergewöhnlich schreckhafte und ängstliche Frau. Schon eine Spinne konnte sie in Angst versetzen. Wenn in ihrer Nähe eine Tür vom Wind heftig zugeschlagen wurde, eine blecherne Kanne scheppernd zu Boden fiel, zuckte sie ängstlich zusammen und legte die Hand auf ihren Leib. Aber da diese kleine Schwäche alle kannten und niemand für ihren Schrecken vom Landgrafen zur Verantwortung gezogen werden wollte, wurden alle Türen sorgfältig geschlossen und auf sämtliches Geschirr achtgegeben.
Marie sah freudig, wie sehr ihre kleine Marthe aufblühte, immer öfter lachte, sich mit den Kindern der Dienerschaft anfreundete, ihre Spiele und Lieder teilte. Manchmal sah Marthe von weitem einen fein gekleideten Herrn, der dem Mann am Schlosstor morgens die Schlüssel brachte und sie abends wieder bei ihm abholte. Dieser Herr war in so feine Stoffe gekleidet, trat mit solcher Würde auf und alle Menschen gehorchten ihm so selbstverständlich, dass Marthe sicher war, dies sei der Landgraf. Aber die Kinder der Diener lachten sie aus. Das sei nur der Herr von Schwertzell, der Hofmeister. Das sei ein Diener des Landgrafen. Der Fürst selbst sei auf Reisen. Marthe schwieg und nahm sich vor, niemals wieder Vermutungen zu äußern. Nur wenige Tage später kehrte der Landgraf zurück. Da konnte die kleine Marthe den Unterschied erkennen. Der Landgraf erschien auf einem prächtigen Pferd, gefolgt von so vielen Reitern, dass Marthe sie nicht zählen konnte und wurde auch von seinem Hofmeister mit so viel Ehrfurcht empfangen, dass Marthe verwundert zuschaute, als sich der fein gekleidete Herr tief verneigte. Die erste Sorge des Landgrafen galt seiner schwangeren Gemahlin. Glücklicherweise konnten Marie und die Ärzte berichten, dass die Landgräfin wohlauf war.
Marthe sah den Landgrafen oft von weitem. Er war prächtiger gekleidet als Herr von Schwertzell, aber es war eine sonderbar kriegerische Pracht. Er flößte Marthe eine leise Angst ein. Das war der Mann, der hier die Steuern und Gesetze erlassen konnte. Der Mann, der oft grausame Strafen verhängte und Aufruhr im Keim erstickte. War er nicht viel mächtiger als Gott? Er war unmittelbar da. Selbst wenn man in seinem Gefängnis saß und Gott um Gnade anflehte, war es an ihm, diese Gnade zu gewähren oder nicht. Aber wenn der Landgraf unterwegs war – und das war er sehr oft – verbrachten Marie und Marthe eine schöne Zeit im Schloss zu Marburg. Marthe konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Leben einmal zu Ende gehen könnte, dass überhaupt irgend etwas zu Ende gehen könnte.
Es war schon später Abend. Der Landgraf hatte den ganzen Tag mit seinen Räten verbracht, Gesetzesentwürfe besprochen, Eingaben der Ritterschaft und Landschaft bearbeitet und kaum Zeit gehabt, einen Imbiss zu sich zu nehmen. Nun saß er noch allein über seinen Papieren am Schreibtisch. Er war so vertieft in seine Arbeit, dass er kaum das Gewitter wahrnahm, das von Westen her aufzog. Erst als der auffrischende Wind ein nachlässig geschlossenes Fenster aufstieß und einen Stapel Papiere vom Schreibtisch fegte, schaute Wilhelm auf und sah, dass der Himmel über der Lahn von Blitzen durchzuckt wurde. Ein fernes Grollen machte sich bemerkbar. Wilhelm schloss das Fenster, das Grollen wurde etwas leiser. Wieder setzte er sich an seinen Schreibtisch. Die Arbeit war noch lange nicht getan. Vielleicht noch eine Stunde, dann könnte er zu Jolanthe gehen. Der Gedanke an sie ließ ein Lächeln über sein Gesicht huschen. Er wusste zwar, dass ein Gewitter ihr auch Angst machte, doch wusste er ihre Dienerinnen bei ihr. Gott hielt ohnehin seine schützende Hand über das Schloss. Jolanthe war sicher.
Das Gewitter zog näher. Marthe hörte deutlich den Regen gegen die Läden rauschen. Zu gerne hätte sie die Läden aufgemacht und durch die Butzenscheiben nach draußen gesehen, wie sie es sonst so gerne bei Regen tat. Butzenscheiben gab es in den wenigsten Häusern. Marthe war fasziniert gewesen, als sie die Scheiben im Schloss gesehen hatte, die tatsächlich kein Wasser hindurch ließen obwohl man durch sie hindurchschauen konnte. Die Scheiben verzerrten alle Dinge auf sonderbare Weise. Nun schlüpfte Marthe zu ihrer Mutter ins Bett, auch wenn sie dafür eigentlich schon zu groß war. Sie spürte, wie ihre Mutter sie fest in ihre Arme nahm und an sich drückte.
„Hab keine Angst, meine Kleine. Hier im Schloss sind wir sicher. Hier kann uns das Gewitter nichts anhaben. Es zieht sicher gleich wieder weg.“
Das helle Zucken der Blitze, das sie durch die herausgeschnittenen Ornamente in den Fensterläden sehen konnten, und der Donner folgten immer dichter aufeinander. Marthe dachte an die vielen Gewitter, die sie schon drunten in der Stadt erlebt hatte. Wenn nachts die schweren Gewitter aufgezogen waren, hatten sie sich alle angekleidet, in die Stube gesetzt und gebetet. Nur aus Erzählungen kannte Marthe die Schrecken eines Blitzeinschlages und des wütenden Feuers, das ganze Stadtteile fraß, wo die Hütten aus Holz und Lehm gebaut waren und eng beieinander standen. In einem Gefühl vollkommener Sicherheit schmiegte sie sich enger an ihre Mutter.
Marie dachte an die Landgräfin. Aber sollte der Landgraf um diese Zeit nicht bei seiner Frau sein? Sie konnte schlecht ins fürstliche Schlafzimmer gehen und nach dem Rechten sehen. Also zog sie die Decke fester um sich und ihre kleine Marthe, um das Ende dieses Unwetters abzuwarten. Ein wenig genoss auch sie dieses Gefühl der Sicherheit in einem so festen Haus aus Stein. Wie oft hatte sie schon in ihrer kleinen Hütte bei Gewitter gesessen und gebetet, dass der Herr sie verschonen möge. Aber Gott der Herr hielt seine Hand schützend über das Fürstenhaus. In diesem Schutz ließ es sich gemütlich weiterschlafen.
Da plötzlich zuckte ein Blitz giftig grell über den Himmel und gleich darauf erschallte ein Donnerschlag, der das ganze Schloss in seinen Grundfesten zu erschüttern schien. Mit einem Schlag waren Marie und Marthe hellwach. Erschrocken klammerten sie sich aneinander. Der Lärm dort draußen war für wenige Augenblicke so ohrenbetäubend gewesen, dass sich die beiden fast wunderten, noch am Leben zu sein. Keuchend lauschten sie mit klopfenden Herzen, ob der Blitz ins Schloss eingeschlagen und ein Feuer verursacht habe. Wäre es doch nur ein Feuer gewesen. Hätte doch nur das ganze Schloss lichterloh gebrannt! Aber es war etwas weitaus Schlimmeres geschehen. Eilige Schritte wurden vor der Türe laut. Ohne ein Klopfen wurde die Tür aufgerissen, eine Dienerin stürmte herein und ohne eine Entschuldigung rief sie: „Geschwind! Zur Gnädigen Frau! Oh, dass der Herr uns gnädig sei!“
Mit einem Satz war Marie aus dem Bett gesprungen. Sie wollte nach ihrem Kleid greifen, doch die Dienerin schrie: „So beeilt Euch! Lasst das Kleid!“
Also griff Marie nur nach ihrer Tasche und eilte der Dienerin im Nachtgewand nach. Marthe lief den Frauen hinterher. Draußen tobte das Gewitter immer heftiger. Es war direkt über dem Schloss. Blitze zuckten in bizarren Linien an den hohen Fenstern vorbei, erhellten die langen Flure für wenige Augenblicke mit ihrem bleichen Licht, gefolgt von höllischem Donner. Überall war die Dienerschaft nun auf den Beinen. Alles rief durcheinander. Marthe, die Mühe hatte, ihrer Mutter zu folgen, konnte kaum verstehen, was die Menschen sagten. Etwas war mit der Fürstin passiert. Marthe wusste, dass die Zeit der Fürstin noch lange nicht gekommen war. Wenn sie sich durch den Donnerschlag so sehr erschreckt hatte, dass sie ... Aber diesen Gedanken wollte sie lieber nicht zu Ende denken. Von weitem hörten sie eine Frau schreien. So laut und durchdringend als liege sie in den Wehen. Endlich waren sie am Schlafgemach der Fürstin angelangt. Marthe schlüpfte in der allgemeinen Aufregung einfach mit ins Zimmer. Niemand hinderte sie daran. Alle waren viel zu sehr damit beschäftigt, heißes Wasser, Tücher, Kerzen und dergleichen zu bringen. Von draußen drang Feuerschein durch die Läden. Auch die Ärzte trafen ein, um zu retten was zu retten war.
So lange sie lebte, würde Marthe niemals das Bild vergessen, das sich ihr nun bot: Die Fürstin lag mit angstverzerrtem Gesicht schreiend und aus ihrem Schoß blutend in dem prächtigen Bett. Ihr Gemahl, der sie in seinen Armen hielt, wurde von einem der Ärzte mit sanfter Gewalt genötigt, nach draußen zu gehen. Kaum wollte er sich von seiner Frau trennen. Auch sie hielt seine Hand fest, solange es ging. Bei jedem erneuten Donner zuckte sie zusammen und hing mit ihren Augen flehend an ihrem Mann, aber die Ärzte drängten ihn mit der Empfehlung zu beten, hinaus. Das volle dunkle Haar klebte der Fürstin an Wangen und Stirn, die selbst in dem warmen Kerzenlicht eigentümlich grau leuchteten. Sie schrie heiser und so voller Leid, Angst und Schrecken, dass Marthe sich abwenden wollte, aber wie gezwungen starrte sie weiter die Frau an, zwischen deren Beinen mehr Blut als gewöhnlich hervorquoll. Die Laken waren nass, zerwühlt und dunkelrot. Da plötzlich hörte sie, wie Marie sie beim Namen rief. Erleichtert löste sie sich aus ihrer Starre und eilte zu ihrer Mutter, um sie mit den nötigen Handreichungen zu unterstützen. Sie reichte ihr die entsprechenden Kräuter und Salben, die die Geburt erleichtern sollten. An ein Aufhalten der Wehen war nun nicht mehr zu denken. Das Kind musste zur Welt kommen, auch wenn es noch viel zu früh war. Marthe wusste, dass eine Frühgeburt unten in der Stadt in den armen Häusern kaum die ersten drei Tage überstehen würde. Doch hier in diesem Schloss, wo es an nichts fehlte, wo man sich um die Mutter und das Kind kümmern würde, als gälte es, das Jesuskind selbst am Leben zu erhalten? Es dauerte nur wenige Augenblicke und das Kind war da. Auf den blutigen Laken lag winzig klein, verschmiert und dunkelrot ein leise wimmernder Knabe. Da hielt den Fürsten nichts mehr auf dem Flur. Sein Erscheinen sorgte für Aufruhr. Es war nicht Sitte, dass ein Vater - und sei es der Kaiser selbst - am Wochenbett seiner Frau erschien, bevor sie wieder in einen halbwegs ansehnlichen Zustand versetzt und das Kind gewaschen und gewindelt war. Aber wer hätte dem Landgrafen den Anblick seines Sohnes verwehren wollen? Ein Sohn! Ein Sohn! riefen sie immer wieder. Zum ersten Mal sah Marthe den Landesfürsten, den mächtigen Wilhelm II., weinen. Er weinte vor Freude und Erleichterung. Er saß am Bett seiner Frau, die ihn aus erschöpften Augen ansah, hielt ihre Hand, küsste sie immer wieder und flüsterte ihr so zärtliche Worte zu, wie Marthe sie noch nie von einem Mann gehört hatte. Kaum wagte der Fürst seinen Sohn zu berühren. Er streckte seine große Hand nach dem Köpfchen aus, berührte es aber nicht, sondern zeichnete nur in der Luft die kleine runde Form nach. Auch die Fürstin weinte. Und gleichzeitig lächelte sie. Aber ihr Gesicht war ein seltsam grauer Fleck auf dem weißen Kissen. Ihre Augen lagen so tief in den Höhlen, wie sonst niemals. In den wenigen Stunden schien sie um Jahre gealtert zu sein. Als Marie ihr das Kind aus den Armen nahm, um es zu waschen und zu windeln, sah sie ihr ängstlich nach, als fürchte sie, das Kind könne ihr für immer genommen werden. Wilhelm sah die Sorge in ihren Augen, liebkoste seine Gemahlin und flüsterte ihr liebe Worte zu. Betreten schauten sich die Hebamme und die Dienerinnen an. Die Ärzte taten sehr geschäftig. Dieses Ehepaar schien sich wirklich zu lieben. Erst als Marie sich räusperte und den Fürsten bat, nach der gnädigen Frau sehen zu dürfen, um sie zu versorgen, schien er inne zu werden, dass er sich weit außerhalb der Grenzen der Schicklichkeit bewegte. Er verließ den Raum, um am 27. März Anno 1500 die Geburt seines Sohnes Wilhelm einzutragen.
Der nächste Tag zog mit so unschuldiger Morgenröte herauf, dass man das Unwetter der vergangenen Nacht kaum für wahr halten mochte. Und langsam erfuhr man, was sich in der Nacht zugetragen und die plötzliche Geburt verursacht hatte.
Jolanthe hatte aus Furcht vor dem Gewitter ihrer Kammerfrau befohlen, ihren Gemahl, der noch immer über seinen Papieren saß, aufzusuchen, um ihn zu bitten, zu ihr zu kommen. Während die Fürstin allein in ihrem Bett gelegen und ängstlich auf das Gewitter gelauscht hatte, war der Blitz in eines der nahen Wirtschaftsgebäude eingeschlagen, das nicht weit vom Fenster ihres Schlafzimmers entfernt gestanden hatte. Der plötzliche Donnerschlag hatte die Schwangere so sehr erschreckt, dass die Wehen einsetzten. Ihre Kammerfrau und ihr Gemahl kamen gerade rechtzeitig, um die Verzweifelte, die in ihrer Angst aus dem Bett gesprungen war, wieder zurück auf ihr Lager zu heben. Der Fürst blieb bei seiner Gemahlin, hielt sie in seinen Armen, während die Kammerfrau eilte, um Hilfe zu holen.1
Mutter und Kind lebten. Der Landgraf wich kaum von der Seite seiner Frau, die sich auch in den folgenden Tagen nur sehr langsam erholte. Ihre Augen starrten seltsam leer und teilnahmslos aus ihrem bleichen Gesicht. Dem Landgrafen nötigte es all seine Fassung ab, wenn sie ihn anlächelte und seinen Händedruck erwiderte. Noch bevor man die Amme aufs Schloss geholt hatte, war der kleine Wilhelm getauft. Die Hebamme hatte man mit ihrer Tochter wieder hinunter in die Stadt geschickt. Die Ärzte sollten nun dafür sorgen, dass Mutter und Kind sich erholten. Doch der kleine Wilhelm tat sich schwer mit dem Stillen. Er war zu klein und schwächlich. Wenn der Landgraf nicht bei seiner Frau war, konnte man ihn in der Schlosskapelle finden, wo er stundenlang vor dem Altar kniete und betete. Die Freude über seinen Sohn, seinen lange ersehnten Sohn, wurde angesichts dieses schwachen Lebens beinahe erdrückt. Die erste Woche überstand das Kind, ja, es schien sogar etwas kräftiger zu werden. Fast hatte es auch die zweite Woche überstanden, doch am Morgen seines dreizehnten Tages lag das Kind tot in seinem Bett. Jolanthe folgte ihrem Kind nur wenige Tage später.
Nachdem Gott ihm seine Frau und seinen Sohn genommen hatte, pochte der Priester vergeblich an die Tür des Landgrafen. Der Fürst wollte weder beichten noch kommunizieren. Nicht einmal seine engsten Vertrauten wollte er sehen. Lediglich ein Diener brachte ihm Speise und Trank auf sein Zimmer, doch rührte der Landgraf kaum etwas an.
Es war Juni. Wieder saß Wilhelm allein im Erker seines Schlosses. Diesmal erwartete er allein den Landvogt Ludwig von Boyneburg, seinen engsten Vertrauten. Die beiden verband eine lange gemeinsame Zeit. Als Knaben schon waren sie gemeinsam erzogen worden, hatten die Tübinger Hochschule besucht und dort Erlebnisse geteilt, die sie zu dem werden ließen, was sie jetzt waren: enge Freunde. So glaubte Wilhelm. Dank dieser langen Freundschaft genoss Ludwig Ämter und Privilegien. In der Tat genoss er sie. Er war ein rechter Lebemann, wenn man ihm dies auch nicht ansah. Er war groß und hager, obwohl er ausgesprochen gerne gut aß und auch den Wein schätzte. Indessen - klare Ziele verlor er dabei nicht aus den Augen. Verheiratet war er mit Mechthild, die zwar nicht seine Sinne ansprach, aber dafür die Tochter des einflussreichen Hofmeisters Rabe von Herda war. Jolanthe de la Lorraine war von ihm tiefer betrauert worden als er zugab, und tiefer, als ohnehin schicklich war. Bevor sich Wilhelm mit allen seinen Vertrauten beriet, wollte er Ludwigs Rat hören, auch wenn er seinen Entschluss bereits gefasst hatte.
Wilhelm nippte an seinem Wein, stellte den Pokal zurück auf den Tisch und ließ seinen Blick wieder über die Stadt und die Lahnberge schweifen. Er war völlig unempfänglich für den Sonnenschein, die milde Luft, den Gesang der Vögel. Er wünschte sich den klirrend kalten Neujahrsmorgen zurück. Doch war es nicht seine Art, Dingen nachzuhängen, die hätten sein können. Er straffte sich und betrachtete sein dunkelgrünes Wams mit den durchbrochenen Ärmeln, unter denen ein frisch gestärktes Leinenhemd hervorsah. Den Trauerflor hatte er an diesem Morgen lange in der Hand gehalten, hatte ihn gedreht und gewendet, all die feinen Perlen und die Schleifen aus schwarzem Tuch angeschaut, als sehe er sie zum ersten Mal. Nur wenige Wochen hatte er den Flor am Ärmel getragen. Mit einer heftigen Geste hatte er ihn zurück in das Kästchen gelegt, sich gestrafft, noch einmal die letzten unsichtbaren Stäubchen von den Ärmeln gewischt. Nun schaute er auf die leere Stelle, an der er den Flor getragen hatte. War er zu hochmütig gewesen? Wollte Gott ihn strafen? Wozu sollten alle seine Anstrengungen nütze sein, wenn nicht für seine eigenen Nachkommen? Aber warum strafte er dann nicht ihn selbst, sondern nahm seine Gemahlin Jolanthe und seinen Sohn zu sich? Jolanthe. Er flüsterte ihren Namen in die Stille, in der die Silben verschwanden als hätte er sie nie ausgesprochen. Er schloss die Augen und neigte seinen Kopf mit einem schmerzlichen Ausdruck zur Seite. Warum? Alles, alles hätte er hergegeben. Doch warum hatte Gott ihm ausgerechnet die beiden Menschen genommen, die er am meisten liebte? Gott hatte ihn empfindlich getroffen. Er hatte ihn wahrhaft meisterlich gestraft. Ja, der Herr sah in die Herzen der Menschen und wusste nur zu gut, wie er sie treffen konnte. Er war auf sich gestellt. Grimmig ballte er die Fäuste.
Wilhelms Gesicht hatte sich zu einer steinernen Maske verwandelt. Niemand sollte wissen, wie es in ihm aussah. Niemand sollte ihn für schwach halten. Er musste nun handeln, wollte er sein Lebenswerk nicht aufs Spiel setzen.
Ludwig kam. Auch er hob erstaunt die Brauen, als er näher kam und den Flor am Ärmel seines Freundes vermisste. Er selbst trug nach wie vor einen Flor. Er hütete sich, seinen Freund darauf anzusprechen, doch Wilhelm hatte sein Gesicht zu deuten gewusst.
„Sie wundern sich, dass ich keine Trauer mehr trage nach so kurzer Zeit?“
„Ich muss zugeben, dass ich ...“
„Wir haben keine Zeit, Ludwig! Die Wettiner lecken sich schon die Mäuler. Ich werde nicht jünger und ein Erbe wird mir nicht vom Himmel fallen. Vor vier Jahren sind Sie zum Herzog von Lothringen gefahren und haben dort um Jolanthes Hand angehalten. Sie werden sich jetzt wieder auf eine kleine Reise machen, mein Freund.“
„Und Sie haben auch schon das Ziel dieser Reise ausgemacht, wie ich Sie kenne. Ich hoffe, Sie tragen damit auch meinen Neigungen Rechnung. Lothringen war herrlich.“
Mit dem vertraulichen Sie und den Vornamen redeten sich die Freunde nur an, wenn sie unter sich waren. Dem Landgrafen entschlüpfte es zuweilen auch in Gesellschaft, doch Ludwig achtete peinlich genau darauf, dass ihm dies nicht passierte. Bevor Ludwig sich in der Beschreibung der Lothringer Spezialitäten verlieren konnte, hob Wilhelm abwehrend die Hände.
„Also, wohin soll die Reise gehen? Mit welchem mächtigen Haus streben Sie eine Verbindung an? Soll ich nach Wien fahren? Dort war ich lange nicht mehr. Der Wein dort ist ausnehmend gut.“
„Ah, ich habe Ihren Wink schon verstanden. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen noch keinen Wein eingeschenkt habe. Für gewöhnlich tun Sie das selbst.“
Ludwig nahm einen tiefen Schluck, betrachtete den Pokal dann mit Kennermiene und sagte: „Das ist ein köstlicher Österreicher! Ich soll also nach Wien fahren! Ich danke Ihnen, mein Freund. Sie wissen, wie sehr ich die Wiener Küche schätze.“
„Nein, nicht nach Wien. Dieser Wein ist eher als ein kleiner Trost gedacht.“
„Schicken Sie mich etwa nach England? Nein! Das werde ich nicht überleben.“
Wilhelm lachte, wenn auch etwas verhalten, über das entsetzte Gesicht seines Freundes.
„Nach Mecklenburg!“
„Nein! Nein! Sie wissen, ich hasse Bier und dieses schwere Essen, so völlig ohne Raffinesse. Und um wessen Hand soll ich dort denn anhalten? Sie müssen wirklich sehr verzweifelt sein, eine Braut in diesem gottverlassenen Land zu suchen. Die Menschen sind oft wie das Land und Mecklenburg ist flach, langweilig, rau und öde. Schlafen Sie noch eine Weile darüber. Warten Sie den nächsten Ball in Wien ab. Dort werden sich Ihnen Tausende von Schönheiten an den Hals werfen.“
„Wollen Sie nicht endlich hören, wer es denn nun sein soll?“ fragte Wilhelm, trotz allem belustigt. Zum Zeichen seiner Aufmerksamkeit lehnte sich Ludwig in seinem Sessel zurück und sah den Landgrafen erwartungsvoll an.
„Anna von Mecklenburg“, lautete die Antwort.
„Was?“ Sofort schnellte Ludwig wieder aus seiner bequemen Haltung empor. „Sie ist höchstens zehn Jahre alt. Sie müssen von Sinnen sein. Sie sollen sich eine Frau suchen, kein Kind, auf das Sie noch aufpassen müssen!“
„Anna ist vierzehn Jahre alt. Zehn war sie vor vier Jahren auf unserem letzten gemeinsamen Ball in Lübeck. Dort habe ich sie gesehen. Wahrhaftig ein Mädchen von munterem Geist. Und wenn Sie nicht immer nur Augen für Wein und Gaumenfreuden hätten, wäre Ihnen sicher nicht entgangen, dass man inzwischen allenthalben ihre Schönheit rühmt. Sehen Sie, ich kann es mir nicht erlauben, eine Frau zu nehmen, dir mir an Jahren fast gleich kommt. Wer weiß, wie lange ich mit dieser Frau auf Kinder warten muss. Ich brauche einen Erben. Anna ist jung. Wenn sie mir in vier Jahren den ersten Sohn schenkt, wird sie immer noch jung genug sein, eine Geburt zu überstehen. Ihre Mutter hat drei Söhne und vier Töchter geboren. Außerdem ist Mecklenburg reich und mächtig. Diesen Herzog zum Schwiegervater zu haben, ist sicher auch kein Nachteil.“
„Also auf nach Mecklenburg!“ sagte Ludwig schließlich, doch nicht eben begeistert.
„Ich weiß, wie Ihnen zumute ist, mein Freund. Bitte, glauben Sie mir, dass ich diesen Schritt nicht leichten Herzens tue.“ Wilhelms Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Der Landvogt sah den Fürsten an. Die Augen des Landgrafen hatten eine Tiefe bekommen, in die hinabzublicken Boyneburg schauderte.
Anna Schreuerin, eine junge Schreinerstochter, war an diesem Morgen besonders aufgeregt. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie in einer richtig großen Stadt. Kassel war nicht irgendeine unbedeutende Siedlung, keine Ansammlung von Hütten und ein paar Häusern aus Stein. Von weitem schon hatten sie die großen Türme und weitläufigen Dächer der Kirchen, die hohen Giebel der Bürgerhäuser im Morgendunst erkennen können. Am Stadttor angelangt, rückte Anna allerdings etwas dichter an ihren Bruder Karl heran, denn hier am Rand der Stadt war nichts zu sehen von all der Herrlichkeit. Die Straßen waren zwar gepflastert und frisch gefegt, doch tummelten sich darauf Menschen, denen Anna lieber nicht auf gleicher Höhe begegnen mochte. Auch die Bettler hatten sich schon eingefunden zu dem großen Ereignis, das man in Kassel seit Wochen vorbereitete. Anna wagte einen vorsichtigen Blick in die Seitengassen, die mit Stroh ausgelegt waren und dadurch etwas Reinlichkeit vorzutäuschen vermochten. Geschrei und Gekeife drang aus dieser Düsternis, in die kaum je ein Lichtstrahl fiel, denn die Giebel der Häuser trafen sich fast über der Gasse.
„Du musst keine Angst haben, Anna. Der Markt ist mitten in der Stadt. Dort wird es dir gefallen, du wirst schon sehen!“ sagte Karl und lächelte ihr mit seinen braunen Augen zu. Karl war zehn Jahre älter als sie und ersetzte in mancherlei Hinsicht den Vater - oft zu Annas Verdruss. Aber heute war sie froh, einen Bruder wie Karl zu haben. Nicht nur, dass sie sich in der Gegenwart des großen, stattlichen Burschen sicher fühlte, er hatte auch nach langen Debatten den Großvater endlich überreden können, dass Anna überhaupt mit durfte. Selbst in ihrer kleinen Heimatstadt Homberg hatten sich die Handwerker in Zünften organisiert und bestimmten mit ihren strengen Regeln jeden Schritt ihrer Mitglieder. Der Großvater hatte Angst um Anna, die ihm noch zu jung und unerfahren schien, um in eine Stadt wie Kassel zu fahren. Ausgerechnet zu einer solchen Gelegenheit! So viele Menschen würden unterwegs sein und Gauner mehr als genug. Er hatte Angst, dass Anna diese Gefahren nicht sehen würde. Sie war zu leichtgläubig und wollte in allen Menschen nur das Gute sehen. Das hatte der Großvater nicht vorwurfsvoll gesagt. Schließlich liebte er seine Enkelin gerade dafür. Und genau deswegen wollte er auf keinen Fall, dass ihr etwas zustieß. Am liebsten wäre er selbst mitgefahren, um auf sie aufzupassen, aber einer musste auch zu Hause bleiben und sich um die Tiere kümmern. Es hatte Anna und Karl viel Überzeugungskraft gekostet, aber das alles war vergessen, als Anna nun mit offenem Mund auf dem Kutschbock saß und all die Herrlichkeiten bewunderte, die sich hinter den Stadttoren und weit ab der engen Gassen ihren Blicken boten. Die großen Häuser bewiesen eindrucksvoll den Reichtum der Bürger. Überall verdeckte die Fahne von Hessen das prächtige Fachwerk der großen Häuser. Und die fremden Fahnen, die sie nicht kannte, mussten wohl die mecklenburgischen sein. Fast sah es so aus, als habe man die Häuser mit ihren Erkern und Giebeln, ihren kunstvoll behauenen Steinen und hohen Fenstern nur erbaut, um daran Fahnen aufzuhängen. Leicht entzifferte Anna die Jahreszahlen über den reich geschmückten Portalen, die von altem und neuem Reichtum zeugten. Auch Inschriften mit klangvollen Namen, in denen die Erbauer sich selbst und die Ihren unter Gottes Schutz stellten, konnte sie flüchtig lesen. Eine Kunst, die sie von ihrem Großvater gelernt hatte. Wie beschaulich waren dagegen die Marktflecken, auf denen sie sonst Löffel, Trippen2 und allerlei Holzgerät für den Haushalt feilboten.
„Siehst du all die fein gekleideten Herrschaften, Anna? Die werden uns unsere Möbel, Kästchen und Kämme schon abkaufen. Mal sehen. Sicher ist auch ein Tuchhändler auf dem Markt, bei dem ich Stoff kaufen kann, um die nächsten Kästchen damit auszuschlagen.“
Karl, der gut rechnen konnte, sah natürlich nur die potentiellen Käufer. Anna dagegen bewunderte die vielen bunten Stoffe, die Formen der Hüte und Hauben, die Schuhe, den Schmuck, den die Menschen an Ohren, Hals und Händen trugen.
„Karl“, flüsterte Anna, „glaubst du, sie ist hier schon irgendwo?“
„Wer denn?“
„Wer wohl! Anna von Mecklenburg natürlich! Die Braut!“
Anna wusste, dass es unsinnig war, sich mit dieser Frau, die alle mit Spannung erwarteten, verbunden zu fühlen, doch auf seltsame Weise fühlte sie eine gewisse Verwandtschaft mit der Braut, die ihren Namen trug und genauso alt war wie sie. Sie war stolz, dass sie ihr Alter kannte. Karl hatte ihre Jahre genau mitgezählt. Wie mochte Anna von Mecklenburg wohl aussehen? Überall hieß es, sie sei sehr schön.
Wenn Anna den Wassereimer aus dem Brunnen holte und wartete, bis die Oberfläche ganz still war, erkannte sie darin ein schmales Gesicht mit großen dunklen Augen, einem vollen Mund und einer geraden Nase. Umrahmt wurde dieser Anblick von einer linnenen Gugel, die ihre dunklen Zöpfe verwahrte. Ganz stolz hatte sie heute morgen noch auf dem Kutschbock gesessen, in der Gewissheit, dass Karl und sie ein hübsches Paar abgaben. Aber nun wurde ihr schlagartig klar, dass mit einer frisch gestärkten Haube allein in der Stadt kein Staat zu machen war. Sie waren nicht gerade reich, aber was sie auf dem Markt einnahmen, reichte aus für einfache, ordentliche Kleidung. Sogar Perlen hatte ihr Bruder einmal für sie besorgt. Natürlich keine solchen, wie sie an den Enden goldener Nadeln in den Frisuren der reichen Damen steckten. Annas Perlen waren aus Knochen gedreht, fein poliert und zierten nun ihr braunes Überkleid. Auf solchen Ersatz musste Anna von Mecklenburg sicher nicht zurückgreifen. Wahrscheinlich war ihr Kleid übersät mit Perlen, ihre Krone besetzt mit Edelsteinen und ihre Schuhe gefertigt aus kostbarem Brokat. Anna hatte solchen Stoff noch nie gesehen. Sie kannte ihn nur dem Namen nach. Einmal hatte eine Händlerin davon gesprochen. Seitdem war in Annas Vorstellung alles, was besonders kostbar sein musste, aus diesem sagenhaften Stoff. Ob sie wohl einen einzigen Blick auf die Braut würde erhaschen können?
„Ich glaube kaum, dass sich die Braut heute früh irgendwo auf der Straße herumtreibt. Oder der Landgraf hätte eine sehr sonderbare Wahl getroffen“, war die Antwort ihres Bruders. „Die Leute, die du hier siehst, sind nicht die Adligen, die zur Hochzeit geladen sind. Das sind die Bürger. Die dürfen sich nicht so sehr herausputzen wie die Adligen. Obwohl sie es sich oft eher leisten könnten als all die Grafen und Herzöge und Barone. Bestimmte Pelze und Stoffe sind dem Adel vorbehalten. Hier siehst du nun feines Leinen, Wolle, Biberpelze, Fuchs und Hase. Die Hermelin- und Zobel-Allianz tritt erst später auf.“
„Sprich nicht so! Du schwatzt dich an den Pranger!“ flüsterte Anna und sah sich um. Doch die Menschen, die sich an diesem Morgen auf dem Marktplatz tummelten, hatten anderes zu tun, als sich um die Worte eines Schreiners zu kümmern. Überall wurden Stände und Buden aufgebaut, wer dies nicht besaß, breitete ein Tuch auf dem Boden aus und bot darauf seine Ware an.
„Wir sind spät dran. Ich hoffe, wir bekommen noch einen Platz.“ Karl zügelte das Pferd am Rand des Marktplatzes, gab Anna die Zügel in die Hand und sagte: „Ich gehe zum Marktvogt. Bleib hier. Ich bin gleich wieder da. Wenn wir Glück haben, können wir hier aufbauen.“ Er fuhr sich mit den Händen noch einmal durch die störrischen braunen Haare, klopfte sich ein wenig den Staub von den Ärmeln und verschwand in der Menge. Anna kam sich nun auf dem Kutschbock des Leiterwagens doch etwas schäbig vor, wie sie zwischen all den großartigen Fuhrwerken der Händler stand. Das Fell dieser Pferde glänzte in der Sonne, die Räder waren zwar auch schmutzig, doch umwehte diese Wagen ein Hauch von Abenteuer und Ferne anstatt Stallgeruch und Ackerdunst. Ihre Besitzer waren so kostbar gekleidet, dass Anna sich fragte, wie der Adel denn in der Lage sein könne, dies noch zu übertreffen. Diese Kaufleute luden beileibe nicht selbst ab. Sie hatten eine Schar von Knechten bei sich, die sie mittels Winken und Fingerschnippens regierten. Doch bei weitem nicht alle hatten diesen Luxus. Die meisten legten auch selbst Hand an. Dazwischen trieben schon Gaukler ihre Späße, machten sich warm für ihren großen Auftritt, Straßenkinder nutzten die allgemeine Geschäftigkeit, um zu kostenlosem Essen zu kommen, während Knechte noch immer versuchten, wenigstens den gröbsten Dreck von den Straßen zu entfernen. Über all dem hing der Duft von frischem Backwerk, mischte sich mit dem Duft, der aus den Schenken und Wirtshäusern zog, dem Geruch der Pferde und Menschen. Übernächtigte Mägde gingen vorbei, die sicher in den letzten Wochen ihr Äußerstes hatten geben müssen, um alles vorzubereiten für diesen großen Tag. Endlose Reihen von Schüsseln waren vorbereitet, das Schrubben und Putzen hatte kein Ende genommen und schließlich hatten sie noch die Launen ihrer Herrinnen und Herren erdulden müssen.
Die Brautkutsche wurde gegen Mittag erwartet. Annas und Karls Standplatz befand sich zwar nicht direkt an der Straße, durch die die Braut einziehen würde, aber Karl war da, um auf alles aufzupassen. Die junge Töpferin, der Anna vorhin geholfen hatte, den Stand aufzubauen, hatte nun keine Zeit mehr, mit ihr zu plaudern, denn schon war der Markt voller Menschen. Die wenigsten kauften schon jetzt. Zu Beginn des Marktes pflegte man hier an den Ständen entlang zu flanieren, Ware und Preise zu vergleichen und sich das eine oder andere Stück im Gedächtnis zu notieren. Anna ließ ihren Blick treiben in diesem Strom aus Menschen, schaute vornehmen Bürgerinnen zu, wie sie Tuche begutachteten oder staunte über die Hartnäckigkeit, mit der manche feilschten.
Die Marktstände glichen sich alle in ihrer Art. Die meisten waren aus Knüppelholz. Die Stangen wurden in einer Art und Reihenfolge, die nur dem Erbauer selbst vollkommen logisch und genial erschien, zusammengesteckt, gebunden oder mit Keilen versehen. Darüber warf man eine Plane aus mehr oder minder wasserdichtem Stoff. Doch jeder war stolz auf seinen Stand, den er selbst gebaut und genäht hatte.
Auf der anderen Seite war ein junger Tuchhändler, der sich sehr für die Ware der Geschwister interessierte. Karl hatte den Wagen ganz dicht an die Hauswand gefahren, vor der sie bleiben durften, und das Pferd abgeschirrt, während Anna einen Tisch aufbaute, auf dem sie die Kästchen, Kämme und Trippen auslegte und die kleineren Möbel, wie Stühle, Schemel und Schränkchen vor dem Wagen aufstellte. Auf dem Wagen stand noch ein Tisch von beachtlicher Größe und eine Truhe. Anna war stolz auf die schönen Möbelstücke, die Karl und ihr Großvater herstellten, aber am meisten liebte sie die schönen Kämme und Kästchen, die ihr Großvater anfertigte und mit feiner Schnitzerei versah. Sie hatte sie alle auf ihrem Tisch ausgebreitet, Efeuranken und die ersten bunten Blätter dazwischen gelegt und gab ganz selbstsicher Auskunft, wenn Herrschaften an ihrem Tisch stehen blieben und sich nach den Preisen erkundigten. Karl hatte recht: Hier waren wirklich ungewöhnlich viele und reiche Leute unterwegs, die sich die Wartezeit mit einem kleinen Spaziergang über den Markt verkürzten. Karl war sich schnell einig mit Jacob, dem Tuchhändler, und kam zurück zum Stand, um Anna abzulösen, die sich nun aufmachen konnte, die Welt zu erobern. So kam sie sich zumindest vor. Die Mahnung ihres Bruders, in seiner Sichtweite zu bleiben, quittierte sie mit einer kleinen Grimasse, aber insgeheim war sie doch beruhigt, an ihn gebunden zu sein. Immerhin hatte er sie mit ein paar kleinen Münzen versehen, die vielversprechend in dem Beutel unter Annas Schürze klimperten. Wie aufregend dieser Markt war. Hier gab es alles! Und dies bezog sich nicht nur auf die Stände, an denen Anna Waren sah, die sie noch nie gesehen hatte, deren Nutzen oder Anwendung ihr nicht begreiflich war und deren fremdländische Pracht Anna den Atem verschlug. Hier gab es Menschen, gekleidet in die unerhörtesten Farben und Kleiderschnitte. Auf den ersten Blick war Anna überwältigt von den schönen Gewändern. Bei näherem Betrachten fand sie die langen Ärmel der Damen, die Schleppen und Schleier sehr unpraktisch. Wie wollte man damit arbeiten, wenn man immer auf seine Kleider zu achten hatte? Aber eben dies war Sinn und Zweck dieser so unzweckmäßigen Kleidung: Man zeigte, dass man nicht zu arbeiten brauchte. Und nicht nur die Kleidung der Damen zeichnete sich mit ihren bestickten Hörnern, die man Teufelsnasen nannte und die von der Kirche natürlich nicht gutgeheißen wurden, den zarten Schleiern und leuchtenden Farben durch Pracht aus, auch die Herren sparten nicht an ihrem Äußeren und zeigten mit kostbaren Stoffen und Pelzen aller Welt, wie erfolgreich sie ihren Geschäften nachgingen. Selbst in Marburg, wo sie schon oft gewesen war, hatte Anna nicht diese Pracht gesehen. Aber dort hatte wohl vor Zeiten die Putzsucht der Frauen so sehr überhand genommen, dass die Stadtväter sich gezwungen gesehen hatten, ein Gesetz zu erlassen, das es nur noch den gelüstigen Fräulein erlaubte, sich zu schmücken. Keine ehrbare Frau wollte nun mit einem solchen verwechselt werden.
Bader priesen laut ihre Wundermittel an, Kräuterfrauen boten ihre Ware etwas bescheidener aus ihren Körben feil, Sattler und Drechsler hatten die Ergebnisse ihrer Arbeit an ihren Ständen sorgfältig ausgebreitet, ebenso Töpfer, Korbflechter und Besenbinder. Bei den Metzgern und Bäckern war der meiste Betrieb. Dazwischen tummelten sich Gaukler, um die die Menge schnell einen großen Kreis bildete, damit sie genügend Raum hätten für ihre Kunststücke. Hatten sie ihre Vorführungen beendet und ließen einen Hut kreisen, zerstreuten sich die Menschen schnell wieder.
Anna hatte nicht bemerkt, wie die Zeit vergangen war. Mittag musste längst vorüber sein. Sie hatte nicht auf den Schlag der Turmuhr geachtet. Plötzlich wurde es leer in der Gasse. Alles drängte hinaus auf die große Straße. Eilig ging sie zurück zu Karl.
„Geh nur, sieh dir den Zug aus der Nähe an. Ich pass auf unsere Sachen auf“, rief Karl ihr schon von weitem zu.
„Auf meine auch?“ fragte die Töpferin.
„Lauft nur, ihr jungen Dinger!“ lachte Karl.
„Komm, Mia! Wir werden die Braut sehen“, sagte Anna und nahm die Töpferin an der Hand. In einem Augenblick waren sie an der Straße, wo sich schon ein schier undurchdringlicher Wall von Menschenleibern aufgebaut hatte.
„Sieh mal, hier auf diesem kleinen Vorsprung ist für uns beide allemal noch Platz“, sagte Mia und war auch schon oben. Anna stieg neben sie auf das kleine Sims, das zwei Fuß über der Erde aus einem Haus hervorsah. Besser hätten sie es nicht treffen können. Fanfaren kündigten den Zug an. Auch das helle Rauschen von vielen Trommeln war zu hören. Alle reckten die Hälse. Von ferne sah Anna schon die bunten Standarten und Flaggen. Sie hörte das Getrappel vieler Hufe auf dem Kopfsteinpflaster. Es mussten viele Dutzend Reiter sein. Annas Herz klopfte bis zum Hals. Sie bekam weiche Knie vor Aufregung, selbst wenn sie nur als Zuschauerin hier stand. Die Menge wich zurück bis an die Häuser, denn der Zug war breit. Prächtige Pferde, behängt mit dem mecklenburgischen Wappen, kamen in Sicht. Darauf saßen grimmig blickende Soldaten, die in ihren dick behandschuhten Händen große Standarten hielten. Dem Anlass entsprechend, hätten sie etwas freundlicher dreinschauen können, fand Mia. Schließlich fuhren sie eine junge Braut zur Hochzeit und nicht zur Hinrichtung. Oder kam das hier auf ein und dasselbe heraus? Darüber nachzusinnen hatten die beiden Mädchen aber keine Zeit, denn nun erschien die Kutsche, in der man die Braut vermuten durfte. Alle jubelten, schrieen ‚Hoch!’ und ‚Vivat!’ Die Kutsche war einer Landesfürstin würdig. Sie wurde gezogen von vier Apfelschimmeln, deren Zaumzeug von Gold und Edelsteinen blitzte. Auf dem Kutschbock saßen zwei Männer, deren gewichtige Mienen keinerlei Regung zeigten. Auch deren Kleidung war unerhört prächtig, wenn auch nicht ganz so funkelnd wie das Zaumzeug der Pferde, bemerkte Anna. Die Kutsche selbst verschlug Anna die Sprache. Solches hatte sie noch nie gesehen. Groß war die Kutsche. Die Stangen, die den dunkelroten Baldachin trugen, waren verziert mit filigranen Schnitzereien und mit Gold beschlagen. Und unter dem Baldachin saß - Anna stockte der Atem – tatsächlich Anna von Mecklenburg. Wer sonst hätte so wunderschön lächeln können? Wer sonst würde seinen Kopf so anmutig neigen und so freundlich winken? Die Braut war tatsächlich noch schöner als Anna sie sich vorgestellt hatte. Ihre Haube! Ihr Kleid! Konnte etwas herrlicher sein? Auch wenn die Braut nur einen Augenblick sichtbar gewesen war, so hatte Anna doch festgestellt, dass ihre Haube – von einem Schnitt, wie ihn Anna noch nirgends gesehen hatte – dicht mit Perlen und Goldfäden bestickt war. Und ihr Kleid war so wundervoll, dass Anna die Worte fehlten. Dunkelrot, besetzt mit einer breiten Borte aus Gold und Edelsteinen. Die an Schultern und Ellbogen durchbrochenen Ärmel, wo man deutlich das seidene Untergewand der zukünftigen Landesherrin erkennen konnte, war die neueste Mode. Der Einsatz vor ihrer Brust war so kunstvoll bestickt mit Fäden aus Gold und Silber, so überaus dicht mit Perlen verziert, dass Anna Schreuerin überzeugt war, selbst die Kaiserin könne kein schöneres Kleid tragen. Und für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Für einen Moment schaute Anna von Mecklenburg in die Augen der Anna Schreuerin, was letztere zu noch heftigerem Winken veranlasste.
„Das war Brokat “, sagte Jacob mit einem besonderen Gewicht auf jeder Silbe. Er hatte sich zu den beiden gesellt, da er als Händler sich natürlich informieren musste, was man fortan tragen würde, um die entsprechende Ware vorrätig zu haben. Doch wusste er schon, dass er davon sicher nicht so viel brauchen würde wie von dem einfachen Leinen.
Es kam noch ein ganzes Meer aus Fahnen, Pferden, Trommeln und Wappen. Anna, Mia und Jacob warteten ab, bis nur noch die Gassenjungen den Reitern hinterherliefen, dann beeilten sie sich, wieder zu ihren Ständen zu kommen. Karl hatte auf alles ein Auge gehabt.
„Ich hab sie gesehen! Ganz nah! Und sie hat mich auch angesehen und mir zugelächelt!“ rief Anna aufgeregt.
„Wer?“ fragte Karl in gespieltem Erstaunen.
„Karl! Wie kannst du mich das fragen? Wer wohl? Die Braut! Anna von Mecklenburg!“
In diesem Moment kam ein zerlumpter Bettler an ihnen vorbei. Anna hatte ihn den Morgen über schon beobachtet, wie er auf dem Markt die Leute angebettelt hatte und gehofft, er würde nicht auch zu ihr kommen. Doch nun war er da mit seinen stinkenden, schmutzigen Lumpen, seinem hässlichen Gesicht, den eitrigen Augen und verfaulten Zähnen.
„Die Braut hast du gesehen! Schönes Kind!“ rief er höhnisch aus. „Die Braut! Wirst du von diesem Anblick etwa satt? Ein paar Krümel sind für uns vom Tisch der Herren gefallen. Aber was essen wir morgen?“ keifte der Alte.
„Scher dich zum Teufel, Alter!“ fuhr Karl den Bettler an, indem er Anna hinter seinen Rücken schob. Der Bettler trollte sich, rief ihnen aber aus sicherer Entfernung noch Schimpfworte zu.
In der Dämmerung räumten sie die Reste ihrer Waren wieder ein. Alle waren zufrieden. Karl hatte sogar den großen Tisch verkauft.
„Wir gehen jetzt was essen. Ich hab riesigen Hunger. Du hast doch hoffentlich was gegessen heute Mittag?“
„Natürlich. Dort drüben gab es Kletzenbrot. Aber jetzt hab ich auch Lust auf etwas Herzhaftes,“ erwiderte Anna. Sie alle hatten Hunger nach diesem langen Markttag, dem Auf- und Abbauen. Der Schuster gegenüber brauchte nur den großen Laden, der seiner Kundschaft gleichzeitig als Dach diente, herabzulassen und von innen zu verriegeln. Bald verlosch die Unschlittkerze im Inneren der Werkstatt. Der alte Meister hatte sich zur Ruhe begeben.
Als endlich alle Stände auf den Fuhrwerken verstaut und festgezurrt waren, setzten sie sich in Bewegung in Richtung Stadttor. Dort gab es eine Herberge, die über einen großen Innenhof verfügte, so dass Kaufleute ihre Wagen ruhigen Gewissens dort unterstellen konnten. Da sowohl Pferd als auch Wagen nur geliehen waren, hatte Karl immer ein besonders wachsames Auge auf sein Fuhrwerk. Anna half, das Pferd zu versorgen, denn allein wollte sie nicht in die Schenke vorausgehen. Sie kannte solche Schenken mit ihren getünchten Wänden und den Tischen, deren Oberflächen Unmengen von Bier, Wein und Fett versiegelt hatten. Um diese Zeit war der Raum voll mit essenden, trinkenden Menschen, die auf ihre Weise die Ankunft der Braut feierten. Auch würdige Kaufleute werden nach zwei Krügen Starkbier weniger würdig und reden und lachen in einer Lautstärke, über die sie sich bei anderer Gelegenheit beklagt hätten. Karl, Anna, Jacob und Mia fanden Platz in einer Fensternische. Von dort konnten sie das teilweise recht bunte Treiben unbehelligt beobachten. Das Bier, das deftige Essen machten Anna schläfrig. Markttage waren für sie immer aufregend und anstrengend, und dieser außergewöhnliche Tag hatte Anna vollständig erschöpft. Sie wusste schließlich nicht mehr, wie sie in ihr Bett gekommen war. Aber als sie endlich dort lag, war sie wieder hellwach. Sie dachte an Anna von Mecklenburg, die morgen schon Anna von Hessen sein würde. Vielleicht konnte sie sie noch einmal sehen auf dem Weg zur Kirche? Der Bettler fiel ihr wieder ein. Sein Gesicht verfolgte sie in einen unruhigen Schlaf, aus dem sie viel zu früh wieder erwachte.
Mitternacht. Anna von Mecklenburg stand am Fenster des Schlosses zu Kassel und sah hinaus in die Nacht. Hinter sich hörte sie die ruhigen Atemzüge ihrer Schwester Katharina, die schon lange schlief. Mit neidischen Augen hatte die jüngere sie betrachtet, ehrfürchtig über ihr kostbares Gewand gestrichen und beim Einzug in die Stadt fleißig mitgelächelt und gewunken.
Anna war dem Landgrafen schon begegnet. Er hatte sie begrüßt und mit ihr gespeist. Er schien ihr vertrauenswürdig. Groß, mit breiten Schultern, einem freundlichen Gesicht. Sein voller Bart gab ihm etwas Väterliches. Sie hatte versucht, in seinen Augen zu lesen. Er hatte graue Augen, hinter deren freudigem Glanz auch Müdigkeit zu lauern schien. Zumindest hatte sie ihm angesehen, dass ihr Anblick ihn freudig überrascht hatte. Anna wusste, dass sie mit ihrem hellen Haar und den blauen Augen weit mehr als ansehnlich war und damit weit mehr als ein Mann in einer politischen Ehe erwarten konnte. Der traurige Witwer sollte schon bald auf andere Gedanken kommen. Das hatte Anna sich fest vorgenommen. Er war mehr als doppelt so alt wie sie selbst, zwar jünger als ihr Vater, aber in ihren Augen doch ein alter Mann. Fältchen umlagerten seine Augen, vereinzelt durchzogen graue Strähnen sein dunkles Haar. Siebzehn Jahre war er älter als sie. Siebzehn würde sie in zwei Jahren sein. Sie dachte an den Tag, an dem ihre Jugend ein jähes Ende genommen hatte. Sie war aus dem Garten gekommen und hatte ihren Vater mit einem Fremden im Saal sitzen sehen. Die beiden Männer hatten genickt und einander die Hände gereicht. Doch anstatt den Herrn nach draußen geleiten zu lassen, hatte ihr Vater Wein einschenken lassen, als habe man soeben einen Vertrag besiegelt. Bei diesem Anblick ließ sie den Blumenstrauß in ihrer Hand sinken. Ahnungsvoll schlich sie an der offenen Tür vorbei. Ihre Mutter hatte sie aber bemerkt und ging ihr nach. Anna stellte gerade ihre Sommerblumen in einen Krug, als ihre Mutter eintrat.
„Kind, wir haben wundervolle Nachrichten für Sie,“ flüsterte sie mit verschwörerischem Gesicht, das ganz und gar nicht zu ihrer weißen, brettsteif gestärkten Haube passen wollte.